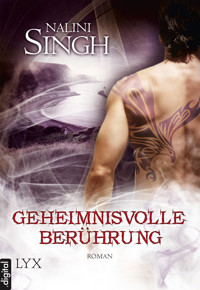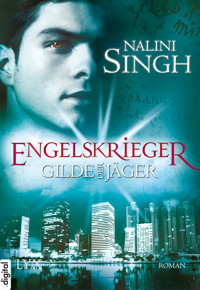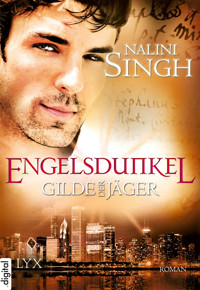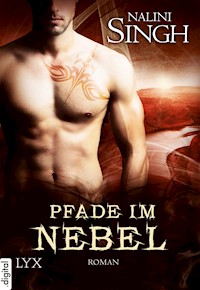9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Elena-Deveraux-Serie
- Sprache: Deutsch
Die Schlacht ist gewonnen - doch der Krieg ist noch nicht vorbei ...
Lijuan ist besiegt. Der Erzengel von China wurde in einer legendären Schlacht über New York vernichtet. Aber ihre tödlichen Kreaturen verbreiten weiter Angst und Schrecken. Besonders schlimm hat es das Territorium von Titus, dem Erzengel von Afrika, getroffen. Zur Unterstützung wird ihm Lady Sharine - der Kolibri - geschickt. Aber was soll dem raubeinigen Krieger die zarte Künstlerin, die jahrhundertelang in ihrer eigenen Welt lebte, nützen? Titus staunt jedoch nicht schlecht, als er Sharine dann gegenübersteht. Denn der Kolibri verfügt nicht nur über eine scharfe Zunge und kann gut mit dem Messer umgehen, sondern sie weckt auch Gefühle in Titus, wie dieser sie niemals zuvor verspürte ...
"Romantic Fantasy geht nicht besser als bei Nalini Singh!" LOVE VAMPIRES
Band 13 der GILDE DER JÄGER von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Nalini Singh
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Epilog
Die Autorin
Nalini Singh bei LYX
Impressum
NALINI SINGH
Engelssonne
GILDE DER JÄGER
Roman
Ins Deutsche übertragen von Dorothee Danzmann
Zu diesem Buch
Lijuan ist besiegt. Der Erzengel von China wurde in einer legendären Schlacht über New York vernichtet. Aber ihre tödlichen Kreaturen verbreiten weiter Angst und Schrecken. Besonders schlimm hat es das Territorium von Titus, dem Erzengel von Afrika, getroffen. Aus dem Norden drängen immer mehr Wiedergeborene in sein Reich und wandeln dabei nicht nur Menschen in alles verschlingende Wesen, sondern auch Tiere. Da bekommt Titus von unerwarteter Seite Hilfe: Raphael, der Erzengel von New York, schickt ihm den Kolibri. Doch was soll der raubeinige Krieger Titus mit einer zarten Künstlerin, die jahrhundertelang in ihrer eigenen Welt gelebt hat, anfangen? Er staunt jedoch nicht schlecht, als er Lady Sharine – wie er sie nennen soll – dann gegenübersteht. Denn sie ist weder schüchtern, noch muss man auf sie aufpassen. Vielmehr verfügt Sharine über eine scharfe Zunge und einen wachen Verstand und kann zudem gut mit dem Messer umgehen. Und von dem Kämpfer lässt sie sich schon lange nichts sagen, sondern entpuppt sich schnell als wertvolle Hilfe. Obwohl sich Titus und Sharine gegenseitig auf die Palme bringen, erkennen sie auch, wie sehr sie den anderen respektieren – und mögen. Und während die Anziehungskraft zwischen ihnen immer größer wird, nimmt die Gefahr zu. Denn Lijuans Vermächtnis hält noch eine schreckliche Überraschung parat …
1
Die Erinnerung ist so lange her, sie gehört zu den verlorenen …
Engel sterben nicht einfach so.
Sharine konnte an nichts anderes denken, als sie jetzt am Grab ihres geliebten Raan stand. Engel sterben nicht einfach so. In der Engelheit bereitete man sich nicht auf den Tod vor, und so hatte sie nicht gewusst, wie sich Raan seine letzte Ruhestätte gewünscht hätte. Sie hatte die Grabgestaltung nach dem ausrichten müssen, was sie in den fünf gemeinsam verbrachten Jahrzehnten über ihren Geliebten erfahren hatte.
Die Zeit mit ihm war so kurz gewesen.
Und dabei hatte sie doch darauf vertraut, diesen älteren, weiseren, sanften Engel eine Ewigkeit an ihrer Seite haben zu dürfen. Er war als ihr Lehrer und Mentor in ihr Leben getreten, als darin die Kunst eine immer zentralere Rolle gespielt hatte, mehr und mehr zum festen Bestandteil ihres Wesens geworden war. Als er dann auch ihr Liebhaber wurde, geschah das mit einer solchen Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, als wäre ihre Beziehung von Anfang an ihr Schicksal gewesen. Sie waren beide mit dem gemeinsamen Leben mehr als zufrieden gewesen, hatten Stunden draußen in der Sonne verbracht, jeder allein mit seiner Leinwand, seinen Gedanken und Farben, und doch zusammen.
Engel sterben nicht einfach so.
Mit zitternden und eiskalten, blutleeren Fingern streichelte sie die kleine Statue, die Raan so sehr geliebt hatte, dass er sich nie von ihr trennen mochte. Jetzt markierte sein Lieblingskunstwerk in diesem windzerzausten, gebirgigen Teil der Zuflucht die Stelle, an der Raan seine ewige Ruhe gefunden hatte.
Als sie an jenem Morgen, der ihr immer noch wie ein Trugbild aus einem Albtraum vorkam, neben seinem reglosen Körper aufgewacht war, hatte sie zuerst gedacht, er hätte den großen Schlaf gewählt, sich für die tiefe Ruhe entschieden, der Unsterbliche sich hingaben, wenn sie nicht länger Teil dieser Welt zu sein wünschten. So etwas tat man gezielt und mit Absicht, und so hatte sie als erste Reaktion einen scharfen Schmerz in der Brust verspürt.
Sie hatte ihn so oft gebeten, genau das nicht zu tun, sich nicht für Anshara, den Schlaf, zu entscheiden. Er war so viel älter als sie. Sie hatte Angst gehabt, er könnte sich nach dem Schlaf sehnen, während sie noch wach bleiben wollte. Sie hatte Angst gehabt, er könnte sie einfach verlassen. Aber Raan hatte auf solche Befürchtungen immer mit seinem warmen, beruhigenden Lachen reagiert und ihr versichert, sie brauche sich keine Sorgen zu machen.
»Mein Vögelchen!«, hatte er gesagt, »warum sollte ich ausgerechnet jetzt schlafen wollen, da ich dich gefunden habe?«
Also hatte sie an jenem Morgen erst einmal verletzt und wütend reagiert, weil sie dachte, er hätte sein Versprechen gebrochen. Und dann hatte sie seine Hand berührt. Denn mochte sie auch noch so wütend auf ihn sein, sie liebte ihn doch trotzdem. Seine geschickte und starke Hand hatte sich eisig kalt angefühlt.
Da war ihr die Luft in den Lungen gefroren, ihre Brust hatte sich in einen einzigen Eisklumpen verwandelt.
Sein ganzer Körper war eiskalt gewesen. So kalt wurde ein schlafender Engel nicht. Das wusste Sharine aus eigener Erfahrung, denn sie hatte als halbwüchsiger Grünschnabel von gerade einmal fünfundachtzig Jahren bei ihren Eltern Wache gehalten, als diese sich in den großen Schlaf begeben hatten. Sie hatte gesehen, wie sich bei beiden Eltern die Brust gleichmäßig gehoben und gesenkt hatte bis zum endgültigen Stillstand. Und die ganze Zeit über hatte sie gehofft, sie würden es sich noch einmal anders überlegen und sie nicht alleinlassen, aber das hatten sie nicht getan.
»Du wirst es schon schaffen, Sharine«, hatte ihre Mutter mit fester Stimme und unendlich müdem Blick gesagt. »Du bist jetzt erwachsen.«
»Bei unserem nächsten Erwachen sehen wir uns wieder.« Ihr Vater hatte ihre Hand getätschelt, aber sie hatte deutlich gespürt, dass er gar nicht mehr richtig anwesend war. Eigentlich hatte er nur noch an die Ruhe gedacht, nach der er sich nun schon so unendlich lange sehnte.
Aber die beiden waren nicht erkaltet, sondern ihre Körper auch dann noch warm geblieben, als der tiefe Schlaf längst eingesetzt hatte. Selbst fünfzig Jahre später, als Sharine die geheime Kammer unter der Erde aufgesucht hatte, um nachzusehen, ob auch niemand die Ruhe der beiden gestört hatte, waren ihre Eltern warm gewesen. Also hatte Sharine gewusst, dass Engel im Tiefschlaf nicht erstarren, dass ihr Blut nicht eiskalt und blau wird.
Dieses Wissen hatte der Heiler dann mit einem erschrockenen Keuchen bestätigt. Aber Sharine hatte auch ohne diese Reaktion gewusst, dass etwas nicht stimmte.
Ihr gütiger und so unendlich begabter Liebster war gegangen.
Mitten in der Nacht war er gestorben, während Sharine neben ihm schlief.
Das kam in der Engelheit so selten vor, dass keiner der Heiler vor Ort je einen solchen Fall erlebt hatte. Sie hatten dicke, verstaubte, alte Bücher wälzen und ebenso alte Engel und Erzengel befragen müssen, bis sie jemanden gefunden hatten, der sich an ein ähnliches Vorkommnis erinnern konnte, das allerdings bereits zwei Jahrtausende zurücklag. Engel waren unsterblich. Im Prinzip. Aber manchmal, sehr selten, so selten, dass entsprechende Ereignisse zwischen einem Zeitalter und dem nächsten in Vergessenheit gerieten, schied ein Engel einfach so aus dem Leben.
Wie eine alte Uhr, die irgendwann einmal nicht mehr weiterläuft, die stehen bleibt.
Die Heiler hatten ihr das alles erklärt, aber Sharine hatte trotzdem nicht verstanden, wie es möglich sein konnte. Raan war alt gewesen, das schon, aber doch nicht annähernd so alt wie manche der Ältesten seiner Art. Viele Engel, die doppelt und dreifach so alt waren wie er, bevölkerten munter die Erde. Aber Raans Uhr war stehen geblieben, während er neben ihr im Bett lag. Das Leben war ihm entglitten, während sie an seiner Seite schlief, sorglos und nichts ahnend.
Hatte er um Luft gerungen? Hatte er die Hand nach ihr ausgestreckt, ihre Hilfe gesucht?
Diese Gedanken quälten sie auch jetzt wieder, während Schneeflocken auf ihren Wangen landeten und sich die Kälte in ihre Haut verbiss. Sie sah zu, wie sich der Schnee sanft auf die kleine Statue legte, und fragte sich, ob sich in den kommenden Jahrhunderten außer ihr überhaupt noch jemand an Raan erinnern würde. Er war ein großartiger Bildhauer und Maler gewesen, jedoch einer, der zurückhaltend gelebt hatte, ein Mann ohne viele Freunde. Wahrscheinlich würde man sich eher an seine Kunst erinnern als an ihn selbst, und Sharine dachte, dass ihm das wohl gefallen hätte. Die Kunst, das war sein Vermächtnis.
Heftiges Weinen überkam sie, und sie fiel auf die Knie. »Eigentlich sterben Engel nicht«, flüsterte sie dort auf dem steinigen Boden. Aber es war niemand da, der sie hören konnte.
Nur der Wind schien ihr die Worte direkt aus dem Mund zu reißen und gegen den nächsten Berggipfel zu schleudern. Ihre Flügel, die Raan einmal als Geschenk aus indigofarbenem Licht bezeichnet hatte, lagen ausgebreitet auf der dünnen, die Steine bedeckenden Schneeschicht und wurden kalt und taub, während ihre Knie immer steifer wurden und in der Stellung einfroren, die sie eingenommen hatte. Aber trotzdem stand Sharine nicht auf. Ein Teil von ihr hoffte immer noch, Raan könnte erwachen und ihr versichern, alles sei nur ein Irrtum gewesen, ein schrecklicher Fehler.
Sharine war gerade einmal hundertsechzig Jahre alt, und die Liebe ihres Lebens lag kalt und tot im Grab. In diesem Moment, inmitten der heulenden Winde, konnte sie sich keinen schlimmeren Schmerz vorstellen.
Sie trauerte allein, während um sie herum der Schnee fiel.
Engel sterben nicht einfach so.
2
Vor dreitausendfünfhundert Jahren
Sire, ich habe einen Sohn geboren, der mit seiner Stimme die ganze Zuflucht wach hält. Und er schreckt vor nichts zurück.
Meine Älteste behauptet, er habe meine Augen und mein Temperament. Die Zwillinge sind jetzt schon fest davon überzeugt, dass er wie sie den Weg des Kriegers wählen wird, und Euphenia kann ihn als Einzige zum Schlafen bringen, wenn er eigentlich um jeden Preis wach bleiben und der Welt seinen Schlachtruf entgegenschmettern will.
Sein Vater findet es immer noch kaum fassbar, dass er daran beteiligt gewesen sein soll, ein solches Kind zu erschaffen. Ich versichere ihm dann stets, dass sich sein Staunen legen und er ein guter Vater sein wird. Auf jeden Fall hat er die Geduld, die mir fehlt. Denn dieser mein Sohn wird noch nicht einmal vor seiner Mutter Angst haben, dessen bin ich gewiss.
Ich werde ihn Titus nennen.
Brief der Ersten Generalin Avelina an Erzengel Alexander.
3
Vor einem Monat
Er wusste nicht mehr, wie er hieß.
Seine Lungen hatten Mühe, sich mit Luft zu füllen, vor seinen Augen verschwamm alles, und seine Flügel hingen ihm schwer und nutzlos vom Rücken herunter. Und doch kroch er weiter, schleppte sich hinaus aus dieser Hölle, dem Sonnenlicht entgegen.
Sein Blick fiel auf seinen Handrücken, auf seine einst so blütenweiße Haut, die er verwöhnt und vor der Sonne geschützt und jeden Tag mit großer Sorgfalt im Spiegel begutachtet hatte. Eine Haut, die den Glanz seiner topasfarbenen Augen immer so wunderbar unterstrichen hatte. Haut, die jetzt mit grünen Flecken durchsetzt war.
Er musste raus hier.
Er musste dringend hier raus und einen Heiler finden.
Aber er war so schwach. Wie konnte er …
Schnell wie ein Reptil schoss seine klapperdürre Hand vor und packte das kleine Wesen, das ihm gerade über den Weg lief. Er hatte die Zähne in den pelzigen Leib geschlagen, noch bevor sein Verstand wieder einsetzen und eine Entscheidung fällen konnte. Der nackte Schwanz des Tierchens zuckte panisch, aber letztendlich hatte es nur wenig Blut und starb sehr schnell.
Er schleuderte den kleinen Leichnam beiseite, fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund und spürte, wie ein wenig Energie in ihm aufflackerte. Dann war er jetzt also ein Vampir? Nein, das konnte nicht sein. Vampir-Engel-Hybride existierten nur in von Sterblichen erdachten Geschichten. Als Unsterblicher wusste er um die fundamentale Tatsache, dass Vampire und Engel biologisch nicht miteinander vereinbar waren. Trotzdem stand außer Zweifel, dass das Blut des kleinen Pelztiers ihm eben Energie gespendet hatte.
Ruckartig fuhr sein Kopf herum, während seine Augen den kleinen Kadaver suchten.
Wieder griff er danach, ohne nachzudenken. Und als er diesmal zubiss, geschah das, weil er das rohe Fleisch essen wollte. Das harte Fell spuckte er wieder aus. Ein Teil seines Verstandes, ein winziger Teil, wusste immer noch, dass er einmal als weltgewandter, gepflegter Höfling am Hof eines Erzengels gelebt hatte, und er schrie und zeterte, aber das drang nur verzerrt und wie aus weiter Ferne zu ihm durch. Zu mächtig war der Energiestoß, der durch seine Adern schoss.
Jetzt wusste er auch wieder, wie man flog.
Auch, wie er verhindern konnte, dass ihm dieses faulige, entstellende, nach Verwesung stinkende Grün weiter durch die Haut kroch.
Wie er seinen Kopf freibekam, um denken zu können.
Und was den Husten betraf, der seinen Leib schüttelte, und den grünschwarzen Schleim, den er immer wieder ausspuckte, ohne etwas dagegen tun zu können, so würde all das wieder verschwinden. Er brauchte nur genügend Energie. Er brauchte Fleisch, frisch und fest und rot, aus dem das Leben tropfte.
Beim nächsten Hustenanfall spuckte er den zähen, unverdaulichen Schwanz aus und kroch weiter, wobei seine langen Krallen Furchen in den Boden gruben und das Fleisch, das sich langsam von seinen Beinen löste, eine nasse Spur hinterließ. In diesem Schleim befanden sich Federn, lieblich und einmalig, ein sattes Braun durchwoben mit Filamenten aus Topas.
4
Heute
Sharine stand auf dem geländerlosen flachen Dach ihres neuen Zuhauses in der sandigen Landschaft Marokkos und blickte hinaus auf die vom Licht der untergehenden Sonne vergoldeten Mauern der umliegenden Häuser. Das Licht erinnerte wirklich an flüssiges Gold, war dicht und satt, wie man es nur bei Sonnenuntergängen erlebte, wenn es schien, als sei die Sonne selbst geschmolzen und würde gerade von einem wohlmeinenden Maler auf die Leinwand verteilt.
In den Straßen unter ihr gingen Vampire und Sterbliche eifrig ihren Geschäften nach, bauten die Stände für den abendlichen Markt auf oder kehrten nach getaner Arbeit nach Hause zurück. Immer mal wieder blickte einer von ihnen hoch und entdeckte sie. Sharine war sehr stolz darauf, dass die Kinder aufgeregt und freudig winkten, während sich die Erwachsenen respektvoll verneigten.
Anfangs, kurz nachdem sie hierhergekommen war, hatte ihr Anblick dieselben Leute verängstigt auseinanderstieben lassen. Es war das Erbe des Engels, der früher hier Aufsicht geführt hatte und dem Macht und Grausamkeit wichtiger gewesen waren als die Verantwortung für die ihm anvertrauten kostbaren Güter. In Lumia bewahrte die Engelheit ihre größten Kunstwerke und Schätze auf, aber der Ort wäre ohne das blühende Leben in der angrenzenden Siedlung nur kalt und einsam gewesen. Deshalb sah Sharine auch in der Stadt und ihren Bewohnern einen kostbaren Schatz, der ebenso wichtig war wie diejenigen, die innerhalb der Mauern der Festung beschützt wurden.
Sharine breitete die Flügel aus und hielt sie eine ganze, kostbare Minute lang gedehnt, bis sie sie langsam wieder in die korrekte Position auf ihrem Rücken zusammenfaltete. Dabei achtete sie auf absolute Muskelkontrolle. Das war eine der Kräftigung dienende Übung, die sie lange vernachlässigt hatte, als ihr Verstand einem zerbrochenen Kaleidoskop geglichen hatte und ihr jegliche Disziplin abhandengekommen war.
Große Teile des letzten halben Millenniums – vielleicht ein oder zwei Dekaden mehr oder weniger – existierten in ihrem Kopf nur noch als Bruchstücke. Als seltsam verschwommene, durch einen zerbrochenen, rissigen Filter betrachtete Bilder, die oft kein Ganzes ergaben, wenn sie versuchte, sie zusammenzufügen. Sie würde die Zeit nie zurückbekommen, in der ihr lachender, frecher kleiner Sohn zu einem mutigen und starken Mann herangewachsen war.
Bei diesem Gedanken loderte heiße Wut in ihr auf.
»Lady Sharine.«
Sie wandte Trace den Kopf zu. Der schlanke Vampir mit den hübschen, sehr dunklen grünen Augen und einer Haut, die sie stets an Mondlicht denken ließ, besaß die Stimme eines Poeten und seidig schwarze Haare. Er erinnerte Sharine immer ein wenig an ihren Sohn. Nicht von der Farbgebung her, darin war jeder der beiden Männer einmalig. Aber genau wie Trace besaß ihr Sohn eine ganz bestimmte Art Charme, die öfter für Herzflattern sorgte.
Denn allem Anschein nach waren eine Menge Leute für diesen Charme empfänglich.
»Was hast du für mich, Jüngling?«, erkundigte sie sich mit liebevollem Lächeln.
Trace schüttelte mahnend den Kopf, wobei die scharf gemeißelten Wangenknochen Schatten auf seine Wangen warfen. Traces Schönheit hatte nichts Weiches. Makellos war sie trotzdem. »Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, meine Dame, dass ich ein erwachsener Mann bin und kein Jüngling!« Sein Ton war streng, doch der Blick, der auf Sharine ruhte, zeugte von tiefer Zuneigung.
»Und ich habe daraufhin gesagt: Wenn du älter bist als die Erde und sämtliche Sterne zusammen, dann ist jeder ein Jüngling für dich.« Sogar Raphael, der Erzengel, den sie oft in ihr Studio mitgenommen hatte, als er noch ein energiegeladener kleiner Junge gewesen war, damit er sich dort mit Farben und Leinwand bis zur Erschöpfung austoben konnte, während seine kleinen Händen zu klebrigen, bunten Farbstempeln wurden – selbst Raphael hatte eingesehen, dass er für Sharine immer ein Kind bleiben würde.
Manchmal fragte sie sich, was wohl aus seinen ausufernden Gemälden geworden sein mochte. Sie hatte sie irgendwo in der Zuflucht verwahrt, da war sie sich sicher, aber wo? All diese Erinnerungen lagen unter den verworrenen mentalen Pfaden ihrer verwundeten Seele verborgen, Opfer der Verrücktheit, zu der Aegaeons perfide geplantes, unfassbar grausames Verhalten sie verdammt hatte.
Es gab Lieblosigkeit, und dann gab es noch das, was Aegaeon getan hatte.
Trace hielt ihr seufzend einen Umschlag aus dickem, cremefarbenem Papier hin, auf dem das Siegel des Kaders prangte. Ein wichtiges Dokument, wollte man nach dem Äußeren gehen. Als müsste alles, was in diesem Brief stand, den Stempel der mächtigen, die Welt regierenden Erzengel tragen.
»Das hat gerade ein Kurier vorbeigebracht«, sagte Trace, der mit seiner Stimme schon so manche junge Frau verführt hatte. »Ein Vampir«, fügte er hinzu, bevor Sharine fragen konnte, warum der Kurier nicht hier oben bei ihr auf dem Dach gelandet war.
Sie nahm den Brief aus seiner Hand entgegen. »Wie ging es dir heute auf deinen Erkundungsrunden?« Trace war erst vor einem Monat zu ihr gekommen. Raphael hatte ihn geschickt, nachdem mehrere von Sharines Leuten an ihre Heimatstandorte zurückgekehrt waren. Sie alle, Engel wie auch Vampire, manche jung, andere alt, hatten gehen müssen, um ihren Leuten zu Hause bei der Beseitigung der verheerenden Schäden zu helfen, die Lijuans Ringen um die Weltherrschaft hinterlassen hatte.
Der Krieg hatte vor einem Monat geendet, aber zum Ausruhen und Heilen war immer noch keine Zeit gewesen.
Dabei ging es nicht nur um die im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen in Städten und Dörfern entstandenen Sachschäden oder die Horden kriechender, verrohter Wiedergeborener, die immer noch viele Gegenden unsicher machten. In den vergangenen zwei Wochen war noch dazu eine weitaus größere Anzahl von Vampiren als sonst dem Blutrausch verfallen.
Trace nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es um diese Vampire ging: »Sie versuchen es ja noch nicht einmal mit Selbstdisziplin«, hatte er Sharine mit kalter, mitleidsloser Stimme erklärt. »Obwohl doch der Bluthunger in uns allen lebt. Er flüstert und lockt in den Dämmerstunden, will Nahrung, will Blut, aber ich habe schon vor langer Zeit gelernt, diese flüsternden Stimmen abzuschalten.«
Das schienen andere Vampire nicht getan zu haben. Jetzt, da viele starke und mächtige Engel gefallen oder schwer verletzt mit ihrer Heilung befasst waren und die Überlebenden in den Nachwehen des Krieges mehr als genug zu tun hatten, schien der übermächtige Drang zu trinken bei vielen jedes Gefühl der Vernunft zu ersticken und das Gewissen auszuschalten. Ganze Städte drohten in Blut zu ertrinken, in der Luft lag ein Geruch wie von feuchtem Eisen.
Was blutrünstige Vampire betraf, stand Raphaels Territorium um keinen Deut besser da als andere Gebiete. Außerdem hatte der Krieg in seinem Land schlimme Verwüstungen angerichtet, wobei gerade New York in der verheerenden Schlacht der Erzengel einiges hatte einstecken müssen. Von den bis in den Himmel reichenden Türmen der Stadt waren vielfach nur noch Ruinen übrig. Eigentlich konnte Raphael nicht eine einzige seiner exzellent ausgebildeten Führungskräfte entbehren. Trotzdem hatte er Trace zu Sharine geschickt. Weil Raphael eben nun einmal genauso Sharines Sohn war wie Illium.
»Es ist alles in Ordnung«, versicherte der Vampir ihr nun. Er war schick wie immer, makellos gekleidet in ein maßgeschneidertes schwarzes Hemd und eine schwarze Hose, die Schuhe blank poliert und so staubfrei, wie es hier in dieser Gegend eigentlich gar nicht möglich war. »Sie haben starke Fundamente gelegt, die jetzt gut tragen.«
Ein größeres Kompliment hätte er ihr nicht machen können, zumal sie wusste, dass er trotz seiner manchmal verspielten und vornehmen Art die Wahrheit sagte. In diesem Moment war Trace ganz Soldat, der seiner Vorgesetzten und Lehnsherrin Bericht erstattete, ohne zu flirten, ohne zu schmeicheln.
Als sie ihm zunickte, verneigte er sich und ging.
Den Brief in der Hand, stieß sie einen leisen Seufzer der Erleichterung aus und blickte noch einmal hinaus in die Landschaft mit der untergehenden Sonne. Würde sie sich je an die Ehrerbietung gewöhnen, die ihr alle entgegenbrachten, mit denen sie es hier zu tun hatte? Natürlich kam solch ein Verhalten nicht ganz unerwartet, Sharine selbst hatte doch Trace gerade erst wieder erklärt, wie alt sie war. Im Grunde in vielen Dingen eine Uralte – nur eben in ihrem Innern nicht.
Wobei das natürlich so auch nicht stimmte! Aus dem Mädchen, das sie vor langer Zeit gewesen war, aus der Frau, die Raan als sein Vögelchen bezeichnet hatte und die von ihren Freunden Sharine genannt worden war, war der Kolibri geworden. Wenigstens ihren Namen hatte sie sich inzwischen ein Stück weit zurückerobert: An diesem kleinen, glücklichen Hof nannten sie alle nur Lady Sharine.
Entschlossen schob sie den Finger unter das Siegel und brach es auf. Der Umschlag enthielt ganz wie erwartet einen Brief des Kaders, und Sharine runzelte die Stirn, als sie die kräftige Handschrift erkannte, in der das Schreiben abgefasst war. Der Brief war von Raphael. Nur schrieb hier nicht der kleine Junge, auf den sie so oft achtgegeben hatte, und auch nicht der Mann, an den sie voll mütterlicher Zuneigung dachte. Diesen Brief hatte der Erzengel von New York verfasst.
Als sie ihn zu Ende gelesen hatte, ließ sie die Hand mit Brief und Umschlag sinken und starrte blicklos in das atemberaubende Schauspiel der Rottöne am Himmel. Nein, damit hatte sie nun nicht gerechnet. Wenn sie jedoch darüber nachdachte, ergab der Vorschlag auf erschreckende Art einen Sinn.
Es gab so viel Chaos auf der Welt, nachdem Lijuan und Charisemnon darin gewütet und Angst und Schrecken verbreitet hatten. Millionen waren gefallen, mehr als ein Erzengel musste als verloren gelten oder lag in einem solch tiefen Heilungsschlaf, dass niemand wusste, wann er zurückkehren würde oder ob überhaupt. Was genau mit Michaela und Astaad geschehen war, war selbst einem Großteil der Engelheit nicht bekannt, aber Raphael hatte Sharine all ihre Fragen dazu beantwortet, und sie wusste nun, was sie hatte wissen wollen.
Sie würde nie etwas davon verraten, da konnte er sicher sein.
All die Jahre, in denen Sharine in den verworrenen Pfaden des Kaleidoskops gefangen saß, zu dem ihr Verstand geworden war, hatte sich Raphael um ihren Sohn und auch um den anderen Jungen gekümmert, der immer Teil ihres Lebens gewesen war. Illium und Aodhan, zwei Flammen in ihrem Herzen, einer der Sohn ihres Blutes, der andere Sohn der gemeinsamen Kunst. Sie hatte Aodhan unterrichtet, wie sie selbst einst von Raan unterrichtet worden war.
Immer noch wurde sie traurig, wenn sie an das geliebte Gesicht, die begnadeten Hände dachte, aber nach all den Jahren, ja Äonen, war ihre Trauer zu schwarz-weißen Schemen verblasst, obwohl sie immer wieder zu Raans Grab gepilgert war. Vor allem, nachdem ihr Gemüt so heftigen Schaden erlitten und ihr Herz sich nach der Zeit gesehnt hatte, in der sie sich sicher und geliebt gefühlt hatte, den Kopf voller Träume.
Die Erinnerungen hatten ihr einen sicheren Ort geschenkt, ihr ein Versteck geboten.
Aber damit war es jetzt vorbei. Sharine versteckte sich nicht mehr, hatte genug davon, nur im eigenen Kopf zu leben. Es wurde Zeit, sich der Wahrheit zu stellen. Und dazu gehörte als Erstes, sich einzugestehen, dass sie um Raan trauern würde, bis es sie nicht mehr gab, sich aber an den lieblichen, wunderschönen Schmerz ihrer jugendlichen Liebe gar nicht mehr richtig erinnern konnte. Hätten sie zusammen älter werden dürfen, wäre es anders. Aber in einer Welt des »Wenn« und »Hätte« zu leben, half ihr nicht weiter.
Zornig reckte sie das Kinn vor, diesmal wütend auf sich selbst. Ihre Freundin Caliane wäre jetzt bestimmt ungehalten über die Richtung, die ihre Gedanken wieder einmal eingeschlagen hatten. Caliane war da sehr streng und felsenfest davon überzeugt, dass Sharine sich nichts vorzuwerfen hatte und endlich mit ihren Selbstzweifeln aufhören musste.
»Aegaeon wusste ganz genau, was er tat«, hatte Caliane nach Aegaeons Erwachen aus dem Tiefschlaf erklärt, in einem Ton, so unbeugsam wie ihr Rücken gerade. »Er wusste, was du durchgemacht hattest, er kannte die Narben, die die Erinnerung bei dir hinterlassen hatte, und er tat etwas so unfassbar Grausames, dass ich ihm nie verzeihen werde. Er nahm deinen schlimmsten Albtraum und sorgte dafür, dass er wieder zum Leben erwachte. Du bist an gar nichts schuld!« Caliane hatte mit finsterer Miene den Kopf geschüttelt. »Er hat die Brüche in deiner Psyche verursacht, nicht du. Du darfst dir nie wieder Vorwürfe machen.«
Aber genau das tat Sharine. Sie warf sich vor, nicht stark genug gewesen zu sein. Sie warf sich ihre tiefe, blind machende Trauer um Raan vor und die mentalen Schreie, die so lange in ihr nachgehallt hatten, nachdem sie beim Besuch des Ruheorts ihrer Eltern die beiden nicht schlafend, sondern tot vorgefunden hatte. Das Blut war in ihren Adern gestockt, während sie schliefen, ihre Körper lagen wie ausgetrocknete Hüllen da.
Auch sie waren gestorben. Keine vier Jahrzehnte nach dem starken, talentierten Raan.
Obwohl Engel doch eigentlich nicht starben, es sei denn, in der Schlacht.
Als Einzige ihrer Art hatte Sharine drei geliebte Personen begraben müssen, die sich schlafen gelegt und die Augen geschlossen hatten, um zu ruhen, und die dann nie mehr aufgewacht waren. Sie hatte den Liebsten begraben, die Mutter und den Vater. Sie alle lagen lange verwest in ihren Gräbern, nie wieder würde die Welt ihre Stimmen hören.
Es liegt an dir, hatte ein kleines, hinterhältiges Stimmchen ihr des Nachts zugeflüstert, wenn alles still war und sich niemand mehr regte. Wen du liebst, der stirbt. Niemand möchte mit dir in einer Welt leben.
Nachdem ihr Aegaeon begegnet war, hatte ihr diese Stimme besonders zugesetzt, hatte sie gequält und in Angst und Schrecken versetzt. Ihre Furcht drohte nach der Geburt ihres Sohnes ins Unendliche zu wachsen, bis Sharine sich vorkam wie eine Glaskugel mit unzähligen winzigen, feinen, unsichtbaren Rissen.
Dann war sie innerlich zersprungen. Verstand und Gemüt hatten in Scherben zu ihren Füßen gelegen.
Natürlich hatte sie sich die Schuld daran gegeben.
Und dass ihr Sohn sie trotzdem liebte, war für sie das größte Geschenk ihres Lebens.
Der Gedanke an Illium ließ sie noch einmal den Brief in ihrer Hand ansehen. Wie stolz er auf sie wäre, brächte sie den Mut auf zu tun, was Raphael hier vorschlug. Und deswegen würde sie es tun! Sie hatte ihn viel zu lange enttäuscht. Es war an der Zeit, Illium zu beweisen, dass er sie nicht ohne Grund voller Stolz seine Mutter nannte.
Die letzten Sonnenstrahlen liebkosten ihre Flügel, als sie über das Dach schritt und das Haus betrat. Dort suchte sie den kleinen, mit allen modernen Raffinessen ausgestatteten Raum auf, dessen glitzernde Geräte einer Technologie dienten, die sie nicht voll verstand. Seit sie das Kaleidoskop endgültig hinter sich gelassen hatte, akzeptierte sie zumindest, wie nützlich diese Technologie sein konnte, und so bat sie einen ihrer Leute, eine Verbindung zu Raphael herzustellen.
Sie nahm den Anruf in ihrer eigenen privaten Bürosuite entgegen. Dort stand ein alter weißer Schreibtisch mit anmutig geschwungenen Beinen, alle Sitzmöbel waren mit weichen Stoffen bezogen. An den Wänden hingen Bilder, überall standen frische Blumen, und insgesamt war dieser Raum viel weicher und weiblicher als der, der schließlich auf dem Wandbildschirm vor ihr auftauchte.
In Raphaels Arbeitszimmer dominierten ähnlich wie in seiner Stadt Glas und Stahl. Diesmal sah sie in seinem Rücken nicht den Ausblick auf die glitzernden Lichter von Manhattan, sondern die Regale mit den Schätzen, die ihm lieb und teuer waren, darunter eine Feder von so reinem Blau, dass ihr der Anblick auch jetzt wieder einen Stich ins Herz versetzte.
»Lady Sharine.«
»Du siehst müde aus, Raphael.« Falten um den Mund, angespannte Schultern, schwarze Schatten unter den ausdrucksvollen blauen Augen. Wie oft hatte sie dieses Blau gewählt, zuerst bei ihren Bildern von Caliane, als sie versucht hatte, den Blick des Erzengels einzufangen, der ihre beste Freundin war, später, um die Augen des Sohnes dieser Freundin auf Leinwand zu bannen. Jedes Mal hatte sie eine Ewigkeit gebraucht, um genau den richtigen Farbton zu treffen. Gemahlene Saphire, geschmolzener Kobalt, der Himmel in den Bergen zur Mittagszeit, all dies und mehr lebte in den Augen von Raphael und Caliane.
Für Sharine als Künstlerin stellte dieser Farbton eine der größten Herausforderungen dar und gleichzeitig eine ihrer größten Freuden.
Raphael fuhr sich mit der Hand durch das Haar. »Bis wir uns ausruhen können, liegt noch ein weiter Weg vor uns.«
Sofort verspürte Sharine den Drang, ihn zu bemuttern. Wahrscheinlich würde dieser Drang nie ganz verschwinden, wie denn auch? Raphael war noch ein Jugendlicher gewesen, als Caliane wahnsinnig wurde, und Sharine war für ihn da gewesen, obwohl es ihr damals schon nicht gut ging und die Anzahl der feinen Risse von Jahr zu Jahr zunahm. Als man Raphaels geschundenen Körper auf diesem Feld weitab jeglicher Zivilisation entdeckte, hatte Sharine ihn in ihre Flügel gehüllt, ihm das verfilzte Haar aus dem Gesicht gestrichen und ihn fest an sich gedrückt.
Er war ein zäher, überaus entschlossener Junge gewesen, aber in seinem Innern tief verwundet.
Jetzt ging ihr das Herz auf, wenn sie ihn sah, so stark, so lebendig, so wild und hingebungsvoll geliebt von einer Frau, die alles verkörperte, was sich Sharine für Raphael erhofft hätte, hätte sie sich vorstellen können, dass so eine Gefährtin für ihn existierte. Das Herz ging ihr auf, und sie konnte wieder an das Glück glauben und daran, dass man die Möglichkeit hatte, das eigene Schicksal selbst zu gestalten.
Caliane hatte es ihrem Sohn nie erzählt, aber bei Raphaels Geburt hatten ein paar von den verbitterten Alten gemunkelt, das Kind sei ganz sicher zu Wahnsinn und Verfall verdammt. Immerhin sei seine Mutter eine Uralte und wirklich nicht mehr frisch und blühend. Schon seltsam, dass solche Vorurteile sogar unter Unsterblichen existierten, aber anscheinend gab es überall Leute, die nach der Dunkelheit suchten.
Dieselben Leute hatten auch gemunkelt, Sharine brächte den Tod.
Calianes Junge hatte all diese Stimmen zum Schweigen gebracht, indem er zur strahlenden Verkörperung all dessen wurde, was für das Beste ihrer Art stand. Es war in ganz entscheidendem Maß Raphael zu verdanken, dass die Welt im Moment nicht in Blutströmen und Tod versank. Allerdings nicht nur ihm. »Wo ist Elena?«, erkundigte sich Sharine, und ihre Finger krümmten sich unwillkürlich zusammen, als würden sie sich um das Messer schließen, mit dem sie unter Elenas Anleitung umzugehen gelernt hatte.
»Im Park. Mit ihrer besten Freundin Sara und Saras Kind.« Raphael strahlte, wie er es nur tat, wenn von seiner Frau die Rede war. »Wir haben beschlossen, dass es uns allen ganz guttut, uns mal ein Stündchen von den gruseligen Aufräumarbeiten hier zu verabschieden. Es kann einem schon aufs Gemüt schlagen, wenn das eigene Zuhause in Schutt und Asche liegt.«
Sharine konnte sich zwar nicht vorstellen, wie man sich fühlte, wenn eine geliebte Stadt in Schutt und Asche vor einem lag, aber eins wusste sie genau: Raphaels New York besaß ein tapferes Herz. Die Stadt würde sich wieder erheben, würde auferstehen mit ihren glitzernden Türmen aus Glas und Stahl, die den Himmel berührten. Die Flüsse würden keinen Schutt und keine Leichen mehr führen und das verbrannte Land würde neu grünen und blühen.
»Und was wirst du mit dieser Stunde anfangen, mein Junge?«, fragte sie, wobei es ihr in den Fingern juckte, weil sie ihm zu gern diese eine Haarsträhne aus dem Gesicht gestrichen hätte.
Er lächelte sie an. »Ich werde mit Illium fliegen. Wir wollen Jason auf seinem Nachhauseweg abfangen.«
»Ich begreife nicht, wieso du überhaupt weißt, dass er im Land ist. Dein Meisterspion huscht durch die Gegend wie Rauch.« Sharine wusste genau, dass Jason in den Monaten vor Kriegsbeginn auch in der Nähe von Lumia gewesen war, was sie allerdings erst nachträglich herausgefunden hatte.
Der Kader vertraute ihr. Was aber nicht bedeutete, dass sie nicht auch unter Beobachtung stand. Sharine hatte nichts dagegen einzuwenden, wusste sie doch, warum die Erzengel so entschieden hatten. In Lumia hatte das Böse florieren können, weil niemand ihren Vorgänger im Auge gehabt hatte. Dass sie nicht vorhatte, in seine Fußstapfen zu treten, garantierte noch lange nicht, dass man ihr und allen, die nach ihr kamen, blind vertrauen konnte.
Raphael lachte, woraufhin sie lächeln musste, weil ihr sofort einfiel, wie vergnügt er als Kind immer gelacht hatte, wenn er nach ein paar Malstunden bei ihr so aussah, als hätte er in Farben gebadet. »Ich glaube ja, Jason wollte, dass man ihn sieht. Er weiß, welche Sorgen wir uns machen, wenn er irgendwo ist, wo wir ihm nicht beistehen können. Also ist er von Zeit zu Zeit nett und wirft uns einen Knochen hin.«
Die Jugend und ihre Spielchen! Sharine schüttelte liebevoll den Kopf. »Ich habe deinen Brief erhalten.«
Erstaunlich blaue Augen, in denen immer noch das Lachen nachklang, richteten sich auf sie. Aber Raphaels Worte waren die eines Erzengels. »Was sagst du zu unserer Bitte, Lady Sharine?«
»Ihr seid sicher, dass ihr mich für diese Aufgabe haben wollt? Ich bin wahrlich alles andere als eine Kriegerin.«
Raphaels Gesichtsausdruck war schwer zu deuten. »Bei Titus muss man wissen, wie man ihn zu nehmen hat.« Um seine Lippen zuckte es. »Er ist ein Krieger und Erzengel, den ich mehr respektiere als viele andere, aber er setzt nun einmal gern seinen Kopf durch.«
Das interpretierte Sharine ganz richtig so, dass es Ärger gegeben hatte und bestimmte Unsterbliche nun drohten, aus dem Dienst beim Erzengel von Afrika auszuscheiden. »Willst du damit andeuten, ich soll die Vermittlerin spielen?« Sie zog die rechte Braue hoch. »Erzengel Titus leitet seinen Hof doch schon seit Langem sehr erfolgreich.«
Im Grunde kannte Sharine den Erzengel kaum, ihre Wege hatten sich in all den Jahren nie gekreuzt. Er war ein paar Jahrtausende jünger als sie und hatte den Weg des Kriegers gewählt, während sie Künstlerin war. Aber im Kontingent der Streitkräfte von Lumia sprachen diejenigen Engel, die unter Titus gedient hatten, mit großer Hochachtung von ihm.
»Ich fürchte, damit könnte es nun vorbei sein«, erwiderte Raphael. »Seine Leute sind ihm treu ergeben, loyal bis aufs Blut, aber von den ihm aus anderen Territorien beigeordneten Kriegern hat eine ganze Reihe gekündigt.« Raphael schob das Kinn vor. »Wer Titus nicht kennt, fühlt sich durch seine ruppige Art vor den Kopf gestoßen. Natürlich fasst er zurzeit niemanden mit Samthandschuhen an, aber diese Leute sind zu dumm, um zu begreifen, dass er momentan alle Unterstützung braucht, die wir ihm verschaffen können, von jedem Einzelnen.«
Ach so, jetzt verstand sie es schon besser. Da fühlten sich einige alte und mächtige Engel beleidigt, weil sie wohl erwarteten, dass auch unter den gegebenen prekären Umständen Süßholz geraspelt und immer die Form gewahrt wurde. »Und du meinst, ich könnte mit ihm umgehen? Das überrascht mich.« Die gesamte Engelheit hatte Sharine lange mit Samthandschuhen angefasst und sie behandelt wie eine besonders wertvolle Vase, die bereits einen Sprung hat.
»Ich will ja nicht unhöflich sein, aber wir haben keine andere Option, Lady Sharine.« Das klang sehr düster. »Ich habe vor zwei Wochen für eine Woche in Afrika Dienst getan, und Jason kehrt gerade aus Titus’ Territorium zurück. Auch Venom befindet sich auf dem Rückweg aus Afrika.«
Sharine erinnerte sich an Venom: Das war der junge, aber bereits sehr starke Vampir mit den Augen einer Viper. »Du hast die Freundschaftsbindungen aufrechterhalten.«
»In diesem Fall ging meine Hilfe über einen Freundschaftsdienst hinaus. Der Kader musste in Afrika eingreifen, der Kontinent wäre sonst überrannt worden.« Raphael stemmte die Hände in die Hüften, hielt die Flügel hoch aufgerichtet und gerade. »Auch Alexander hat die Grenze zu Afrika überquert, um mitzuhelfen. Eigentlich waren wir davon ausgegangen, es würde ausreichen und dass drei Erzengel in der Lage sein müssten, so weit mit den Wiedergeborenen aufzuräumen, dass Titus und seine Leute den Rest allein erledigen könnten. Aber die Lage dort ist katastrophal.«
»Ich habe gehört, dass sich die Infektion rasend schnell ausbreitet.« Lumia lag einsam, war aber keineswegs vom Rest der Welt abgeschnitten. Schon gar nicht, seit Trace dort lebte, der es meisterhaft verstand, für einen guten Informationsfluss zu sorgen.
»Ja. Der Erregerstamm in Afrika scheint stärker und virulenter zu sein als im Rest der Welt. Charisemnon muss sich mit Lijuan zusammengetan haben, um einen noch schädlicheren Feind zu kreieren. Gut dabei ist lediglich, dass dieser Erregerstamm auf Afrika beschränkt zu sein scheint, doch für Titus schafft das eine Situation, um die ihn nun wirklich niemand beneidet.«
Raphael breitete die Flügel aus und klappte sie wieder zusammen. »Wenn ich könnte, würde ich nach Afrika übersiedeln, bis wir die Gefahr ausgeräumt haben, aber mein Territorium ist selbst sehr in Mitleidenschaft gezogen – viel schlimmer, als wir ursprünglich annahmen. Dazu kommen die Vampire, die sich dem mörderischen Blutrausch ergeben haben – ich kann nicht fort. Ich muss zu Hause bleiben und brauche auch meine führenden Leute hier. Die anderen Territorien sind in mehr oder weniger derselben Lage.«
Nichts von alledem beantwortete die Frage, warum der Kader annahm, Sharine könne mit einem reizbaren Erzengel umgehen, der sich nicht zu beherrschen wusste. In der Engelheit gab es sicher einige Personen, die wohl eher erwarteten, dass sie unter solch einem Druck zusammenbräche. Nein, zusammenbrechen würde sie nicht, das wusste Sharine. Dazu war sie viel zu wütend, und diese Wut war das Instrument, das sie gegen ihre verhärteten Narben einsetzen konnte.
Wobei Caliane das ja anders sah. »Ich glaube, dieses Kaleidoskop, wie du es nennst, war der verzweifelte Versuch deines Verstandes, dir den Raum zu verschaffen, den du zur Heilung der Wunden brauchtest, die sich nach deinen ersten Verletzungen nie ganz geschlossen hatten. Diese grässlichen Leute, die dich nach dem Tod deiner Eltern so grausam verhöhnten, haben dir Wunden in einer Zeit zugefügt, in der du ohnehin eine zutiefst verletzte, blutende Kreatur warst.«
Calianes lebhafte blaue Augen funkelten jedes Mal vor Wut, wenn dieses Thema zur Sprache kam. »Dass Aegaeon jetzt plötzlich und ohne Vorankündigung wiederaufgetaucht ist, hat deine Rückkehr in die Realität nur beschleunigt. Aber nicht besonders stark. Du warst bereits wieder fast du selbst, sonst hättest du doch auch nie die Leitung von Lumia übernehmen können.«
Langsam fing Sharine an zu glauben, dass Caliane recht haben könnte. Sie hätte Lumia wirklich nicht leiten können, wenn sie nach wie vor in der zerbrochenen Landschaft ihres Verstandes gehaust hätte. Ihr Gedächtnis bestätigte ihr das, sie konnte sich an jeden einzelnen Tag des vergangenen Jahres erinnern. Gut, am Anfang waren da ein paar verschwommene Ränder, aber unter dem Strich hatte sie nichts vergessen oder ganz verloren.
Trotzdem verstand sie immer noch nicht, warum sie gebeten wurde, sich Titus anzuschließen. »Ich bin nicht so stark wie einer deiner Sieben und kann es auch wohl kaum mit einem Erzengel aufnehmen.«
Raphael musterte sie aufmerksam. »Meine Mutter hat mir einmal gesagt, wenn ich wissen wollte, woher Illium seine Stärke bezieht, dann müsste ich ihn mir ganz genau ansehen. Damals habe ich das nicht verstanden, aber inzwischen frage ich mich, von wem er das alles geerbt hat. Seine Loyalität, sein Haar, sein Herz … und seine Schnelligkeit.«
Ganz hinten in Sharines Kopf rührte sich etwas, eine längst vergessen geglaubte Erinnerung. »Deswegen nannte mich Raan seinen Kolibri!« Sie sagte das leise, eher für sich als für Raphael. Das waren sehr alte Erinnerungen, die hier langsam zum Leben erwachten.
Wie schnell du bist, mein Vögelchen. Deine Augen funkeln wie der Sonnenschein, du hast immer einen Farbfleck auf der Wange, bist leichtfüßig – und schnell wie ein Kolibri. Wenn du dich entscheiden würdest, fortzufliegen, könnte ich dich nicht einfangen.
Sie hatte doch wirklich vergessen, wie sie zu ihrem zweiten Namen gekommen war! Sie hatte ihn einer liebevollen Umarmung ihres Raan zu verdanken. Sie hatte vergessen, dass er ein Bild von ihr im Flug gemalt hatte, auf dem ihre Flügel und ihr Körper Farbstreifen an den Himmel projiziert hatten, ähnlich dem kleinen, juwelengeschmückten Vogel.
»Lady Sharine?« Raphael sprach sie leise an, ruhig und ohne Ungeduld. Aber seine Stimme holte sie in die Gegenwart zurück.
Die Mutter des blauäugigen Jungen war eine Uralte; er wusste, dass Erinnerungen Zeit brauchten, um sich im Bewusstsein dieser alten Engel zu entfalten. Dort, wo bei den Unsterblichen die Erinnerung wohnte, ging es nicht immer ordentlich zu. Dort gab es verworrene Stränge und Knoten und im Fall von Sharine viele, viele durchtrennte Fäden.
»Ich nehme die Aufgabe an«, erklärte Sharine mit dem deutlichen Gefühl, einen Schritt in die Zukunft zu tun. »Ich werde mich bereit machen, zu Titus zu fliegen.«
5
Mit einem markerschütternden Schrei erledigte Titus noch ein weiteres der fressgierigen Monster, die die stinkenden Pestbeulen Lijuan und Charisemnon der Welt hinterlassen hatten. In letzter Sekunde wandte er den Kopf ab, damit das faulige Blut des Biestes ihn wenigstens nicht im Gesicht erwischen konnte. Er hatte von dem Zeug inzwischen wahrlich mehr als genug abbekommen, ohne sich gegen den widerlichen Gestank selbst wehren zu können.
Sobald der Wiedergeborene Geschichte war, nahm Titus die Unterhaltung mit seiner Truppenausbilderin Tanae wieder auf. »Sie schicken mir den Kolibri!« Es klang wie ein verzweifelter Schrei.
»Das sagten Sie bereits. Vier Mal.« Eine Mischung aus Blut und Schweiß hatte dafür gesorgt, dass Tanae ein paar dunkelrote Haarsträhnen an der Wange klebten.
Auch sie erledigte rasch noch einen Wiedergeborenen und wischte sich das Schwert an der bereits blutdurchtränkten Hose ab.
Tanae hatte sich in der vergangenen halben Stunde beim Eliminieren eines Nestes Wiedergeborener in einen wirbelnden Derwisch verwandelt, und jetzt hing ihr eine grauenhafte Schicht Blut und Gehirnmasse an den Flügeln. »Das ist ein Vorschlag vom Kader, Sire, dem Sie selbst auch angehören. Sie müssen nicht akzeptieren, wenn Sie nicht wollen.«
Titus funkelte sie erbost an. »Der Kolibri!«, wiederholte er, wobei er den Namen der größten lebenden Künstlerin der Engelheit absichtlich in die Länge zog. »Den soll ich ablehnen? Und mein ganzes Volk gegen mich aufbringen?«
Alle liebten den Kolibri. Auch Titus selbst liebte diese Frau, wenn auch eher aus der Ferne. Er kannte sie nicht persönlich, er wusste nur von ihr. Er wusste, dass sie ein Geschenk an die Engelheit war, dass ihre Güte Stoff für Legenden war, dass sie sich in ihrem ganzen Leben nicht einen Feind gemacht hatte. Und natürlich wusste er, dass sie Illium zur Welt gebracht hatte, einen jungen Engel, den Titus sehr gern mochte.
Tanae, selbst Mutter, wenn auch ohne enge Beziehung zu ihrem Sohn und generell keine Frau großer Gefühle, verdrehte die hellgrauen Augen. »Sie ist keine Kriegerin, und wir stecken mitten im Kampf gegen die Seuche der Wiedergeborenen. Es wird niemanden wundern, wenn Sie das Angebot ablehnen. Respektvoll natürlich.«
Titus musste sich umdrehen und drei weitere verwesende Wiedergeborene niederstrecken, ehe er antworten konnte. »Sonst will ja niemand mehr kommen«, maulte er. »Ich habe alle verprellt, die frei gewesen waren, sich uns anzuschließen, und jetzt sind keine Krieger mehr übrig.«
»Den letzten hätten Sie tatsächlich nicht so anbrüllen sollen«, kommentierte Tanae seelenruhig, nachdem sie einem Wiedergeborenen, dem bereits der eine Augapfel zerquetscht aus der Augenhöhle baumelte, den Kopf abgeschlagen hatte. »Er war eigentlich ganz kompetent.«
»Er war ein Hasenfuß!«, röhrte Titus. »Welcher Krieger rennt denn gleich weg, wenn man ihn mal ein bisschen anbrüllt? Du rennst ja auch nicht weg!«
»Weil ich nach all den Jahren an Ihrer Seite inzwischen taub geworden bin.« Tanae blickte sich suchend um, entdeckte auf dem Schlachtfeld nichts als verwesende, sich auflösende Leichen und steckte ihr Schwert in die Scheide.
Dass die toten Wiedergeborenen sich auflösten, war neu und geschah erst, seitdem Lijuan gefallen war. Die Leichen wurden zu einer zähen Masse, die derart stank, dass Titus’ Stellvertreter Tzadiq einen Trupp Zivilisten zusammengestellt hatte, deren Aufgabe darin bestand, mithilfe großer Baumaschinen Löcher zu graben und die Leichen hineinzuschieben. Sie sozusagen vom Erdboden abzukratzen.
Das war eigentlich ein Luxus, wenn man bedachte, was sonst noch für Aufgaben auf sie warteten. Aber Titus’ Leute wussten es ihm zu danken, denn sonst hätte es überall, auch in ihren Häusern, nach fauligem, verwesendem Fleisch gestunken, und niemand hätte mehr einen Bissen hinuntergebracht.
Und Nahrung war etwas, das Titus sehr zu schätzen wusste.
Weil niemand wusste, inwiefern der gelatineartige Glibber den Boden vergiftete, hatte Titus vor, die Gräber eins nach dem anderen mit Erzengelskraft zu reinigen. Aber damit würde man noch warten müssen, denn beides gleichzeitig, reinigen und gegen Wiedergeborene kämpfen, schaffte er nicht. In der Zwischenzeit wurden die tiefen Gruben mit dichtem Material ausgekleidet, um zu verhindern, dass eventuelle Giftstoffe ins Erdreich sickerten. Zusätzlich überwachten Titus’ Wissenschaftler die Situation.
»Du hast keinen Respekt vor mir!«, beschwerte sich der Erzengel gerade bei Tanae. »Ich sollte dich fortjagen.«
»Ich habe Dauerangebote von drei anderen Höfen.«
Er sollte sie wirklich fortjagen, dachte Titus grimmig. Wenn er sie nur nicht so gut leiden könnte! Außerdem wusste er ganz genau, dass es nicht guttat, wenn sich ein Erzengel nur mit unterwürfigen Höflingen umgab, die ihm schmeichelten und vor ihm katzbuckelten. Das führte unweigerlich zu Verfall, wie Lijuans Beispiel gezeigt hatte. Deren Höflinge hatten an ihren Lippen gehangen, hatten sie grenzenlos verehrt, und so war aus einer fähigen, kompetenten Anführerin eine Frau geworden, die den Tod für das eigentliche Leben hielt.
Tanae mochte eine scharfe Zunge und keine Zeit dafür haben, irgendjemandem um den Bart zu gehen, aber sie war gleichzeitig loyal bis zum Äußersten. Wenngleich Titus sich manchmal fragte, wie ihr Gefährte Tzadiq mit ihr fertigwurde. Als Mann hatte man es doch gern, wenn die Liebste auch mal ein bisschen weich sein konnte.
Was das betraf, bekam Titus selbst momentan nicht gerade viele Liebhaberinnen zu Gesicht. Im Grunde gar keine. Er war den Freuden des Fleisches beileibe nicht abgeneigt, aber im Augenblick fehlten ihm Zeit und Lust, die hübschen, zerbrechlichen Wesen zu verzärteln und zu besänftigen, deren Gesellschaft er ansonsten genoss.
»Ich werde aufräumen und sauber machen müssen, ich werde sie unterhalten müssen!«, stöhnte er verzweifelt und klang so gar nicht wie ein Erzengel. Allein die Vorstellung war schon scheußlich genug.
»Vielleicht ist sie uns eine größere Hilfe, als wir es für möglich halten.« Tanae dachte gern praktisch. »Ihren Job als Aufsicht in Lumia bekommt sie doch prima hin, wie man so hört. Und Sie werden kaum abstreiten, Sire, dass in Ihrem Haushalt zurzeit Chaos herrscht und wir dort eine feste Hand am Steuer gut gebrauchen können.«
»Das mit dem Chaos liegt nur daran, dass jeder, der ein Schwert schwingen kann, gegen Wiedergeborene kämpft und der Rest Löcher aushebt, damit wir den Glibber begraben können. Und die Schutzbedürftigen habe ich in sichere Häfen geschickt.« Diese sicheren Häfen waren größtenteils die Afrika vorgelagerten Inseln. »Sie wird nichts anderes tun, als herumzusitzen und es uns übel nehmen, wenn wir sie nicht nach Strich und Faden verwöhnen, wie es einer Dame zusteht.«
Nein, diesen Vorschlag hatte Titus von Raphael nicht erwartet! Der Jungspund war doch hier gewesen, hatte eine brutale, erschöpfende Reise auf sich genommen, um Titus zu unterstützen, und wusste genau, was hier gebraucht wurde. Auf keinen Fall eine zerbrechliche Künstlerin, die bekanntermaßen auf einer höheren Ebene existierte, weit entfernt von vor sich hin kriechenden Wiedergeborenen, Krieg und Blut.
Hier bei Titus gab es keine höhere Ebene. Hier gab es nur Verwüstung, Tod und Verwesung.
»Vielleicht hatten die anderen keine Wahl«, tröstete er sich selbst mit einem lauten Seufzer. »Wir haben so viele gute Leute verloren.« Tausende Krieger waren in den Schlachten gefallen, und obwohl Titus jetzt auch über das verfügen konnte, was von Charisemnons Streitkräften übrig geblieben war, konnte er diesen Leuten doch nicht vertrauen.
Er hatte es ihnen freigestellt, in ein anderes Territorium zu wechseln, denn ein nachtragender, missgünstiger Krieger richtete oftmals mehr Schaden an, als er Nutzen brachte. Nur ein winziger Teil der ehemals feindlichen Truppen hatte das Angebot angenommen und Afrika verlassen. Es waren die Leute, die an Charisemnons Hof eine führende Rolle gespielt hatten.
Titus hatte ihnen keine Träne nachgeweint.
Die Fäulnis im Land seines Feindes saß tief, denn sie war von der Führung des Landes ausgegangen.
Die, die geblieben waren, hatten das wahrscheinlich auch deshalb getan, weil sie außerhalb Afrikas kaum mit einem begeisterten Empfang rechnen durften. Natürlich wusste die Engelheit, dass ein ganz unten in der Rangordnung stehender Krieger auf Entscheidungen und Handlungen seines Erzengels keinen Einfluss hatte, und niemand würde diesen Kriegern ganz direkt aus dem Weg gehen, aber trotzdem blieb die simple Tatsache bestehen, dass jeder Engel sich entscheiden konnte. Er hatte die Wahl.
Diese Engel – und Vampire – hatten sich dazu entschlossen, Befehle von oben auch dann noch zu befolgen, als diese längst untragbar, unverzeihlich geworden waren. Diese Festlegung würde ihnen auch in den nächsten Jahrhunderten noch anhaften, und wie sie damit umgingen, wie sie sich jetzt verhielten, das würde ihr Vermächtnis sein. Im Moment jedoch hatte Titus zu viele missmutige Krieger zu befehligen, die er nicht in der Nähe seiner Leute wissen wollte.
Manche hatte er zur Bewachung von Städten im Norden zurückgelassen, in denen sie sich auskannten. Es wäre sinnlos gewesen, eigene Leute dorthin abzukommandieren, wenn Charisemnons ehemalige Kommandierende bereits Erfahrung damit hatten.
Selbst der unzufriedenste Krieger und die feindseligste Kriegerin würden es nicht wagen, zur Rebellion gegen einen Erzengel aufzurufen. Es würde ihnen ja auch außer ein paar Selbstmordkandidaten niemand folgen. Was konnten sie also schlimmstenfalls anrichten? Gut, sie konnten ihre Pflichten als Stadtkommandanten vernachlässigen, aber dem hatte Titus’ Meisterspionin vorgebeugt, indem sie dafür sorgte, dass in allen Städten Leute saßen, die ein solches Verhalten sofort weitermeldeten.
Was die Krieger betraf, die nicht in der Verwaltung der Städte untergebracht werden konnten, so hatte Titus Tzadiq gebeten, sie in einsam gelegenen Gebieten des Territoriums zu stationieren. Dort konnten sie sich nützlich machen, indem sie die betreffende Gegend von Wiedergeborenen säuberten, und Titus musste sich nicht an seinem Hof mit dem Gift ihres Hasses auseinandersetzen.
»Prima, dann sehen Sie die Sache langsam positiv!«, lobte Tanae jetzt die Bemerkung ihres Erzengels, der Kader könnte aus Mangel an Kandidaten keine andere Wahl gehabt haben. »Hatten Ihre Schwestern das nicht von Anfang an vorgeschlagen?«
Titus wäre gern stehen geblieben, um mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand zu schlagen. Reichte es denn nicht, dass er sich mit der heimtückischen Saat auseinandersetzen musste, die dieser elende Erschaffer von Seuchen ihm hinterlassen hatte? Musste er sich wirklich auch noch ständig mit vier älteren Schwestern herumschlagen, die alle wach und auf dieser Welt zu sein beliebten und es für ihre Aufgabe hielten, ihm gute Ratschläge zu erteilen? Wunderte es da, wenn er als jüngerer Bruder eine vielleicht etwas zu laute Stimme entwickelte, um sich wenigstens manchmal Gehör zu verschaffen? Blieb ihm denn überhaupt etwas anderes übrig?
Und wenn seine Stimme inzwischen so laut und dröhnend geworden war, dass sie andere abschreckte und sie sich von seinem Ton beleidigt fühlten? »Wenn ich wirklich so furchterregend bin, warum haben dann meine Schwestern keine Angst vor mir?«
Da rang sich Tanae doch wirklich fast so etwas wie ein Lächeln ab. »Titus, ich weiß, Sie würden mir im Kampf den Kopf abschlagen, stünde ich auf der Gegenseite. Aber wäre ich jemand, in dem Sie zuerst die Frau und dann erst etwas anderes sähen, dann hätte ich von Ihnen noch nicht einmal den kleinsten blauen Fleck zu befürchten. Das weiß auf dieser Welt jede Frau.«
Titus knurrte sie wütend an, wusste aber nichts darauf zu erwidern. Er hielt es nicht für richtig, jenen gegenüber Gewalt anzuwenden, die nicht in der Schlacht gegen ihn antraten. Das galt für beide Geschlechter, und ja, er hatte ein besonders weiches Herz für Frauen. Sobald eine Frau allerdings zum Schwert griff, wurde sie zur Kriegerin. Eine Kriegerin war etwas anderes, eine Frau jedoch, die musste beschützt werden.
Nun waren zwar zwei seiner Schwestern Kriegerinnen, aber Titus begegnete ihnen nicht in dieser Funktion. Er begegnete ihnen als Bruder. Und sosehr ihn das manchmal auch ärgerte, er konnte ihnen einfach nichts antun, selbst wenn sie ihm ständig neue Vorschläge für den richtigen Umgang mit der Plage der Wiedergeborenen zukommen ließen. Als stünde er nicht selbst schon im vierten Jahrtausend seines Lebens! Als wäre er kein Erzengel, der gerade einen anderen Erzengel besiegt hatte!
Als ihm das letzte Mal der Kragen geplatzt war, hatte er gedroht, sie bei Alexander zu verpetzen, wenn sie ihn weiter so piesackten, und sich bei dem Erzengel zu beklagen, dass seine Schwestern ganz sicher ihre Pflichten vernachlässigten. Denn kämt ihr wirklich den Aufgaben nach, die euch aufgetragen werden, hatte er geschrieben, dann hättet ihr bestimmt nicht so viel freie Zeit für meine Angelegenheiten.
Woraufhin er von den Zwillingen erst einmal nichts mehr gehört hatte. Allerdings traute er dem Frieden nicht.
Mit dem Begriff »Niederlage« konnte keine seiner Schwestern etwas anfangen.
»Komm«, sagte Titus nun zu Tanae. »Lass uns den nächsten Abschnitt freiräumen, damit die Barrikaden errichtet werden können.« Und so gingen sie dann auch vor, immer einen Abschnitt nach dem anderen, wobei Gruppen aus Sterblichen und jungen Vampiren dafür zuständig waren, die Begrenzungen zu verschieben, wenn wieder ein Gebiet von Wiedergeborenen gesäubert war.
Es funktionierte, nur kamen sie sehr langsam voran. Und ohne die Hilfe von Raphael und Alexander wären sie noch nicht viel weitergekommen als ein wandernder Gletscher. Die beiden hatten geholfen, das Gebiet um das lebendige Handels- und Verkehrszentrum Narja zu säubern. Dass Narja inzwischen auch zur zentralen Zitadelle geworden war, von der aus Titus kämpfte, hatte sich eher aus Zufall ergeben, denn eigentlich war Narja keine Kampfzitadelle. Als Titus damals das südliche Afrika übernommen hatte, war Charisemnon ihm noch als friedlicher Nachbar gegenübergetreten, und Narja war als natürliches Resultat eines regen Handels zwischen den beiden Teilen des Kontinents entstanden.
Die kämpferischen Auseinandersetzungen hatten erst viel später begonnen. Damals hatten die Bewohner von Narja sofort beschlossen, zur Unterstützung in der auf einer Anhöhe in der Stadtmitte errichteten Zitadelle zu bleiben und sich zusätzlich zu verbarrikadieren. Glücklicherweise befand sich die Stadt nicht direkt in Grenznähe und war daher von den schlimmsten Gefechten verschont geblieben.
Aber vor der Plage der Wiedergeborenen hatte nichts sie schützen können. Charisemnon, dieser stinkende Schweinehund von einem kranken Kriechtier, hatte so getan, als sei er Titus’ Verbündeter, während er gleichzeitig still und heimlich seine Truppen massenweise hochansteckende Wiedergeborene über die Grenze treiben ließ, als seien es Schafherden. Und diese Wiedergeborenen hatten unter Titus’ Leuten wüten können, waren als übel riechende Welle von Tod und grauenhafter Wiederauferstehung über das Land gerollt.
Selbst zu dritt, Titus, Raphael und Alexander, hatten sie mit brutaler Intensität kämpfen müssen, bis es ihnen gelungen war, die Seuche aus Narja zu verbannen. Was immer Charisemnon, seine größenwahnsinnige Partnerin oder beide zusammen mit den Wiedergeborenen hier angestellt haben mochten, der Erregerstamm war in Afrika eindeutig heimtückischer und virulenter als im Rest der Welt.
Diese neuartigen Wiedergeborenen jagten in Rudeln und schienen über eine zumindest rudimentäre Intelligenz zu verfügen, die auf die ersten von Lijuan geschaffenen Wiedergeborenen zurückging. Viele von ihnen hatten gelernt, Höhlen zu graben, in die sie sich in den hellen Tagesstunden zurückziehen konnten, um dann in der Abenddämmerung hervorzukriechen und ihre Angriffe zu starten.
Und anders als in anderen Teilen der Welt schien die Übertragungsrate der Seuche bei den Wiedergeborenen auch noch nach deren Eliminierung einhundert Prozent zu betragen, solange ihnen nicht der Kopf abgeschlagen oder zumindest gespalten wurde. Wer von einem Wiedergeborenen getötet wurde, stand als Wiedergeborener wieder auf. Noch schlimmer: Durch Wiedergeborene verursachte Kratz- oder Bisswunden führten bei Sterblichen und Vampiren zu hässlichen Infektionen, in fünfzig Prozent aller Fälle sogar zum Tod.
Ja, der Erzengel des Todes und der der Seuchen hatten ein ungeheuerliches Hybridwesen erschaffen. Noch dazu mit einer weiteren, grauenvollen »Verbesserung«, die dazu geführt hatte, dass auf dem Territorium von Titus inzwischen alle Verstorbenen eingeäschert werden mussten. Diese Wiedergeborenen konnten ihre Krankheit nämlich auch an Leichen weitergeben, wobei es da schon reichte, wenn sich noch ein einzelner Fetzen Fleisch an den Knochen befand. Die Monster hoben Gräber aus, entwendeten die Leichen und nährten sich an ihnen. Aber solange sich danach noch Fleischreste an den Knochen befanden, wurden diese Toten wiedergeboren.
Als Titus Afrika verlassen hatte, um gegen Lijuan zu kämpfen, war ein ganzes Dorf von den eigenen, eben erst bestatteten Kriegsopfern abgeschlachtet worden. Die Menschen dieser Regionen verbrachten ihre Tage inzwischen damit, weinend und mit gebrochenen Herzen ihre Toten wieder auszugraben. Natürlich wurden alle Leichen mit Respekt behandelt, aber man konnte nichts anderes tun, als sie aus ihrer Ruhe zu reißen und der reinigenden Kraft des Feuers zu übergeben.
»Charisemnon und Lijuan waren wohl wild entschlossen, diesen neuen Erregerstamm zu verbreiten«, hatte Tzadiq Titus gegenüber geäußert, als ihnen zum ersten Mal klar geworden war, welchem Grauen sie da gegenüberstanden. Die Sonne, das Zeichen dafür, dass sie jetzt eine Weile ausruhen konnten, war gerade aufgegangen und spiegelte sich auf seinem sauber rasierten Kopf. »Warum ist ihr Plan in Afrika wohl ins Stocken geraten?«
»Das werden wir wohl nie mit Sicherheit herausfinden.« Nach einer weiteren Nacht der Kämpfe gegen die Wiedergeborenen dampfte Titus’ Rücken vor Schweiß. »Aber ich möchte wetten, dass Charisemnons Versuch, seine Seuchen und Lijuans Umgang mit dem Tod zusammenzubringen, ihn letztlich teuer zu stehen kam.« Die Seuchen, Charisemnons »Talent«, waren etwas, das in zwei Richtungen losgehen konnte. »Wahrscheinlich hat er es nicht geschafft, das geplante Tempo einzuhalten.«
Aber einiges hatte er durchaus geschafft, dieser aus Aufgeblasenheit und Pestilenz bestehende Erzengel.
Eigentlich hatte Titus mit all diesen Problemen schon genug zu tun, nur machte ihm zusätzlich noch eine weitere Sorge zu schaffen. Als er nach seiner Rückkehr aus New York den inneren Hof von Charisemnons Grenzfestung betreten hatte, musste er dort eine große Anzahl scheußlich verwester Leichen entdecken. Dabei war seit Charisemnons Tod niemand mehr in den Gebäuden dieses Hofes gewesen, denn sämtliche Streitkräfte des Territoriums, die von Titus und die, die früher unter Charisemnon gedient hatten, waren ausschließlich mit dem verzweifelten Kampf gegen die Wiedergeborenen befasst.
Die Wesen hier mussten nach dem Tod ihres Herrn verrückt geworden sein.
Erst später, nachdem Titus ein paar der leitenden Verantwortlichen des ehemals feindlichen Hofes hatte sprechen können, hatte er erfahren, dass kaum jemand wusste, was in diesem Innenhof vorgegangen war. Charisemnon hatte ihn völlig abgeschottet, und nur wenige Ausgewählte hatten Zugang dazu gehabt. Das war so weit gegangen, dass nicht eingeweihte Höflinge sich schon besorgt gefragt hatten, ob ihnen vielleicht die Gunst ihres Erzengels entzogen worden war. Nachdem Titus die Leichen entdeckt hatte, wussten diese Höflinge nun, dass die, die sie für die bevorzugten wenigen gehalten hatten, in Wirklichkeit die unglücklichen wenigen gewesen waren.
Was die Vampire betraf, die er gefunden hatte, so glaubte Titus, dass Charisemnon sie entweder versehentlich mit einer Seuche infiziert oder aber für seine Versuche benutzt hatte. Die Engel waren den Vampiren möglicherweise als Opfergabe hingeworfen worden, oder der Verwesungsgrad ihrer Leichen verbarg alles, was ebenfalls auf eine Krankheit hindeuten konnte. Und das, die Vermutung, die Engel könnten krank gewesen sein, ließ Titus keine Ruhe. Denn eigentlich waren Engel gegen Seuchen immun.
Das war ein in Stein gemeißeltes Gesetz.
So unverrückbar wie Regen und Himmel.
Zumindest, bis Charisemnon auf den Plan trat.
Dann hatte Tzadiq etwas entdeckt, das alles noch schlimmer machte: eine schwarz-grüne Schleimspur, die aus dem Raum mit den verwesenden Leichen hinausführte. Alles, aber auch alles deutete darauf hin, dass ein Engel ihr Urheber war. Kein anderes Wesen auf dieser Welt hätte eine Spur mit einem solchen Muster hinterlassen können. Hier war ein Engel entlanggekrochen oder hatte sich dahingeschleppt und hatte seine Flügel über den Steinboden schleifen lassen.
Ja, Titus hatte es hier mit einem sehr ernsten, einem tödlich ernsten Problem zu tun.
Und er wusste genau, dass der Kolibri absolut keine der erforderlichen Fähigkeiten besaß, die zur Lösung all dieser Probleme beitragen konnten.
Am liebsten hätte Titus noch einmal laut gestöhnt. Gab es in seinem Stab überhaupt jemanden, der in der Lage war, ein Zimmer hübsch für sie herzurichten?
Das konnte doch gar nicht gut ausgehen!
6
Nachdem Sharine ihre Entscheidung getroffen hatte, galt ihre erste Sorge dem Wohlergehen von Lumia und dem angrenzenden Städtchen. Sie rief die drei Leute aus ihrem Team zusammen, die ihr zurzeit in der Führung eine Stütze waren: Trace, Tanicia und Farah.
Tanicia, die Dienstälteste der drei, trug das schwarze Haar vorn dicht am Kopf geflochten, während es hinten wie ein Heiligenschein aufragte. »Seien Sie unbesorgt, Lady Sharine«, versicherte sie. »Wir werden keinen Deut von den Regeln abweichen, die Sie aufgestellt haben.« Ihre Stimme war rau und tief, der Blick entschlossen, und ihre herbstlich orange und rot gefleckten Flügel boten einen wunderschönen Kontrast zu ihrer dunkelbraunen Haut. »Wir werden nicht zulassen, dass ein Schatten auf Ihre Ehre fällt.«