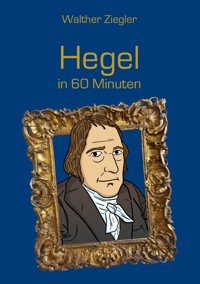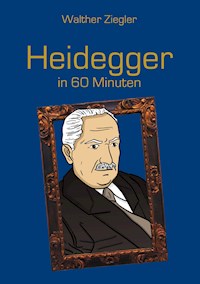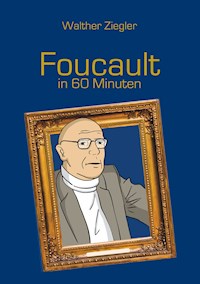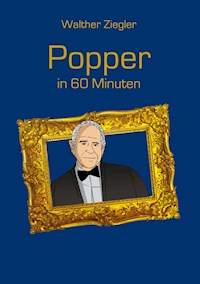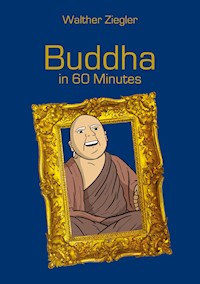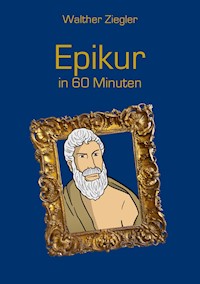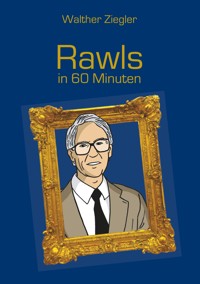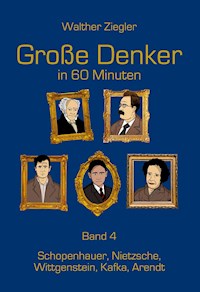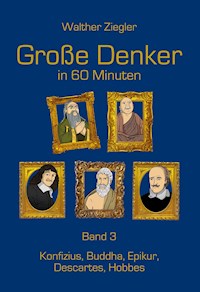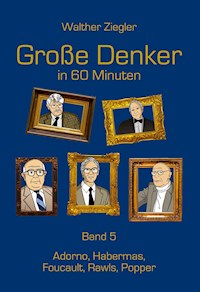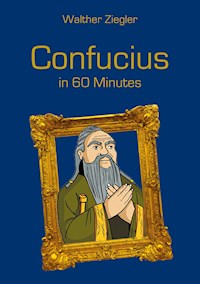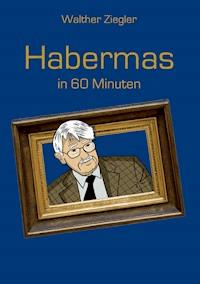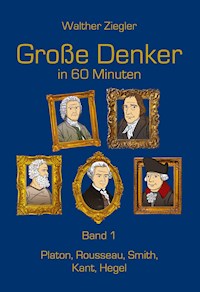
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Große Denker in 60 Minuten - Band 1 " ist der erste Sammelband der beliebten gleichnamigen Buchreihe. Er umfasst die fünf Einzelpublikationen "Platon in 60 Minuten", "Rousseau in 60 Minuten", "Smith in 60 Minuten", "Kant in 60 Minuten" und "Hegel in 60 Minuten". Dabei wird der Kerngedanke des jeweiligen Denkers auf den Punkt gebracht und die Frage gestellt: "Was nützt uns dieser Gedanke heute?" Vor allem aber kommen die Philosophen selbst zu Wort. So werden ihre wichtigsten Aussagen als Zitate in Sprechblasen grafisch hervorgehoben und ihre Herkunft aus den jeweiligen Werken angezeigt. Jeder der fünf Philosophen ist mit 40 bis 80 seiner besten Aussagen vertreten. Die spielerische, gleichwohl wissenschaftlich exakte Wiedergabe der einzelnen Denker ermöglicht dem Leser den Einstieg in die großen Fragen unseres Lebens. Denn jeder Philosoph, der zu Weltruhm gelangt ist, hat die Sinnfrage gestellt: Was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Herausgekommen sind dabei sehr unterschiedliche Antworten. Bei Platon ist es beispielsweise die Idee des Guten, der wir unsere Seele öffnen sollen, bei Rousseau unsere innere ursprüngliche Natur, der wir einzig und allein noch vertrauen können, bei Adam Smith das Eigeninteresse, das alle Individuen antreibt und sich am Ende durch eine unsichtbare Hand in Allgemeinwohl verwandelt. Bei Kant ist es die Anwendung des Verstandes, die uns befreit und zu außerordentlichen moralischen Leistungen befähigt. Bei Hegel schließlich wird alles durch die dialektische Entfaltung des Weltgeistes zusammengehalten, der sich durch die Taten der Individuen und Nationen von Epoche zu Epoche vorantreibt, bis er am Ende sein großes Ziel erreicht. Die Frage nach dem Sinn der Welt und somit dem Sinn unseres Lebens wird von den Philosophen also durchaus unterschiedlich beantwortet, doch eines steht fest: Jeder der fünf Denker hat aus seiner Perspektive einen Funken aus dem Kristall der Wahrheit herausgeschlagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dank an Rudolf Aichner für seine unermüdliche und kritische Redigierung, Silke Ruthenberg für die feine Grafik, Angela Schumitz, Lydia Pointvogl, Eva Amberger, Christiane Hüttner, Dr. Martin Engler für das Lektorat und Dank an Prof. Guntram Knapp, der mich für die Philosophie begeistert hat.
Große Denker
in 60 Minuten
Platon in 60 Minuten
Rousseau in 60 Minuten
Smith in 60 Minuten
Kant in 60 Minuten
Hegel in 60 Minuten
Walther Ziegler
Platon
in 60 Minuten
Inhalt
Platons große Entdeckung
Platons Kerngedanke
Der Weg zum Glück im Wagengleichnis
Die ‚platonische’ Liebe
Die Ideenlehre
Lernen ist Wiedererinnerung der Ideen
Die Unsterblichkeit der Seele
Das Sonnengleichnis
Das Höhlengleichnis
Der ideale Staat
Was nützt uns Platons Entdeckung heute?
Der Idealstaat – Vision oder Alptraum?
Platon – der Vordenker des Abendlandes
Wir alle sind Gefangene – der Aufstieg zum Guten, Wahren und Schönen
Der Stachel der letzten Erkenntnis
Zitatverzeichnis
Platons große Entdeckung
Platons (428–348 v. Chr.) große Entdeckung war ebenso bahnbrechend wie folgenreich. Mit seiner „Ideenlehre“ prägte er die gesamte abendländische Kultur. Sein Name ist auf der ganzen Welt bekannt. Dabei entdeckte Platon im Grunde etwas ganz Einfaches. Es ging ihm lediglich darum, einen verlässlichen Maßstab für Wahrheit zu finden, einen letzten unhintergehbaren Orientierungspunkt für unser Leben. Immer und immer wieder stellte er die Frage: Was ist richtig und was ist falsch? Wie kann ich Wahrheit von Unwahrheit unterscheiden?
Bereits zu Lebzeiten Platons, also gut vierhundert Jahre vor Christus, stritten Philosophen und Bürger auf den Marktplätzen der griechischen Städte um die Wahrheit. Jeder behauptete etwas anderes und bezichtigte seine Gesprächspartner der Naivität. Die ständigen Meinungsverschiedenheiten erschienen den Streithähnen aber ganz natürlich zu sein. Denn die damals tonangebenden Philosophen, die sogenannten Sophisten, allen voran Protagoras, behaupteten, der Mensch sei das Maß aller Dinge. Deshalb hätten fünf verschiedene Menschen logischerweise auch fünf verschiedene Vorstellungen von der Wahrheit. Schließlich habe jedes Individuum seinen eigenen Maßstab und ziehe deshalb auch seine eigenen Schlüsse. Eine verbindliche Wahrheit für alle könne es daher prinzipiell nicht geben.
Genau darum aber ging es Platon. Er suchte eine allgemeingültige und absolute Wahrheit. Ohne eine solche Wahrheit, so entgegnete er den Sophisten, komme es zwangsläufig zu einem moralischen Verfall. Jeder würde sich nach eigenem Ermessen verhalten, so wie es ihm gerade passt. Platon wollte einen unhintergehbaren Punkt, von dem aus man jede Theorie, jeden Gedanken und jede Handlung überprüfen kann. Ihn interessierte nur eines: Was ist wirklich wahr und wie kann man ein wahrhaftes Leben führen?
Er stellte damit als erster die Kernfrage der Philosophie. Die griechische Wortkombination „philo“ und „sophia“ bedeutet nämlich nichts anderes als Liebe zur Weisheit oder frei übersetzt: Wahrheitsliebe. Natürlich ist die Suche nach einer letzten Wahrheit eine ungeheure Herausforderung. Es verwundert daher nicht, dass Platon in seiner Jugend zu keinem endgültigen Ergebnis kam. Er beschloss aber, die Frage so lange weiter zu stellen, bis er eine Antwort finden würde. Hierzu entwickelte er eine eigene Methode, das sogenannte Streitgespräch beziehungsweise den Dialog. Er schrieb sechsunddreißig seiner einundvierzig Bücher in diesem neuartigen Frage- und Antwort-Stil. Dabei unterhält sich Platons Lieblingsphilosoph Sokrates mit mehreren Personen über ein philosophisch relevantes Thema.
Anfangs haben alle verschiedene, oft sogar gegensätzliche Meinungen. Jeder Gesprächsteilnehmer muss nun so lange die bohrenden Fragen des Philosophen Sokrates beantworten, bis er seine These entweder begründen kann oder zugeben muss, dass er sich geirrt hat. Platon konnte mit Hilfe dieser brillant geschriebenen Streitgespräche die widersprüchlichen Meinungen seiner Zeitgenossen kritisieren, ohne sich selbst auf eine Wahrheit festlegen zu müssen. Er gibt in den frühen Dialogen sogar ehrlich zu, dass er noch nicht weiß, worin eine solche endgültige Wahrheit bestehen könnte.
So lässt Platon seinen Hauptredner Sokrates den berühmten und viel zitierten Satz sagen: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Wortwörtlich sagt er:
Platons frühe Dialoge haben immer ein offenes Ende. Es genügte ihm aufzuzeigen, dass die anderen Philosophen, insbesondere die Sophisten, sich in Widersprüche verwickeln. So behauptete beispielsweise der sophistische Rhetoriklehrer Gorgias im gleichnamigen Dialog, dass die Rhetorik eine edle und hohe Kunst sei. Doch Sokrates zwingt ihn mit seinen Fragen, nach und nach zuzugeben, dass die Rhetorik als Überredungskunst ebenso gut für eine gerechte Sache wie für eine ungerechte eingesetzt werden kann. Am Ende muss Gorgias zugeben, dass es sich bei der Rhetorik weniger um eine Kunst als um eine Fertigkeit handelt, von der man guten oder schlechten Gebrauch machen kann.
Im Dialog ‚Laches’ geht es um die Tapferkeit. Sokrates genügt es nicht, dass seine Gesprächspartner auf die Frage nach dem Wesen der Tapferkeit immer nur Beispiele von verschieden tapferen Männern vorbringen und deren Fechtkunst, Ausdauer, Furchtlosigkeit und Mut befürworten. So wäre Tapferkeit ja jedes Mal etwas anderes, je nachdem, welcher tapfere Mann gerade betrachtet wird. Am Ende müssen alle Gesprächsteilnehmer Sokrates eingestehen, dass ihnen ein präziser Maßstab fehlt, mit dem sie beurteilen könnten, was Tapferkeit eigentlich ist.
Auf diese Weise lässt Platon seine Hauptfigur Sokrates in den Dialogen das Gespräch jedes Mal in die gewünschte Richtung lenken. Sokrates ist übrigens keine von Platon erfundene literarische Gestalt, sondern hat wirklich gelebt. Lange Zeit war er sogar Platons wichtigster Lehrer. Da Sokrates seine Schüler nur mündlich unterrichtete und kein einziges Buch geschrieben hat, konnte Platon später seinem Lehrer sehr leicht all das in den Mund legen, was er selbst für richtig hielt. Für die Forschung ist es bis heute äußerst schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, die ursprünglichen Gedanken des Sokrates von denen Platons zu unterscheiden, da fast alles, was wir über Sokrates wissen, aus den platonischen Dialogen stammt.
Zweifellos aber wird die Figur des Sokrates von Platon ganz bewusst eingesetzt, um die zentralen Positionen seiner eigenen Philosophie zu transportieren. Die von Sokrates praktizierte Methode, seine Dialogpartner in Widersprüche zu verwickeln, bis sie zugeben müssen, dass sie sich geirrt haben, wird von Platon auch „Hebammenmethode“ oder „Dialektik“ genannt, da Sokrates die Wahrheit wie eine Hebamme behutsam mit seinen Fragen zur Welt bringt, beziehungsweise seine Fragen so lange wiederholt, bis sich alle Widersprüche auflösen und die Wahrheit von den Gesprächsteilnehmern selbst geboren wird.
In seinem berühmtesten Dialog „Der Staat“, beschreibt Platon seine Gesprächsführung als entlarvendes dialektisches Verfahren. Denn nur die dialektische Methode würde alle barbarischen Vorurteile und falschen Voraussetzungen beseitigen, die Menschen zum eigentlichen Anfang und Grund der Wahrheit führen und das Auge der Seele vom Schlamm der Vorurteile befreien:
Erst wenn die dialektische Methode die Seele ganz nach oben geführt hat, kann das innere Auge die Wahrheit erblicken. Was ist nun aber die Wahrheit? Wie kann man Wahres von Falschem unterscheiden? In seinem Hauptwerk „Der Staat“ und in den beiden berühmten Dialogen „Phaidon“ und „Symposion“ gibt Platon die entscheidende Antwort: Es ist die Idee des Guten. Anders als in den frühen Dialogen hat er nun als fünfzigjähriger Philosoph einen Weg zur Wahrheit gefunden.
Wir können, so Platon, die Wahrheit erkennen, wenn es uns gelingt, hinter die bloßen Erscheinungen zu blicken. Denn es gibt hinter den uns umgebenden Alltagsgegenständen und der sichtbaren Welt eine zweite unsichtbare Wirklichkeit, eine Art höhere Seinsebene, die uns erst die wahre Welt enthüllt. Diese zweite Wirklichkeit ist das Reich der Ideen. Platon macht eine klare Unterscheidung zwischen der Welt der trügerischen und vergänglichen Gegenstände, die wir mit den Sinnen tagaus, tagein betrachten und der Welt der Ideen, die sich nur dem inneren Auge erschließt.
Allein auf Letztere sollten wir unsere Seele ausrichten, wenn wir vernünftig sein wollen:
Wahr sind nach Platon also einzig und allein die zeitlosen und unsichtbaren Ideen, die hinter den Erscheinungen stehen. Mit ihrer Hilfe können wir die alltäglichen Meinungen überprüfen. Wahr ist letztlich nur das, was den Ideen entspricht oder ihnen nahe kommt. So gibt es beispielsweise die Idee des Schönen, mit deren Hilfe wir beurteilen können, ob bestimmte Dinge schön oder hässlich sind. Ferner gibt es eine Idee der Gerechtigkeit, mit der wir Recht von Unrecht unterscheiden können, oder die Idee der Größe, mit deren Hilfe wir klein und groß unterscheiden. Die Ideen selbst sind zwar unsichtbar, aber mit unserer Seele können wir, wie Platon sagt, an den Ideen teilhaben.
Es gibt eine ganze Reihe solcher Ideen, mit deren Hilfe wir die Welt verstehen. In erster Linie geht es Platon aber nur um die letzte, größte und oberste Idee – die Idee des Guten. An ihr müssen wir uns orientieren. Im Dialog „Der Staat“ bezeichnet Sokrates die Idee des Guten als die höchste Einsicht, die allen anderen Ideen vorausgeht. In mehreren Gleichnissen erklärt er dies einem seiner Gesprächspartner mit folgenden Worten:
Die Idee des Guten ist deshalb so wichtig und umfassend, weil erst durch sie jede andere Idee, zum Beispiel die der Gerechtigkeit, einen Sinn bekommt und angewandt werden kann. Wenn es uns also gelingt, die Idee des Guten zu erkennen und dementsprechend zu handeln, stehen wir auf dem Boden der Wahrheit und können ein gerechtes und glückliches Leben führen. Denn Glück und Wohlbefinden hängen, so Platon, ganz entscheidend von der Liebe zur Wahrheit und dem rechtschaffenen Leben ab:
Die sogenannte Ideenlehre ist zweifellos der Kerngedanke Platons. Er war so sehr von der übergeordneten Kraft der Ideen überzeugt, dass er die Ideen für real hielt. Sie sind für Platon nicht nur in unserem Kopf, sondern haben eine eigene Existenz. Das heißt, die Ideen sind nicht nur Gedanken oder Begriffe, mit deren Hilfe wir etwas beschreiben oder beurteilen, sondern haben eine Wirklichkeit, die sogar realer ist als die trügerische Wirklichkeit der Alltagsdinge. Oder wie Platon es auch formuliert: den unsichtbaren Ideen kommt ein höherer Grad an Sein zu. Wer sich den Ideen zuwendet und diese zu erkennen versucht, ist
Die Ideen sind also im Vergleich zu den Gegenständen die tiefere und grundlegende Wirklichkeit. Platonforscher sagen deshalb zu Recht, die Ideenlehre habe eine ontologische, eine erkenntnistheoretische und eine ethische Dimension. Das heißt, dass Platon mit seiner Ideenlehre gleich drei wichtige Fragen der Menschheit beantwortet hat. Erstens behauptet Platon im Hinblick auf die Ontologie, also auf die Lehre vom Sein, dass die Idee des Guten eine eigene reale Kraft darstellt, die es unabhängig vom Menschen im Universum gibt und immer geben wird. Die Idee des Guten ist eine Art ewige Energiequelle, an der wir teilhaben können, wenn wir unsere Seele dafür öffnen. Zweitens sagt Platon im Hinblick auf die Erkenntnistheorie, dass die Ideen uns erst ermöglichen, die Wahrheit von bloßen Meinungen und Irrtümern zu unterscheiden. Und drittens beantwortet Platon am Ende sogar die ethische Frage nach dem richtigen Handeln, indem er sagt, dass nur die Idee des Guten eine verbindliche Orientierung für sittlich moralische Entscheidungen gibt. Wer sich stets an der Idee des Guten, des Wahren und des Schönen orientiert, wird am Ende zur Reinheit der Seele gelangen und glücklich werden.
Aber was sind nun diese seltsamen Ideen? Woher kommen sie? Was genau meint Platon, wenn er vom Guten spricht? Und vor allem – wie können wir es erkennen und ein entsprechendes Leben führen?
Platons Kerngedanke
Der Weg zum Glück im Wagengleichnis
Der Weg zur wahren Erkenntnis und damit zum glücklichen Leben ist für uns Menschen nicht einfach. Er muss jeden Tag aufs Neue bewältigt werden. Dabei ist es wichtig, dass wir unsere Seele ins Gleichgewicht bringen und weiterentwickeln. Wie wir das bewerkstelligen können, erklärt uns Platon mit seinem berühmt gewordenen Wagengleichnis: Das Wesen der Seele gleicht einem Pferdewagen, auf dem ein Wagenlenker sitzt, der zwei geflügelte Pferde gleichzeitig im Zaum halten muss. Die beiden Pferde stehen zum einen für die menschliche Willenskraft, zum anderen für den Eros, also den Liebestrieb. Doch diese beiden kraftvollen Zugtiere sind äußerst flatterhaft und übermütig:
Es besteht nämlich die große Gefahr, von dem Gespann, also von Liebestrieb und Willen, in den Abgrund gezogen zu werden. Denn sowohl die Willenskraft als auch der Eros sind Bestandteile der Seele, die sich bei mangelnder Vorsicht negativ auswirken können. So symbolisiert der Eros im Wagengleichnis den sinnlichen und begehrenden Seelenanteil, der nach immer währender Lust strebt, nach Essen, Trinken und sexueller Erfüllung.
Das zweite Pferd, also der Wille, ist der muthafte Anteil der Seele, der auf Erfolg, Anerkennung, Ruhm und Durchsetzung der eigenen Interessen abzielt. Der Wagenlenker schließlich steht im Gleichnis für den dritten Seelenanteil, für die Vernunft, welche die schwierige Aufgabe hat, die beiden gefiederten Zugpferde, den Eros und die Willenskraft, zu bändigen und nach oben zu führen.
So muss die Vernunft als strenge Wagenlenkerin die Liebeskraft im Zaum halten und von den körperlich sexuellen Reizen auf höhere Ziele umlenken. Dies gilt insbesondere für die Philosophen. So stellt Sokrates im Dialog Phaidon, einem seiner Schüler, folgende rhetorische Frage:
Und Platon fährt fort:
Auch das zweite Pferd, der Wille, muss von der puren Selbstbehauptung, dem blinden Ehrgeiz auf Besonnenheit und Respekt umgelenkt werden. Die Beherrschung und Veredelung der niederen Seelenanteile spielt nach Platon eine entscheidende Rolle sowohl für das Leben nach dem Tod, als auch für ein einträgliches Leben auf der Erde:
Entscheidend ist im Wagengleichnis die Forderung Platons, dass der Geist beziehungsweise die Vernunft den Körper beherrschen möge. Denn sowohl die Lust als auch der Wille sollen von der Vernunft als Wagenlenkerin geführt werden. Aufgabe der Vernunft ist es also, die Seele von den niedrigen Trieben nach oben auf den Weg der Tugend und der Wahrheit zu führen.
Die ‚platonische’ Liebe
Auch in seinem berühmten Dialog „Symposion“, auf Deutsch „Das Gastmahl“, weist Platon darauf hin, dass der Mensch sich nicht allein in der sinnlichen Lust verlieren darf, sondern seine Triebe veredeln muss. Zwar lässt er Sokrates in diesem Dialog sagen, dass der Liebestrieb das stärkste Grundbedürfnis des Menschen ist. Denn der Eros, wie die Griechen den Geschlechtstrieb nach ihrer Liebesgottheit nannten, ist die kreativste und vitalste Energiequelle überhaupt. Aber gerade deshalb, so fährt Sokrates fort, muss seine Zeugungskraft unbedingt für höhere Zwecke genützt und veredelt werden. Über die rein sexuelle Liebe hinaus kann man, so Platon, den Eros auf die geistige Liebe und sogar auf die Liebe zur Wissenschaft lenken.
Dies schildert er im „Symposion“ sehr anschaulich. So widersteht Sokrates vorbildlich der sexuellen Begierde, als ihn der Jüngling Alkibiades zu einem homoerotischen Abenteuer verführen will. Obwohl die Knabenliebe in der Antike weit verbreitet und Alkibiades ein auffallend schöner Jüngling war, lehnt Sokrates das Angebot ab. Stattdessen hält er dem Jüngling einen Vortrag über die vier verschiedenen Stufen der Liebe.
Nur auf der allerersten Stufe, so erzählt er dem erstaunten Alkibiades, zielt der Eros auf die sexuelle Vereinigung ab. Schon auf der zweiten Stufe speist er darüber hinaus die Liebe zu schönen und guten Lebenseinstellungen. Denn ein guter Liebhaber, so argumentiert Platon, ist ja in aller Regel daran interessiert, dem Geliebten Gutes zu tun, und vollbringt somit automatisch auch gute Taten, um dem Liebhaber zu gefallen. So leitet und erzieht uns die Liebe viel besser zu selbstlosen, schönen und gerechten Taten, als dies unsere Eltern oder Verwandten je vermocht haben:
Deshalb schämen wir uns auch viel mehr vor dem Geliebten, als vor den Eltern, wenn wir etwas Schlechtes oder moralisch Verwerfliches getan haben:
Deshalb verhilft uns die Verliebtheit auf der zweiten Stufe, gute Taten zu vollbringen. Auf der dritten Stufe kann man den Eros auf die Liebe zur Wissenschaft umlenken. Doch dies gelingt eher wenigen Menschen. Die meisten gehen der Zeugungslust in direkter Weise nach:
Die Menschen können aber nicht nur durch Kinder eine gewisse Unsterblichkeit erlangen, sondern auch durch ihre Werke, indem sie ihre Zeugungskraft auf die Literatur oder die Kunst richten. Denn, so Platon:
Erfindungen und wissenschaftliche Erkenntnisse sind also auch Produkte des Eros. Auf der vierten und höchsten Stufe der Liebeskunst löst sich die Liebe dann völlig von allen konkreten Liebesobjekten ab, auch von der Wissenschaft. Der Eros richtet sich nun auf das Gute und Schöne selbst:
Es geht nach Platon also darum, den erotischen Trieb von der Wahrnehmung des schönen Körpers der geliebten Person zu lösen, schöne und tugendhafte Taten für den Geliebten zu vollbringen, die Tugend selbst als schön zu erkennen und schließlich das Schöne an sich, also die reine Idee des Schönen zu empfinden:
Und genau das ist der Sinn der viel zitierten ‚platonischen Liebe’, nämlich das zu erkennen und zu begehren, was unsere Seele wirklich glücklich macht – das Schöne an sich. Im Volksmund wird unter platonischer Liebe in der Regel nur eine nicht sexuelle, geistige Liebe zwischen Mann und Frau verstanden. Das ist aber zu kurz gegriffen und entspricht nur zum Teil Platons Intention. Denn Platon geht es jenseits aller zwischenmenschlichen Beziehungen um die spirituelle Liebe zum Schönen, Wahren und Guten schlechthin. Allerdings gelingt dieser Aufstieg zur höchsten Form der Liebe nur Wenigen. Viele, so räumt Platon ein, bleiben schon auf der allerersten Stufe stehen und versäumen, den Liebestrieb zu veredeln. Sie verwechseln die Idee des Guten mit dem, was ihre Begierde für gut hält. So erklärt Sokrates einem Gesprächspartner:
An anderer Stelle, im Dialog Georgias, sagt Platon nicht ohne Spott, dass der rein trieborientierte Mensch ein Leben lang vergeblich versuchen würde, ein Fass aufzufüllen, das ein Loch habe. Als sein Diskussionskontrahent Kalikles ihm entgegnet, dass doch gerade dieses Loch sehr positiv sei, da sich dadurch das Hunger- und Lustgefühl immer wieder aufs Neue einstellen und weitere Genüsse ermöglichen würde, erwidert Platon schroff:
Denn auch die Ente, so erklärt Platon provokativ, verbringt ihr ganzes Leben damit, zu fressen, auszuscheiden und auf erneuten Hunger zu warten. Der Triebmensch verliert sich also in kurzlebige Genüsse. Derjenige hingegen, der sein Begehren auf die Idee des Guten, Wahren und Schönen richtet, erfährt eine viel intensivere Form der Liebe:
Das Ziel des Menschen sollte also darin bestehen, seine Liebe auf die ewigen Ideen des Schönen und Guten zu richten. Was sind nun diese Ideen? Wie kann ich beispielsweise die reine Idee des Schönen wahrnehmen und woraus besteht sie?
Die Ideenlehre
Als erstes muss man sich vor Augen halten, dass das Wort „Idee“ im antiken Griechenland eine etwas andere Bedeutung hatte als heute. Unter Idee verstand man damals keineswegs eine plötzliche Eingebung oder einen Gedankenblitz in dem Sinne, wie wir heute manchmal ausrufen: „Hey, ich habe eine gute Idee!“ Stattdessen bedeutete das altgriechische Wort „eidos“ soviel wie „Gestalt“ und „Urbild“. Platon verwendet das Wort nur in diesem Sinne. Er vermutete hinter allen wandelbaren Einzeldingen ursprüngliche Gestalten, die als Urbilder den Einzeldingen zu Grunde liegen. Man spricht deshalb auch von der platonischen Urbild-Abbildtheorie.
Die Ideen sind bei Platon archaische Urbilder, die jeder Mensch bereits bei seiner Geburt im Kopf hat und mit denen er die Welt ordnen und verstehen kann. Ohne diese Ideen wären wir nach Platon gar nicht in der Lage, die vielen Veränderungen um uns herum zu begreifen, und würden im Chaos der Sinneswahrnehmungen untergehen.
Als Idee können wir zunächst alles verstehen, was eine Reihe von Einzeldingen unter demselben Namen zusammenfasst. So gibt es die Idee des Baumes. Diese Idee fasst alle konkret sichtbaren Bäume unter einem einzigen abstrakten Urbild zusammen, nämlich dem Begriff Baum. Birken, Tannen, Palmen, Eichen, Fichten oder Trauerweiden haben zwar jeweils verschiedene Blätter, Rinden und Äste, aber sie folgen dennoch alle einem unsichtbaren einheitlichen Entfaltungsprinzip, einem Urbild beziehungsweise einer erkennbaren Gestalt, einem „eidos“ – dem Baumhaften oder wie Platon sagt, der Idee des Baumes. Nur deshalb kann ich die unterschiedlichen Gewächse, klein oder groß, verdorrt oder grün, mächtig, dick oder dünn immer als Baum erkennen und sofort von anderen Pflanzen wie Blumen oder Büschen unterscheiden.
Wenn ich also aus dem Haus gehe, beginne ich sofort, hinter den vielen bunten Sinneseindrücken, Gerüchen und Geräuschen die ursprünglichen Ideen zu erkennen und damit das Chaos zu ordnen.
So stehen hinter allen sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen und der ganzen Vielfalt der Natur ewige Ideen, von denen die konkreten Dinge nur Abbilder sind. Dabei betont Platon, dass die Idee zuerst da sein muss, damit überhaupt konkrete Dinge erscheinen können, die an dieser Idee teilhaben. Die Ideen sind somit die erste und eigentliche Wirklichkeit. Das ist für uns moderne Menschen nur schwer zu verstehen. Denn wir sind gewohnt, vom Konkreten auszugehen und erst dann Sammelbegriffe und abstrakte übergeordnete Einheiten zu bilden. Für unser Empfinden ist eher das konkrete Ding das Ursprüngliche und der Sammelbegriff ein Gedanke, den wir hinterher fassen, um alles unter einen Hut zu bringen. Für Platon nicht. Er besteht darauf, dass die Idee ursprünglicher und wichtiger ist und begründet dies auch.
Wenn zum Beispiel ein Schreiner einen Tisch baut, hat er lange bevor er Säge und Hobel in die Hand nimmt, schon eine genaue Idee vom Tisch im Kopf. Damit der konkrete Tisch entstehen kann, muss die Idee „Tisch“ bereits vorher da sein. Alle verschiedenen viereckigen und runden Tische, die der Schreiner in seinem langen Handwerkerleben herstellt, haben lediglich Teil an dieser bereits vorgängig existenten Tisch-Idee.
Noch eindringlicher zeigt Platon den Vorrang der Idee am Beispiel des Kreises oder des Zirkels. Der Kreis kommt nämlich in der konkreten Natur in seiner Reinform gar nicht vor. Denn er besteht per Definition aus einer Vielzahl von Einzelpunkten, die sich konzentrisch um einen Mittelpunkt anordnen, von dem sie exakt gleich weit entfernt sind. Selbst sorgfältig hergestellte Keramikschalen, Diskusscheiben oder Silbermünzen ergeben niemals ganz präzise Kreise.
Sie bleiben mehr oder weniger gut gelungene Abbilder des Urbildes Kreis. Den Mathematikern geht es deshalb auch nicht um real sichtbare Kreise oder darum, deren Schatten nachzuzeichnen, sondern immer um die unsichtbare Idee des Kreises selbst, die man nur mit dem Verstand erkennen kann:
Auch das gleichseitige Dreieck ist eine solche Idee, beziehungsweise ein Urbild, das in der konkreten Alltagswelt gar nicht vorkommt. Selbst wenn ein Schreiner mit größter Sorgfalt ein hölzernes gleichseitiges Dreieck konstruiert oder ein Mathematiker mit größter Präzision ein solches Dreieck in den Sand malt, ist es doch nur ein unvollkommenes Abbild des präzisen Urbildes, das er im Kopf hat. Es ist obendrein recht vergänglich. Das in den Sand gezeichnete Dreieck kann sogar beim ersten Windstoß verweht oder vom Regen verwischt werden. Selbst das hölzerne Dreieck verfault irgendwann. Die Idee des Dreiecks aber bleibt für immer erhalten, denn Ideen sind nun mal unsichtbar und zeitlos.
Die Ewigkeit der Ideen auf der einen Seite und die Vergänglichkeit der sinnlich wahrnehmbaren Dinge auf der anderen, sind für Platon ein entscheidendes Indiz dafür, dass die Ideen wichtiger sind als die erscheinenden Dinge und diesen gegenüber eine höhere Form von Wirklichkeit haben. Alles, was wir mit dem Auge an Äußerlichkeiten wahrnehmen, ist in ständiger Veränderung begriffen und schon deshalb nur schemenhaft erkennbar. Hätten wir nicht eine vorgängige Idee von dem, was einen Menschen wirklich ausmacht, wäre es nicht einmal möglich, so verschieden anmutende Lebewesen wie einen Säugling, einen Jugendlichen, einen Mann, eine Frau oder einen Greis jedes Mal treffsicher als Mensch zu erkennen.
Als letztes Beispiel für die größere Bedeutung der Wirklichkeit der unsichtbaren Ideen sei die Idee der Schönheit angeführt. Ein schöner Mensch kann altern, einen Unfall haben und eine Narbe bekommen. Auch eine schöne Vase kann verblassen oder durch einen Sprung verunstaltet werden. Die Idee der Schönheit selbst aber, so Platon, bleibt davon unberührt. Menschen, Tiere, Pflanzen und Gegenstände können immer nur kurze Zeit an der Schönheit teilhaben. Dann verfallen sie wieder. Das Schöne selbst aber ist vom Verfall nicht betroffen, da es unkörperlich und unvergänglich ist. So unterscheidet Platon die schönen Gegenstände von der Idee des Schönen und stellt fest:
Schönheit, erklärt uns Platon an dieser Stelle, kann niemals mit einer konkreten Gestalt, Form oder Farbe erklärt werden. Wir finden zum Beispiel die Farbe Rot oder die Gestalt einer Kugel einmal schön, ein anderes Mal hässlich, je nachdem, in welchem Zusammenhang die Farbe und die Form vorkommen. So kann die im Meer untergehende rote Sonne wunderschön sein, eine blutverschmierte rote Gewehrkugel dagegen ekelerregend, obwohl beide rot und rund sind. Die Schönheit eines Gegenstandes hängt also weder von der Kugelform oder der roten Farbe ab, noch von irgendeiner definierten Gestalt, sondern allein davon, ob das Rot und die Kugelgestalt gerade an der Idee des Schönen teilhaben oder eben nicht. Deshalb langweilt es Platon, sich lange detaillierte Erklärungen anzuhören, weshalb etwas schön sein soll. Letztlich ist doch alles nur durch die Anwesenheit und Teilhabe an der Idee des Schönen schön:
Unser Gefühl für Schönheit ergibt sich also aus der Teilhabe der Dinge an der unsichtbaren Idee und nicht aus konkreten Farben und Formen.
Lernen ist Wiedererinnerung der Ideen
Schon das Kind kann schön und hässlich, groß und klein unterscheiden, obwohl es vielleicht noch gar nicht viel erlebt und gesehen hat. Die Tatsache, dass wir von Anfang an Unterscheidungen vornehmen können, ist nach Platon ein Indiz dafür, dass wir die Ideen der Schönheit, der Größe und der Gleichheit und alle anderen Ideen bereits vor unserer Geburt kennen gelernt haben müssen. So stellt er die rhetorische Frage:
Dies ist ein wichtiger Meilenstein in Platons Philosophie. Die Ideen, wie zum Beispiel die Ideen des Gleichen, der Größe, der Schönheit oder der Gerechtigkeit müssen den Kindern nicht erst beigebracht werden. Sie sind offensichtlich bereits da. Selbst ein Sklave, der nie mit Geometrie in Berührung gekommen ist und nie eine Schule besucht hat, kann, so Platon, eine Reihe von geometrischen Aufgaben lösen, indem er einfach nur mit der Idee arbeitet, die er schon in sich trägt. Im Dialog Menon testet Sokrates zu diesem Zweck einen Knaben. Dieser ist tatsächlich in der Lage, ohne Vorwissen die Fragen zum gleichseitigen Viereck allein mit Hilfe seiner Ideen vom Viereck und von der Gleichheit der Seiten zu beantworten. Er kann dies, obwohl ihm zuvor niemand von diesen Ideen erzählt hat. Sokrates zieht daraus folgende Konsequenz:
In welcher anderen Zeit soll das gewesen sein? Platons Antwort ist erstaunlich. Es muss bereits vor seiner Geburt passiert sein. Nicht nur die Ideen, auch unsere Seele existiert nach Platons Auffassung bereits lange bevor wir zur Welt kommen und hat Anteil an den Ideen. In einer Art Unterwelt sind die Seelen der Menschen vor der Geburt mit den ewigen Ideen vereint. Wenn dann die Seele wieder in den menschlichen Körper hinein fährt und in das Leben hineingeboren wird, vergisst sie zunächst einiges von dem, was sie im Zustand der Verbundenheit von den Ideen wusste. Sie kann sich aber nach und nach an alles vorgeburtlich Gesehene wieder erinnern, an die einfachen Ideen, aber auch an die Idee der Tugend:
Bei Platon ist all unser Lernen somit nur Wiedererinnerung früherer Seelenzustände, in denen wir mit den unsichtbaren Ideen vereint waren. Die Seele gibt es lange vor unserer Geburt. Auch nach dem Leben auf der Erde stirbt sie nicht einfach, sondern verlässt lediglich den menschlichen Körper. Im Augenblick des Todes befreit sie sich vom Leib und kehrt nach Platon wieder zurück in das Reich der Ideen.
Die Unsterblichkeit der Seele
Die Seelen der Menschen sind unsterblich. Dennoch haben sie, so Platon, nach dem Tod nicht alle das gleiche Schicksal. Es ist nämlich von großer Bedeutung, wie der einzelne Mensch gelebt hat. Wenn er seine Seele bereits zu Lebzeiten den Ideen zugewandt und sich der Idee des Guten geöffnet hat, dann, so eröffnet uns Platon, kann sich seine Seele leicht vom Körper lösen:
Platons Antwort ist konsequent. Sie kann es nicht. Eine Seele, die lebenslang in körperlichen Bedürfnissen und materiellen Reizen befangen war, schafft es auch im Augenblick des Todes nicht, sich ganz vom Körper zu befreien. Unerlöst irrt sie deshalb in der Schattenwelt umher.
Ähnlich wie später im Christentum bleibt den sündigen Seelen der Zugang zum Reich der Ideen versperrt. Anders aber als in der christlichen Religion gibt es bei Platon kein Fegefeuer, das diese Seelen noch reinigen könnte. Stattdessen bleibt denjenigen, die noch nicht reif sind, sich mit den göttlichen Ideen zu vereinigen, nur der Weg zurück in den Körper – die Reinkarnation.
Sokrates schildert dem Dialogpartner Kebes in aller Deutlichkeit, dass es viele schlechte Seelen gibt, die dazu verurteilt sind, eine Weile hilflos als dunkle Erscheinungen in der Schattenwelt an Denkmälern und Gräbern umherzuschleichen, bis sie irgendwann wieder an einen Leib gefesselt werden:
Platons Auffassung von der Wiedergeburt weist zweifellos eine große Nähe zum Hinduismus auf. Die Forschung vermutet, dass er auf seinen Reisen mit der hinduistischen Reininkarnationslehre in Berührung gekommen ist. Denn wie im Hinduismus ist auch bei Platon der Lebenswandel im vorausgegangenen Leben entscheidend für den Körper, in den man in seinem nächsten Leben wieder hineingeboren wird. Wer lasterhaft gelebt hat, wird als entsprechend niedriges Tier wiedergeboren:
Die weniger belasteten Seelen werden zu Bienen, Ameisen, Frauen oder Männern. Wie aber kommt Platon überhaupt zu der Überzeugung, dass die Seele unsterblich ist? Im berühmten Dialog Phaidon, der vielleicht bedeutendsten Schrift der griechischen Prosa, beschreibt er die letzten Stunden des Sokrates vor seinem Tod und begründet eindrucksvoll seine Auffassung von der Seelenwanderung. Der zum Tode verurteilte Sokrates tröstet seine Freunde und versichert ihnen, dass er keine Angst vor dem Tod habe. Denn Sokrates ist sich sicher, dass es nach dem Tod „etwas gibt“:
Da die Seelen der Verstorbenen weiterleben, indem sie sich im Augenblick des Todes vom Körper lösen, ist es für wahre Philosophen keine Strafe, aus dem Leben zu scheiden. Im Gegenteil, sie bereiten sich im Grunde genommen ein ganzes Leben lang auf diesen Moment vor. Philosophie in diesem Sinne heißt sterben lernen. So lässt Platon seinen Protagonisten Sokrates kurz vor seinem Tod sagen:
Die Leichtigkeit zu sterben nimmt Sokrates aus der Überzeugung, dass der Tod für die Seele eine Befreiung darstellt. Denn zu Lebzeiten befindet sie sich in einen bedauernswerten leiblichen Zustand:
An anderer Stelle bezeichnet Platon unseren Leib sogar als Grab der Seele.33 Dabei ist für ihn die Unsterblichkeit keine bloße Vermutung, sondern kann bewiesen werden. Platon lässt Sokrates neben dem Phänomen der Wiedererinnerung der Ideen noch drei weitere Argumente vortragen. Zum einen stellt er fest, dass es auf der Welt prinzipiell nur zwei Arten von Seiendem gibt, das Sichtbare und das Unsichtbare. Sichtbar sind zum Beispiel Stühle, Tische, Häuser, Steine, Pflanzen und Tiere. Unsichtbar sind dagegen die Ideen der Gerechtigkeit, des Guten oder des Schönen. Alle sichtbaren Dinge sind vergänglich. Der Stuhl etwa kann verfaulen, der Stein zerbröseln, das Haus zusammenstürzen. Die unsichtbaren Dinge aber sind ewig, denn die Idee der Gerechtigkeit gibt es schon seit vielen Jahrhunderten und es wird sie auch in Zukunft geben. Da die Seele wiederum eindeutig zu den unsichtbaren Dingen gehört, folgt daraus, dass sie genau wie diese unsterblich sein muss.
Ein zweiter Beweis ist für Platon die Veränderlichkeit. Der Körper einer Pflanze, eines Tieres oder eines Menschen ist in ständiger Veränderung begriffen. Er ist jung, blüht auf, wird irgendwann alt, gebrechlich und anfällig für Krankheiten. Unsichtbare Ideen hingegen, wie die Gerechtigkeit oder die Schönheit, sind unveränderlich. Da die Seele nicht, wie der Körper, einer ständigen Veränderung ausgesetzt ist, gehört sie zu den unveränderlichen Dingen und ist genau wie diese unsterblich.
Drittens kann man alle Seinsformen danach unterscheiden, ob sie sich selbst bewegen können oder nicht. Ein Stein muss ins Rollen gebracht oder durch die Luft geworfen werden. Er kann sich niemals aus eigener Kraft fortbewegen. Er ist, wie alles andere, das bewegt werden muss, endlich und vergänglich. Anders verhält es sich bei der Seele:
Und damit sind wir beim Kerngedanken von Platons Philosophie angekommen. Die unsterbliche Seele hat in jedem Menschenleben die Chance, sich vom Leib zu befreien, indem sie sich höher entwickelt. Da wir uns aber im Alltag viel zu sehr von Kleinigkeiten und allerlei Sensationen ablenken lassen, vergessen wir oft, den Blick auf das Wesentliche zu richten. Die ganze Platonische Philosophie kreist letztlich um die Frage, wie wir die ewigen Ideen des Guten, Wahren und Schönen erkennen können. Platon beantwortet uns diese Frage in seinen beiden berühmten Gleichnissen, dem Sonnengleichnis und dem Höhlengleichnis.
Das Sonnengleichnis
Im Sonnengleichnis zeichnet Platon den Erkenntnisweg der Seele dem Vorgang des Sehens nach. So wie das Licht es unseren Augen ermöglicht, die Gegenstände klar und deutlich zu erkennen, ist die Idee des Guten für die Seele notwendig, um auf die Wahrheit zu blicken.
Zunächst schildert Platon im Sonnengleichnis nur das alltägliche Sehen. Ohne die Lichtstrahlen der Sonne kann das sehende Auge weder Helligkeit, Dunkelheit oder irgendwelche Farben erkennen, noch werden Gegenstände angestrahlt und ausgeleuchtet. Das Licht ist also entscheidend dafür, dass wir mit den Augen überhaupt etwas wahrnehmen. Je nachdem, wie stark dieses Licht ist, erkennen wir die Welt besser oder schlechter:
Diesen physischen Vorgang des Sehens überträgt Platon nun auf die Seele:
Es kommt also darauf an, die Seele für das Licht und somit die Idee des Guten zu öffnen. Denn nur der Existenz des Guten verdanken wir wahre Erkenntnis. Das Licht ist nicht nur verantwortlich dafür, dass wir die Dinge erkennen können, sondern darüber hinaus auch dafür, dass sie überhaupt existieren. Denn erst das Sonnenlicht, so Platon, erweckt sie zum Leben, wie er einen seiner Dialogpartner im Sonnengleichnis zusammenfassen lässt:
An dieser Stelle im Sonnengleichnis macht Platon in dem kleinen Nebensatz „ungeachtet sie selbst nicht Werden ist“ eine folgenreiche Unterscheidung. Die gesamte abendländische Philosophie und Theologie spricht seitdem von der „ontologischen Differenz“. Das klingt anspruchsvoll, doch letztlich ist damit etwas ganz Einfaches gemeint. Die Sonne, also die Idee des Guten, erzeugt zwar das Licht, das allem Seienden seine Existenz, sein Wachstum und sein Werden ermöglicht, doch ist sie selbst kein solches Werden und somit kein solch Seiendes. Die Sonne beziehungsweise das Gute ist etwas Höheres und Göttliches, eine Art unbewegter Beweger, ein metaphysischer Ursprung aller physisch vorhandenen Dinge, Pflanzen, Tiere und Menschen.
Denn die Sonne, darauf verweist Platon in seinem Gleichnis immer wieder, verleiht Leben. Sie bewirkt, dass Blumen, Wiesen und Felder sich entwickeln, wachsen und gedeihen und doch ist sie selbst keinerlei Veränderung unterworfen. Die Sonne unterliegt als einzige nicht dem Gesetz von Werden und Vergehen, sondern ist deren Ursache. Es gibt sie seit jeher und wird sie immer geben. Und genauso ist es, nach Platon, mit dem Guten. Die Idee des Guten verhilft den Menschen dazu, die Wahrheit zu erkennen und ist dennoch nicht identisch mit der Wahrheit, sondern deren Ursache:
Wissen und Wahrheit sind zwar etwas Guthaftes und haben Teil an der Idee des Guten, aber sie sind nicht identisch mit dem Guten selbst.
Diese Konstruktion von Platon, dass wir hinsichtlich der Erkenntnis des vergänglich Seienden auf etwas „Höheres“ angewiesen sind, das selbst nicht mehr zu diesem Seienden gehört, war der Beginn der abendländischen Metaphysik, wonach alles physisch Vorhandene letztlich nur durch Metaphysisches, also durch etwas über die Physik Hinausgehendes, erkannt werden kann. Die Seele kann zwar bei Platon an der Idee des Guten teilhaben, die Idee des Guten selbst aber entspringt einer Quelle außerhalb der Seele. Und eben diese Differenz zwischen dem Sein der bloß vorhandenen physischen Dinge und den Möglichkeiten der Erkenntnis dieses Vorhandene mit Hilfe von etwas zu erkennen, das über dieses Seiende hinausweist, wurde später in der Philosophie die „ontologische Differenz“ genannt.
Wir befinden uns jetzt in der Herzkammer von Platons Philosophie. Da unsere Seele an den ewigen Ideen teilhaben kann, eröffnet sich uns ein Weg zur Wahrheit und zum Licht. Denn jeder Mensch ist von seiner Ausstattung her in der Lage, seine Seele für die Idee des Guten zu öffnen und die Wahrheit zu erkennen. Allerdings lassen wir uns im Alltag viel zu oft ablenken und gehen irrtümlicherweise medialen Projektionen und Trugbildern auf den Leim. Platon verdeutlicht dies in seinem Höhlengleichnis.
Das Höhlengleichnis
Um das Gute zu erkennen, muss der Mensch die Welt der Alltagsmeinungen und Vorurteile hinter sich lassen und Schritt für Schritt zur Wahrheit und zum Licht aufsteigen. Diese Befreiung der Seele aus der alltäglichen Welt der Trugbilder beschreibt Platon bildhaft als mühsamen Aufstieg aus einer dunklen Felsenhöhle. Im entsprechenden Dialog „Politeia“ fordert er daher gleich zu Beginn seine Zuhörer auf, sich die düstere Situation von Menschen vorzustellen, die ihr ganzes Leben tief unten in einer Höhle verbringen:
Eine Gruppe Menschen sitzt also mit dem Rücken zum Höhlenausgang. Da sie sich wegen der Fesseln nicht umdrehen können, starren sie ihr ganzes Leben lang auf die vor ihnen liegende Höhlenwand. Hinter ihrem Rücken verläuft ein Weg, auf dem immer wieder Leute bestimmte Gegenstände vorbeitragen. Dieser Weg wird von einem brennenden Feuer erleuchtet, so dass die Schatten vorbeiziehender Menschen und Gegenstände von den lodernden Flammen schemenhaft an die Höhlenwand geworfen werden. Da die Gefangenen von Kindheit an gefesselt sind und ihr ganzes Leben lang niemals etwas anderes gesehen haben, halten sie die Projektionen der vorüberziehenden Menschen mitsamt der Gegenstände für echt. Sie geben den Schattenfiguren sogar Namen und reden über sie, als würden sie wirklich existieren. Wie sollten sie auch erkennen, dass es sich nur um Trugbilder handelt, wenn sie sich niemals umdrehen können?