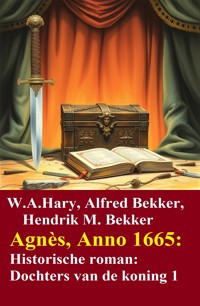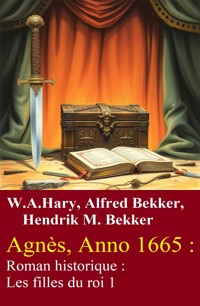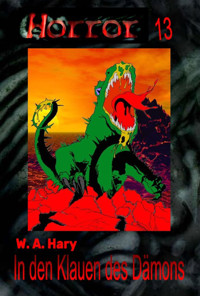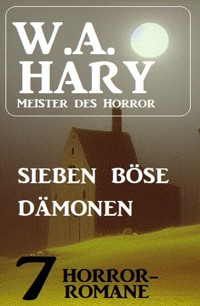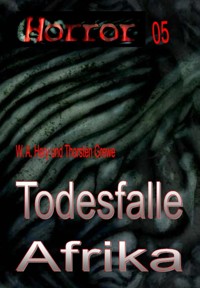
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
HORROR Buchausgabe 005: Todesfalle Afrika
- A. Hary und Thorsten Grewe: »Fünf Fortsetzungsromane gesammelt in einem Buch!«
Dieses Buch beinhaltet insgesamt fünf Fortsetzungsromane des Autorenduos W. A. Hary und Thorsten Grewe, wie sie ursprünglich in der Romanheftreihe HORROR erschienen als Band 25 bis Band 29.
Der Religionswissenschaftler Thorsten Grewe hat zusätzlich Anmerkungen hinzugefügt, die den Bezug schaffen zwischen der Realität des Kontinents Afrika und den Fiktionen dieser Romane.
Impressum:
Copyright dieser Ausgabe 2016 by HARY-PRODUCTION * Canadastraße 30 * 66482 Zweibrücken * ISSN 1614-3299
Buchgestaltung: Anistasius
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
HORROR Buchausgabe 005: Todesfalle Afrika
»Fünf Fortsetzungsromane gesammelt in einem Buch!«
Der Religionswissenschaftler Thorsten Grewe hat zusätzlich Anmerkungen hinzugefügt, die den Bezug schaffen zwischen der Realität des Kontinents Afrika und den Fiktionen dieser Romane. BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenHORROR Buchausgabe 005: Todesfalle Afrika
HORROR 005:
Todesfalle
Afrika
W. A. Hary
und Thorsten Grewe
Impressum:
Alleinige Urheberrechte: Wilfried A. Hary
Copyright Realisierung und Folgekonzept aller Erscheinungsformen (einschließlich eBook, Print und Hörbuch) by www.hary-production.de
ISSN 1614-3310
Erstauflage: 2004
Diese Fassung:
© 2016 by HARY-PRODUCTION
Canadastr. 30
D-66482 Zweibrücken
Telefon: 06332-481150
www.HaryPro.de
eMail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung jedweder Art nur mit schriftlicher Genehmigung von Hary-Production.
Covergestaltung: Anistasius
Todesfalle Afrika
Prolog
Belgisch-Kongo 1879
Jan Koopmans blinzelte in die Sonne, die gerade wie ein alles verschlingendes weißes Auge aus dem Horizont hervorschmolz. Die Feuchtigkeit, die sich in der etwas erträglicheren Nachtkühle auf die Blätter gelegt hatte, stieg jetzt wie ein wehender Vorhang aus Chifon aus den Baumkronen auf. Ein Schwarm grellbunter Vögel flatterte lärmend aus dem Unterholz hervor und begrüßte den Morgen.
Er zügelte sein Pferd und ließ die zu Fuß folgende Kompanie aufschließen. Sein Pferd schüttelte die Mähne und verscheuchte die scheinbar allgegenwärtigen Mücken. Wie eine undurchdringliche, grüne Mauer breitete sich der Dschungel vor ihnen aus. In sanften Wellen zog sich der Urwald die Innenseite des Talkessels hinauf. Ein Fußweg, wohl eher ein ausgetretener Trampelpfad, führte in das wogende, grüne Meer hinein, gähnte wie ein bläulicher Schlund herüber und schien die heranrückende Armee zu verspotten.
Koopmans fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn und rückte den Tropenhelm zurecht. Die afrikanische Hitze und die gottverfluchte Luftfeuchtigkeit des Urwalds bekamen ihm nicht. Jetzt begann er schon damit, sich Dinge einzubilden. Was hatte ihn bloß in diesen gottverlassenen, verbrannten Kontinent getrieben? Seine Gedanken flossen acht Jahre zurück, kehrten auf das mit zerfetzten Leibern und zertrümmerten Geschützen übersäte Schlachtfeld zurück. Als viel zu junger Lieutenant hatte er damals die Kraft seines linken Arms in dem Gemetzel zurückgelassen. Er hatte das Morden überlebt, hatte sogar irgendeinen Hügel gestürmt, was ihn zum Helden werden ließ. Er blickte auf seinen nutzlosen linken Arm, den er seitdem wie ein spiegelverkehrter Napoleon in die Uniformjacke steckte - er fühlte sich nicht als Held, sondern als Krüppel. Alle blechernen Orden und goldenen Epuletten, die man ihm hinterher mit einer Beförderung zum Capitaine angeheftet hatte, konnten ihm keinen brauchbaren Arm wiedergeben. Für ein menschenwürdiges Leben hätte die schmale Pension, die ihm nach den paar Dienstjahren zugestanden hätte, wahrlich nicht gereicht. Zum Leben eben zu wenig und zum Sterben zuviel, wie man sagte. Außer Hügel zu stürmen und herumzukommandieren, hatte er nichts gelernt. Da blieben nicht viele Alternativen übrig - noch dazu für einen Flamen, der in den Augen der hochnäsigen Walonen ohnehin nur ein Belgier zweiter Klasse war. König Leopold II. hatte sich den Kongo zu seinem höchsteigenen Privatspielplatz erkoren. Für diesen Tummelplatz königlicher Eitelkeit und Geldgier brauchte der Monarch ständig frischen Nachschub aus dem Mutterland, viele tausende Siedler, Missionare und Soldaten, um den königlichen Selbstbedienungsladen urbar zu machen und das letzte Jota an Reichtum und Bodenschätzen herauszupressen. Es schien der einzige Ort zu sein, wo ein verkrüppelter Capitaine noch sein Glück machen konnte. Und nun hockte er in diesem Talkessel im Katangagebirge mit dem blumigen Namen Petiteville und führte auf Befehl des Oberkommandos des Kolonial-Hauptquartiers in Leopoldville eine Kompanie Infanterie gegen einen wahnsinnig gewordenen Großgrundbesitzer. Dies brütendheiße Land fraß sie alle auf, Grundbesitzer und Besatzungssoldaten gleichermaßen. Der Kongo war ein Moloch und niemand konnte ihm entgehen. Das war Koopmans' feste Überzeugung.
Im stoischen Gleichschritt kamen die Infanteristen heran. Die aufgepflanzten Bajonette fingen die sich durch das Blättergrün verirrenden Sonnenstrahlen und verwandelten sie in irisierende Lichtreflexe. Der Capitaine winkte dem Mann in dem schwarzen Anzug, der am Ende des Zuges geritten war und nun seinen Braunen neben Koopmans' Pferd zügelte. Die kleinen, beständig hin und her ruckenden Augen des Mannes taxierten die Umgebung, als erwarteten sie jederzeit eine Attacke aus dem Hinterhalt. Seine runde Nickelbrille, die ihm die Seriosität eines Buchhalters verlieh, konnte nicht gänzlich über die füchsische Listigkeit in seinen Zügen hinwegtäuschen. Capitaine Koopmans wusste nicht, was er von der Anwesenheit des Priesters auf dieser Strafexpedition halten sollte. Die Kolonialverwaltung in Leopoldville hatte darauf bestanden, dass die Kompanie erst dann aufbrechen durfte, wenn der Geistliche aus Brüssel eingetroffen war. Er warf dem Mann mit dem gehetzten Gehabe und dem in der aufsteigenden Hitze völlig unpassenden schwarzen Anzug, der diesen nicht im mindesten zu beeinträchtigen schien, einen Blick zu: „Wenn ich die Karte richtig im Kopf habe, kann es von hier aus nicht mehr weit sein, Hochwürden.“
Der Priester verzog sein spitzes Fuchsgesicht zu einem süffisanten Grinsen. Unruhig rutschte er im Sattel hin und her. Die Aussicht, bald mit de Maldorac, dem das gesamte Tal tyrannisierenden Grundherrn, aufeinander zu treffen, bereitete ihm sichtliche Vorfreude.
„Ich weiß, ich weiß, mon Capitaine. Die ungesunde Ausstrahlung dieses Teufels, ist schon wie eine pestilenzisch heranziehende Wolke zu spüren.“ Er kniff die Knopfaugen zusammen, als könne er so das ungehemmt wuchernde Grün des Urwalds durchdringen. „Also vorwärts!“
Mit einem Schnalzen drückte er seinem Braunen die Absätze in die Flanken und preschte in die grüne Hölle hinein. Irritiert blickte der Offizier dem Exorzisten nach. Er ließ sein Pferd antraben und bedeutete seiner Kompanie, ihm zu folgen. Keine Zeit mehr fürs Grübeln, jetzt war es Zeit zu kämpfen - für den König und Belgien! Und wenn es gegen den Teufel persönlich ginge...
Begehrlichkeiten
Für russische Verhältnisse war die Nacht ungewöhnlich mild.
Effektvoll positionierte Scheinwerfer tauchten die in Weiß und Blau gehaltene Fassade des Sommerpalasts von Zarskoje Selo in strahlende Taghelligkeit. Über die Front des gesamten Katharinenpalasts - wie das eindrucksvolle Gebäude auch genannt wurde - entlang hatte man Diener mit weiß gepuderten Perücken und prunkvollen Livreen aufgereiht. Fast schien der Pomp der Zarenzeit zu neuem anachronistischen Leben erwacht.
Allein die schier nicht enden wollende Reihe der modernen Luxuslimousinen und Nobelkarossen, die für diesen besonderen Abend aus dem 25 Kilometer nördlich gelegenen St. Petersburg hier herausgefahren waren, holte die Szenerie wieder in die Gegenwart zurück.
Wie das geschäftige Treiben am Eingang eines Bienenstocks eilte das Personal die breite Freitreppe des Hauptportals hinauf und hinab, hielt Autotüren auf, überprüfte Einladungen und Presseausweise, geleitete die geladenen Gäste zu den Garderoben und wies den Chauffeuren den Weg zu den hinter dem Gebäudekomplex, von vorn nicht einsehbar angelegten Parkplätzen.
Kunstmäzene und Geschäftsleute, Politiker und Diplomaten aus aller Herren Länder, Kunstkritiker und Gelehrte, Kamerateams und Journalisten sowie zuletzt die unumgänglichen Stars und Sternchen aus der Glitzerwelt des Films und der Gazetten für das nötige, schmückende Beiwerk ergossen sich in die Festsäle.
Blitzlichtgewitter spritzten Myriaden Reflexe über die kristallenen Sektgläser. Dort ein geliftetes Lächeln für die Kameras, hier ein mit Fremdworten bestücktes, kunstbeflissenes Statement, drüben ein kurzes Interview, da hinten ein hastiges Kaviar- oder Lachs-Hors d'Oeuvres.
Niemand, der sich auch nur im Geringsten einbildete, wichtig zu sein, hätte es sich nehmen lassen, diesem Ereignis beizuwohnen - der Eröffnung des wiederhergestellten Bernsteinzimmers am 300. Jahrestag der Grundsteinlegung von St. Petersburg.
Seit 1979 hatten 52 Handwerker, Tischler, Künstler und Steinschneider bis vor wenigen Tagen elf Stunden täglich mit Hochdruck daran gearbeitet, das legendäre, in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verlorene Kunstwerk nachzubauen. Grundlage dafür waren die etwas über zweihundert Farbfotografien gewesen, die von deutschen Soldaten 1941 bei der Demontage gemacht worden waren. Zweihundert mit der Zeit verblasste Zeugnisse des sogenannten „achten Weltwunders“.
In dieser Nacht präsentierte sich das Bernsteinzimmer wieder an jenem Ort, an dem es zwei Jahrhunderte lang zuhause gewesen war. Die 58 Jahre seit dem Krieg, in denen es verschollen war, schmolzen im Glanz der funkelnden Edelsteinwände zu einem bedeutungslosen Intermezzo.
*
Mordechaj Mistelczwyg schritt durch den 100 Quadratmeter großen Saal und ließ seinen Blick über jedes Detail des auf 125 Millionen Dollar geschätzten Kunstwerks gleiten - die Wandpaneele aus leuchtend orangenem Bernstein, die eingelegten Intarsien aus gelbem, weißem, grünem und schwarzem Stein, die aus glühendrotem Stein geschnittenen Zierleisten, die 24 Wandspiegel aus venezianischem Glas, die Florentiner Steinmosaiken, die vergoldeten Leuchter. Hier und dort strich der massige Geschäftsmann über den unter seinen fleischigen Fingern so kühlen und doch so lodernd funkelnden Edelstein. Mistelczwyg hatte ein Imperium von erlesenen Unterhaltungs-Etablissements aufgebaut. Phantasievoll gestaltete Casino-Hotels und bizarre Schickimicki-Clubs erwirtschafteten kaum abschätzbare Vermögen. Einen Gutteil diese Geldes investierte der Unterhaltungs-Tycoon in den Erwerb ausgesuchter Stücke für seine Kunstsammlung. Der Wiederaufbau des Bernsteinzimmers hatte ebenso von seinem Mäzenatentum profitiert wie auch der schlanke junge Mann in dem unverschämt eng sitzenden, schwarzen Samthemd und ebensolcher Cordhose, der ihn begleitete. Mistelczwygs „Neuerwerbung“ hieß Andrej Roschenkow und war der gefeierte, neue Star am Himmel des Bolschoi Balletts. Seitdem er den 'Faun', Nijinskis Paraderolle, nackt getanzt hatte, war er zum weltweiten Liebling der Kritiker und zum Schwarm aller pubertierenden Mädchen avanciert.
An Mistelczwygs Arm hatte sich eine Frau mit olivfarbener Haut und schulterlangem, braunem Haar untergehakt.
„Es ist bis aufs i-Tüpfelchen absolut genau wie damals“, flüsterte der Geschäftsmann seiner eleganten Begleiterin zu. Das aufregend ärmellose Abendkleid mit Rollkragen von Chanel hob die Vorzüge ihrer vollendeten Figur dezent hervor. Mit ihrer imposanten Statur überragte sie Mistelczwyg um einiges.
„Kannst du dich so genau erinnern?“ Ihr zwangloser Plauderton verriet, dass sie weit mehr war als nur die Geschäftsführerin seiner Unternehmenskette.
„Ja, es ist mir, als wäre es gestern gewesen, Beltaine.“ In einer fast zärtlichen Geste berührte er ihre Hand, als könne er die Britin damit Anteil an den Bildern nehmen lassen, die vor seinem inneren Auge abliefen.
Beltaine DuLac lächelte: „Es war Anfang des 18. Jahrhunderts, nicht wahr?“
„1701, um genau zu sein, meine Liebe.“ Mistelczwyg schmunzelte. „Ich brachte König Friedrich I. auf die Idee, der Tradition, dass sich Preußen von den Deutschrittern herleitete, einen sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Der Reichtum des Deutschen Ritterordens basierte nämlich auf dem in den Ostgebieten gefundenen Bernstein. Die Legende wusste zu erzählen, dass der Bernstein der Ostsee von dem unter den Fluten des Meeres gelegenen Schloss einer Meeresprinzessin stammt. Also schlug ich dem König vor, ebenfalls ein Schloss aus Bernstein zu besitzen. Das muss wohl die Eitelkeit Friedrichs angestachelt haben. Jedenfalls erteilte er mir den Befehl, das Bernsteinzimmer zu entwerfen.“
„Nanntest du dich damals nicht David Viscumius?“ warf Beltaine ein.
Einen Moment blieb Mistelczwyg stehen. Seit über anderthalb Jahrhunderten hatte ihn niemand mehr so genannt. „Zuerst wurde das Bernsteinzimmer im Schloss Charlottenburg eingebaut, später wanderte es ins Berliner Stadtschloss. Friedrich Wilhelm I, der Soldatenkönig, hatte beileibe nicht soviel Sinn für Kunst. 1716 schenkte er mein Meisterwerk Zar Peter dem Großen - im Tausch gegen 55 Grenadiere für seine Truppe 'langer Kerls'.“
Mordechaj schüttelte den Kopf. Noch immer konnte er den ästhetischen Unverstand des Monarchen nicht nachvollziehen.
„Peters Tochter, die Zarin Elisabeth, ließ das Bernsteinzimmer zunächst in den Winterpalast einbauen, dann aber in den neu erbauten Sommerpalast, hier in Zarskoje Selo. Ich überredete den 'Alten Fritz' dazu, die nötigen Ergänzungen für den jetzt viel größeren Raum zu liefern. Ich konnte mein Werk nach Herzenslust erweitern.“
„Wie gut, dass du gerade Geheimrat der Zarin warst“, warf Andrej mit gespieltem Spott ein.
„Ein paar Jahrzehnte später konnte ich mich als der von Robespierre nach Russland entsandte Botschafter Revolutions-Frankreichs davon überzeugen, wie sehr das Bernsteinzimmer Elisabeths Nachfolgerin, Katharina der Großen, ans Herz gewachsen war. Es war ihr Lieblingszimmer.“ Mistelczwygs Blick schien nach innen gerichtet. Verträumt strich er durch seinen King Arthur Bart. „Ich war gern Thermidor Sanguine. Es war eine schöne Zeit am russischen Hof... und mit Katharina.“
Beltaine tätschelte seine Hand: „Ich weiß noch, wie schwer es dich getroffen hat, als du davon erfuhrst, dass die Wehrmachts-Heeresgruppe Nord das Bernsteinzimmer 1941 demontiert und nach Königsberg verbracht hatte.“
Der massige Geschäftsmann seufzte. „Der Verlust eines eigenen Kindes könnte nicht schlimmer sein. Auf eine gewisse Weise war das Bernsteinzimmer ja mein Kind. Als ich 1945 nach Königsberg kam und nur noch die zerbombte und ausgebrannte Schlossruine vorfand, war von meinem 'Kind' nichts übriggeblieben außer den 200 Fotos. Damals konnte ich nicht ahnen, dass man das Zimmer bereits vor den Bombenangriffen in 27 Kisten verpackt hatte, um es rechtzeitig auszulagern. Du weißt ja selbst, wie ich erst Jahre später erfuhr, wer sich den Transport in dem Durcheinander der letzten Kriegstage unter seine raffgierigen Klauen gerissen hatte!“
Kaum wahrnehmbar legte Mrs. DuLac einen Finger auf den Mund. Zielstrebig steuerte ein Pärchen auf Mistelczwyg und seine Begleiter zu.
„Nein, so eine Überraschung! Wenn ich gewusst hätte, dass Sie sich heute Abend auch die Ehre geben...“
Mistelczwyg wechselte einen vielsagenden Blick mit seiner Geschäftsführerin. „Die Geschwister di Sospiro, Mariluisa und Marioluca“, zischte Beltaine, „Kunstkenner. Sie haben uns vor zwei Jahren den Ankauf des Jean Giraud vermittelt.“
Dunkel erinnerte sich Mistelczwyg an das Geschwisterpaar. Wie die meisten seiner Transaktionen war auch der Erwerb des Giraud-Gemäldes damals von Beltaine erledigt worden. Ganz der weltgewandte Geschäftsmann setzte er eine vor Charme nur so triefende Miene scheinbaren Wiedererkennens auf und lächelte: „Die Welt ist wahrlich klein! Mariluisa, Marioluca - wie schön, Sie zu sehen.“
Die Ähnlichkeit der di Sospiros war verblüffend. Tiefschwarze, zart bläulich schimmernde Locken umrahmten die länglichen, schlanken Gesichter der Zwillinge mit den hohen Wangenknochen. Beide besaßen auffällig ausdrucksstarke, goldbraune Augen. Identisch gekleidet in karmesinrote, engantaillierte Herrenanzüge hatten die Geschwister etwas Androgynes. Man war versucht, Mariluisa für einen schönen jungen Mann zu halten, ihren Bruder hingegen für eine herbere junge Frau. Der Anblick war verwirrend.
Mit ihrer beider Wirkung kokettierend blieb Mariluisa in einer etwas zu lässigen Pose vor Mistelczwyg stehen. Ihr Bruder lehnte sich mit verschränkten Armen auf ihre Schultern. Sein stechender Blick galt Mistelczwygs Mündel Andrej. Unverhohlen sog er die athletische Figur des Tänzers mit den Augen in sich auf. Anzüglich fuhr er sich mit der Zunge über die vollen, blass rosé Lippen.
„Wie man so hört - Sie kennen ja das Getratsche - haben Sie eine gehörige Stange Geldes für den Wiederaufbau des Bernsteinzimmers beigesteuert.“ Mariluisa di Sospiro lächelte süffisant und entblößte eine Reihe makellos weißer Zähne. Mariolucas Blick war noch immer starr auf Andrej Roschenkow geheftet. In einer aufdringlichen Geste fuhr er mit der Zunge die Konturen der Ohrmuschel seiner Schwester entlang. Sie schien es nicht zu bemerken: „Waren Sie es nicht, Mr. Mistelczwyg, der seinerzeit dazu beigetragen hat, dass eine Truhe und ein Mosaik aus dem originalen Bernsteinzimmer wieder aufgetaucht sind?“
Mariluisas Frage war weniger eine Frage als eine Feststellung.
„Das Glück des Sammlers. Sie wissen ja selbst, wie das ist, Signora di Sospiro. Man hört so allerlei im Kunstgeschäft.“ Die Gegenwart der di Sospiro Geschwister war Mordechaj zutiefst unangenehm. Er konnte es sich selbst nicht erklären, aber er meinte geradezu fühlen zu können, wie eine negative Ausstrahlung von ihnen ausging.
Beltaine spürte das Unbehagen ihres Freundes und zog ihn mit sich fort: „Oh, schau nur, in der Vitrine dort hinten hat man Fabergé-Eier ausgestellt. Wie wunderbar. Komm - die muss ich mir ansehen.“
Mistelczwyg warf den di Sospiros ein gut gespieltes entschuldigendes Lächeln zu und ließ sich von Beltaine zu der Vitrine mitziehen.
„Fabergé-Eier! Das ist interessant.“ Die karmesinroten Geschwister schienen sich nicht abschütteln zu lassen. Ungeniert folgten sie dicht auf. Marioluca hielt die Hand seiner Schwester und saugte an ihrem Mittelfinger. Dabei ließ er Andrej keinen Moment aus den Augen. Scham zählte offensichtlich nicht zu seinen hervorstechendsten Eigenschaften.
„Just neulich las ich von Peter Carl Fabergé in einer Biographie eines seiner Zeitgenossen.“ Mariluisa di Sospiro schob sich dichter an Mistelczwyg heran, als habe sie ihm ein brisantes Geheimnis zu offenbaren. „Ich stieß zufällig beim Stöbern in einem ungarischen Antiquariat darauf. Eigentlich beschäftigte mich die Suche nach einem antiken Folianten, der den Zugang zur Hölle durch acht oder neun Pforten beschreibt. Krauses Geschreibsel eines abergläubische Geistes eben.“ Als teilten sie ein gemeinsames okkultes Wissen, zwinkerte sie dem Unterhaltungs-Tycoon zu.
„Wie gesagt fand ich stattdessen zufällig besagte Biographie.“ Sie machte eine Kunstpause, um die Dramatik ihrer unumgänglich zu erwartenden Offenbarung zu erhöhen. „Es ist unglaublich, aber es hieß darin, die Anregung für die künstlerischen Kleinode, die Fabergé von 1884-1917 für die Zarenfamilie entworfen hat, sei eine bereits ältere Serie von Schmuck-Eiern gewesen. Diese seien im Atelier eines gewissen Juweliers und Uhrmachers namens 'Moosberg' entstanden, wo Fabergé einige Lehrjahre verbracht habe.“
Sie bedachte Mistelczwyg und Beltaine mit einem bedeutungsschwangeren Blick und flüsterte im Verschwörerton: „Es soll fünf 'Moosberg-Eier' geben, heißt es. Wahre Meisterwerke der Feinmechanik und Goldschmiedekunst. Sie gelten als verschollen. Ihr Verbleib ist ebenso geheimnisumwittert wie das Ende ihres Schöpfers.“ Ihre geflüsterten Worte waren jetzt kaum mehr als ein Hauch.
„Fünf Eier. Und jedes einzelne mehr wert als alle Fabergé-Eier zusammen...“
Mistelczwyg schluckte. Nun war er ernstlich beeindruckt.
Marioluca schien kein Interesse an den Enthüllungen seiner Schwester zu finden. Man mochte spekulieren, ob er psychisch gestört war. Mit Ausnahme der auf Andrej Roschenkow gezielten Anzüglichkeiten, wirkte er beinah autistisch.
„Es liegt demnach vollständig im Dunkeln, was aus den Moosberg-Eiern geworden ist?“ Mistelczwygs Sammlerleidenschaft war geweckt. Wie ein unstillbarer Hunger nagte es in ihm, schrie wie ein gebundenes Tier. Vor seinem geistigen Auge drehte sich spöttisch ein Reigen fünf eiförmiger Kunstwerke. Höhnisch glitzerten sie, gleißten hämisch. Sie nicht berühren, nicht mit Händen greifen zu können, schoss wie eisigquälendes Feuer durch sein Innerstes.
„Natürlich habe ich meine Fühler ausgestreckt. Hier und dort unauffällig nachgehorcht. Beziehungen spielen lassen.“ Mariluisa di Sospiro betrachtete ihre Fingernägel. „Kurz nach Moosbergs mysteriösem Tod haben sich damals schon die ersten Schatzjäger auf die Suche nach den Eiern gemacht. Einen belgischen Edelmann soll es dabei bis in die Tiefen des schwarzen Kontinents verschlagen haben...“
Zärtlich streichelte sie die Wange ihres Bruders. Sein fiebriges Grinsen schien an dem durchtrainierten Körper des Ballett-Tänzers festgeschweißt zu sein.
„Nun ja“, mit seinen fleischigen Händen winkte Mistelczwyg einen livrierten Kellner heran, „Immerhin ist uns die Schönheit der vollendeten Schöpfungen Fabergés erhalten geblieben.“
Mit einer angedeuteten Verbeugung reichte der Diener das Silbertablett mit den Krimsekt-Gläsern in der Runde herum.
„Dann wollen wir auf Fabergé anstoßen“, erhob Andrej sein Glas.
„Und auf die Schönheit“, ließ sich Marioluca vernehmen, „und auf die Schönheit!“
Kristallklar hallte der helle Ton der aneinander stoßenden Sektgläser von den glühendfeurigen Bernsteinwänden wider.
Dunkle Schatten
„Nein!“ brüllte er und presste die Hände an die Ohren.
Es hörte nicht auf, dieses Hämmern und Rumoren in seinem Schädel, als hausten darin tausend und abertausend Abbruchhämmer.
Dies infernalische Röhren, das auf ihn eindrang, ihn geißelte, ihn nicht mehr losließ.
Ein rasender Schmerz durchzuckte ihn: sein Zentrum war der Kopf, der von einer schrecklichen Macht traktiert wurde.
Santiago Cabaral konnte sich nicht mehr halten. Ächzend ging er in die Knie. Seine Augen zeigten nur noch das Weiße. Sein Gesicht war zur grauenerregenden Grimasse verzerrt.
„Santiago!“ schrie jemand, packte ihn hart an den Schultern und schüttelte ihn.
Doch das Röhren, das über den Dschungel herüberklang und in Cabaral Resonanz fand, übertönte alles. Es erinnerte an das Trompeten eines Elefantenbullen, obwohl der Urschrei eines Dickhäuters sich gegenüber diesem Laut mehr als ein süßes Säuseln ausgenommen hätte. Santiago Cabaral öffnete den Mund und schien sich zu bemühen, das Dröhnen nachzuahmen.
Wieder wurde er geschüttelt. Wie aus weiter Ferne vernahm er die Stimme. Er hörte Worte, sie wurden lauter und wieder leiser: „Santiago! Um Himmels willen, was ist mit dir los? Komm zu dir!“
Und dann sah Santiago Cabaral den Giganten. Er war nicht mehr als ein mächtiger Schatten, der sich hinter der undurchdringlich wirkenden Kulisse der grünen Hölle erhob - schwarz, dunkeldrohend und gefährlich wie die Nacht. War es ein Wirrspiel des Lichts oder glommen dort zwei Punkte in dem Schatten, dort, wo sich die Augen befinden würden? Jetzt beugte er sich über Santiago Cabaral, der unter dem Gewicht des Mächtigen nach Luft schnappte und - sein Bewusstsein verlor.
*
Anique Bolenge betrachtete sich im Spiegel. Eine Sechzehnjährige schaute ihr entgegen - ein nougatbraunes, ebenmäßiges Gesicht, in dem das Leben noch nicht seine Jahresringe eingegraben hatte und Augen, die erwartungsvoll glommen.
Anique war schlank, mit einer hübschen, unübersehbar voll entwickelten Figur, auf deren nackter Haut das Licht der Kerze spielte.
Mit beiden Händen strich sie sich über Taille und Hüften. Es war eine mädchenhafte Geste und zugleich auch so viel mehr.
Die vollen, sinnlich geschwungenen Lippen waren feucht. Ihre Nasenflügel blähten sich leicht. In einem heftigen Atemzug hob und senkte sich die Brust. Ein Dämon schien die Glut in ihren ausdrucksvollen Augen zu schüren.
„Hörst du mich, Gebieter?“ hauchte sie erschaudernd.
Sie legte den Kopf schief, schien in die Stille ihres Zimmers hineinzulauschen.
Da war ein fernes Wispern. Kam es vom Wind, der draußen am geschlossenen Fensterladen vorbeistreifte?
„Gebieter!“ Ihre Stimme bebte, „Gebieter, bald werde ich bei dir sein, bald. Ich höre schon das Flüstern des Todes. Das Blut rauscht mir in den Schläfen - nur für dich, mein Gebieter...“
Für Sekunden war es ihr, als verzerrte sich das Spiegelbild. Ein düsterer Schatten glitt darüber hinweg. In Augenhöhe glühten zwei Punkte.
Der Atem des Mädchens beschleunigte sich noch mehr. Feine Schweißperlen, die wie frischer Tau wirkten, traten auf ihre Stirn.
„Gebieter!“ flüsterte sie.
Das seltsame Schattenbild verblasste. War es nur eine Einbildung ihrer Phantasie gewesen?
Anique Bolenge schluchzte laut auf. Sie stützte sich gegen den mannshohen Spiegel, drückte sich gegen seine kaltglatte Oberfläche, tat, als wolle sie hineinkriechen. Schließlich sah sie die Sinnlosigkeit dieses Tuns ein und trat zurück.
Weinend schlug sie die Hände vor das Gesicht und sank langsam auf die Knie.
In diesem Moment drang ein Geräusch an ihre Ohren. Erschrocken fuhr sie auf. Die Stimme einer Frau, durch hölzerne Wände gedämpft.
Gehetzt wirbelte sie herum. Für ihr Spiegelbild hatte sie jetzt keinen Blick mehr. Auf nackten Füßen lief sie zu dem schweren Wollvorhang, der die Kammer, in der sie schlief, vom Rest der Hütte abteilte. Sie starrte auf den schweren, grauen Wollstoff, als könne sie ihn mit Blicken durchdringen und lauschte.
Jetzt hörte sie auch eine Männerstimme. Anique griff nach der Kerze, blies sie aus - sofort wurde es dunkel. Allein durch die Blendladen fiel ein Streifen Licht, in dem feine Staubpartikel silbern tanzten.
Es dauerte eine Weile, ehe sich ihre Augen an das Zwielicht im Zimmer gewöhnt hatten. War denn wirklich bereits die Sonne aufgegangen?
Anique Bolenge lief zu dem knarrenden Pritschenbett zurück. Sekundenlang blieb sie daneben stehen und horchte. Ihr Gesicht nahm einen gespannten Ausdruck an.
Es war still im Haus.
Fröstelnd umfasste sie ihre Schultern. Dank der Fensterladen war es noch immer kühl im Zimmer. Doch unter ihrer Haut glühte sie.
Mit der Zunge fuhr sie über die Lippen und legte den Kopf zurück. Ihr blauschwarzes Haar fiel in Wellen in den Nacken. „Oh, mein Gebieter“, ihre Stimme war ein Flüstern, „warum quälst du mich so sehr?“
Draußen, vor der Kammer näherten sich jetzt Schritte. Aniques Gedanken kehrten in die Wirklichkeit zurück. Blitzschnell schlüpfte sie unter die Decke. Der grobe Stoff war rau und kratzte. Die Schritte verharrten vor dem Vorhang. Als er beiseite geschoben wurde, raschelte es leise.
Eine schwielige Hand langte herein und ließ das Licht der verloren unter der Zimmerdecke hängenden Glühlampe aufflammen. Anique rührte sich nicht. sie stellte sich schlafend.
Jemand durchquerte die kleine Kammer mit dem gestampften Lehmboden und blieb vor dem Bett stehen. Die Decke wurde leicht zurückgezogen.
„Anique!“ schimpfte eine keifende Stimme, „Anique, liegst du schon wieder ohne Nachthemd im Bett!? Du weißt, wie unzüchtig das ist. Schäm' dich!“
Anique tat, als erwachte sie.
Sie streckte ihre Arme hoch, rekelte sich und blinzelte ins Licht. Das über ihr hängende Gesicht wirkte wie ein Schattenriss. Aufmerksam musterte das Mädchen die Gestalt. Wettergegerbte, fast ebenholzfarbige Haut und eine schwielige Hand, die sich gegen den schmallippigen Mund drückte. Der Gesichtausdruck wirkte hart, nicht wie der einer Vierzigjährigen.
Jetzt waren die Augen vor Entsetzen geweitet.
„Wie verdorben du bist, Anique. Schämst du dich denn überhaupt nicht vor der eigenen Mutter? Nein, diese Schande. Warte nur, bis Vater N'Gome davon erfährt!“
Anique lächelte unergründlich. Mit einem Ruck warf sie die Decke beiseite und sprang aus dem Bett. Die derbe Frau warf die Arme in die Luft und flüchtete kreischend aus dem Zimmer. „Der Satan ist in sie gefahren, der Satan!“ zeterte sie. Anique Bolenge sah ihrer Mutter böse lachend nach. Sie schaute in den Spiegel: „Der habe ich es gegeben, Gebieter, nicht wahr? Einen ganz gehörigen Schreck habe ich ihr versetzt, stimmt's? Am liebsten würde ich so, wie ich bin, auf die Straße laufen. Alle sollen sie erschrecken.“
Verbissen hielt sie ein. Sie ballte die kleinen, zierlichen Hände zu Fäusten. „Ja, der Satan ist in mir“ murmelte sie, „der wirkliche Satan.“
Mit ausgebreiteten Armen himmelte sie den Spiegel an. „Gebieter, bitte sende mir ein Zeichen! Ist das, was ich vorhabe, richtig?“
Da war nichts und niemand, der ihr eine Antwort gab. Abrupt wandte sie sich ab. „Egal, es wird getan, was getan werden muss. Alles ist vorbereitet. Für ein Zurück ist es jetzt zu spät!“
Auf einmal wirkte sie fast traurig.
Sie rückte den hohen Bastkorb, den sie vor dem Auftauchen ihrer Mutter vergessen hatte, wieder an seinen Platz vor dem Spiegel zurück. Der Mutter war der Spiegel gar nicht aufgefallen. Auch ihn hätte sie für ein Teufelswerk gehalten. Dann nahm sie den tönernen Krug und schüttete Wasser in eine Schüssel. Während sie damit begann, sich langsam zu waschen, weilten ihre Gedanken ganz woanders.
*
Seit einem Tag bahnten sie sich ihren Weg durch den Dschungel der Hochebenen Zaires, des ehemaligen Belgisch-Kongo: Floyd Maloy, Santiago Cabaral und ein paar farbige Träger. Ihr Ziel war der Talkessel, den man Petiteville nannte. Petiteville - der malerische Name täuschte darüber hinweg, dass es sich bei der Siedlung in einem langgestreckten, unwegsamen Tal des Berglandes von Katanga lediglich um eine Ansammlung grob gezimmerter Holzhäuser handelte, die sich um eine armselige Missionsstation drängten. Im 19. Jahrhundert hatte es einen Marquis de Maldorac in dies Nest am Ende der zivilisierten Welt verschlagen. Er schien auf der Suche nach irgendetwas gewesen zu sein, das er hier nun gefunden zu haben glaubte. Unter Aufbietung eines schier unerschöpflichen Vermögens und unter menschenverachtendem Verschleiß schwarzer Fronarbeiter hatte er seinen mittelalterlichen Familiensitz aus den belgischen Ardennen Stein für Stein verschiffen und durch den Dschungel transportieren lassen, um ihn an den Steilhängen des Talkessels von Petiteville wieder aufzubauen. Mit der Zeit war Herr de Maldorac zu einer weiteren skurillen Fußnote der Geschichte geworden. Nachdem der Kongo 1960 nach 81 Jahren belgischer Kolonialherrschaft die Unabhängigkeit errungen hatte, hatten die Bewohner von Petiteville die weißen Missionare vertrieben. Als Pater Roger N'Gome nach seinem Studium im Priesterseminar von Brüssel in sein Heimatdorf zurückgekehrt war, hatte er Kirche und Missionsschule nur noch verlassen vorgefunden. Er war geblieben. Sei es aus Sturheit, sei es aus Scham für die Bewohner des Ortes, aus dem auch er stammte. Er war geblieben und man hatte ihn geduldet. Die verwaiste Missionsschule war weitergeführt worden, als wäre nichts geschehen und die Bewohner von Petiteville hatten wie eh und je ihre Felder bepflanzt. Irgendwo hoch in den Hängen über dem Dorf klammerten sich die vergessenen Reste des Chateau de Maldorac in die vom dichten, grünen Urwald überwucherten Felsen. Maloy und Santiago versprachen sich großen Gewinn von ihrem Unternehmen, denn zur Zeit wagte sich niemand mehr in diese Gegend. Seitdem der Kontakt mit Petiteville vor ein paar Monaten abgebrochen war, hatte es zwar einige Versuche gegeben, die kleine vom undurchdringlichen Dschungel umgebene Siedlung auf dem Fußweg zu erreichen, doch die von den örtlichen Behörden losgeschickten Expeditionen waren allesamt gescheitert. Genauer gesagt, war keiner zurückgekehrt und es fehlte jeglicher Ansatzpunkt, was mit den Trupps geschehen sein konnte. Die einstige Kolonialstraße war bereits seit Jahren kaum mehr als ein kläglicher Trampelpfad. Eingestürzte Brücken und metertiefe Schlaglöcher als Vermächtnis vieler Regenzeiten machten diese Strecke selbst für die geländegängigen Militär-Jeeps unpassierbar. Die unberechenbaren Fallwinde an den Berghängen des Massivs von Katanga ließen auch die wagemutigsten Helikopter-Piloten zurückschrecken. So blieb nur der beschwerliche Fußweg für den Handelsverkehr mit Petiteville. Und der war vor rund einem Vierteljahr abgebrochen. Kein Einwohner Petitevilles hatte sich in der kleinen Handelsstation blicken lassen. Der wöchentliche Funkverkehr mit der quäkenden Funkanlage von Pater N'Gome war einem Rauschen gewichen. Es schien, als sei Petiteville von der Landkarte verschwunden.
Floyd Maloy und Santiago Cabaral waren zwei Abenteurer, mit allen Wassern gewaschen - nur nicht mit Weihwasser. Wo das große Geld winkte, waren sie sofort zur Stelle. Egal, ob man sie gerufen hatte oder nicht. Wie Aasgeier schienen sie solche Gelegenheiten förmlich zu wittern. Sie scherten sich nicht um das, was im Handelsposten am Fuß des Katanga erzählt wurde. Es gab nicht mehr viel auf dieser Welt, was sie noch hätte schrecken können.
Mit aller Vorsicht waren sie in den Dschungel eingedrungen. Der sich über die beständig ansteigenden Hänge des Gebirgszugs ausbreitende Urwald war bis jetzt wenig erforscht. Welcher Mensch wäre auch schon auf die Idee gekommen, hier sein Leben und seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Wer außer den Bewohnern von Petiteville? Doch für Cabaral und Maloy hieß der Antriebsmotor Geld und das war ein starker Antrieb. Die Regierung in Kinshasa stellte eine über Gebühr großzügige Entlohnung für die Klärung der seltsamen Vorkommnisse in Aussicht.
Und nun das hier!
Floyd Maloy verstand die Welt nicht mehr. Er blickte auf den zusammengebrochenen Freund und Partner hinab. Plötzlich hatte Santiago Cabaral zu schreien begonnen und war schließlich zusammengebrochen. Einen Grund hierfür sah Floyd nicht.
Vielleicht ein Hitzekoller? So etwas sollte es ja geben. Aber ausgerechnet bei Santiago Cabaral, diesem Burschen, der nur aus Muskeln und Sehnen zu bestehen schien? Maloy beugte sich hinab. Er achtete im Moment nicht auf die einheimischen Träger. Er war zu besorgt um seinen Freund.
Das war sein Pech, denn so entging ihm, dass die kleine Kolonne von Unruhe erfasst wurde. Einige ließen Ausrüstung und technische Geräte einfach zu Boden fallen. Sie bildeten einen Kreis, in dem leise diskutiert wurde. Immer wieder warfen sie ängstliche Blicke auf den regungslos am Boden liegenden Weißen.
Santiagos Gesicht hatte sich wieder etwas entspannt. Es war ein markant geschnittenes Gesicht, umrahmt von dunklem, kräftigem Haar - momentan zwar unrasiert, aber anziehend, was besonders die Frauen fanden. Floyd Maloy wusste das aus Erfahrung, obwohl er nicht der Mann war, in dem dabei Neid aufkeimte. Floyd war eher ein grobschlächtiger Typ. Er war fast so groß wie Cabaral, stämmig gebaut und wirkte im Vergleich mit seinem dunkelhaarigen Partner plumper.
Als Floyd Maloy Santiago berührte, erschrak er. Der Freund schien zu fiebern. Seine Muskeln waren verhärtet, die Haltung eigentümlich verkrümmt. Nur der Puls schlug einigermaßen normal.
In diesem Moment öffnete Santiago Cabaral die Augen. Mit verschleiertem Blick schaute er um sich. „Wo... wo ist er?“ Seine Stimme klang rau. Maloy runzelte die Stirn.
„Da - zwischen den Baumriesen!“ Santiago Cabaral zitterte wie Espenlaub. Er sprang auf die Beine, stierte in die Wand aus wucherndem Grün. Floyd Maloy konnte beim besten Willen nichts Ungewöhnliches entdecken. Eine Gänsehaut fingerte seinen Rücken hinauf.
Um seine unbestimmte Angst zu unterdrücken, hob er das schwere Buschmesser hoch über den Kopf und ließ es niedersausen. Die Klinge riss ein beachtliches Loch in das Pflanzengewirr. Licht schimmerte hindurch - das gleißende Licht einer unbarmherzigen Sonne. Der Sonne?
Seit Stunden hatten sie keine Sonne mehr gesehen. Immerhin befanden sie sich in einem von Menschen kaum angetasteten Urwald. Hier gab es nur grünliches Dämmerlicht. Das Geflecht aus wachsender und wuchernder Natur filterte das Licht bis zu einem grünlichblauen Halbdunkel. In aberwitzigen Winkeln zuckten Insekten durch das Zwielicht. Irgendwo in den Baumkronen weit über ihnen wurden bunt schillernde Vögel aufgeschreckt. Man mochte fast glauben, dass die grüne Wildnis ausgerechnet in diesem Teil Zentralafrikas beschlossen hatte, sich besonders undurchdringlich zu zeigen.
Floyd Maloy war erstaunt. Einen Augenblick lang vergaß er seine Sorge um den Freund und teilte die Zweige mit den Armen. Hinter einem verwobenen Blättervorhang tat sich eine kleine Lichtung auf. Unerfindlich, warum sie entstanden sein mochte. Jedenfalls war sie groß genug, um den blauen Himmel und die grelle Sonne sichtbar werden zu lassen. Sie lud geradezu dazu ein, eine Pause einzulegen.
Maloy nahm einen tiefen Schluck aus seiner Wasserflasche und wandte sich um. Santiago Cabaral hatte sein Gesicht in den Händen vergraben.
„Madre de Dios, es fängt schon wieder an!“ stöhnte er.
Floyd fasste ihn am Arm: „Verdammt, Santiago! Jetzt sag mir endlich, was mit dir los ist!“
Santiago Cabaral hob den Kopf und blickte ihn verblüfft an. „Soll das heißen, du hörst es gar nicht?“
„Was zum Teufel soll ich denn hören?“
Santiago warf den Kopf in den Nacken, trat einen Schritt zurück, breitete die Arme aus: „Es kommt doch von überall und nirgends - dies Röhren und Heulen. Der Schatten ist erwacht und spürt, dass wir näherkommen!“
Floyd Maloy schüttelte den Kopf. Jetzt wusste er, dass es den Freund wirklich erwischt hatte. Santiago fixierte ihn: „Du glaubst mir nicht. Das spüre ich. Du denkst, ich wäre durchgeknallt. Trotzdem! Hör auf mich! Wir müssen sofort umkehren! Denk an die anderen Expeditionen. Keine ist zurückgekommen. Für uns ist es noch nicht zu spät...“
Floyd Maloy setzte zu einer scharfen Erwiderung an. Da fiel sein Blick auf die wartenden Träger. Er sah die unverhohlene Angst, die sich in ihren Gesichtern widerspiegelte, sah die verstohlenen Blicke, die sie Santiago zuwarfen.
Er ging auf die Lichtung zu und winkte die anderen heran. Zögernd setzten sich seine farbigen Begleiter in Bewegung. Auch Santiago rappelte sich auf und kam herüber. Immer wieder hob er lauschend den Kopf. Im Moment vernahm er nichts mehr. Die fremde Macht hatte von ihm abgelassen. Doch die Erinnerung an das, was er durchlebt hatte, schnürte ihm die Kehle zu. Er war gewiss kein Feigling. In mehr als einer brenzligen Situation hatte er sich behaupten können. Allein der Gedanke daran, es könnte sich alles wiederholen, trieb ihm allerdings den kalten Schweiß auf die Stirn.
Die einheimischen Träger legten ihre Lasten auf der Lichtung ab und setzten sich darauf. Aufgeregt unterhielten sie sich. Jetzt flüsterten sie nicht mehr und ihr Palaver ging Floyd Maloy gehörig auf die Nerven.
„Hör zu, Floyd, du musst mir glauben. Ich bin nicht übergeschnappt. Um uns lauert irgendeine entsetzliche Gefahr.“ Er horchte auf die Geräuschkulisse, die hier so allgegenwärtig war wie die feuchtdampfende Hitze, die einem untrainierten Menschen alle Kraft aus dem Leib zehren konnte. Da war es wieder! Ein fremder Laut schälte sich heraus, drängte in den Vordergrund, übertönte alles andere. „Hörst du es wirklich nicht?“
Auch Floyd Maloy konzentrierte sich jetzt. Er glaubte ein Stöhnen zu vernehmen - dumpf und grollend, als stamme es von einem aufziehenden Unwetter. Ein Schaudern durchlief ihn und er musste sich unwillkürlich schütteln. Was war das?
Abermals jener Laut. Diesmal war er deutlicher. Der Wind trieb ihn hoch über dem Blätterdach der grünen Hölle zu ihnen herüber. Das aufgeregte Diskutieren der Träger verstummte. Ihre Gesichter wirkten unnatürlich fahl. Langsam erhoben sie sich.
Floyd Maloy glaubte zu wissen, woher das Stöhnen kam - genau aus der Richtung, in die sie sich die ganze Zeit bewegt hatten. Ein Schnauben, laut und machvoll. Ein Röhren folgte, so wie es vor wenigen Minuten Santiago vernommen haben mochte. Die Einheimischen stießen markerschütternde Schreie aus... Dann begannen sie zu laufen.
Auch Santiago lief los - allerdings in die Richtung, aus der die durchdringenden Laute kamen.
„Halt! Wartet!“ Floyd Maloy brüllte über die Lichtung. Er war im Moment unschlüssig, wem er folgen sollte. Mit einem Mal war er allein. Es war plötzlich still - ja unangenehm still. Um ihn herum schien alles wieder absolut normal. Er lauschte. Da war nichts Ungewöhnliches wahrzunehmen.
*
Vor dem Türvorhang blieb Anique Bolenge stehen.
Von drinnen war die Stimme der Mutter zu hören. Sie schimpfte laut und keifend vor sich hin. Niemand ging auf ihre Worte ein. Doch Anique wusste, dass auch ihr Vater im Raum sein würde. Er verhielt sich schweigend - wie immer.
„Bei meiner Seele, ich weiß nicht, was mit ihr los ist. In den letzten Wochen ist es ganz schlimm geworden mit ihr. Heute Mittag werde ich zur Kirche hinübergehen und mit Vater N'Gome reden. So geht das nicht weiter. Man sollte sie in ein Kloster stecken, in ein Kloster. Dort wird man ihr den Teufel schon wieder austreiben.“
Ein heiseres Räuspern unterbrach den Redeschwall der Mutter: „Wie kannst du so etwas sagen, Frau? Anique ist ein junges Ding. Die haben heute ganz andere Vorstellungen vom Leben als wir.“
„Wie? Willst du sie etwa auch noch in Schutz nehmen? Ja, merkst du denn nicht, dass der Teufel von ihr Besitz ergriffen hat? Neuerdings geht sie sogar ins Bett, ohne was anzuhaben. Ja, du hast schon richtig gehört, sie hat nichts an. Heute Morgen war das auch schon wieder so. Ich dachte, ich kriege einen Herzschlag. Was meinst du, wie mich das erschreckt hat. Ich konnte das gar nicht mit ansehen.“
Jetzt sagte der Vater nichts mehr. Er schien genauso schockiert zu sein wie die Mutter. Anique beschloss, dem Spiel ein Ende zu bereiten. Sie zupfte das leichte Kleid zurecht und griff nach dem Vorhang.
Elegant schob sie sich hindurch. Sofort verstummte die Mutter.
Anique verhielt in der Türöffnung, als gäbe es eine unsichtbare Wand, die sie mit aller Gewalt durchbrechen musste. Ihr unsteter Blick wanderte durch den großen Raum der Hütte. Hier wurde gekocht, gewaschen und gegessen. Die Einrichtung war spärlich. Auf einem Bord stand tönernes Geschirr. Ein Emaille-Eimer mit abgestandenem Wasser rostete in der Ecke. Über der roh gemauerten Feuerstelle schickten frische Fladenbrote Rauch durch den Abzug in der hölzernen Decke. In einer Ecke hing ein Kruzifix aus schwarzem Holz. Die Christusfigur zeigte die traditionellen Gesichtszüge afrikanischer Schnitzarbeit. Die beiden Menschen, die an dem grobgezimmerten Tisch saßen, verschmolzen fast mit der Einrichtung.
Die Mutter war in ein schwarzes, knielanges Kleid gekleidet. Die Haare waren unter einem über der Stirn geknoteten Tuch verborgen. Ein bitterer Zug lag um den schmallippigen Mund, deren Seiten wie gewöhnlich leicht herabgezogen waren. Mutter Bolenge hatte gut dreißig Kilo Übergewicht, die das einfache Kleid schlecht verbergen konnte.
Der Vater wirkte dürr und ausgezehrt, als wäre er magenkrank. Sein Gesicht hatte eine ungesunde, aschfarbene Tönung. Die dunkle Haut war zerknittert wie bei einem alten Mann - dabei mochte er nicht viel älter sein als seine Frau. Er trug ein kariertes, ärmelloses Hemd und zerschlissene Hosen. Die Füße steckten in Korklatschen.
Aniques Blick blieb an den knochigen Händen hängen, die ruhig auf der Tischplatte ruhten. Die Gelenke der Finger waren knotig. Diese Hände waren es gewohnt, von Sonnenauf- bis -untergang fest zuzupacken. Aber Anique hatte sie auch schon anders erlebt - wenn sie auf sie niedersausten und klatschend auf ihrem Gesicht, auf ihren Händen landeten. Wenn sie einen Stock hielten, um sie zu züchtigen. Sie schluckte. Trotzig trat sie über die Türschwelle und kam heran. Welten schienen sie von ihren Eltern zu trennen und diese Welten waren unüberbrückbar.
„Wo warst du so lange?“ Die Stimme der Mutter war ein einziges Kreischen.
Anique zeigte sich unbeeindruckt. Sie setzte sich und zog den Hocker näher zum Tisch.
Die Mutter erging sich in Tiraden. Wahre Sturzbäche an Wortergüssen prasselten auf das Mädchen nieder. Anique aß und trank seelenruhig. Nur einmal hielt sie inne. Dann nämlich, als die Mutter sie anschrie: „Der Teufel steckt in deinem Leib! Ja, der Teufel!“
Anique unterbrach ihr Frühstück und schob alles von sich: „Das ist DEIN Problem.“
Ihre Mutter war sprachlos. Sie starrte mit offenem Mund. Der Vater schüttelte den Kopf. „Du hast recht, Frau“, knirschte er, „Was ist los mir ihr?“
Marie Bolenge funkelte ihren Mann an: „Das fragst du mich, du Waschlappen? Da sitzt das Produkt deiner Hätschelei. Dein Kind beleidigt die eigene Mutter und du lässt es auch noch durchgehen! Der Teufel hat sie in seinen Krallen, ich sag es dir doch, der Teufel!“
Die schwieligen Hände von Maurice Bolenge ballten sich. Mit einem Ruck sprang er auf. „Dann werden wir diesen Teufel schon austreiben.“ Er war außer sich und zeigte alle Anzeichen eines typischen Cholerikers.
Auch diesmal blieb Anique ungerührt. Sie maß ihren Vater von Kopf bis Fuß mit einem mitleidigen Blick. „Das kannst du, Vater, die Fäuste schwingen. Das hast du immer getan. Komm, schlag mich doch! Worauf wartest du denn? Schlag mich.“ Ihre Augen sprühten Feuer. Sie trat auf ihren Vater zu, sah ihm herausfordernd ins Gesicht: „Was ist? Ich kann mich doch gar nicht wehren. Du brauchst keine Angst zu haben.“
Maurice Bolenge war stocksteif vor Entsetzen. Sein Verstand hakte aus. Er begriff nicht, was er vor sich sah. Sonst, wenn er mit Schlägen gedroht hatte, hatte Anique die Flucht ergriffen. Sie hatte sich in eine Ecke verkrochen und gewartet, bis er sie mit Gewalt hervorgezerrt hatte. Schwer atmend ließ er sich auf den Hocker fallen. „Ich.. ich verstehe die Welt nicht mehr“, seine Stimme klang müde. Er sah seine Frau an: „Was haben wir denn getan? Haben wir nicht immer die Gebote befolgt? Haben wir Anique nicht immer im Sinne des Glaubens erzogen?“
„Es hat mit ihren seltsamen Träumen begonnen“, murmelte die Frau mit brüchiger Stimme, „erst waren es nur kleine Anzeichen... Mit ihnen ist der Schatten des Bösen über dies Haus gekommen. Glaub mir, deine Tochter hat den Teufel zu uns gebracht. Bestimmt ist der Keim des Bösen in Anique - und jetzt geht die Saat auf.“
„Seid ihr fertig? Dann will ich euch nicht länger stören.“ Anique drehte sich um, griff den neben ihr liegenden Jutebeutel und verließ grußlos das Haus. Die Eltern schauten ihr nach. In den Gesichtern spiegelte sich Ratlosigkeit wider.
„Wir müssen etwas tun“, sagte Maurice Bolenge endlich. Er zögerte einen Augenblick. Seine Frau reagierte nicht. Er sprang auf und eilte seiner Tochter nach.
„Warte, Anique! Wo willst du hin. Bleib stehen, du kommst mit mir. Hast du gehört, du sollst stehen bleiben!“
Marie Bolenge stellte sich neben ihn. „Was hast du vor, Mann?“
„Ich bringe sie jetzt sofort zu Vater N'Gome“, flüsterte er. Anique konnte es nicht hören. „Er soll entscheiden. Sie ist krank. Bestimmt ist sie krank. Benimmt sich so eine normale Tochter? Wir haben ihr Zucht und die Gebote des HERRN beigebracht.“
Anique hatte schon die Umfriedung aus Bruchsteinen erreicht, als ihr Vater nachgelaufen kam. Sie blieb stehen. Langsam drehte sie sich um. Ihre Augen flackerten. Maurice Bolenge ballte die Fäuste und nahm eine drohende Haltung an. „Sofort kommst du hierher!“
Die Gedanken des Mädchens überschlugen sich. Sie dachte an das, was sie vorhatte. Würde jetzt alles scheitern? Nein, das durfte nicht sein.
Gebieter! riefen ihre Gedanken. Gebieter, warum hilfst du mir nicht? Ich hasse sie. Vernichte sie!
„Ich werde dich lehren, deinem Vater zu folgen“, Maurice Bolenge war außer sich, „das Maß ist voll!“
„Dann komm doch.“ Anique lachte. „Komm, Verfluchter. Ja, hörst du, du bist verflucht! Auf deine Seele wartet schon der Satan. Komm doch! Mein Geliebter wird dich vernichten. Ich wünsche es und er wird es tun.“
Ihr Vater verhielt im Schritt. Anique wirkte wie eine Wahnsinnige. Unwillkürlich bekreuzigte er sich. Seine Frau flüchtete ins Innere des Hauses.
Anique warf einen letzten Blick auf das armselige Gehöft. Die ungefügten Holzbohlen waren von der Sonne gebleicht. Die rohen Feldsteine waren nicht verputzt. Marie Bolenge hatte einen kleinen Garten mit Bohnenranken und Kräutern angelegt. Dafür hatte sie eine gute Hand. Links lehnte sich ein windschiefer Ziegenstall aus Wellblech an die Wohnhütte. Die Felder der Familie lagen außerhalb des Dorfes. Verächtlich spuckte Anique aus.
Mit ausdruckslosem Gesicht schaute der Vater ihr nach. Sie würde ihm nicht folgen. Er fühlte sich wie vor den Kopf geschlagen. Seine Frau als auch er waren in Petiteville geboren. Seine Welt endete an den Grenzen seines Feldes und den Hängen des Talkessels. Sie verließen das Dorf nur selten. Vor fünf Jahren hatte seine Schwester in ein anderes Dorf am Fuß des Katanga geheiratet. Seit der Hochzeitsfeier hatte er sie nicht mehr gesehen. Seine Welt war bisher klein und überschaubar gewesen. Mit dem Stock in der Hand hatte er seiner Tochter die Worte der Bibel eingeprügelt. Bis heute war ihm nie der Gedanke gekommen, dass er sich Anique gegenüber in irgendeiner Weise vielleicht nicht richtig verhalten hatte. Er und seine Frau hatten das an die Tochter weitergegeben, was ihr Leben ausgemacht hatte - ständige Demut, Gottesfurcht und harte Arbeit. Was war daran falsch gewesen? Als Anique seinen Blicken entschwunden war, barg der gebrochene Mann das wettergegerbte Gesicht in den groben Händen. Er schluchzte. Ein dunkler Schatten hatte sich über das Tal gelegt.
Anique hatte alles gut vorbereitet. Eine winzige Träne rollte über die Wange. Ärgerlich auf sich selbst wischte sie sie fort.
„Du musst dich in der Gewalt haben“, murmelte sie vor sich hin, „Bald wird alles besser werden.“
Sie hatte einen recht weiten Weg vor sich. Er führte über den Dorfplatz aus gestampftem Lehmboden und vorbei an der Missionsstation.
„Bald, Gebieter, bald wirst du mich in deine eisigen Arme schließen können. Dann werde ich für alle Ewigkeit dein sein.“ Anique schauderte. Es waren angenehme Schauder.
Sie erreichte den Dorfplatz. Der Wind fegte darüber hinweg und wirbelte eine Staubwolke vor sich her. Der Tag würde heiß werden. Auf der anderen Seite des Platzes wohnte Yves Matswha. Er war nur ein Jahr älter als Anique. Eine Zeit lang hatte er sie früher von der Schule nach Haus gebracht. Doch jetzt arbeitete er mit seinem Vater und den Brüdern auf den Feldern. Es war offensichtlich, dass der Junge sich in das hübsche junge Mädchen verliebt hatte. Anfangs hatte Anique seine Gefühle erwidert. Obwohl nie etwas Konkretes zwischen ihnen gewesen war, hatte sich nun alles verändert.
Anique Bolenge hatte sich verändert.
Daran dachte sie, als sie an der Missionsstation mit der alten Kirche und dem kleinen Schulraum anlangte. Der alte Pater N'Gome läutete eine blecherne Glocke über der Tür. Ein gutes Dutzend Kinder aller Altersgruppen drängelte sich krakelnd und lachend in die Schule.
Sie hasste Pater N'Gome, der nicht das Geringste davon ahnte. Hätte Anique Gelegenheit dazu gehabt, hätte sie den alten Priester liebend gern umgebracht. So stark war ihr Hass.
„Hereinspaziert“, rief er fröhlich, „Mach kein so finsteres Gesicht, Anique, so schlimm ist die Schule doch auch nicht.“
Das Mädchen schluckte, als ob ihr ein Kloß im Hals steckengeblieben wäre.
„Ich kann heut nicht zur Schule, Pater“, stieß sie hervor. Der grauhaarige Priester runzelte die Stirn. „Nanu, wieso denn das? Du bist doch nicht etwa krank, mein Kind?“
„Ich muss meiner Mutter heute beim Sorghum-Mahlen helfen“, unterbrach ihn Anique mit einem Ton, der eine Spur zu eisig klang. „Sie haben es jetzt gehört und damit Schluss. Lassen Sie mich in Ruhe!“
„So, davon hat mir deine Mutter gar nichts gesagt, als sie gestern in der Messe war.“ Pater N'Gome schob die Brille zurecht. Etwas machte ihn stutzig. Das war nicht die Anique, die er kannte. „Na gut“, nickte er, „Wenn das so ist.“
Aniques Gesicht verzerrte sich: „Das ist SO!“ Ob er etwas gemerkt hatte? Ihr war es egal. Alles war ihr letztlich egal. Was zählte, war allein ihr Vorhaben.
Pater N'Gome blickte dem Mädchen nach. Eine dunkle Vorahnung legte sich über seine Gedanken - erst versagte sein Funkgerät und nun wurden die Kinder seltsam. Ein Schatten zog herauf...
*
Mit dem alles übertönenden Röhren waren ebenfalls die rasenden Schmerzen zurückgekommen. Doch diesmal hatten sie nur sekundenlang angehalten, um etwas anderem Platz zu machen - einer verschwörerisch flüsternden Stimme, einer lockenden Stimme, die Santiago Cabaral zuraunte näher zukommen. Die Stimme kroch in seinen Verstand, zwängte sich in seinen Willen, umschmeichelte und streichelte ihn. Santiago schlug um sich. Er war nicht länger Herr seiner Sinne. Sein Körper wurde aufgepeitscht, gegen das zähe Gesträuch geworfen, das ihm ein Fortkommen verwehren wollte. Unnatürliche Kräfte, die nicht die seinen waren, drängten ihn weiter. Rücksichtslos riss er Blätter und Zweige auseinander, drückte sie beiseite und zwängte sich durch die entstandenen Lücken. Er achtete nicht auf Lianen, die sich in seinen Haaren verfingen, auf Äste, die ihm ins Gesicht schnellten und die nackten Arme zerkratzten. Die unbekannte, unbarmherzige Macht trieb ihn vorwärts.
Weiter und weiter in das feuchtdampfende Grün hinein! Bei jedem Schritt schmatzte es. Die Schuhe saugten sich fest, mussten mit Gewalt losgerissen werden. Tiefer und tiefer hinein in den sumpfigen Morast.
Vorwärts ging es, einem ungewissen Ziel entgegen - einem Ziel, das irgendwo vor ihm lag. Dorthin musste er. Was erwartete ihn?
Der flüsternde Schatten lockte. Er lauerte in der Ferne und dirigierte den Besessenen wie mit unsichtbaren Fäden.
Der Boden wurde zusehends sumpfiger. Kleine Pfützen mit wuchernder Vegetation. Es roch nach Fäulnis und brackigem Wasser. Wolken von Mücken und Moskitos stoben umher, wurden dichter und aggressiver.
Santiago konnte seine Füße nicht mehr vom saugenden Untergrund lösen. Knietief stand er im gurgelnden Wasser. Mit aller Kraft zog er sich an den bizarr geformten Luftwurzeln eines Urwaldriesen hoch. Bläulich traten die Adern auf seiner Stirn hervor. Dunkle Flecken bildeten sich auf seinem Hemd. Die Rinde der Wurzeln schnitt in seine aufgerissenen Hände. Wie in Zeitlupe glitten die Wurzeln durch seine Finger. Er fiel nach hinten - direkt in das Zentrum des Schlammlochs.
Dumpfe Laute entrangen sich seiner rauen Kehle. Panisch schlug er um sich. Ärger keimte in ihm auf, unbändige Wut. Er musste weiter. Nichts durfte ihn aufhalten.
Doch alle hektischen Bewegungen, alles Schreien und Toben blieb ohne Erfolg. Im Gegenteil - mit jedem unkontrollierten Umsichschlagen versank er schneller und schneller.
Die Hände öffneten und schlossen sich, suchten nach einem Halt, griffen ins Leere. Die Wurzeln waren inzwischen zu weit entfernt. Unerreichbar für ihn.
*
Pater N'Gome konnte sich nicht entschließen, in den Klassenraum zu gehen. Eine unbestimmte Unruhe hatte ihn ergriffen, die sich nicht verscheuchen ließ. Was stimmte nicht mit Anique? Sie war bisher stets ein schüchternes, wortkarges Mädchen gewesen. Nun wirkte sie verschlossen und kaltschnäuzig.
„Kein Wunder - bei diesen Eltern!“
Er hatte sich oftmals darüber geärgert, wie die Bolenges mit ihrer Tochter umsprangen. Vielleicht hätte er sich einmischen sollen. Ihr Verhalten war nicht untypisch für die Bewohner dieses abgelegnen Dorfs.
Was hatte das Mädchen behauptet? Es müsse seiner Mutter helfen, Sorghum zu mahlen? Warum hatte sie dann einen Beutel bei sich?
Der alte Priester wurde schlagartig hellwach. Er stürzte in den Klassenraum, sagte, die Kinder sollten das Lied von 'Maitre Jacque' auf ihre Tafeln schreiben - er wäre sofort wieder zurück - gab einem der älteren Jungen die Aufsicht und eilte die staubige Straße hinab.
Von Anique fehlte jede Spur. Roger N'Gome lief in die Richtung, in der das Mädchen wohnte. Er wollte schon die Tür der Hütte der Bolenges aufreißen, um hineinzugehen und zu fragen, aber dann kam er sich auf einmal lächerlich vor.
Was, wenn er Gespenster sah? Er würde die Bolenges nur unnötig ängstigen. Kurz entschlossen drehte er sich um. Er rannte zurück zum Dorfplatz und an der Missionsstation vorbei. Einige vor ihren Hütten sitzende, Hirse mahlende Frauen blickten ihm fragend nach.
„Oh HERR“, schnaufte er, „ich werde für solche Aufregungen zu alt.“
Weiter vorn hatte er Aniques buntes Kleid erkannt. Das Mädchen schien etwas bemerkt zu haben, denn im nächsten Augenblick war sie wie vom Erdboden verschluckt.
Stirnrunzelnd blickte Pater N'Gome um sich. Von dem Mädchen war nichts zu sehen. Er befand sich in einer der typischen Gassen des Dorfs. Irgendwo bellte ein Hund in die Morgensonne. Der Priester stützte die Hände auf die Knie und versuchte, wieder zu Atem zu kommen.
„Anique, was soll das? Wo bist du?“
Die Gasse blieb menschenleer. Möglicherweise war er ein alter Narr und begann schon Dinge zu sehen, die es gar nicht gab. Das Mädchen mochte wohl selber wissen, was es tat. Alt genug dafür war Anique schließlich. Zwar plagte ihn das schlechte Gewissen und am liebsten wäre er noch einmal zu den Bolenges gegangen, aber er ließ es sein. Schon allein deshalb, weil er wusste, was Aniques Eltern mit dem Mädchen anstellen würden. So sehr er sich jedoch bemühte - Anique und ihr eigenartiges Verhalten gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Den ganzen folgenden Vormittag musste er an sie denken. Er beendete die Schule an diesem Tag recht früh und grübelte vor sich hin. Er wurde das Gefühl nicht los, dass irgendetwas Schlimmes in der Luft lag und seinen dunklen Schatten voraus warf.
*
Floyd Maloy erwachte aus seiner Erstarrung. Nichts deutete darauf hin, welchen Weg sein Freund eingeschlagen hatte. Hinter den flüchtenden Trägern und Santiago Cabaral hatte sich die Wand aus grüner Vegetation wieder geschlossen. Floyd musste sich auf seinen Orientierungssinn verlassen.
Er arbeitete sich voran. Mit jedem Hieb der Machete fluchte er über die feigen Einheimischen, die ihn und die Ausrüstung im Stich gelassen hatten. Aber waren sie wirklich feige? War das, was sie eben erlebt hatten, nicht dazu angetan, Hals über Kopf die Flucht zu ergreifen?
Der Sumpf begann.
Floyd schlug sich gegen die Wange und erwischte ein aufdringliches Insekt. Dann sah er Santiago Cabaral. „Nicht bewegen!“ schrie er entsetzt, „Verdammt, du musst ruhig bleiben!“
Schimpfend kletterte er über die freischwingenden, rutschigen Luftwurzeln und versuchte sich zu Santiago hinabzubeugen.
„Hier! Nimm meine Hand, damit ich dich 'rausziehen kann!“
Santiagos Augen schienen Blitze zu verschleudern. Schaum quoll ihm aus dem Mund. Floyd bückte sich tiefer. Santiago Cabaral knurrte wie ein gereiztes, wildes Tier und - biss zu.
Gottlob erwischte er nur Floyds Ärmel mit den Zähnen.
Seine muskelbepackten Arme schnellten nach oben. Die Finger krallten sich in Maloys Oberarm. Ein Griff wie ein Schraubstock. Floyd Maloy schrie vor Schmerz auf.
Nein, der Freund hatte nicht nach ihm gepackt, um sich herausziehen zu lassen. Er wollte seinen Retter mit sich in den Tod reißen!
Maloy biss die Zähne zusammen. Santiagos Fingernägel krallten blutige Kratzer in seinen Arm. Er erwischte Santiago am Hemdkragen, stemmte sich hoch. Langsam wuchs Santiagos Körper aus dem saugenden Morast empor.
Da - wie ein Peitschenhieb raste das Röhren heran. Um ein Haar hätte Floyd die Balance verloren. Das durchdringende Crescendo hämmerte gegen Maloys Schädel, fand ein dumpfes Echo in Santiagos Kehle.
Das Entsetzen verdoppelte Floyds Kräfte. Es ging jetzt auch um sein Leben. Jede Faser seines Körpers war zum Zerreißen gespannt. Schmatzend gab der Sumpf Santiago Cabaral frei.
Floyd konnte seine verkrampfte Hand lösen.
Kurzerhand schlug er zu. Gewissensbisse verspürte er dabei keine. Santiago hörte abrupt auf, um sich zu schlagen. Schlaff hing er in Floyds Griff, der ihn vollends aufs Trockene zerrte.
Maloys Atem ging keuchend. Sterne tanzten vor seinen Augen, verwandelten sich in feurige, rasend schnell drehende Räder. Floyd drohte zu stürzen. Doch Floyd Maloy war kein Schwächling. Relativ schnell konnte er den Schwindel verscheuchen.
Ein kreischender Laut kroch über die Wildnis hinweg. Es klang wütend. Dann setzte das gewohnte Konzert der Natur wieder ein, als wäre nichts geschehen.
Maloy blickte auf seinen bewusstlosen Partner. Er verzog das Gesicht. Auch die geringste Verletzung konnte in diesem Dschungel lebensbedrohliche Folgen haben. Es gab jede Menge Insekten, die über offene Wunden ihr Gift in den Körper ausgießen konnten.
Floyd streifte das schwirrende Ungeziefer von Santiagos zerkratzten Armen. Der Globetrotter fischte ein kleines Fläschchen aus der Brusttasche seines Hemds und rieb die bloßen Körperstellen mit einer stinkenden Flüssigkeit ein. In dieser Umgebung war sie wichtiger als das tägliche Brot.
Santiago Cabaral kam allmählich zu sich.
Misstrauisch griff Floyd nach seinem Revolver. Er war auf alles gefasst. Auch wenn er seinem Freund nichts Böses wollte, würde er sein Leben so teuer wie möglich verteidigen, wenn Santiago von neuem durchdrehen würde.
Verständnislos blickte sich Santiago um. Er ruckte hoch. Mit geweiteten Augen stierte er auf den sie umschließenden Urwald. „Er verhält sich ruhig“, murmelte er brüchig, „Floyd, wir müssen verschwinden. Hauen wir ab, ehe es zu spät ist, ehe die nächste Attacke beginnt.“
Floyd Maloy umschloss den Revolver fester.
„Du hast recht, Santiago, aber wir werden uns erst auf den Weg machen, wenn ich sicher bin, dass mir von dir keine Gefahr mehr droht.“
Santiago schüttelte traurig den Kopf: „Schade, dass du nicht begreifst, Floyd.“
„Vielleicht kannst du etwas dagegen tun?“
„Du weißt, dass da vor uns eine Gefahr lauert, über die wir nichts wissen. Es müssen seltsame Kräfte sein. Wahrscheinlich sind ihnen die vorangegangenen Expeditionen in die Falle gegangen. Ich weiß auch nicht warum, aber auf mich scheint die unbekannte Macht ein besonderes Auge geworfen zu haben. Die anderen Expeditionen müssen wesentlich näher gewesen sein, als es sie erwischte, sonst hätten wir etwas von ihnen entdeckt. Ich bin wohl empfänglicher als andere Menschen, ja, so muss es sein. Bei mir ging es schon los, noch bevor es für dich und die Träger gefährlich wurde...“
Floyd Maloy runzelte die Stirn.
Für ihn war Santiago Cabaral vom Sonnenstich oder einem Dschungelfieber erwischt worden. Doch diese Theorie stand auf schwachen Beinen, wie er zugeben musste. Hatte er doch selbst diese furchtbaren Laute vernommen, deren Ursprung im Ungewissen lag. Er konnte sich einfach nicht mehr länger den Tatsachen verschließen. Sollte Santiago nicht auch noch den letzten Rest seines strapazierten Verstands einbüßen, mussten sie die momentane Atempause nützen und den Rückzug antreten.
Entschlossen schob er den Revolver wieder zurück in den Schulterholster und erhob sich.
„Beeilen wir uns!“ entgegnete er knapp und blickte mit gemischten Gefühlen in die Runde. Im Augenblick geschah nichts Ungewöhnliches. Es stank nur fürchterlich. Noch ein weiterer Grund, diesen Ort schleunigst zu verlassen: Das sogenannte Sumpfgas. Es setzte sich aus Methan und Kohlendioxid zusammen und entstand im Schlamm durch Vergärung von Pflanzenteilen unter Mitwirkung von Bakterien. Bei längerem Aufenthalt in seinem Dunstkreis konnte es gesundheitsschädigende und sogar tödliche Wirkung haben.
Die Lichtung war leer, als sie sie erreichten. Nur die Packstücke lagen verstreut herum. Erst jetzt schien es Santiago bewusst zu werden, dass sie von den Trägern im Stich gelassen worden waren.