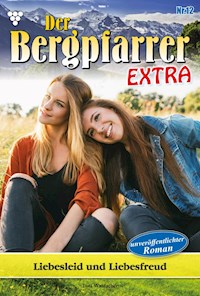
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergpfarrer Extra
- Sprache: Deutsch
Mit dem Bergpfarrer Sebastian Trenker hat der bekannte Heimatromanautor Toni Waidacher einen wahrhaft unverwechselbaren Charakter geschaffen. Sein größtes Lebenswerk ist die Romanserie, die er geschaffen hat. Seit Jahrzehnten entwickelt er die Romanfigur, die ihm ans Herz gewachsen ist, kontinuierlich weiter. "Der Bergpfarrer" wurde nicht von ungefähr in zwei erfolgreichen TV-Spielfilmen im ZDF zur Hauptsendezeit ausgestrahlt mit jeweils 6 Millionen erreichten Zuschauern. Wundervolle, Familienromane die die Herzen aller höherschlagen lassen. Die siebenundzwanzigjährige Miriam Dippold ließ ihren prüfenden Blick über die Sonnenterrasse des kleinen Lokals, das sie am Achsteinsee zusammen mit ihrer Schwester Sandra betrieb, schweifen. Es war Anfang Mai und die Badesaison hatte noch nicht begonnen, dennoch hatten sich schon die ersten Urlauber in St. Johann eingefunden. Zumeist handelte es sich um Paare, die keine schulpflichtigen Kinder hatten und Leute, die außerhalb der Hauptsaison Ruhe und Beschaulichkeit suchten. Miriam war zufrieden. Die Tische und Stühle standen in Reih und Glied, und jeder Tisch war mit einem bunten Sonnenschirm bestückt. Die Siebenundzwanzigjährige hob den Blick ein wenig und ließ ihn über den See schweifen. Die Badeinsel war schon verankert worden, die kleinen Geschäfte, Cafés, Wirtshäuser und Eisdielen entlang der Uferpromenade hatten geöffnet und warteten auf Gäste. Der Campingplatz, den ein Zaun von der Liegewiese abgrenzte, war – abgesehen von einigen Wohnwagen, die einen Dauerstandplatz innehatten –, noch verwaist. An den Bootsanlegestellen, die ein ganzes Stück vom Badestand entfernt waren, dümpelten einige mit Planen abgedeckte Motor- und Segelboote. Es war offensichtlich, dass die Hauptsaison noch nicht begonnen hatte. Auf der anderen Seite des Sees und auch an seinem nördlichen Ende erhoben sich bewaldete Berge. Dahinter reckten sich die kahlen Felsen des Hochgebirges zum ungetrübt blauen Himmel, der sich von einem Horizont zum anderen über dem Wachnertal spannte. Die Sonne hatte ihren höchsten Stand erreicht und die Schatten waren kurz. In dem kleinen Lokal hörte Miriam ihre Schwester Sandra hantieren. Sie riss ihren Blick von der Idylle, die der See und die Berge vermittelten, los und ging in den Gastraum, der lediglich dem Tresen, zwei Tischen und insgesamt acht Stühlen Platz bot. Hinter der Theke war eine Tür, die in eine Küche führte, die so klein war, dass man sich in ihr kaum umdrehen konnte. Aber da die Schwestern in ihrem Lokal nur kalte und warme Getränke anboten, war der vorhandene Platz ausreichend. Sandra stellte gespülte Gläser in das Regal hinter dem Tresen, dessen Rückwand aus einem Spiegel bestand, der den gesamten Raum optisch vergrößerte. Sie und Miriam glichen sich fast wie Zwillinge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Bergpfarrer Extra – 12 –Liebesleid und Liebesfreud
Toni Waidacher
Die siebenundzwanzigjährige Miriam Dippold ließ ihren prüfenden Blick über die Sonnenterrasse des kleinen Lokals, das sie am Achsteinsee zusammen mit ihrer Schwester Sandra betrieb, schweifen.
Es war Anfang Mai und die Badesaison hatte noch nicht begonnen, dennoch hatten sich schon die ersten Urlauber in St. Johann eingefunden. Zumeist handelte es sich um Paare, die keine schulpflichtigen Kinder hatten und Leute, die außerhalb der Hauptsaison Ruhe und Beschaulichkeit suchten.
Miriam war zufrieden. Die Tische und Stühle standen in Reih und Glied, und jeder Tisch war mit einem bunten Sonnenschirm bestückt.
Die Siebenundzwanzigjährige hob den Blick ein wenig und ließ ihn über den See schweifen. Die Badeinsel war schon verankert worden, die kleinen Geschäfte, Cafés, Wirtshäuser und Eisdielen entlang der Uferpromenade hatten geöffnet und warteten auf Gäste. Der Campingplatz, den ein Zaun von der Liegewiese abgrenzte, war – abgesehen von einigen Wohnwagen, die einen Dauerstandplatz innehatten –, noch verwaist. An den Bootsanlegestellen, die ein ganzes Stück vom Badestand entfernt waren, dümpelten einige mit Planen abgedeckte Motor- und Segelboote.
Es war offensichtlich, dass die Hauptsaison noch nicht begonnen hatte.
Auf der anderen Seite des Sees und auch an seinem nördlichen Ende erhoben sich bewaldete Berge. Dahinter reckten sich die kahlen Felsen des Hochgebirges zum ungetrübt blauen Himmel, der sich von einem Horizont zum anderen über dem Wachnertal spannte.
Die Sonne hatte ihren höchsten Stand erreicht und die Schatten waren kurz. In dem kleinen Lokal hörte Miriam ihre Schwester Sandra hantieren. Sie riss ihren Blick von der Idylle, die der See und die Berge vermittelten, los und ging in den Gastraum, der lediglich dem Tresen, zwei Tischen und insgesamt acht Stühlen Platz bot. Hinter der Theke war eine Tür, die in eine Küche führte, die so klein war, dass man sich in ihr kaum umdrehen konnte. Aber da die Schwestern in ihrem Lokal nur kalte und warme Getränke anboten, war der vorhandene Platz ausreichend.
Sandra stellte gespülte Gläser in das Regal hinter dem Tresen, dessen Rückwand aus einem Spiegel bestand, der den gesamten Raum optisch vergrößerte. Sie und Miriam glichen sich fast wie Zwillinge. Beide waren mittelgroß, schlank, blondhaarig und blauäugig.
Sandra war allerdings ein Jahr jünger als Miriam. »Jetzt können die ersten Gäste kommen«, empfing sie ihre Schwester und musterte sie eindringlich. Ihr entgingen nicht der schwermütige Ausdruck in Miriams Augen und der herbe Zug um ihren Mund. »Dennis hat immer noch nicht angerufen, wie?«, fragte sie.
Miriam ließ sich an einem der Tische nieder und schüttelte den Kopf. »Nein. Er hat mir auch nicht verraten, aus welchem Grund er nach München gefahren ist.« Sie seufzte. »Er ist in den vergangenen vier Wochen immer zurückhaltender geworden. Ich kann mich des Eindrucks net erwehren, dass er sich mehr und mehr von mir zurückzieht, und ich hab’ mich schon gefragt, ob’s vielleicht jemand gibt, der ihm mehr bedeutet als ich.«
»Du sprichst von einer anderen Frau?«
»Irgendetwas muss es ja schließlich sein. Seine Gefühle mir gegenüber sind längst nimmer die, die sie einmal waren.«
»Das glaub’ ich net«, murmelte Sandra. »Ich denk’, dass du das alles ein bissel überbewertest. Man ist halt net jeden Tag gleich. Vielleicht gibt’s bei ihm daheim Probleme, oder an seinem Arbeitsplatz. Hast du net versucht, dahinterzukommen, was ihn verändert haben könnt’?«
»Ich hab’ ihn drauf angesprochen.« Miriam lachte bitter auf. »Und das net nur einmal. Er weicht mir aus, oder behauptet einfach, dass nix wär’. Aber ich kenn’ ihn. Da ist sehr wohl was, das ihn belastet. Er scheut sich nur, es mir zu sagen. Mich aber macht das nervlich fertig.«
»Dann können wir uns ja die Hand geben«, erklärte Sandra und setzte sich zu ihrer Schwester an den Tisch. Ein Lächeln umspielte für einen Moment ihren Mund. »Ich wüsst’ eine Bezeichnung für uns zwei: Die unglücklichen Schwestern.«
Das Lächeln war wieder erloschen und Sandra legte ihre Hand auf die Miriams. »Der Dennis wird wieder, Schwester. Der liebt dich wirklich. Und wenn er sich grad in einem Stimmungstief befindet, dann solltest du das net unbedingt auf dich beziehen. Es gibt Dinge im Leben, mit denen man allein fertig werden muss. Vielleicht befindet sich Dennis momentan in einer solchen Situation. Irgendwann spricht er wahrscheinlich von sich aus drüber.« Sie ließ diesen Worten eine kurze Pause folgen, atmete schließlich tief durch und fuhr fort: »Bei mir schaut das schon anders aus. Ich bin in einen Kerl verliebt, der nix von mir wissen will, weil er die Donhauser-Katharina liebt. Glaub’s mir, Miriam, nix ist schlimmer als eine unerfüllte Liebe. Das nagt und frisst in dir, geht mit dir am Abend schlafen und steht mit dir am Morgen wieder auf.«
»Davon solltest du dich langsam lösen«, riet Miriam. »Der Alexander hat dir nie irgendwelche Hoffnungen gemacht. Wahrscheinlich weiß er net mal, dass du ihn liebst.«
»Gezeigt hab’ ich’s ihm bei jeder Gelegenheit. Entweder will er’s net merken, oder er ist blind.«
»Blind vor Liebe – für Katharina. Damit wirst du dich abfinden müssen, Schwester.«
»Das ist net so einfach«, sagte Sandra. »Es hat nämlich eine Zeit gegeben, da hat mir der Alex schöne Augen gemacht und ich war voller Hoffnung, dass irgendwann mehr draus wird. Doch dann ist die Katharina gekommen …«
»… und hat dem Alexander das Herz gestohlen. Akzeptier’s, Schwester. Die beiden lieben sich. Du wirst daran nix mehr ändern können. Gönn’ den beiden ihre Liebe und find’ dich einfach damit ab.«
»Mir wird schon gar nix anderes übrig bleiben. Aber es ist schwer – sehr schwer.«
Miriam erhob sich. »Komm’ her, Schwester, und lass dich in die Arme nehmen. Solang wir zwei zusammenhalten, ist alles halb so schwer. Geteiltes Leid ist halbes Leid.«
Sandra erhob sich, und dann lagen sich die Schwestern kurze Zeit in den Armen.
»Das tut gut«, murmelte Sandra mit Tränen der Rührung in den Augen.
*
Pfarrer Trenker hatte die Maiandacht beendet und kehrte ins Pfarrhaus zurück. »Sie werden schon erwartet, Hochwürden«, empfing ihn Sophie Tappert. »Der Herr Deininger und sein Vater sind da. Ich hab’ sie ins Wohnzimmer gebeten.«
»Danke, Frau Tappert. Ich glaub’, ich weiß, was die beiden zu mir führt.« Sebastian lächelte. Es war nicht einfach gewesen, Jürgen Deininger und seinen Vater, den neunundsiebzigjährigen und sehr autoritären Michael P. Deininger, zu versöhnen.
Er betrat das Wohnzimmer. Jürgen und sein Vater erhoben sich und der Bergpfarrer begrüßte sie mit Handschlag. »Bitte, nehmen S’ wieder Platz«, sagte Sebastian dann und schaute Jürgens Vater an. »Ich denk’, Sie kommen, um sich von mir zu verabschieden, Herr Deininger, weil S’ wieder nach Landshut zurückkehren.«
»So ist es, Herr Pfarrer«, antwortete Michael, als sie wieder saßen. »Ich würde zwar gern noch ein paar Tage bleiben, aber es gilt in Landshut einige Dinge zu regeln, die ich nicht auf die lange Bank schieben will.«
Sebastian schoss Jürgen einen fragenden Blick zu und sah diesen vielsagend lächeln. Er wandte sich wieder an Michael. »Sie werden sich doch net etwa entschlossen haben, sich aus der GmbH zurückzuziehen, Herr Deininger?«
Jetzt lächelte der alte Deininger und erwiderte: »Doch, habe ich. Und noch viel mehr, Herr Pfarrer. Ja, ich steige aus der GmbH aus und räume meinen Platz einem jungen, aufstrebenden Mann – namens Philipp. Und dann kehre ich nach St. Johann zurück und verbringe hier meinen Lebensabend.«
Sebastian war verblüfft. »Das wollen Sie wirklich, Herr Deininger?«, entfuhr es ihm.
Michael P. Deininger nickte nachdrücklich.
Jürgen Deininger sagte: »Ja, so hat sich mein Vater entschieden. Wir werden die GmbH neu ordnen. Paul und ich werden als stille Gesellschafter in das Unternehmen einsteigen, Philipp als Gesellschafter und Gesellschafter-Geschäftsführer. Das heißt im Klartext, dass er die Stelle seines Großvaters einnehmen wird.«
»Das freut mich aber«, stieß Sebastian hervor. »Ich hab’ nämlich schon befürchtet, dass Sie sich nie einigen und am Ende vielleicht sogar wieder miteinander verkrachen werden.«
»Ich habe eingesehen, dass es so nicht weitergehen kann«, erklärte Michael. »Die Geschäftspraktiken, nach denen ich gearbeitet und die Gesellschaft geführt habe, sind nicht mehr zeitgemäß. Umstellen oder ändern will ich mich in meinem Alter aber nicht mehr. Ich habe, bevor ich mich endgültig entschieden habe, mit der Sieglinde telefoniert, und sie hat mich zu meinem Entschluss ermutigt. Wir werden hier in St. Johann noch ein paar schöne Jahre verleben.«
»Wir?« Einen Moment lang schien Sebastian nicht zu verstehen, doch dann glitt der Schimmer des Begreifens über sein Gesicht. »Die Frau Baldauf zieht also auch mit nach St. Johann«, sagte er, und es war keine Frage, sondern eine Feststellung.
»So ist es«, versetzte Michael und grinste. »Ich brauche ja jemand, der auf mich achtet. Schließlich bin ich nicht mehr der Jüngste.«
»Ich verstehe«, versetzte Sebastian lächelnd. »Haben S’ denn schon eine Wohnung?«
»Mein Sohn Jürgen und die Katrin werden bald in ihr neu gebautes Haus einziehen können. Ich übernehme dann ihre Wohnung auf dem Moserhof. Die Tanja Moser ist einverstanden. Selbst wenn sie heiraten und der Harald Hohenegger bei ihr einziehen sollte, würde das Bauernhaus reichen.«
»Das ist ja fabelhaft«, freute sich Sebastian. »Wann ziehen S’ denn her?«, fragte er dann.
»Sobald in Landshut alles geregelt ist.«
Im Flur läutete das Telefon und gleich darauf schaute Frau Tappert zur Tür herein. »Es ist der Dennis Meier, Hochwürden. Reden S’ gleich mit ihm, oder soll ich ihn bitten, später noch einmal anzurufen.«
»Sagen S’ ihm, Frau Tappert, dass ich ihn zurückruf’«, gab Sebastian zu verstehen.
»Mach’ ich«, kam es von der Haushälterin, sie zog ihren Kopf zurück und schloss die Tür wieder.
»Wir wollen Sie eh nicht länger aufhalten, Sebastian«, erklärte Jürgen. »Papa wollte sich nur von Ihnen verabschieden und noch einmal Dankeschön sagen.«
Jürgen erhob sich und auch sein Vater stand auf.
»Dankschön – wofür?« Sebastian erhob sich ebenfalls.
»Dafür, dass Sie geholfen haben, die Familie Deininger wieder zu einen«, versetzte Michael und reichte Sebastian die Hand. »Ich bin echt froh, dass alles so gekommen ist. Leider haben wir zwei Jahre unseres Lebens verschenkt …«
Sebastian wusste, wie das gemeint war. »Sie werden diese zwei Jahre wieder hereinholen«, erwiderte er.
»Wir wollen zumindest nichts unversucht lassen, um das Versäumte wieder nachzuholen«, versicherte Michael.
Sebastian reichte auch Jürgen die Hand.
Dieser sagte: »Der Gerhard und die Helga werden auch noch vorbeikommen, um sich zu verabschieden, ebenso mein Bruder Vinzenz. Ich glaube, Sebastian, die Familie Deininger befindet sich auf einem guten Weg. Und Sie haben dabei eine wichtige Rolle gespielt. St. Johann hat uns Glück gebracht.«
»Ein bissel Pech ist aber auch im Spiel«, versetzte der Bergpfarrer lächelnd.
Jürgen schaute ihn fragend an. Seine linke Braue hob sich. »Inwiefern? Gibt’s was, das ich vielleicht nicht weiß?«
»Sie müssen sich nach einem neuen Braumeister umschauen, wenn der Philipp nach Landshut zurückkehrt, um den Platz seines Opas einzunehmen.«
»Ach so.« Jürgen lachte auf. »Nun ja«, fügte er dann hinzu, »eine Zeitlang packt das der Paul sicherlich ohne einen zweiten Mann. Wir werden die Stelle einfach ausschreiben, außerdem können wir die Arbeitsagentur einschalten. Und da die Deininger Bräu St. Johann keine schlechten Arbeitsbedingungen bietet, werden wir sicherlich jemand finden, der zu uns passt.«
»Da bin ich mir ganz sicher.« Sebastian geleitete seine beiden Besucher bis zur Haustür. »Grüßen S’ mir die Katrin und die Tanja, Jürgen«, sagte er zum Abschied und Jürgen sicherte es zu.
Sebastian ging ins Haus zurück und nahm das Telefon, ging damit ins Arbeitszimmer und klickte eine Nummer her, dann drückte er den grünen Verbindungsknopf. Nach zweimaligem Anläuten erklang eine dunkle Stimme: »Grüß Gott, Herr Pfarrer. Das ist aber schnell gegangen mit dem Rückruf.«
»Grüaß di, Dennis. Wo brennt’s? Ich hoff’, du wartest net mit einer schlechten Nachricht auf.«
»Nein, Herr Pfarrer. Ich hab’ Ihren Rat befolgt und hab’ mir einen Termin bei einem Spezialisten in München geben lassen. Heut’ war ich da.«
»Und? Spann mich doch net so auf die Folter, Dennis. Was ist herausgekommen?«
»Das weiß ich noch net, Herr Pfarrer. Das heißt, ich weiß es noch net genau. Aber der Professor hat gemeint, dass sich das Ergebnis der ersten Untersuchung net bestätigt hat. Der Schatten, der ursprünglich für einen Tumor gehalten worden ist, scheint verschwunden zu sein. Bevor eine endgültige Aussage getroffen werden kann, muss noch das Ergebnis der Blutuntersuchung ausgewertet werden. Der Professor wird mich unverzüglich telefonisch informieren, wie die Blutwerte ausgefallen sind. Wenn das Blutbild passt, meint er, kann ich aufatmen. Dann war die ursprüngliche Diagnose fehlerhaft.«
»Ich wünsch’ dir das so sehr, Dennis«, erklärte Sebastian.
»Ich bin guter Dinge, Herr Pfarrer. Wenn ich weiß, dass das alles ein Fehlalarm war, dann kann ich mich auch innerlich wieder davon freimachen. Ich war seit der Diagnose nämlich nimmer der, der ich vorher war. Das hat auch die Miriam zu spüren bekommen, denn ich hab’ ihr einfach nimmer so unbefangen begegnen können. Ständig hab’ ich den Gedanken mit mir herumgetragen, dass ich meinen dreißigsten Geburtstag nimmer erleben werd’. Das belastet einen schon sehr, Herr Pfarrer.«
»Du und die Miriam …«, sagte Sebastian, »… ihr habt doch deswegen kein Problem?«
»Ich glaub’, ich hab’ sie ziemlich vernachlässigt, nachdem ich nur noch daran denken konnt’, dass mich der Tumor …« Dennis brach ab und atmete durch, denn völlig schien die Belastung noch immer nicht von ihm genommen worden zu sein. »Ach was, es wird schon wieder werden. Wir lieben uns ja, und wenn sich herausstellt, dass ich gesund bin und ich mein inneres Gleichgewicht wieder gefunden hab’, dann kann ich auch der Miriam wieder unbefangen begegnen, und ich werd’ ihr dann auch erzählen, was mir so sehr zugesetzt hat.«
»Halt’ mich bitte auf dem Laufenden, Dennis. Ich drück’ dir ganz fest die Daumen. Und kümmere dich mehr um dein Madel. Die Miriam hat’s net verdient, dass du sie einfach links liegen lässt. Aber ich kann dich schon verstehen. So eine Diagnose kann einen ganz schön erschüttern.«
»Es kam mir vor wie ein Todesurteil, Herr Pfarrer. Vielen Dank noch einmal für Ihren Rat, mir eine zweite Meinung einzuholen. Hätt’ ich’s net getan, wär’ ich wahrscheinlich verzweifelt. So hab’ ich wieder große Hoffnung.«
»Und ich hoff’ mir dir, Dennis.«
»Danke.« Dennis lachte auf. »Die Hoffnung stirbt zuletzt, Herr Pfarrer. Ich meld’ mich wieder bei Ihnen. Auf Wiedersehen.«
»Servus, Dennis, und – halt’ die Ohren steif …«
*
Tags darauf, es war um die Mittagszeit, fuhren vier Motorräder mit dröhnenden Motoren durch St. Johann. Die Lenker der schweren Maschinen waren von Kopf bis Fuß in Leder gekleidet und trugen Sturzhelme mit verdunkelten Visieren.
Alle, ob Einheimische oder Touristen, die sich auf der Hauptstraße befanden, blieben stehen und blickten dieser kleinen Invasion von schweren Maschinen hinterher.
Sie durchquerten den Ort, die ineinander verschmelzenden Motorengeräusche, die die Maschinen produzierten, wurden leiser und leiser und versanken schließlich.
Maria Erbling, die zusammen mit zwei anderen Frauen vor dem kleinen Supermarkt stand und den neuesten Tratsch diskutierte, stieß entsetzt hervor: »Hoffentlich fallen jetzt net die Rocker bei uns ein. Da wär’s vorbei mit Ruhe und Beschaulichkeit. Das sind doch meistens junge Leut’, die dieser furchtbaren Musik … Wie nennt man sie doch gleich wieder? Heavy – Heavy …«
»Heavy Metal«, half ihr eine der Frauen auf die Sprünge.
»Genau, Heavy Metal!«, stieß die Erbling hervor. »Von dieser Musik kriegt unsereiner Kopfweh. Na ja, vielleicht sind diese Rocker nur durch St. Johann hindurch gefahren. Hoffen wir es. Solche Leut’ bringen nur Unfrieden in unsere Gemeinde.«





























