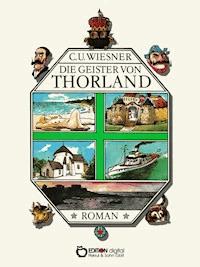7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hier ist vom Nebel die Rede, vom Nebel der Vergangenheit. Aus jenem Nebel der Vergangenheit tauchen die Gestalten der Kindheit des Autors auf, von denen C.U. Wiesner – das C.U. steht übrigens für Claus Ulrich -, sehr anschaulich und detailreich zu erzählen weiß. Zu diesen Gestalten gehört jenes Schneewittchen aus dem Titel dieser Memoiren. Aber wieso Schneewittchen? Dazu muss man sich in die Geschichte „Als mich der LIEBE zarter Flügel striff“ vertiefen. Diese lange Geschichte beginnt mit einem Exkurs über den Zeitpunkt der ersten gewissen Gefühle eines Menschenjungen und mit dem Geständnis des Autors, dass er mit sechs Jahren ein ausgemachter Stubenhocker war, „vielleicht weil mich größere Jungen zwei- oder dreimal verdroschen hatten, vielleicht auch weil ich, ohne dass mich jemand dazu angehalten, lange vor der Einschulung fließend lesen konnte.“ Im Zuge seiner Leseabenteuer kommt der Junge im Stadtanzeiger auch an den Fortsetzungsroman „Drei Nächte im Zirkus van Bevern“, in dem es vor Leidenschaften nur so brodelt. Die Lektüre brachte ihn zu der Erkennts, dass Liebe etwas Schönes, aber auch sehr Gefährliches sein müsse. Eine gewisse Vorsicht im Umgang mit der Weiblichkeit erschien ihm auf alle Fälle geboten. Viel später erzählt der Autor von einigen Tagen Heimaturlaub seines Onkels Oskar, um der Taufe seiner Tochter beizuwohnen. Die Erwachsenen, mindestens ein Dutzend an der Zahl, drängten sich bei Bier und Schnaps in dem winzigen Wohnzimmer zusammen, redeten lautstark durcheinander und landeten schließlich bei Witzen, deren Pointen die Frauen mit kreischendem Lachen belohnten. Ich hörte diesmal überhaupt nicht zu, nippte an meinem Glas verdünnter Pfirsichbowle und starrte wie ein Trottel das Mädchen mir gegenüber an, als wäre mir die Märchenfee leibhaftig erschienen. Dabei sah ich Annemarie, eine Nichte von Tante Trudchens Seite her, nicht zum ersten Mal. Aber früher hatte ich sie als dumme Gans betrachtet, die man als richtiger Junge links liegen ließ. Eine Märchenfee war sie natürlich nicht, eher schon das liebe Schneewittchen: weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz. Wenn sie meinen Blick auffing, schaute sie auf das Tischtuch. Und es beginnt eine zarte Romanze. Als letztes will ich noch berichten, was aus meinem Schneewittchen geworden ist. Auch hier übertraf die Banalität des Lebens jegliche Fantasie. Annemarie ging mit vierzehn von der Oberschule ab, wurde Fleischermamsell und heiratete den Klotzgesellen ihres Meisters.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
C. U. Wiesner
Machs gut Schneewittchen
Zehn Geschichten aus der Kinderzeit
ISBN 978-3-86394-418-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1982 im Eulenspiegel Verlag Berlin.
Titelbild: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Wie ich beinahe TERRORIST wurde
Kein Mensch wird als Gewalttäter geboren. So war auch ich zunächst ein braver, etwas moppelhaft anzusehender Knabe, bevor mich das Gefühl jäh angetanen Unrechts um ein Haar zu einer mordgierigen Bestie werden ließ. Dabei zählte ich nicht viel mehr als sieben Lenze und lebte vorwiegend bei meiner Großmutter, die sich redlich mühte, mich zu einem Prachtexemplar von deutschem Jungen zu erziehen. So prangte an unserer einzigen Stubentür eine bunte Europakarte. Darauf durfte ich nach den täglichen Wehrmachtsberichten aus den Reichsrundfunksendern mit selbst gebastelten Stecknadelfähnchen den jeweiligen Frontverlauf markieren. Im ersten Kriegsjahr war das noch eine aufregende Beschäftigung. Später, als die Fähnchen immer häufiger nach links zurückgesteckt werden mussten, hat meine Großmutter die Landkarte abgenommen und eines Tages trotz des warmen Frühlingswetters in unserem einzigen Kachelofen verbrannt. Als wir jedoch das Jahr 1940 schrieben, musste ich noch jeden Abend mein Kindergebetchen sprechen: „Lieber Gott, ich bitte dich: Ein gutes Kind lass werden mich! Gib mir Gesundheit und Verstand und schütze unser Vaterland! Schütz auch den Führer jeden Tag, dass ihm kein Leid geschehen mag! Amen!“
Dieses ersprießliche Gebet geriet erst aus der Mode, als uns die Sirenen des Fliegeralarms zur Schlafenszeit immer häufiger in den Luftschutzraum trieben.
Für mich stand felsenfest, dass ich einmal Jagdflieger, zumindest aber U-Boot-Kommandant werden würde. Dazu waren zwei Voraussetzungen nötig. Einmal durfte der Krieg nicht zu schnell beendet werden, indem sich etwa die feige Feindesbrut gar zu eilig ergeben sollte. Zum anderen musste man selber Mumm in den Knochen haben, ein ganzer Kerl sein, eben ein mutiger deutscher Junge. Selbst Siebenjährige ließen keine Gelegenheit aus, ihre Heldenneigung zu beweisen.
In der Nähe des Hauptbahnhofs befand sich eine Fußgängerbrücke. Man hatte sie errichtet, damit die Kleingärtner und Siedler zu ihren Grundstücken gelangen konnten und nicht ewig vor den Schranken warten mussten, die wegen rangierender Güterzüge fast immer geschlossen blieben. Vor Jahren hat man übrigens - ich vermute, auf Wunsch der heutigen Kleingärtner und Siedler - besagte Brücke abgerissen, und als ich dort neulich den Motor ausschaltete und mir eine Zigarette anzündete, ist mir das alles wieder eingefallen. Kam damals eine Lokomotive angefahren, so bestand die erste Mutprobe darin, unerschrocken auf der Brücke stehen zu bleiben und sich den schwarzen Qualm nebst den Funken um die Nase wehen zu lassen. Höherer Mut gehörte schon dazu, auch dann nicht fortzulaufen, wenn das schwarze, fauchende Ungetüm genau unter der Brücke anhielt. Rußgeschwärzte Gesichter, schmerzende Brandflecken und Brandlöcher im Pullover waren der sichtbare Beweis für unsere Kühnheit, die erst dann kläglich dahinschwand, wenn verständnislose Eltern zum unwürdigen, doch bewährten Rohrstock griffen.
Die höchste Mutprobe aber bestand darin, sich von einem rangierenden Güterzug überfahren zu lassen. Das war ganz einfach. Man brauchte nur ein paar Handvoll Schotter zwischen zwei Schwellen herauszuklauben und sich vor dem Herannahen des Zuges flach zwischen die Schienen zu pressen. Hier nun, fast stocke ich beim Berichten, gebrach es mir an jener letzten Kühnheit. Auch nach mehreren, immer höhnischer werdenden Aufforderungen der älteren Jungen machte ich Ausflüchte und traute mich schon gar nicht mehr recht auf die Straße. Bis mir ein Einfall kam, mit dem ich mich zum Helden des gesamten Bahnhofsviertels aufzuschwingen gedachte.
Ich hatte irgendwo läuten gehört, dass es zu ungeheuren Explosionen käme, wenn man Feuer und Wasser vermischt. Mein erster Laborversuch schien das zu bestätigen. Sobald ich gegen die rot glühende Tür des Kachelofens spuckte, ertönte ein warnendes Zischen. Ich wurde kühner, heizte heimlich unsere elektrische Kochplatte auf der dritten Stufe an und goss ein Viertellitermaß kalten Wasses in einem Zug darüber. Ich erschrak fast zu Tode, als das gemarterte Eisen förmlich aufkreischte und sich mit einer heißen Dampfwolke zur Wehr setzte.
Nun war ich mir meiner Sache sicher. Sollte ich nach dem heldenhaften Wagnis noch am Leben sein, so würde ich mich umgehend an die Westfront melden, um alle noch nicht in deutscher Hand befindlichen französischen Eisenbahnzüge umgehend in die Luft zu sprengen. Ich krakelte auf die ausgerissene Seite eines Schulheftes: „Wenn ich fale, fale ich für Deutschland. Weint nicht um mir. Meine Spilsachen sol mein kleiner bruder haben. Euer lieber Ulrich.“
In das Vorhaben hatte ich nur meinen besten Freund, den Malermeistersohn Hansi eingeweiht. Er sollte unterhalb der Brücke Zeuge der großen Tat werden und im Falle eines Opfertodes meinen Ruhm der Nachwelt künden.
Wir warteten lange vergeblich. Die Abenddämmerung zog herauf. Hansi wurde immer kleinlauter, denn sein strenger Vater pflegte die Hausaufgaben zu kontrollieren. Endlich zeigte sich eine Rangierlok willig und blieb mit dem nur schwach dampfenden Schlot genau vor dem Brückengeländer stehen. Die Ausführung fiel mir ungeahnt leicht, denn meine Blase drückte mich nach stundenlanger opferbereiter Enthaltsamkeit gehörig. Schon der erste Strahl fand sein Ziel, genauer gesagt, er traf ins Schwarze.
Der Gegner indessen zeigte nicht die geringste Wirkung. Er schnaubte heftig auf und fuhr unbeeindruckt dem Rangierberg zu. In namenloser Enttäuschung knöpfte ich den Hosenlatz zu. Ich war so sehr in finstere Gedanken versunken, dass ich den neuen Feind, der mir unerwartet in der Gestalt des Schrankenwärters Hampke erwuchs, beim Abstieg gar nicht bemerkte. Statt meines Freundes Hansi, der sich längst verkrümelt hatte, nahm mich am Fuße der Treppe der kräftige Mann mit der Bahnermütze in Empfang, zog mich an den Ohren in die Höhe, beschimpfte mich als Regimentsschwein und Pullerferkel und kündigte mir an, mich bei der Polizei zu melden. Ich heulte ein wenig, nicht so sehr aus Angst oder vor Schmerzen, mehr aus dem ohnmächtigen Gefühl heraus, diesem groben Unhold gegenüber nicht die durchaus edlen Motive meines Tuns artikulieren zu können.
Seitdem mied ich für längere Zeit die Bahnbrücke und ging fortan fast jeden Nachmittag brav an Großmutters Hand zur Tante Meta. Sie war eine gütige , immer bleiche Matrone, die selber kinderlos, dazu neigte, mich mit Süßigkeiten, Zinnsoldaten und selbst erdachten Märchen zu verwöhnen. Manchmal, noch nach vierzig Jahren, träume ich von ihr. Ich bin sehr krank, liege im fast abgedunkelten Zimmer. Tante Meta sitzt an meinem Bett, legt mir etwas angenehm Kühles auf die Stirn und singt mit ihrer wunderschönen klaren Stimme: „Schlaf, Herzenssöhnchen, mein Liebling bist du.“
Vielleicht rührte Tante Metas Bleichsucht von ihrer Tätigkeit her. Sie besaß eine Heißmangel, mit der sie mehr schlecht als recht ihren Lebensunterhalt verdiente. Tagaus, tagein stand sie hinter dem brummenden Ungeheuer. Ich durfte es nicht berühren, denn da waren ungewisse Geschichten in Umlauf - von Leuten, denen es die Hand weggerissen, ja den ganzen Arm mit durchgedreht hatte. Ich habe die friesumspannte Walze nur hier und da, wenn es keiner bemerkte, flüchtig angetippt. In meiner Vorstellung sah ich mich nämlich platt gewalzt zu einem bunten Tuch mit menschenähnlichen Umrissen am anderen Ende herauskommen und zusammengefaltet in einem Wäschekorb verschwinden.
Die Heißmangel, so dachte ich bis vor Kurzem, sei ein Relikt meiner Kindertage. Wir haben eine vollautomatische Waschmaschine, und die sogenannte große Wäsche holt der freundliche Herr Wegener vom Dienstleistungsbetrieb REWATEX ab und bringt sie uns nach vierzehn Tagen mit seinem Barkas frisch gebügelt in einem handlichen Paket zurück. Es würde mich nicht verwundern, wenn ich eines Tages in der Wochenpost lesen sollte: „Liebhaber sucht guterh. Heißmangel. Zahle Höchstpr.“ Und dann stellt er die ungeschlachte Maschine im Garten seines Wochenendgrundstücks auf und bepflanzt sie mit Petunien.
Als ich neulich meine Heimatstadt besuchte, kam ich an einem kleinen Laden vorüber. „Heißmangel“ stand an der Schaufensterscheibe. Ich warf einen Blick durch die geöffnete Ladentür. Da drehte sich summend, von einem Elektromotor getrieben, von einer Zeile blauer Gasflämmchen beheizt, die wohlbekannte friesumspannte Walze. Auf dem gusseisernen Rad stand in erhabenen Buchstaben: „Gebr. Stute Hannover“. Die ältere Dame hinter der Mangel besprenkelte ein Laken mit einer Wasserbüchse, bevor sie es einlegte, ein krumm gewordenes Mütterchen nahm das ausgespiene Wäschestück entgegen und faltete es zusammen. Ich war wieder zu Hause in meiner Kindheit.
Tante Metas Heißmangel brachte für mich dazumal das große Geschäft. Als Siebenjähriger wurde ich für alt und seriös genug befunden, mittwochs und sonnabends die fertige Wäsche bei den Kundinnen der Umgebung auszufahren. An diesen Tagen hatte nämlich der etatmäßige Wäschefahrer Werner sein Braunhemd anzulegen und bei den Hitlerpimpfen den Gleichschritt zu üben, den Lebenslauf des Führers auswendig herzusagen und das völkische Liedgut zu pflegen. Wenn der Wind günstig und die Ladentür offenstand, hörten wir den markigen Schlachtgesang herüberklingen: „Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg ...“
Meine Arbeit erschien mir nicht schwer. Die Wäschepakete, manchmal auch Körbe - aber die musste ich nicht allein heben - wurden auf einen gummibereiften Fahrradanhänger verladen, und dann gings ab heidi! im Dauerlauf um die Ecke. Und im selben Tempo füllte sich das kleine schweinslederne Portemonnaie, das mir Tante Meta zur Einschulung geschenkt hatte.
Die Einnahmen bezog ich gleich aus zwei Quellen. Einmal entlohnte mich die gute Heißmangelprinzipalin redlich mit einem Fünfziger pro Arbeitstag. Zum anderen lernte ich schon frühzeitig die köstlichen Segnungen eines Trinkgeldberufes kennen und schätzen, und ich verstehe bis heute nicht, warum ich später eine so bakschischfremde Laufbahn wie die eines Literaten eingeschlagen habe. So mancher Groschen wanderte in meine immer praller werdende Börse. Und der gute messingne Groschen mit den gekreuzten Ähren war in seinem güldenen Glanze noch das Sinnbild üppigen Vorkriegswohlstands, wenigstens so, wie er sich damals in den naiven Hirnen von Kindern und fleißigen Kleinbürgern verklärte - besonders nachdem der Führer, von einer Welt von Feinden dazu gezwungen, mit seinem Zauberstab das gelbe Messing zu Granatzündern verwandelt und das stumpfe Zehnpfennigstück aus verzinktem Eisen in Umlauf gesetzt hatte.
Damals aber hortete ich meinen glänzenden Kinderschatz und mehrte ihn durch etwas, von dem ich noch nicht wusste, dass man es angewandte Psychologie nennt. Ich hatte nämlich ziemlich bald spitzgekriegt, wie man die einzelnen Kunden am wirkungsvollsten begrüßte, wenn man auf Trinkgelder spannte. Bei Klavierlehrerin Haseloff zum Beispiel machte man einen tiefen Diener und verkündete mit bescheidener Stimme: „Guten Tag, Frau Klavierlehrerin. Meine Tante, Frau Schubotz, schickt Ihnen die Wäsche. Würden Sie so freundlich sein ... ich kann den Korb nicht alleine tragen.“ Fräulein Haseloff trug den Korb sogar ohne meine Hilfe die Treppe hinauf und flötete, immer wieder nach Luft schnappend: „Nein, was es noch für wohlerzogene Kinder gibt!“ Hier war mir außer einem Fünfziger sogar ein Himbeerbonbon sicher.
Anders sah es aus, wenn ich Mittelschullehrer Tetzner zu beliefern hatte. Sein Wäschepaket war nie allzu schwer. Trotzdem schaffte ich mir ein asthmatisches Keuchen an, bevor ich den Klingelknopf drückte. Erschien der etwas zu kurz geratene Mann mit der goldgeränderten Brille und dem korrekten Scheitel in der Tür, so legte ich ihm das Paket zu Füßen, um den rechten Arm hochreißen zu können, und krähte: „Heil Hitler, Volksgenosse! Ich bringe die Wäsche!“ Dann schmunzelte Volksgenosse Tetzner wohlgefällig, legte mir die Hand auf den Kopf, wie er es im „Völkischen Beobachter“ dem größten aller Deutschen abgeschaut hatte, und schnarrte mir zu: „Jawollja, immer in strammer Haltung, mein Junge!“ Allerdings gab er nie mehr als einen Groschen.
Allmählich wurde mein Vermögen so umfangreich, dass ich es zum größeren Teil ins Sparschwein umfüllen musste. Mein Vater, der finanziell gesehen ein ziemlich armer Teufel war, empfahl mir, auf ein Knabenfahrrad zu sparen. Er hätte es mir kaum kaufen können, denn es kostete im Kaufhaus Gentz am Steintorturm bare zweiundvierzig Mark.
Leider wurde aus diesem Plan vorerst nichts, denn an der anderen Ecke von Tante Metas Häuserblock lauerte ein ruchloser Versucher darauf, mir die sauer gewordenen Groschen aus der Tasche zu ziehen. Wenn ich heute so Worte wie Konsumzwang und Manipulation höre, muss ich immer an Kaufmann Sumpf denken. Dabei tue ich dem armseligen Tante-Emma-Laden und seinem Inhaber, den gewiss längst die Brandenburgische Friedhofserde deckt, zweifellos unrecht.
Worin denn bestand sein Verführungswerk? Es gab in seinem Laden zwei Artikel, die Kinderaugen zum Leuchten bringen mochten. Kaufmann Sumpf führte sechs Sorten köstlicher Brauselimonade: Himbeere (rot), Waldmeister (grün, heute sowieso verboten, da angeblich Krebs erzeugend, aber von köstlichem Wohlgeschmack), Apfel (gelblich), Apfelsine (orangefarben, was sonst?), Zitrone (farblos), Schokolade (braun, vielleicht ein Zugeständnis an das herrschende Regime, schmeckte übrigens scheußlich).
Die Brause wurde in 1/3-Liter-Flaschen verkauft. Die hatten noch einen eisernen Bügelverschluss mit Porzellanknopf und Gummimanschette und machten beim Öffnen vernehmlich „plupp !“.
Vor einigen Jahren habe ich mir auf einem polnischen Flohmarkt so eine Flasche gekauft, ziemlich teuer, aber zum ehrlichen Umtauschkurs. Nun könnte ich Kaufmann Sumpf zum Gedenken ab und zu mal „plupp“ machen, aber wer tut das schon? Damals. aber pluppte es bei mir mehrmals täglich. Jedes ,,Plupp“ kostete mich fünfundzwanzig Pfennige, aber wenn ich die Flasche gleich vor der Ladentür ausgetrunken hatte, belohnte mich Kaufmann Sumpf mit einem blanken Groschen für die leere Flasche. Er dachte übrigens gar nicht daran, mir Vorhaltungen zu machen wegen möglicher gesundheitlicher Schädigungen, wusste ich doch von meiner guten Tante Meta, dass Kinder vom allzu vielen Trinken Läuse in den Bauch bekämen. Aber so waren sie eben, diese Kleinkapitalisten, nur Profit, Profit, Profit ...
Bald begann mir Kaufmann Sumpf auf noch schnödere Art das Geld aus der Hosentasche zu ziehen, indem er mich in gütigem Onkelton auf seine Wundertüten aufmerksam machte. Ich war manipulierbar und ging ihm auf den Leim. Besagte Tüte kostete einen Groschen, und dafür, das muss man zugeben, wurde allerlei geboten. Zugesteckt war sie mit einer Nadel, die gleichzeitig einen Fingerring mit Glasperle festhielt. Was sollte ich als deutscher Junge mit weibischen Fingerringen anfangen? Ich verschenkte sie, wenn gerade keine anderen Jungen in Sicht waren, gönnerhaft an die Mädchen aus dem Häuserblock. Des Weiteren enthielt die Tüte eine kleinere Tüte mit bunt gefärbtem Puffreis. Den konnte man immerhin essen, schon als Äquivalent zu dem täglichen Liter Brause. Das eigentliche Wunder der Tüte bestand jedoch in irgendeiner billigen Schnurrpfeiferei, einem Schnickschnack, einem Firlefanz: Mal war es ein Würfel, mal eine Schleife oder ein Geduldspiel. Jedenfalls blieb der Gegenstand, mit dem man nie was Rechtes anzufangen wusste, stets unter der Erwartung. Von der aber lebte Kaufmann Sumpf, denn ich war nicht sein einziger Kunde. Übrigens nahm ich damals an, er fülle die Wundertüten eigenhändig. Ob es wirklich so war, wird heute kaum noch festzustellen sein.
Der Krieg nahm seinen Fortgang. Im Kreisblatt mehrten sich die Anzeigen mit dem schwarzen Eisernen Kreuz. Immer wieder las man, dass jemand in treuer Pflichterfüllung für Führer, Volk und Vaterland gefallen sei. Die Frauen gingen in stolzer Trauer einher, sahen aber verweint und gar nicht so stolz aus. Überhaupt wirkten die Leute etwas stiller als früher.
Ohne dass es einer so recht angekündigt hätte, wurden manche Dinge teurer. Mir wäre das freilich verborgen geblieben, hätten mich nicht Kaufmann Sumpf und Maxe Kuhtz sozusagen mit der Nase darauf gestoßen.
Maxe Kuhtz galt als ein Original unserer Stadt. Er verrichtete Botengänge und mit seinem Handwagen kleinere Lohnfuhren. Man erzählt von ihm, er sei da oben nicht ganz dicht gewesen, aber davon muss mich erst einer überzeugen. Er pflegte eine Kneipe zu betreten, und alsbald steckte ihm ein Stammgast einen Groschen zu und sagte: „Maxe, pfeif mal!“
Maxe ließ sich nicht lange nötigen. Sein Repertoire war recht einschichtig, er beherrschte nur eine einzige Melodie, die aber perfekt. Maxe pfiff den Militärmarsch „Preußens Gloria“. Ob wir den heutzutage schon wieder von unseren Blasorchestern hören können, weiß ich nicht. Wir Jungen sangen damals unseren eigenen Text darauf: „General von Ziethen lag im Bett mit seiner Frau Elisabeth. Sie lagen beide Arsch an Arsch und furzten den Radetzkymarsch ...“ Maxe Kuhtz also pfiff und pfiff und hörte nicht mehr auf. Bis es dem jeweiligen Kneiper zu bunt wurde. Dann langte er Maxe einen Groschen hin und knurrte: „Nu ist jut, Maxe!“ Worauf dieser beide Groschen dem Kneiper aushändigte, seinen Schnaps trank und das Restaurant verließ. Ich glaube übrigens nicht, dass der einfältige Bote die Fachliteratur über Chicago und Umgebung, über Al Capone und Konsorten studiert hat. Bei Maxe kam das mehr so von innen heraus und war unsagbar gutartiger. In gewisser Weise nahm er die Einstellung heutiger Unterhaltungskünstler vorweg: Es kam ihm nicht darauf an, wo und vor wem er auftrat - Hauptsache, die Gage stimmte. So konnte ihn ein beliebiger Halbwüchsiger auf offener Straße engagieren - Maxe pfiff eben für gutes Geld. Mein Freund Hansi und ich haben es selber ausprobiert. In die Kosten teilten wir uns. Ich zahlte den Groschen fürs Pfeifen, Hansi den fürs Aufhören.
Als wir gegen Ende des ersten Kriegsjahres anderen Jungen unseren Künstler vorführen wollten, bekamen wir eine herbe Abfuhr. Maxe betrachtete geringschätzig meinen Heißmangelgroschen, spuckte darauf, gab ihn mir zurück und knurrte: „Een Fumziger und ne Zijarre, sonst fang ick jar nicht erst an!“ So war Maxe Kuhtz unter die verabscheuungswürdigen Kriegsgewinnler gegangen, und nicht nur er. Als ich meinen Groschen auf den Ladentisch legte und von Kaufmann Sumpf eine Wundertüte erheischte, sagte er patzig: „Kost jetz zwanzig Fennje, wir ham nämlich Kriech.“
Das mit dem Krieg war mir bekannt, aber eine Verbindung zwischen diesem und der verteuerten Wundertüte vermochte ich zunächst nicht herzustellen. Der Führer hat gesagt, das deutsche Volk muss Opfer bringen für die heldenhaft kämpfenden Soldaten. Das wusste ich von meiner Großmutter. Auch dass er die Losung ausgegeben hat: „Kampf dem Verderb!“ Das wusste ich von Fräulein Schwartzlose, unserer Lehrerin. Die hatte uns das genauer erklärt: Jeder Teller Eintopf, den ein deutsches Kind nicht brav aufisst, bedeutet Verrat an der deutschen Volksgemeinschaft. Ich betrachtete Kaufmann Sumpf. Er hatte genauso ein Bärtchen wie der Führer, aber im Gegensatz zu dem eine spiegelblanke Glatze. Auch war die braune Uniform des Führers viel schöner als Kaufmann Sumpfs fleckiger brauner Kittel. Aber der Blick! Kaufmann Sumpf schaute genauso streng drein wie der Führer in der Wochenschau. Zögernd langte ich den zweiten Groschen aus meiner Schweinslederbörse. Das Geschäft und der Fahrradanhänger waren schließlich heute ganz gut gelaufen.
Draußen öffnete ich die Wundertüte. Sie enthielt einen hölzernen Würfel - und sonst nichts. Spornstreichs lief ich zurück in den Laden und krähte: „Herr Sumpf, Herr Su-umpf! Sie haben nicht mal Puffreis reingetan. Det is Beschiss!“
Kaufmann Sumpf glotzte mich an. Im Laden standen zwei Kundinnen, gemeinsame Kundinnen, denn ich belieferte sie mit Heißmangelwäsche. Die freundlichsten waren sie nicht, obwohl ich sie mit schallendem „Heil Hitler!“ zu begrüßen pflegte. Kaufmann Sumpf blickte auf die beiden Damen, heute würde ich sie als Zimtzicken bezeichnen. Sie schauten einander an und machten mit der Zunge jenes schmatzende Geräusch, das man so unzulänglich mit „Tz, tz, tz“ wiedergibt. Dies ermunterte den Ladeninhaber. Er kam auf mich zu, haute mir rechts und links eine runter, fügte in der Mitte noch eine hinzu, packte mich am Kragen und beförderte mich mit dem Rufe „Lass dir nicht noch mal bei mir blicken, du Lausewanst!“ vor die Ladentür.
Mir war merkwürdig taumlig zumute. In meinem Kopf summte es. Mir kamen die Tränen. Ich begann schniefend hochzuziehen. Es schmeckte so komisch. Als ich mit dem Handrücken über die Nase fuhr, war alles rot. Nur nicht so der Tante Meta und der Großmutter unter die Augen treten! In einem Hausflur presste ich das Taschentuch gegen die Nase, bis das Bluten aufhörte. Dann warf ich das Taschentuch weg. Bei der Heißmangel herrschte Hochbetrieb. Mein verstörtes Aussehen fiel keinem auf. Ich ging in die Küche, wusch mir die Nase und setzte mich auf einen Stuhl.
Meine Logik war glasklar: Der Führer ist gerecht. Kaufmann Sumpf ist ungerecht. Auch die Feinde sind ungerecht, denn sie wollen Deutschland verderben. Kaufmann Sumpf hat versucht, mich zu verderben. Also ist er ein Feind, denn ich bin ein deutscher Junge. Feinde muss man töten, also muss Kaufmann Sumpf sterben.
Wie aber sollte ich mein Urteil vollstrecken? Ich war ein halbes Pfund Hackfleisch, der Feind aber ein kräftiger Unhold. Das hatte das erste Treffen erwiesen. Vielleicht sollte ich ihm einfach die Schaufensterscheibe mit einem Stein einwerfen? Hier aber setzte eine andere Hemmung ein. Als ich noch sehr klein war, bin ich mit meinem Vater durch die Innenstadt gegangen. Da sind Männer in braunen Uniformen aus einem Auto gestiegen und haben mit Knüppeln eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Mein Vater hat mich auf den Arm genommen. Er hat so komisch gezittert und immerzu vor sich hin gemurmelt: „Diese Schweine, diese Schweine!“ Dann ist er mit mir in die Stehbierhalle von Bunke gelaufen und hat ganz viel Schnaps getrunken. Wie wir nach Hause gekommen sind, hat uns meine Mutter ganz schnell ins Bett gebracht, und ich durfte bei meinem Vater schlafen. Er hat mich ganz doll gedrückt und immer geweint. Schaufenster einschmeißen, das wusste ich schon damals, muss etwas ungeheuer Böses sein.
Meine Nase schmerzte noch heftig, als mich Großmutter an diesem Abend zudeckte, aber ich behielt mein Wundertütenerlebnis für mich. Die Großmutter schnarchte schon ein wenig, da sprang mich plötzlich der zündende Gedanke für meine Rachepläne an. Wenn ich Kaufmann Sumpf einfach umbrachte, kam er womöglich noch in den Himmel - wer kannte sich in solchen Fragen schon aus? - und durfte täglich die lieben Englein singen hören. Und was hatte ich davon?
Nein, das Schicksal sollte ihn härter treffen. Man muss ihm das Liebste nehmen, was er auf dieser Erde hatte, und das war unbestritten seine Frau. Selbst wenn Kunden im Laden waren, turtelte er mit dieser Dame herum, dass man schon gar nicht mehr wusste, was man als Siebenjähriger für ein Gesicht machen sollte. Mit honigsüßer Stimme sprach er zu ihr: „Mein Pusselchen, mein Schnudelchen“ und betatschte sie dauernd unter ihrem faltigen Doppelkinn. Dabei war Frau Sumpf alles andere als schön. Sie überragte als dürre Bohnenstange ihren Mann um Haupteslänge, watschelte wie eine Ente und hatte eine genauso scheppernde Stimme wie der Wecker meiner Großmutter. Dabei tat sie aber ungeheuer fein, und wenn sie wirklich mal im Laden mit bediente, verbesserte sie ständig meine Aussprache. Kurzum: Frau Sumpf war das geeignete Opfer meiner Rache. Diese aber musste sorgfältig geplant werden.
Da ich fast täglich in der Gegend herumstreunte, wusste ich, dass Schnudelchen jeden Donnerstagnachmittag in die Stadt fuhr. Sumpfs wohnten zwar nicht auf dem Lande, aber wenn man bei uns Stadt sagt, meint man noch heute die beiden rechtwinklig zueinander verlaufenden Hauptgeschäftsstraßen im Weichbild der historischen Neustadt. Was Frau Sumpf dort jeden Donnerstag zu suchen hatte, habe ich nie erfahren. Ich will ihr - schon ob des geschilderten Aussehens - nicht unterstellen, dass sie einen Liebhaber besuchte. Ich weiß auch nicht, ob sie Singestunde im Kirchenchor von St. Katharinen hatte oder gar Versammlung bei der NS-Frauenschaft, einer Organisation, über die ein literarischer Spottvogel nach dem Ende des Tausendjährigen Reiches schrieb: „Dem Führer unsre Mühe, dem Führer unsre Kraft. Wir sind die alten Kühe der NS-Frauenschaft.“ Ich wusste jedenfalls, dass Frau Sumpf zu ihrer Stadtfahrt stets die Weiße Linie der Straßenbahn benutzte, und zwar genau um 15 Uhr. Woher ich das so genau weiß? Natürlich hatte man mir noch keine Quarzuhr zur Einschulung geschenkt. Meine erste Uhr bekam ich mit neunzehn Jahren. Das Westgeld dafür haben meine Eltern zum Schwindelkurs eingetauscht. Meine genaue Zeitangabe entsprang einer einfachen Beobachtung. Kaufmann Sumpf öffnete pünktlich um 15 Uhr seine Ladentür für die Kundschaft. Donnerstags ließ er bei der Gelegenheit sein aufgedonnertes Pusselchen hinaus, drückte ihr einen vermutlich nach Fassgurken schmeckenden Schmatz auf den Mund, und Schnudelchen stöckelte eilig zu der etwa 100 Meter oberhalb des Eckladens liegenden Haltestelle. Fuhr die Weiße Linie dann am Laden vorüber, so warf Kaufmann Sumpf seiner Holden durchs Fenster eine Kusshand zu.
Ein echter Terrorist studiert die Gewohnheiten seiner Opfer, und man sieht, ich war ganz gut im Bilde. Mein Plan schien so genial wie einfach: Ich brauchte nur die Straßenbahn unmittelbar vor dem Sumpfschen Laden zum Entgleisen zu bringen, so fand nicht nur Pusselchen ein grausiges Ende - der Schläger im fleckigen Kittel musste auch noch die Katastrophe mit eigenen Augen ansehen.
Vielleicht sollte ich, bevor ich zum Attentat schreite, erklären, was es mit dem Phänomen der Weißen Linie auf sich hat. In meiner Heimatstadt führten die Straßenbahnlinien bis 1945 nicht, wie andernorts üblich, Nummern zur Unterscheidung, sondern Farben, die sie auf drehbaren Schildern oberhalb der Fahrerkabine zeigten. Es war ähnlich wie bei Kaufmann Sumpfs Brausesortiment. Es gab eine Rote, eine Gelbe, eine Blaue, eine Weiße und zeitweise auch eine Grüne Linie. Die Weiße sollte nach meinem Willen die Sumpfsche Todeslinie werden.
Wenn ich die Dinge heute so überschaue, so erschreckt es mich noch im Nachhinein. Mir kam nicht einmal der Gedanke, dass doch auch der Fahrer, die Schaffnerin und etliche unschuldige Fahrgäste zu den Opfern hätten zählen können. Darum begreife ich vielleicht als einziger Bürger unseres so friedlichen wie gutartigen Landes in vollem Umfang die Schrecken des internationalen Terrorismus. Damals war es mir - den vulgären Ausdruck kannte ich freilich noch nicht - scheißegal.
Der nächste Abschnitt der fahrplanmäßigen Strecke bot ohnehin seine Gefahren. Die Bahn überquerte die kesselförmige Erweiterung des Büttelhandfassgrabens. Der Überlieferung nach pflegte sich dort im Mittelalter der Scharfrichter, wenn er am nahen Galgen einen armen Sünder gehenkt hatte, die Hände zu waschen. Auf dem Eis des zugefrorenen Kessels tummelten sich im Winter die Kinder mit Schlittschuhen oder Holzpantinen, je nach dem sozialen Status. Ich habe dieses Eis nie betreten, denn von Tante Meta wusste ich, dass hundert Jahre zuvor ein durchgehendes Fuhrwerk in den Kessel gerast sei. Weder vom Fuhrmann noch vorn Wagen und den Pferden habe man jemals eine Spur gefunden. Leider stand es nicht in meiner Macht, die Bahn mit Frau Sumpf in den grausigen Kessel stürzen zu lassen.
Der von mir bestimmte Todesort lag etwa zweihundert Meter davor. Als sich, von der Haltestelle kommend, die Bahn der geballten Ladung näherte, war ich für Sekunden bereit, auf die Schienen zu springen, um das Unheil doch noch zu verhindern. Pure Feigheit hielt mich zurück.
Fünf Jahre später erlebte ich fast an derselben Stelle, was es heißt, Todesfurcht zu empfinden. Wir hatten im Frühjahr 1945 die noch immer umkämpfte Stadt verlassen müssen. Als wir, Vater, Mutter, Bruder und ein unechter Foxterrier zurückkehrten, unsere Habe auf einen Handwagen gepackt, war jene Büttelhandfassbrücke der einzig mögliche Zugang zu unserem inzwischen halb niedergebrannten Stadtviertel. Aber die Brücke bestand nur noch aus zwei einsamen Straßenbahnschienen, über die man ein paar Bretter und ausgehängte Türen gelegt hatte. Nachdem wir mit winzigen Zeitlupenschritten das andere Ufer erreicht hatten, troff uns der Angstschweiß aus allen Poren.
Heute ist der Kessel längst zugeschüttet. Eine breite Straße führt darüber. Es gibt keine Tante Meta mehr und auch keinen Kaufmann Sumpf. Bei aller Feindschaft wünsche ich ihm nachträglich, dass er seine Frau noch oft „Mein Pusselchen“ und „Mein Schnudelchen“ nennen durfte.
Wer einen Groschen aus Messing auf die Schienen legt, bringt keine Straßenbahn zum Entgleisen und keine dürre Kaufmannsfrau vom Leben zum Tode, genauso wenig, wie ein Bombenleger den gesetzmäßigen Lauf der Dinge ändert. Und ich bin ganz froh, dass ich das aus eigener Erfahrung sagen kann.
Wie meine Laufbahn als KLAVIERVIRTUOSE scheiterte
Man müsste Klavier spielen können, behauptete man vor einem Menschenalter, denn wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Was mögen das für rückständige Zeiten gewesen sein! Ein junger Mann von heute würde bei den meisten Mädchen als bleicher Spinner abblitzen, versuchte er, auf diese altmodische Art zu landen, es sei denn, er säße schön und blond wie der Franzose Richard Clayderman im weißen Frack am weißen Flügel und spielte Pour Adeline oder Song Of Joy. Aber wer klimpert sonst schon noch selber auf dem Piano herum, wo es doch viel bequemer ist, eine Platte aufzulegen oder den Rekorder einzuschalten? Im Zeitalter der wachsenden Spezialisierung überlässt man die Musik den professionellen Fachleuten, anstatt sich mit hausgemachter Stümperei abzugeben.
Was mich betrifft, so bin ich ein altmodischer Mensch und bedauere das Dahinsterben des Klavierspielens. Eingeweihte wissen, dass ich nicht von jenem Instrument rede, wie es Annerose Schmidt in internationalen Konzertsälen zu immer neuen Ehren führt. Ich meine jenes Klavier, das in einem Café stand. Drei würdige Herren, Violine, Cello, Piano, gaben dort nachmittags zu Mokka und Kirschtorte die Serenade von Toselli oder das Poem von Fibig, vertauschten nach dem Abendbrot den schwarzen Smoking mit der Lüsterjacke, die Streichinstrumente mit Saxofon und Schlagzeug und spielten zu gedämpftem Licht eine so leise, zärtliche Barmusik, dass man seiner Partnerin beim Tanzen nicht das Ohr abbeißen musste, um ihr mitzuteilen, dass man das erste Mal in dieser zauberhaften Stadt sei.
So was gab es, Ehrenwort! bei uns noch Mitte der sechziger Jahre, zum Beispiel im Bahnhofshotel zu Quedlinburg. Als die Nostalgiewelle trotz allen Hohngeschreis der Presse auch bei uns eindrang, vielleicht nicht so sehr die Seelen wie die Haushalte überspülte, hegte ich die heimliche Hoffnung, auch das Klavier mit seiner dezenten Barmusik würde wieder in unseren Breiten heimisch werden. Ein törichtes Hoffen, wie inzwischen jeder weiß.
Wäre ich nicht ein so faules und undiszipliniertes Kind gewesen, so könnte ich heute mich und die Meinen an den himmlischsten Gaben der Frau Musica laben. In meinem Zimmer stünde ein braunes, matt glänzendes Klavier mit messingnen Kerzenleuchtern. Und wenn mir so wäre, mitten in der Nacht, so setzte ich mich im Schlafanzug auf den harten Schemel, schlüge behutsam den Deckel auf und spielte mit versonnenem Lächeln die Mondscheinsonate.
Geboren bin ich in einer Eckkneipe, im letzten Monat der Weimarer Republik. Die Stammkunden nannten das Lokal den „Blauen Affen“, obwohl es eigentlich ganz anders hieß. Es verkehrten dort Arbeiter, Straßenbahner und Inhaber kleiner Läden, Kommunisten, Sozialdemokraten und parteilose Kleingärtner. Familienväter versoffen ihren Wochenlohn und Arbeitslose ihr Stempelgeld. Selbst der berüchtigte Zuhälter und Messerstecher Schmalte Brebeck trank ab und an seine Molle und seinen Korn, soll jedoch niemals randaliert haben.
Der „Blaue Affe“ muss eine mächtig verräucherte Stampe gewesen sein, hatte aber außer den herkömmlichen schlichten Getränken auch einiges zu bieten, nämlich Bockwurst mit Kartoffelsalat, Soleier und Buletten und nicht zuletzt das Klavierspiel meines Vaters. Das war nämlich das einzige, was ihm in dieser Kneipe Spaß machte. Als sehr jungen Mann hatte ihn der Rat der älteren Geschwister dazu verdammt, meiner Großmutter am Thresen mannhaft zur Seite zu stehen.
Mein Vater hat nie Klavierspielen gelernt, aber es ist noch heute so mit ihm: Er nimmt ein Instrument zur Hand, fingert ein bisschen daran herum, und schon entlockt er ihm zusammenhängende und durchaus melodisch klingende Töne. Im „Blauen Affen“ spielte er im Nu die allerneuesten Schlager: „In einer kleinen Konditorei ...“, „Schöner Gigolo, armer Gigolo ...“, „Adieu, du kleiner Gardeoffizier ...“, „Es war einmal ein Musikus ...“.
Die Schlager des Jahres 1935 hießen: „Regentropfen, die an dein Fenster klopfen ...“ und: „Du kannst nicht treu sein, nein, nein, das kannst du nicht ...“.
Man sagt mir nach, ich hätte neben Vaters Klavier gestanden und aus voller zweijähriger Kehle mitgesungen.
Es waren schlechte Zeiten für eine Arbeiterkneipe, deren Pächter von der Adlerbrauerei doch ziemlich ausgeräubert wurde. Die verlangte als Pacht vierzig Prozent vom Bierumsatz, wobei Vater natürlich das Bier nur von der Adlerbrauerei beziehen durfte, und das war fast noch schlechter als das, was man heute für gewöhnlich in den Kaufhallen meiner Heimatstadt in seinen Korb fischt.
Meine Mutter hat allerdings noch eine andere Version für den Exodus aus dem Blauen Affen anzubieten: Sie habe um ihr Kind gefürchtet. Einmal sei sie dazugekommen, wie ein betrunkener Stammgast an der Pinkelrinne stand, mit der Rechten sein Gerät bedienend, mit der Linken dem Kleinkind eine angebissene Bulette entgegenhaltend: „Na, Kleener, wiste ma abbeißen?“ Außerdem soll man mich mehrfach gesichtet haben, wie ich in Windeseile Likör- und Bierneigen leerte.
Ohne näher auf solche Legenden einzugehen, will ich nur mitteilen, dass sich meine Großmutter Ende 1935 ins Rentnerdasein zurückzog, während meine arbeitslosen Eltern von ihren letzten Ersparnissen eine mehr als bescheidene Zweizimmerwohnung in der Bahnhofsgegend mieteten. Vater bekam endlich eine dürftig bezahlte Stellung als Fürsorgearbeiter bei der Stadtverwaltung. Es reichte trotzdem nicht hin und nicht her. Großmutter sprang ein und nahm wenigstens einen Fresssack, nämlich mich, in Kost und Logis.