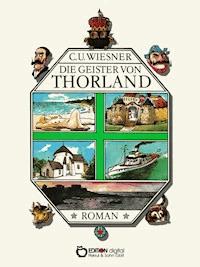6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein unglücklich verliebter junger Mann verabredet sich mit der Dame seines Herzens zum Schlittschuhlaufen, obwohl er noch nie solche Eisen unter den Sohlen gehabt hat … Ein paar neunmalkluge Männer machen eine bahnbrechende Erfindung, mit der man sich das Rauchen abgewöhnen könnte … In Leipzig, vor der Thomaskirche, steigt Johann Sebastian Bach von seinem Sockel, um mit ein paar Musikstudenten nächtlicherweile zu jazzen … In 25 Kurzgeschichten, zuvor schon in der Zeitschrift Eulenspiegel veröffentlicht, geschehen komische, skurrile, alberne und abgründige Dinge. Die Erstausgabe erschien 1974 im Eulenspiegel Verlag. Noch heute wundert sich der Autor, dass solche Texte wie Zitronen aus Kummersbach oder Spuk auf der Lichtung dem Zensor durch die Lappen gingen. Die verschwundene Partitur wurde übrigens zum Grundstoff für ein gleichnamiges Musical, das 1976 in Halle seine Uraufführung erlebte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
C. U. Wiesner
Die singende Lokomotive
25 Kurzgeschichten
ISBN 978-3-86394-396-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1974 im Eulenspiegel Verlag Berlin.
Titelbild: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Die singende Lokomotive
Es war einmal eine kleine Lokomotive. Die hatte man auf ihr Schmalspurgleis gehoben, als noch der Großherzog von Wolkenwieck regierte. Seitdem schleppte sie tagaus, tagein den Personenzug von Hoppenstedt nach Quarmbrück und von Quarmbrück nach Hoppenstedt. Sie beförderte Bauern und Soldaten, Landgendarmen und Arbeitslose, Schulkinder und Betrunkene, Drahthaarterrier und Hausierer, Gerichtsvollzieher und Mädchenheiminsassinnen, Waldarbeiter und Revolutionäre, Krankenschwestern und Jungingenieure, Schwarzfahrer und Grünschnäbel.
Früher war die Strecke links und rechts der Gleise eintönig gewesen - Felder, ein bisschen Wald und zwei Froschtümpel, höchstens noch die alte Schäferei von Ladenthin. Abwechslung gabs nur vor den beiden kleinen Bahnhöfen, wo jeweils ein Landweg die Schienen kreuzte. Dort stand ein Schild mit den Buchstaben „LP“. Das hieß nicht Langspielplatte, sondern war eine Aufforderung an die Lokomotive, ein bisschen zu läuten und zu pfeifen. Das tat sie denn auch treu und brav jahraus, jahrein, aber (jetzt kann mans ja sagen) ohne innere Anteilnahme, mehr so pflichtgemäß.
Eines Tages - Hoppenstedt war längst an seinem Bahnhof vorbeigewachsen - wurde dicht beim dortigen LP eine neue Schule eingeweiht. Früher hatte da mal inmitten einer Distelwiese das rumplige Häuschen des Trunkenbolds Neigenfind gestanden, und der kleinen Lokomotive war es eine Lust gewesen, den alten Saufsack mit einem besonders schrillen Pfiff aus den Federn zu scheuchen. Nun aber machte ihr das Pfeifen an dieser Stelle keinen Spaß mehr, denn sie fürchtete, die Kinder könnten es altmodisch finden. So kam es, dass sie es sich in den Schornstein setzte, das Singen zu erlernen. Immer wenn sie des Abends in ihren Schuppen gesperrt wurde, begann sie leise zu üben. Sie hatte sich ein besonders schönes Lied ausgedacht. Es enthielt alles, was sie auf ihren Fahrten aus den Transistorradios aufgeschnappt hatte: Ein bisschen Beat, ein bisschen Walzer, ein paar Takte Herbert Roth und ein paar Töne von Frank Schöbel, zwei Kinderreime und einen halben Wirtinnenvers (den kannte sie vom Quarmbrücker Stationsvorsteher), eine Zeile aus einem Shanty und den Kehrreim aus einem Pionierlied, und dazu wollte sie leis mit dem Glöckchen was Russisches bimmeln. Schmunzelnd malte sie sich aus, wie die Kinder mitten im Unterricht an die Fenster stürzen und ihr lachend zuwinken würden. Die Deutsche Reichsbahn wäre ratlos, weil singende Lokomotiven in keiner Vorschrift vorgesehen sind, und der Kreisredakteur des „Quarmbrücker Abendwinds“ hätte endlich mal was Besonderes zu berichten.
Leider ist aus alledem nichts geworden. Kurz vor ihrem musikalischen Debüt wurde die kleine Lokomotive außer Dienst gestellt, denn ihre Strecke hat sich als veraltet und unrentabel erwiesen. Heute verkehren nur noch Autobusse zwischen Hoppenstedt und Quarmbrück.
Da niemand wissen konnte, dass es sich um die einzige singende Lokomotive der Welt handelte, sollte sie verschrottet werden. Um das zu verhindern, habe ich die zuständige Reichsbahndirektion gebeten, mir die kleine Lokomotive wenigstens als Titel und Zugkraft für meine fünfundzwanzig Kurzgeschichten zu überlassen. Nun warte ich geduldig auf Antwort.
Hoffnung in Hoppenstedt
Herr Löwlein lebt seit vierzig Jahren in Hoppenstedt. Dort ist er geboren und aufgewachsen, hat einen Beruf erlernt, eine Tochter der Stadt zur Frau genommen und mit ihr drei gesunde Kinder gezeugt. Darum lässt er auf Hoppenstedt nichts kommen. Gewiss, das Stadttheater kann sich weder mit der Berliner Volksbühne noch mit der Leipziger Oper messen; auch mit der Obstversorgung sieht es dort noch aus wie anderswo vor Jahren. Dafür besitzt die Stadt eine einmalig schöne Umgebung. Man denke nur an den Großen Buckelhahn (714 m ü. M.) mit seiner unvergleichlichen Aussicht auf das Schnaupatal, die Perle des Krotzengebirges, oder den prächtigen Schrieberwald mit dem Forsthaus Hübelberg und dem Singenweiler Wasserfall, Wanderziele, welche die Familie Löwlein so manchen Sonntag in die grüne Natur lockten. Dennoch, der Mensch ist nie zufrieden, und das ist gut so, denn sonst gäbe es auch in Hoppenstedt keinen Fortschritt.
Für die Löwleins sah der Fortschritt so aus, dass das Familienoberhaupt vor einigen Jahren aus reiner Unzufriedenheit in seinem Betrieb mit einigen Verbesserungsvorschlägen hervorgetreten war. Es hatte dabei nicht so sehr an sich gedacht. Um so erstaunter war es, dass seine - wie er immer sagte - kleinen Feierabendideen nicht nur dem Betrieb einen beträchtlichen Gewinn einbrachten, sondern auch Herrn Löwlein so beachtliche Prämien, dass er sich zum ersten Mal in seinem Leben ein Sparkonto einrichtete. Von nun knobelte er teils aus Spaß und teils aus Freude an seinem Konto immer neue nützliche Sachen für den Betrieb aus.
Auch Frau Löwlein war unzufrieden - nämlich mit ihrem Los als Hausfrau. Und da die Kinder langsam selbstständiger wurden, kehrte sie schließlich in ihren alten, gut bezahlten Beruf zurück. Eines Abends sprach sie zu ihrem lieben Mann: „Nun haben wir einen Kühlschrank, einen Fernseher und ein Konzertanrecht, die Kinder gehen flott gekleidet. Jetzt kann ich dir sagen, was ich mir schon so lange wünsche.“ Sie wünschte sich ein schmuckes kleines Auto, und auch Herrn Löwlein dünkte es reizvoll, den Großen Buckelhahn auf vier Rädern zu erklimmen und an freien Wochenenden mit seiner Familie einmal die Landschaft jenseits des Krotzengebirges zu genießen. Ahnungslos ging er los und meldete sich für einen Trabant an. Als er erfuhr, dass er darauf sieben Jahre warten müsse - wie ein Märchenprinz verdammt noch mal auf sein verwunschenes Mägdelein -, schimpfte er zum ersten Mal seit seiner Geburt gottsjämmerlich auf sein liebes Hoppenstedt. Herr Bamme, sein Stammfriseur, der solches hörte, sprach tiefsinnig von einer Ironie des Schicksals. Er selber sei nämlich im übernächsten Jahr mit einem Trabant dran, sein kleiner Friseurladen indessen werfe leider zu wenig ab, als dass man an einen Autokauf denken könne. Herr Löwlein witterte Morgenluft. Wenn nun von seinen Ersparnissen Herr Bamme den Wagen kaufte und ihn pro forma Herrn Löwlein zur Nutzung überließe? Friseur Bamme wiegte nachdenklich den Kopf. Warum nicht? Und er werde sich das mal genau überlegen. Herr Löwlein verlieh seiner aufkeimenden Hoffnung Ausdruck, indem er ein Trinkgeld von zwei Mark in die Tasche des Friseurkittels gleiten ließ.
Zu Hause machte er seiner Frau klar, dass sie bei Friseur Bamme besser bedient werde als bei der PGH „Figaro“, und sie solle nur ja nicht kleinlich sein. Auch die drei jungen Löwleins wurden jetzt alle zwei Wochen der tüchtigen Schere Meister Bammes preisgegeben und durften ihm jedes Mal eine eingewickelte Mark extra in die Kitteltasche stecken. Wenn sich Herr Löwlein selber die Haare schneiden ließ, pflegte er mit dem Friseur pfiffige Verschwörerblicke zu tauschen. Meister Bamme hatte sich zwar noch nicht endgültig zu dem Geschäft geäußert, doch Herrn Löwlein immerhin darauf hingewiesen, dass die Sache niemand anders in Hoppenstedt anginge. Und eine regelmäßige Kopfwäsche mit anschließender Massage könne nicht von Schaden für den Haarwuchs sein. Herr Löwlein zwang sich manchen dankbaren Blick für derlei Ratschläge ab und verzichtete sogar auf sein Bierchen im „Goldenen Löwen“, um die ständig steigenden Veredlungskosten für seine Kopfoberfläche decken zu können.
Ein Jahr ging herum, und für den kommenden Sommer planten Löwleins schon einen Autourlaub für die ganze Familie. Eigentlich war nun die Anzahlung für das Wägelchen fällig.
Meister Bamme jedoch hatte für diesbezügliche Bemerkungen nur ein stilles, fast orientalisches Lächeln, was Herrn Löwlein bewog, den Trinkgeldsatz um weitere fünfzig Prozent zu erhöhen.
Eines Tages traf Herrn Löwlein fast der Schlag. Am Lenkrad eines funkelnagelneuen Trabants kurvte Meister Bamme stolz und noch etwas verhalten über den Albert-Fliedermüller-Ring, den Hauptboulevard der Stadt. Offenbar hatte der Friseurladen in der letzten Zeit doch etwas abgeworfen. Nicht nur Herr Löwlein ballte die Faust in der Tasche. Viele Hoppenstedter legten fortan keinen allzu hohen Wert mehr auf die Pflege ihres Haarwuchses. Die PGH „Figaro“ bekam enormen Kundenzuwachs. Herr Löwlein erstand für seine Familie ein Wochenendhäuschen am Fuße des Großen Buckelhahns, das bequem mit den Fahrrädern zu erreichen ist. Meister Bamme aber hat sich einen neuen Laden in der Kreisstadt eingerichtet, wo er seinen Kunden vertraulich von dem Wartburg erzählt, für den sich seine Frau angemeldet habe und den man sich leider selber nicht kaufen könne.
Der motorisierte Neandertaler
Wenn ausgerechnet ich sage, dass ich keine Motorräder mehr mag, so ist das eigentlich unsinnig. Ich konnte die Dinger ja schon vor jener für mich so entscheidenden Reise nicht leiden. Und jetzt? Was könnte mir jetzt noch eine Jawa oder RT anhaben?
Es war im letzten Sommer. Ich hatte mich mit Susi endgültig verkracht, und zwar wegen ... aber was spielt das heute noch für eine Rolle? Susi war dann allein nach Ahrenshoop gefahren, und ich saß in meiner Bude und machte den Lebensmüden. Bis am Sonntagvormittag das Telegramm eintraf:
„ERWARTE DICH DRINGEND 15 UHR AHRENSHOOP HO SEEZEICHEN + SUSI“.
Das Seezeichen wurde zum Hoffnungslämpchen für mich Schiffbrüchigen. Susi hatte offenbar bereut, und alles würde gut werden. Benommen durchblätterte ich das Kursbuch. Verdammter Mist: Mit dem Zug war es nicht mehr zu schaffen! Ich ging zu Kleindarsteller Rogge, der einen alten Hanomag sein eigen nennt, und erinnerte ihn daran, dass ich ihm neulich in einer Kritik bescheinigt hatte, dass er ein brachliegendes Talent sei. Der Hanomag war vor zwei Tagen an einen Bastler verkauft worden. Der brachliegende Rogge versprach mir jedoch, mit dem Nachbarssohn zu reden. Der junge Leisegang habe ein Motorrad und sei als sehr hilfsbereit bekannt.
Gegen elf klingelte es bei mir. Vor der Tür stand eine Art Neandertaler, ganz in Leder eingenäht, fletschte die Zähne und knurrte: „Ick fahr Ihnen nach Ahrenshoop rüber.“ - „Sehr freundlich“, sagte ich, „bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet.“ - „Machense kein Schmus!“, schnauzte er mich an. „Det kost hundertfuffzig Piepen, für Sprit und so.“ Ich war versucht, ihm eine freche Antwort zu geben, doch dann dachte ich an Susi, suchte die Scheine zusammen und schob sie dem Scheusal in die Pranken. „Los, uffsteijen, Vata“, grunzte es, „ick bin heute ahmt hier verabredet!“ Das Motorrad musste in guten Zeiten mal eine Sport-AWO gewesen sein. Wo der Hersteller den Tacho vorgesehen hatte, steckte ein dreckiger Lappen. Dem Soziussitz fehlte der Bezug. Mein Hinweis, dass das Hinterrad verblüffend wenig Speichen habe, wurde mit der brummigen Bemerkung abgetan: „Sone Mücke wie Ihnen trägt er noch lange.“
Die ersten Kilometer sind mir nicht mehr recht in Erinnerung. Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass das Motorrad hinten keine Stoßdämpfer hatte. Genau weiß ich nicht mehr, warum der Verkehrspolizist an einer Pankower Kreuzung hinter uns her trillerte. Ergebnislos übrigens. Erst hinter der Stadtgrenze begann ich bewusst, gegen meine Todesangst anzukämpfen, indem ich nach der Armbanduhr die Geschwindigkeit stoppte. Bei 120 Kilometern war ich überzeugt, dass die Straßenmeisterei die Steine falsch beziffert habe. Der junge Leisegang fuhr wortlos. Nur einmal drehte er sich um und schrie: „Jeümpft die Düse, Vata, staunse, wa?“ - Ich stellte mir Susi vor und dass noch alles gut werden könne.
Bei Neustrelitz überfuhren wir einen Gänserich, aber es war gerade kein Bauer in der Nähe. Kurz hinter Greifswald verloren wir den Auspuff, aber der Neandertaler band ihn mit Strippe wieder fest. Vor Stralsund zerknickten wir eine Bahnschranke, aber bevor die Polizei eintraf, hatte der kräftige Urmensch die Vorderfelge zwischen seinen Knien gradegebogen und dem Bahnwärter zur Erinnerung ein paar Speichen zurückgelassen. In Barth überfiel uns ein Wolkenbruch, aber meinem Fahrer machte das nichts aus, denn sein Lederfell war offenbar wasserdicht. In Zingst bestand er darauf, zu Mittag zu essen. Ich schaute auf meine Uhr. Es war halb drei. Verzweifelt beschwor ich den Unhold, sich lieber erst in Ahrenshoop zu stärken, ich würde doch dort in einer halben Stunde erwartet. „Na, denn loofense doch hin!“, sagte er gelassen. Während ich vor Aufregung nicht mal meinen Apfelsaft austrank, verzehrte der junge Leisegang in Seelenruhe ein Eisbein, eine Rinderroulade, ein Beefsteak a la Mayer sowie zwei Pilsner und zur Verdauung einen Boonekamp. Nachdem ich die Rechnung bezahlt hatte, war meine Hoffnung, Susi noch im Seezeichen zu finden, erheblich gesunken, zumal wir hinter Prerow eine Reifenpanne zu beheben hatten. Die kultivierten Badegäste wichen entsetzt zurück, als wir in Ahrenshoop einfuhren. Ich fiel vom Sozius und begab mich nass, dreckig und wütend ins Seezeichen. Susi war nicht zu sehen. Der Kellner herrschte mich an: „Raus! Betteln hat im Sozialismus keiner nötig.“ Ich gab ihm zehn Mark und beschrieb ihm Susi, wozu nicht viel gehört. „Aha!“, sagte er und schnalzte mit der Zunge. „Die Dame ist vor 'ner Stunde in einen Polski-Fiat gestiegen. Berliner Kennzeichen.“
Herrn Leisegang am Strand aufzustöbern, war nicht weiter schwierig, denn er erregte ob seines allseitig starken Haarwuchses beträchtliches Aufsehen. Als er mich sah, grunzte er unwillig. „Bitte!“, flehte ich ihn an. „Sofort zurück nach Berlin. Es geht um mein Lebensglück!“ - „Zwanzig Mark Eilzuschlag!“, sagte er ungerührt und hielt die Hand auf. Ich suchte meine letzten Markstücke zusammen. Von der Rückfahrt weiß ich nicht mehr viel, weil ich vor Wut nur noch rot sah. Wenn wir den Polski-Fiat einholten, was würde es noch nützen? Ich malte mir aus, wie Siegfried, dieser unappetitliche Kalbskopf, lässig neben ihr am Steuer säße. In Altentreptow kassierte ein Polizist wegen überhöhter Geschwindigkeit 10 Mark von meinem Urmenschen. „Könnse mir za Hause wiederjehm“, sagte der zu mir. Hinter Neubrandenburg streiften wir ein Fahrrad, aber als ich mich umwandte, richtete sich die alte Frau schon wieder auf. Unweit Fürstenbergs gingen wir des Scheinwerfers verlustig. „Macht nischt“, schrie Leisegang, „koofense mir ehmt za Hause ’n neuen!“ Bei Gransee überholte uns ein Tatra, den wir gerade ziemlich hart geschnitten hatten. „Ihr Lumpenhunde!“, brüllte der Fahrer aus dem Fenster und schüttelte eine Drohfaust. „Euch müsste man ...“ Und schon war er vorbei. Bald darauf begann unser Hinterrad entsetzlich zu schlackern. Irgendwas krachte, dann wurde es finster. Ich erwachte noch einmal für Sekunden, als sich Siegfrieds Kalbskopf über mich beugte. „Nein, Susi!“, rief er. „Das ist er bestimmt nicht! Der Feigling würde sich nie auf ein Motorrad wagen. Steig ein, Schätzchen, das ist kein Anblick für dich!“
Trotz alledem - auf den Neandertaler bin ich längst nicht mehr böse. Er erweist sich sogar - nunmehr ohne seinen Feuerstuhl - als ein umgänglicher Mensch. Ich habe ihm auch schon fast mein ganzes Geld wieder abgewonnen, beim Sechsundsechzig, mit dem wir uns auf unserer Wolke die Zeit vertreiben. Es ist schön ruhig hier oben. Nur wenn ein Gewitter aufzieht, zucke ich zusammen und schaue furchtsam zur Erde hinab. Das Donnern erinnert mich an irgendetwas Schreckliches.
Die weiße Frau zu Ladenthin
Es war im Jahre 1945. Der klare Märzabend hüllte Turm und Zinnen von Schloss Ladenthin in ein mildes Dämmerlicht. Gedankenverloren schritt der Gutsherr Friedrich Graf von Wutzow zu Ladenthin, auf seinen Krückstock gestützt, über die eichene Zugbrücke. Nie in den letzten Jahren hatte er geglaubt, dass für ihn noch einmal die Stunde käme, da er dem Deutschen Reich beweisen könne, welch wackeres Herz in seiner alten Soldatenbrust schlug. In den ersten Weltkrieg war er noch in der stolzen Uniform eines Husarenobersten geritten; nach einer unrühmlichen Affäre allerdings, auf die näher einzugehen das Taktgefühl hier verbietet, hatte er vorzeitig den Abschied erhalten. Siebzehn langweilige Friedensjahre waren ins Land gezogen, in denen dem Grafen von Wutzow wie so vielen Männern seines Standes nichts übrig blieb, als auf seiner Klitsche in Vorpommern Rüben zu bauen und Schweine zu züchten.
Als dann im Jahre 1939 eine neue deutsche Wehrmacht siegreich gen Polen und Frankreich marschierte, hatte der alte Reitersmann inständig gehofft, dass man sich seiner entsinnen und ihn an die Spitze eines Kavallerieregimentes stellen werde. Indessen fiel Warschau, fiel Paris, fielen die ersten Bomben auf Berlin - aber der alte Wutzow, wie ihn seine Gutsleute nannten, wartete noch immer vergeblich auf seinen großen Tag, putzte jede Woche eigenhändig seinen Husarensäbel und versank schließlich in tiefen Groll. Dennoch versäumte er in seiner echt vaterländischen Gesinnung nicht, den Schöpfer des Himmels und der Erden um einen Sieg der deutschen Waffen zu bitten.
Der einzige Spaß, den er an diesem Krieg hatte, bestand in einer riesigen Landkarte, die an der Ostwand des Rittersaales hing. Dort pflegte Oberst von Wutzow, soweit es sein Rheuma erlaubte, jeden Tag eine Stunde zuzubringen und die Karte gemäß den Wehrmachtsberichten mit Fähnchen zu bestecken, wobei er blaue und gelbe Fähnchen benutzte. Die blauen entsprachen dem tatsächlichen Stellungsverlauf, die gelben hingegen markierten die Frontlinie, wie sie ausgesehen hätte, wenn das Oberkommando der Wehrmacht einsichtig genug gewesen wäre, die strategische Kriegführung Herrn Friedrich Grafen von Wutzow zu überlassen. In den letzten Monaten jedoch war er der Russlandkarte ferngeblieben, was wohl darin begründet sein mochte, dass er weder für die blauen noch für die gelben Fähnchen die rechte Verwendung fand.
An diesem klaren Märzabend nun lag eine eigenartige Stimmung in der Luft. Viele solcher frostigen Vorfrühlingsabende hatte der greise Husarenoberst schon erlebt, aber er konnte sich nicht entsinnen, jemals ein derartig seltsames Gefühl verspürt zu haben. Ihm war, als müsste sich gerade an diesem Abend etwas Unheimliches, ja etwas nie zuvor da gewesenes ereignen.
Jenseits des weiten Bruchwaldes erscholl in Abständen dumpfer Kanonendonner. Die deutschen Truppen mussten die Russen bereits über die Oder gelockt haben. Wohlan, der alte Haudegen war gerüstet! Er hielt es nicht für ausgeschlossen, dass die Entscheidungsschlacht dieses Krieges unter den Zinnen von Ladenthin geschlagen werden würde.
Nachdem die armselige Zivilistengarde, wie Graf Wutzow den Volkssturm verächtlich nannte, bereits am Vortage aus dem Dorf desertiert war, hatte er selbst die Befehlsgewalt übernommen. Dabei kam ihm die preußische Anekdote um General Coubiere, den mannhaften Verteidiger der Festung Graudenz, in den Sinn, der im Jahre 1807 dem französischen Parlamentär Savary zugerufen hatte: „Wenn es keinen König von Preußen mehr gibt, so bin ich König von Graudenz.“ Ein spitzbübisches Lächeln verirrte sich auf die welken Lippen des Obersten. „Warum nicht?“, murmelte er. „König von Ladenthin.“
Schon am frühen Morgen hatte er seine Gutsleute zusammengerufen und die Wehrfähigen unter ihnen ausgesucht. Es waren dies drei Kriegskrüppel, neun Männer über siebzig, sechs Pimpfe und der Dorftrottel. Sie alle wurden nun aus den Beständen des von Wutzowschen Jagdwaffenarsenals armiert, wobei jedoch die unsicheren Kantonisten, die vor 1933 rot gewählt hatten, statt eines Schießgewehrs nur eines Hirschfängers für würdig befunden wurden.