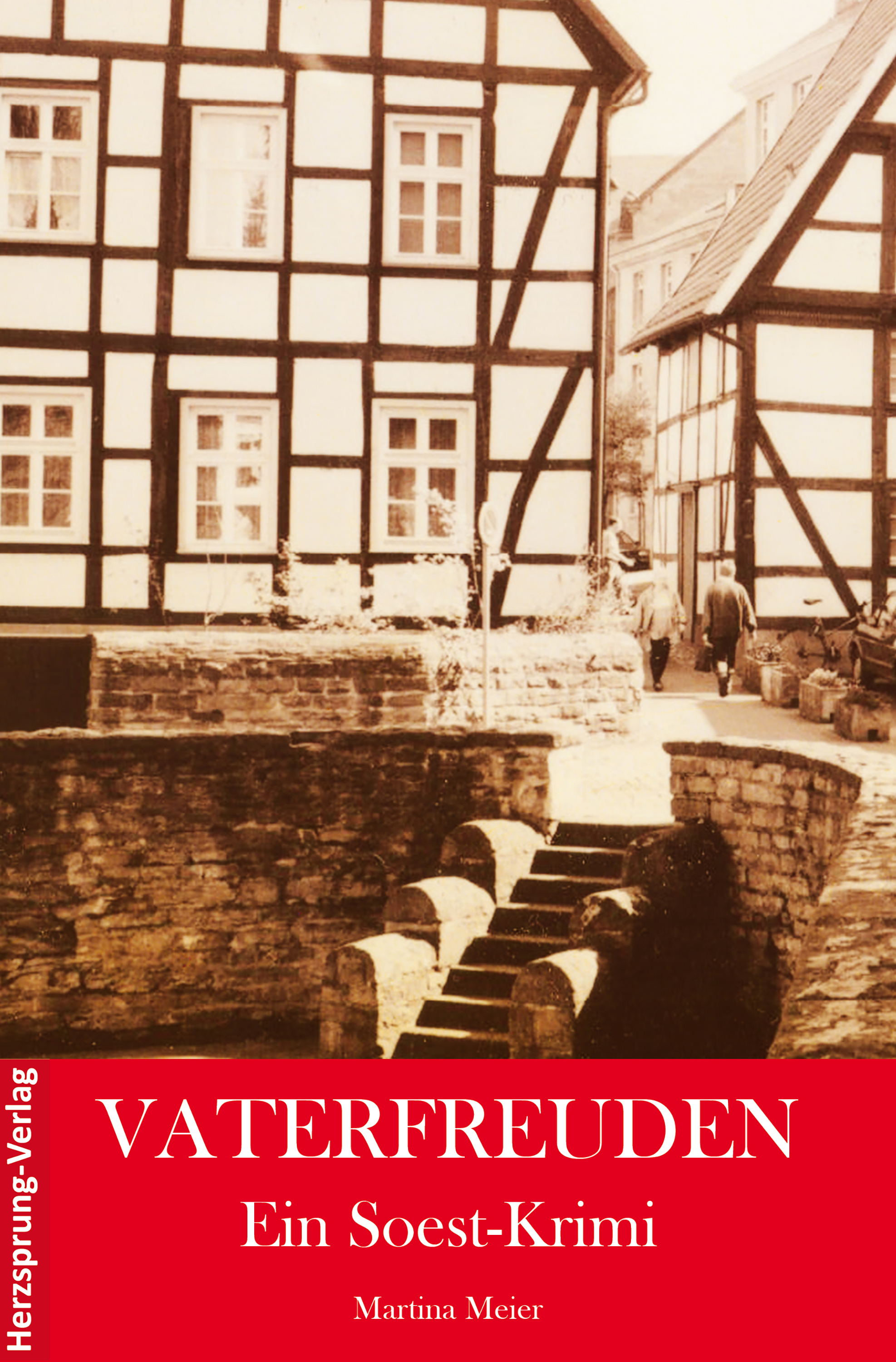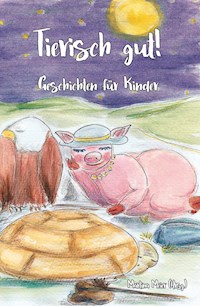9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Papierfresserchens MTM-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Das kleine Mädchen fragte: „Mama, was hast du denn früher bei deiner Mutti zum Muttertag gemacht?“ „Ich hatte ein Gedicht gelernt. Als dann meine Mutti aufwachte, habe ich mich zu ihr auf die Bettkante gesetzt und gleich das Gedicht aufgesagt. ... Ein anderes Jahr habe ich ein Bild gemalt, ein Bild mit einem schönen Blumenstrauß. Also, es sollte jedenfalls ein Blumenstrauß sein. Um das Bunte als einen Blumenstrauß zu erkennen, brauchte man schon recht viel Fantasie. Aber gefreut hatte sich meine Mutti damals schon.“ (Charlie Hagist) Erinnerungen pflegen oder einmal „Danke“ sagen, das möchte das Anthologieprojekt „Meine Mutter … und ich – Geschichten über eine ganz besondere Beziehung“. Immerhin ist die Mutter-Kind-Beziehung die erste Beziehung im Leben eines jeden Menschen. Das Buch ist dabei nicht nur ein tolles Geschenk zu Muttertag, sondern auch zu vielen anderen Gelegenheiten. Manche Geschichten und Gedichte sind anrührend, andere dagegen regen zum Nachdenken an und manche zeigen, dass nicht immer nur die Sonne scheint im Mutter-Kind-Verhältnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
o
Meine Mutter ... und ich
Geschichten über eine ganz besondere Beziehung
Martina Meier (Hrsg.)
o
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet - www.papierfresserchen.de
© 2023 – Papierfresserchens MTM-Verlag GbR
Mühlstr. 10, 88085 Langenargen
Alle Rechte vorbehalten. Taschenbuchauflage erschienen 2023.
Bearbeitung: CAT creativ - www.cat-creativ.at
Coverbild: erstellt mit Bildern von © Elena Schweitzer und
© Dieter Pregitzer - Stock Adobe lizenziert
ISBN: 978-3-99051-121-3 - Taschenbuch
ISBN: 978-3-99051-122-0 - E-Book
*
Inhalt
Ich schenk dir die Rose aus Nachbars Garten
Grenzenlose Liebe
Muttertag – ein Tag der Erinnerung
Es ist so schwer, loszulassen
Dein heller Stern
Totaloperation
Danke, Mama, an jedem einzelnen Tag
Mutter
Meine Mutter und ich
Liebe Mama ...
Erinnerungen
Mutter, deine Hände
Heldinnen selbdritt
Gesundschreiben
Mama sagt ...
Weil es Dich gibt4
Mamas Akte
Mutter fehlt
An meine Mutter
Der letzte Satz
Um zu zeigen
Das Spiel
Mutter so fern
Mein schöner Spiegel
Mütter sind mutige Wesen
Mama
Meine Mama und ich
Von Mutter sein zu Mutter sein
Meine liebe Mama
Mamas Geburtstagsfeier an der Ostsee
Danke, Mama
Erinnerungen an meine Mutter
Wieder Muttertag
Erinnerungsstücke
Mama, ich würde dir gern was sagen
Mamas 80. Geburtstag
Ewiglich WIR
Mama und der schwarze Mantel
Ruhe finden
Erinnerungen an ein Fest
Das Märchen von der Tränenschale
Kokon der Unwirklichkeit
Mama
Meine Mutter, die stolze Löwin
Zwei Herzen
Nach Hause kommen
Lieschen Müller und der Muttertag
Muckefuck
Deine kleine Hand
Muttertag-Frühstück
Liebe Mama ...
Sonntagabends beim Fritz
Deine Mama
Ein ganz besonderes Geschenk zum Muttertag
Ein Dankeschön zum Muttertag1
Muttertag im Märchenland
Wir beide
Wildes, liebes, kleines Mädchen
Deine Züge in meinem Gesicht
Ein Tag zum Danken und zum Denken
Mamas Gebot
Ohne Titel
Gedanken eines Neugeborenen
Danke sagen
In Liebe
Danke sagen am Muttertag
Was ist, wenn ...
Mama
Meine Rose
Tennis ohne Netz
Lieblingsfrau
Traummutter
Für dich
Ich bin anders, als du denkst
Mein Wort druff ...
*
Ich schenk dir die Rose aus Nachbars Garten
Als ich noch ein Baby war
tauschtest du manch ruhige Nacht
gegen zweifelndes Bangen
kühltest glühende Wangen
die mein erster Zahn mir gebracht
und streicheltest sachte mein Haar
Nun bin ichs, der das Kleinkind hält
versteh jetzt deine endlose Liebe
fühle mit brechendem Herzen
zehnfach meines Sprösslings Schmerzen
und wenn mir die Wahl auch bliebe
ich tauscht es für nichts in der Welt
Heute, am Tag, der den Müttern gedenkt
blick zurück ich auf Freude und Wunden
auf all die Momente, die wir geteilt
und ist auch nicht jede Verfehlung verheilt
dank ich für all deine Stunden
die du mir so innig geschenkt
Sonja Jurinkawurde 1989 geboren und lebt in Wien. Sie hat ihren Bachelor in Bildungswissenschaften gemacht und ist als Sozialpädagogin tätig. Seit ihrer späten Kindheit schreibt sie Gedichte; mittlerweile versucht sie sich auch an anderen Textgattungen. Bisherige Veröffentlichungen im „kkl-Magazin. Magazin für Kunst, Kultur und Literatur“ (online Magazin) und im Rahmen diverser Anthologieprojekte.
*
Grenzenlose Liebe
Der Tisch im Eck deines Zimmers stand voll mit Tellern. Auf ihnen Krümel, Fliegen, der schlummernde, beständig lauernde Tod.
Denk ich an deine spätesten Stunden, fallen sie mir ein: wortlose Klagen auf deinen Lippen. Deine schütteren Augenbrauen, nurmehr von Chemo und Bestrahlung ausgelaugte Bögen. Es fehlte dir an Atem, beim Schlucken trieben Stacheldrähte deinen Rachen hinunter, egal ob Götterspeise aus dem Plastikbecher oder püriertes Thunfischsandwich, bei jedem einzelnen Bissen röcheltest du, deine Mimik entglitt.
Im grellen Zorn protestierte ich. Schwestern und Pfleger, so nachsichtig sie gewöhnlich waren, schickten mich aus dem Raum, während sie dich löffelweise fütterten oder umlagerten, um Dekubitus zu verhüten. Am Ende deines Lebens schien ihnen die Wahrung deiner Intimsphäre vordringlicher als der Einbezug deines Sohnes.
Angenommen, deine Seele existiert jenseitig fort, so verzeih meine kopflose Notwehr, als ich mangels Alternativen, überladen mit Flaschen aus deinen Schränken, den Kiosk stürmte, zwei Etagen tiefer, Pfand abgab und ein paar Münzen kassierte. Welch ein lächerliches Tauschgeschäft und dennoch der zu dieser Zeit verlässlichste Handel. Fraglos brauchte mein Ausgeliefertsein an dein ratenweises Sterben anderweitige Verbindlichkeiten.
Solange ich auf unserem Planeten halbwegs lichte Gedanken zu fassen befähigt bin, werde ich dir nicht vergessen, dass du eine an sich schlichte Erziehung durch mütterlich ungeteilte Aufmerksamkeit veredelt hast. Selbst als ich erwachsen wurde, hast du dich nie davon abbringen lassen, mich zu umsorgen. Die Wucht deiner Zuwendung erkenne ich. Leider erst jetzt, eigentlich viel zu spät.
Du wolltest daheim sterben. Die Ärzte behaupteten, einen Transport würdest du nicht überstehen. Gestorben bist du auf der Palliativstation.
Nach der Ablehnung deines finalen Wunsches bin ich durch die endlos gedehnten, stets zugigen Korridore getigert. Der Widerhall meiner damaligen Schritte ist mir bis in die Gegenwart präsent. Das Mosaik aus Urin, ätzenden Putzmitteln, von den Balkonen zu den Aufzügen in immer flaueren Schwaden herankriechendem Tabakrauch. All das ist mir geläufig, als wärst du gestern gestorben.
Andauernde Erinnerungen an unsere gemeinsamen Unternehmungen dominieren mein Jetzt, sie machen mich chronisch benommen.
Bei meinen täglichen Besuchen durchschritt ich die Eingangshalle, ließ die Kapelle links liegen, prüfte Namen und Gewicht der Neugeborenen auf der kreidebeschriebenen Schiefertafel, bestieg den Fundamentstein, mein Sohlenprofil hinterließ Spuren auf dem eingravierten Baujahr des Klinikums. Belanglosigkeiten kommen mir zuweilen in den Sinn, ärmliche, dabei aber kostbare Kontinuität in einer Episode konsequenter Entfesselung.
Der zuerst eintreffende Lift presste mich in die zweite Etage. Zu dir Todesanwärterin, verzehrt von einem Karzinom, das nie anderes im Schilde führte, als zu metastasieren. Wie hinterhältig Krebszellen auch an deinen Organen nagten, so gab es Momente, in denen ich dich nicht anlügen musste, wenn ich deine Schultern über das hochgezogene Bettgitter hinweg gestreichelt habe und sagte: „Hab Geduld, sie kriegen dich wieder hin.“
Jene Erfahrungen mit dir verfangen in mir. Dein Porträt an der Wohnzimmerwand verblasst zusehends, doch hauchen ihm meine keineswegs leichtfertigen Worte ungeahnte Lebendigkeit ein: „Deine Enkelkinder wachsen auf. Ohne dich. Sie durften dich nicht kennenlernen, sie vermissen dich trotzdem.“
Allesamt sind wir Akteure eines geliehenen Daseins von geringer Spanne. In vorgezeichneten Bahnen ziehen wir Strippen. Dann kommt der Schlag. Die Show ist aus. Unendlichkeit im Rahmen des irdischen Lebens ist reine Illusion.
Bis unter dein spitzes Kinn ragte die Daunendecke, verschleierte dein Gerippe. Mit heiserer Stimme hast du mich jählings hinausbedeutet.
Ich kam wieder.
Bei meiner Rückkehr warst du entschlafen. Dein Mund eingenommen von einem Schmunzeln. Dein wächsernes Gesicht gebettet in ein Kissen, das durch deine schleichende Magerkeit zunehmend ausuferte. Stirn, Wangen, keine noch so winzige Partie ließ ich zum Abschied ungeküsst. Laue Plätze, die allmählich erkalteten, durfte ich letztmalig liebkosen.
Deine Perücke habe ich mit einem Tränenmeer besudelt. Zeitweise meines Standes beraubt, umklammerte ich dein Nachtkästchen. Auch auf die schwarze Antirutschmatte neben deinem Bett bin ich getreten. Einst winseltest du, ob ich das Loch in ihr nicht sähe. Ich musste mich durch das Wagnis, mich auf die Matte zu stellen, vom Trug deiner Befürchtungen befreien.
Gesiebtes Sonnenlicht fiel durchs Fenstergitter auf den Monitor, auf grüne Kurven und rote Linien, auf deine Verkabelungen am Unterarm, das hölzerne Kruzifix, auf blubbernde Gefäße und dröhnende Apparate. In Zimmer 207. Ich spähte durch die Miniquadrate in den Hof, unerschütterlich im Glauben, deine Todesbotschaft müsse ein Irrtum sein. Ein Volvo mit getönten Scheiben kollerte übers Kopfsteinpflaster des Klinikvorplatzes. Unmittelbar daneben warfen Kinder Stöckchen in den Springbrunnen.
Der Tod zögere nicht, heißt es. Und doch ist sein Eintritt zu hemmen. Bei der Unmenge an Arzneien, die aus Kunststofftanks direkt in deine Adern flossen, hätte der Verdacht entstehen können, Medizin bewillige Leid, verlängere wissentlich Höllenqualen.
Du wirkst nach in mir. Drohe ich in Schwierigkeiten zu versinken, flehe ich um deinen Beistand. Ich rufe nach dir. Womöglich sind meine erstickten Schreie stille Gebete. Insgeheim, das gestehe ich, halte ich dich für einen Engel.
Hoffnungen an deine Auferstehung möchte ich zerschmettern. Wofür deinen Frieden stören, dich erwecken, wenn dir doch auch so in den Zwischenzeilen meiner geschriebenen Texte Raum gegeben ist, dich mitzuteilen? Meine Geschichten ranken durch deine verborgene Anwesenheit. Du gibst ihnen Substanz, bist ihre Würze, das Ausrufezeichen hinter sämtlichen von mir unbeantwortbaren Fragen.
Häufig stehe ich vor der Urnenwand, studiere die Inschriften, schnuppere das Wachs angezündeter Kerzen in Laternen auf dem Sockel darunter, den Moder welker Blütenblätter, die in Vasen mit Schrammen schwimmen. Dort am Friedhof bist du mir ganz nah. Das spüre ich. Unsere getrennte Zweisamkeit ermüdet mich.
Meine im Laufe deines Krankheitsprozesses beinahe versiegte Stärke gereicht eines mir unangekündigten Tages zu keinem weiteren Friedhofsbesuch, so lautet mein Bedenken.
Sofern ich dich dränge, deine Gestalt möge vor meinem geistigen Auge Konturen annehmen, entziehst du dich völlig. Meine vermeintlichen Ansprüche auf deine Omnipräsenz scheinen dich zu verschrecken. Den Kredit für deinen hinausgezögerten Tod hast du ohnehin mit Zinseszinsen abgegolten. Kein Superlativ von überteuert vermag die Unkosten wahrheitsgetreu abzubilden. Wenigstens zukünftig möchtest du ruhen.
Ach, wäre ich bloß imstande, das Drehbuch deines Lebens nachträglich mit einem Happy End auszuschmücken. Obwohl ich deinen Verlust niemals werde verwinden können, gelingt es mir zumeist, die fixe Idee zu verjagen, es hätte meinen Pflichten entsprochen, die Ärzte zu instruieren, deinen Tod mit schonenderen Methoden zu vertagen.
Meine Überzeugung ist unerschütterlich: Deine Lippen formten ein letztes Mal meinen Namen, nachdem dein Tod bereits festgestanden hatte.
Kein Morgen vergeht, ohne dass ich mit dem anfänglichen Piepen meines Radioweckers sinne: Zu welchem Zeitpunkt wurde dein Sterben unausweichlich? Neigtest du durch Veranlagungen zu einem verfrühten Ableben? Kein Abend findet statt, ohne dass du mir fehlst.
Ruhe in Frieden, Mama, meine Liebe zu dir ist unverbrauchbar.
Oliver Fahnwurde 1980 in Pfaffenhofen an der Ilm im Herzen Oberbayerns geboren. Der Heilerziehungspfleger lebt bis heute zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in der Kreisstadt. Fahn veröffentlicht regelmäßig Beiträge in Kulturmagazinen und verfasst Texte für Anthologien.
*
Muttertag – ein Tag der Erinnerung
Muttertag – ein Tag der Erinnerung –
wo meine Gedanken weit gehen zurück
bis in die Zeit, als ich unterm Herzen
spürte meines werdenden Kindes Glück.
Muttertag – ein Tag der Erinnerung –
als zum ersten Mal mein Mädchen kam
und ich aus seinen kleinen Händen
einige Gänseblümchen entgegennahm.
Muttertag – ein Tag der Erinnerung –
ans Heranwachsen und die Jugendzeit,
an viele Freuden, aber auch Sorgen,
der Alltag hatte von allem etwas bereit.
Muttertag – ein Tag der Erinnerung –
als ich hoffte, Mutter würde mein Kind,
die Gefühle der Verantwortung spürt,
dass Kinder eine große Aufgabe sind.
Muttertag – ein Tag in der Gegenwart –
wo Kinder ihren Müttern „Danke“ sagen,
für alles, was sie ihnen geben konnten
an Liebe und Sorge in den Kindertagen.
Muttertag – eine Erinnerung im Jetzt –
an Mutter, leider fern von Raum und Zeit!
Ein leises „Danke“ aus meinem Munde
erreicht sie ganz sicher in der Ewigkeit.
Sieglinde Seilerwurde 1950 in Wolframs-Eschenbach geboren. Sie ist Dipl. Verwaltungswirt (FH) und lebt mit ihrem Ehemann in Crailsheim. Seit ihrer Jugend schreibt sie Gedichte. Später kamen Aphorismen, Märchen und Prosatexte hinzu. Ferner fotografiert sie gerne. Bislang hat sie bereits über 200 Gedichte im Internet und diversen Anthologien veröffentlicht.
*
Es ist so schwer, loszulassen
Obwohl es schon für mich unfassbare zwölf Jahre zurückliegt, habe ich die Stimme noch so klar im Gedächtnis, als wäre es gestern oder vorgestern geschehen.
Wir waren verreist, während es meiner Mutter zu Hause gesundheitlich nicht gut ging. Mehrmals erkundigten wir uns telefonisch aus dem Urlaubsort nach ihrem Gesundheitszustand. Sie gab sich große Mühe, bis zu unserer Rückkehr einigermaßen auf den Füßen zu bleiben. Nach unserer Rückkehr gab es aber keine andere Möglichkeit, als sie in ein Krankenhaus zu bringen. Ihr Zustand verschlimmerte sich rapide. Es schien, als hätte sie alle Kraft dafür gebraucht, wenigstens unsere Rückkehr zu erleben. Sie wollte anscheinend die Gewissheit haben, dass wir wieder gut ankommen sind. Jetzt hätte sie sich wieder voll und ganz ihrer Gesundheit widmen können, aber ihre Kraft reichte einfach nicht mehr aus.
Eine knappe Woche lang besuchte ich sie täglich auf der Intensivstation. Meine Mutter bekam davon nichts mit (jedenfalls nicht erkennbar). Viele Stunden verbrachte ich an ihrem Bett.
Zuletzt war ich bis etwa 22 Uhr bei ihr. Dann kam eine Stationsschwester und meinte, dass ich doch nach Hause gehen könne, denn hier könne ich nichts für meine Mutter tun. Und ich müsse doch auch mal schlafen und an etwas anderes denken. Ich verabschiedete mich schweren Herzens von meiner Mutter und versprach, am folgenden Tag wiederzukommen.
Dann musste ich mich im Vorraum der Intensivstation setzen. Ein Weinkrampf verhinderte, dass ich zur Bushaltestelle vor der Eingangshalle gehen konnte. Plötzlich strich behutsam eine Hand über meinen Hinterkopf und legte sich dann für eine kurze Zeit ganz leicht und vorsichtig auf meine Schulter.
„Es ist so schwer, loszulassen“, sagte eine Stimme.
Ich blickte mit verheulten Augen kurz hoch und meine erkannt zu haben, dass es die Schwester war, die mir kurz zuvor das Nach-Hause-Gehen nahegelegt hatte. Ganz klar konnte ich sie aber nicht erkennen. Vom Gefühl her hätte es auch ein Engel gewesen sein können, der mir damit sagen wollte, dass jetzt keine Hilfe mehr möglich war und dass es keine Umkehr geben konnte. Der Abschied soeben war der Abschied für immer gewesen. Mit diesem einen kurzen Satz: „Es ist so schwer, loszulassen“, hätte sie die Situation nicht treffender beschreiben können.
Nachdem ich nach einer Stunde Fahrzeit in unserer Wohnung ankam und ins Bett ging, klingelte das Telefon und die Schwester von vorhin konnte mir nur noch die traurige Nachricht vom Einschlafen meiner Mutter nennen.
Warum nur, warum bin ich nicht noch diese eine Stunde bei ihr geblieben? Es wäre doch gewiss nicht schlimm gewesen, wenn ich diese eine Stunde auch noch im Krankenhaus geblieben wäre. Wollte sie mir den Abschied erleichtern, indem ich erst in meinen eigenen vier Wänden sein sollte, bevor sie mich zurückließ? Meinte sie, dass ihr und mir das Loslassen leichter fallen würde, wenn wir uns nicht in einer Nähe befänden, in der wir uns an den Händen fassen könnten?
Ich glaube, es war für beide schwer, loszulassen. Sie hatte es geschafft und auf unerklärbare Weise über die Krankenschwester den Auftrag gegeben: Du, mein Sohn, gehe jetzt nach Hause zu deiner Familie, ich lasse dich – schweren Herzens, aber zugleich in Sicherheit wissend, los.
Und ich musste es dann auch loslassen. Es bleibt nur die Erinnerung.
Aber: Es war so schwer, loszulassen!
Charlie Hagistwurde 1947 in Berlin-Steglitz geboren. Nach Grund- und Oberschule absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Während seiner Tätigkeit in der Personalabteilung des Hauses bildete er sich zusätzlich zum Personalfachkaufmann (IHK) weiter. Ehrenamtlich war er als Richter am Amtsgericht Berlin-Tiergarten, am Sozialgericht Berlin und danach am Landessozialgericht Berlin tätig. Charlie Hagist ist verheiratet, hat einen Sohn.
*
Dein heller Stern
Heut ist dein Tag,
ich denke an dich,
doch gratulieren
kann ich dir nicht!
Du bist jetzt ein Engel
oben im Himmel,
schaust sicher herab
aufs Erdengewimmel!
Siehst Enkel und Kinder,
sie springen durch Pfützen,
Du auf der Wolke
wirst uns beschützen!
Wir vermissen dich schrecklich
das ist ja klar,
denn du warst immer
für alle da!
Im Urlaub, zu Hause,
am Ostseestrand
Waren wir hilflos,
du hieltest die Hand!
Manchmal des Nachts
seh ich deinen Stern,
er leuchtet so hell.
Ich hab dich soooo gern!
Dörte Müller,geboren 1967, schreibt und illustriert Kinderbücher. Sie lebt mit ihrer Familie in Bonn. Ihre Mutter starb unerwartet im Alter von 70 Jahren nach einer Operation.
*
Totaloperation
Als ich zwölf Jahre alt war, unterzog sich meine Mutter einer Totaloperation. Die gute Nachricht dabei bestand darin, dass sie keinen Krebs hatte. Trotzdem musste sie drei Wochen ins Krankenhaus. Und als sie heimkehrte, fehlten ihr die Gebärmutter und beide Eierstöcke.
„Jetzt kann da unten wenigstens nichts mehr passieren“, verkündete sie und freute sich darüber, dass die verhasste Regelblutung ausblieb. Die hatte sie, so lange ich sie kannte, gebeutelt. Wehklagend stand sie im halbdunklen Schlafzimmer, wo sie mit diversen Binden rumhantierte. Das fand nun ein Ende und die ständige Angst vor Unterleibskrebs auch. Ich selbst wartete dagegen auf meine erste Menstruation und wusste nicht, was mich erwartete – im Zweifelsfall nichts Gutes, wenn ich an die Jahre zurückdachte, die ich mit meiner Mutter und ihrem Unterleib verbracht hatte.
Meine Mutter litt von jeher an gynäkologischen Problemen. Als ich drei Jahre alt war, wurde sie das erste Mal operiert. Damals begriff ich noch nicht, was vor sich ging. Es hieß, sie habe gutartige Myome. Darunter konnte ich mir nichts vorstellen. Gutartig – war dies ein freundliches Geschwür, lustig wie eine Kasperlepuppe?
„Jedenfalls nichts Bösartiges“, erklärte sie mir, „kein Krebs.“ Damit war das böse Wort zum ersten Mal gefallen. Krebs, eine Krankheit, die von einem heimtückischen Tier durch den Körper getragen wurde, Knoten bildete, die immer größer wurden, bis sie den Kranken schier erdrückten. Schmerzen und ein qualvoller Tod folgten. Doch ihre Geschwulst war gutartig, Mami musste nicht sterben, jetzt zumindest nicht. Von da an gingen wir regelmäßig zur Frauenärztin, eine unheimliche Person im weißen Kittel, die, wie mir schien, über Leben und Tod entschied.
„Wenn der Krebs rechtzeitig erkannt wird, dann hat deine Mutter eine Überlebenschance, wenn er zu spät entdeckt wird, dann leider nicht“, erklärte sie mir bei einem Besuch, bei dem Mami und ich in ihrem Sprechzimmer wie die begossenen Pudel hockten. Oft ging es jedoch nur zur Blutentnahme. Ängstlich betraten wir die Anmeldung. Dort standen mehrere Frauen. Einmal wurde eine von ihnen mit einer Nadel in die Fingerkuppe gestochen.
„Mami“, rief ich. „Die Frau blutet.“
Meine Mutter und die anderen Frauen nickten. Die Sprechstundenhilfe packte die Nadel weg und sprach mich an. „Das war doch noch gar nichts. Gleich, bei deiner Mutter, wird viel mehr Blut fließen. Sie zeigte mir ein leeres Gefäß. „Wir machen eine Blutsenkung“.
„Mami“, schrie ich diesmal.
Ihr angsterfülltes Gesicht blickte mich an. „Das muss sein, es geht nicht anders“, war ihr einziger Trost.
Die Sprechzimmertür flog auf und Frau Doktor rauschte ins Zimmer. Die Schöße ihres weißen Kittels flatterten wie die Segel eines fortfahrenden Schiffs. „Der Nächste bitte“, rief sie in den Raum und eine Frau erhob sich hastig vom Wartestuhl. Mit einem satten Schmatzengeräusch schloss sich die Tür hinter ihnen. Kurz hatte ich den Blick auf eine Art Bahre werfen können mit aufgerichteten Beinschienen – ein Folterinstrument.
Meine Mutter stütze sich am Schreibtisch ab und drückte stöhnend ein Stück Watte auf ihren Arm. Die Sprechstundenhilfe hielt mir triumphierend das mit dunkler Flüssigkeit gefüllte Gefäß hin. Nun hatte ich gar nicht gesehen, wie das Blut floss.
„Mami, warum ist dein Blut so dunkel?“, fragte ich.
„Schhhh“, flüsterte sie, „komm jetzt nach Hause, wir müssen auf das Ergebnis warten.“
Bange Tage folgten. Ich ging nicht nach draußen, um zu spielen. Durchs Fenster beobachtete ich die anderen Kinder. Wie konnten sie so fröhlich sein, während ihre Mütter vielleicht auch in Kürze an Krebs sterben sollten. Immer wieder schaute ich zum Telefon. Dann, am dritten Tag, griff meine Mutter mit zitternder Hand selbst zum Hörer. Tatsächlich, die Ergebnisse waren da, schlechte Ergebnisse, sie solle morgen in die Praxis kommen. Meine Mutter weinte.
„Was ist denn, hast du nun Krebs?“, fragte ich ängstlich. Mein Herz klopfte bis zum Hals.
„Vielleicht“ antwortete sie, „jedenfalls sind die Ergebnisse der Blutsenkung schlecht.“ Die letzten Worte gingen in einem Schluchzen unter. Sie putze sich geräuschvoll die Nase. „Wenn Mami sterben muss, wirst du bei deinem Patenonkel wohnen. Er und deine Tante ziehen dich dann groß.“
„Ich will da aber nicht hin.“ Jetzt fing ich auch an zu weinen. „Ich mag die beiden nicht“.
„Ich auch nicht, aber es geht nicht anders.“
Als mein Vater von der Arbeit kam, ließ meine Mutter die Taschentücher verschwinden.
„Was ist denn hier los?“ Instinktiv nahm er die schlechte Stimmung wahr.
Meine Mutter hastete zum Herd und füllte das bereits fertige Essen auf. „Ach nichts, ich war nur heute beim Arzt.“ Eine Nachfrage meines Vaters kam nicht, da er nun kaute. Wir lebten am Rande des Todes und er merkte es nicht einmal.
Am nächsten Morgen brachen wir früh auf. Eine überfüllte Straßenbahn brachte uns in die Stadt. Dann standen wir wieder an der Anmeldung. Die Sprechstundenhilfe nickte mir verschwörerisch zu und zeigte auf ein leeres Gefäß. Ich wandte den Blick ab und wir setzten uns. Immer wieder trat die Ärztin ins Wartezimmer.
„Frau …“ Sie machte eine bedeutungsvolle Pause. Die ängstlichen Blicke der Frauen ruhten auf ihr. Dann sprach sie den Namen aus und eine weitere Frau musste durch die Tür. Als sie den Namen meiner Mutter aufrief, griff ich ihre Hand und ging mit ihr. Nun konnte ich den eigentümlichen Stuhl aus der Nähe sehen.
„Zur Untersuchung muss das Kind dann aber raus.“
Meine Mutter nickte. „Was ist denn mit der Blutsenkung?“, fragte sie ängstlich.
„Die Werte sind schlecht.“ Sie wedelte mit einem Blatt Papier. „Genau wie beim letzten Mal.“
„Was heißt das denn?“, fragte meine Mutter nach.
„Sie stehen unter Beobachtung, regelmäßige Kontrollen. Ich hatte eine andere Patientin, die hatte auch so schlechte Blutwerte.“ Sie griff zu einem leeren Blatt und zückte einen spitzen Bleistift. „Hier“, sie malte einen Kreis. „Das war der Krebs, so groß wie eine Haselnuss.“ Dann malte sie Pfeile. „Metastasen, der Krebs ist ausgestrahlt, von der Gebärmutter in den ganzen Körper.“ Immer mehr Pfeile folgten. „Sie war erst 36 Jahre alt und nun ist sie tot. Tja, so ist das nun Mal. Ich werde Sie jetzt untersuchen. Vielleicht finden wir ja auch etwas.“ Sie griff nach dem Zettel. „Hier, nimm den, darauf kannst du jetzt weitermalen, aber draußen, hörst du.“ Ich nahm den Zettel, verschwand ins Wartezimmer und stellte mir vor, wie meine Mutter auf den schrecklichen Stuhl kletterte.
Jahrelang gingen wir zu der Ärztin. Die Besuche verliefen stets ähnlich. Dann entschied sich meine Mutter zur Totaloperation. Die permanente Krebsangst war zu unserem ständigen Begleiter geworden und vergällte mir meine Kindheit. Nie habe ich mit Freundinnen über diese Arztbesuche gesprochen. Ich weiß nicht, ob es bei ihnen ähnlich zuging. Ich weiß nur, dass fast alle Mütter irgendwann für drei Wochen ins Krankenhaus verschwanden.
Meine Mutter ist auch später nicht an Krebs erkrankt. Doch wie heißt es so schön: Es gibt keine gesunden Menschen, sie sind nur nicht ausreichend untersucht worden.“
Ellen Norten,geboren 1957 in Gelsenkirchen ist promovierte Biologin. Als freie Wissenschaftsjournalistin arbeitete sie zunächst bei verschiedenen Hörfunksendern, danach folgte eine mehrjährige Tätigkeit bei der Fernsehsendung „Hobbythek“, auch vor der Kamera. In dieser Zeit entstanden ein Dutzend Sachbücher und Ratgeber. Seit 2010 tourt sie zusammen mit ihrem Mann Zaubi M. Saubert mit dem Wohnmobil durch die Welt, schreibt Kurzgeschichten, die in diversen Anthologien und Zeitschriften veröffentlich werden. Außerdem verfasst sie Rezensionen für Kultura-Extra, beteiligt sich an Poetry-Slams und Science-Slams und arbeitet als Herausgeberin von humoristischen Science-Fiction Anthologien bei p.machinery. Passend zum Science-Slam zeichnete und textete sie ihr Buch „Mein süßer Parasit“.
*
Danke, Mama, an jedem einzelnen Tag
Liebe Mama,
viel zu selten sagen wir dir, wie gern wir dich haben. Speziell am Muttertag denken wir zwar an dich und feiern DEINEN Tag, aber eigentlich würde dir auch an jedem anderen Tag im Jahr ein Dankeschön gebühren. Was wir dir jetzt sagen möchten, gilt also nicht nur heute, sondern an jedem einzelnen Tag unseres Lebens.
Wie ein Leuchtturm stehst du felsenfest da und hast uns immer den Weg gezeigt. Haben wir uns verlaufen, hast du uns auf den richtigen Weg zurückgeführt.
Oft haben wir mit unseren Streitereien die idyllische Ruhe gestört und trotzdem hast du uns immer wieder aufs Neue verziehen. Jeden noch so großen Fehler hast du uns vergeben.
Wie bunte Farben hast du unser Leben mit Worten, Taten und Gebeten bereichert.
Wie eine Brücke hilfst du uns, das Band zwischen uns Schwestern standhaft zu halten.
Mit zweien von uns bist du bereits einen großen Lebensabschnitt gegangen und hast uns auf den nächsten weiten Weg abbiegen lassen. Auch die dritte im Bunde wirst du bestimmt mit viel Liebe zu ihrem großen Glück führen.
Du leuchtest uns wie ein Licht in der Nacht. Mit Rat und Tat stehst du uns zur Seite. Wenn wir uns einer Sache unsicher sind, können wir immer zu dir kommen.
Du hast uns unser eigenes Wesen immer vor Augen gehalten, egal ob wir es hören wollten oder nicht. Auch das hat uns wachsen lassen.
Unzählige Tränen hast du für uns vergossen, mit dem Gedanken, dass es uns in Zukunft gut gehen wird. Mit allem, was du uns gegeben hast, könnten wir keinen besseren Reiserucksack für unseren weiteren Lebensweg packen.
Deine Liebe zu uns ist unzerbrechlich und schwankt nie, die Liebe zwischen uns kann jedes Hindernis überwinden.
Egal wie weit entfernt wir sind oder wie lange wir uns schon nicht mehr gesehen haben, du hältst uns immer die Tür zu unserem Zuhause offen.
Danke, Mama, dass du schon so viel für uns gegeben hast. Lass uns dir jetzt zumindest ein klein wenig davon zurückgeben.
Wir haben dich unglaublich lieb,
deine drei Mäderl
Sabrina Baierl,geboren 1991, lebt mit ihrem Ehemann und ihren zwei Katzen in Kremsmünster, Oberösterreich. Sie hat das Studium Lehramt Primarstufe in Linz absolviert und ist derzeit in Ausbildung zur gewerblich, medizinischen Masseurin. Seit ihrer Jugend ist sie fasziniert vom Schreiben, dabei gilt ihre Vorliebe der Lyrik und dem Fantasy Genre.
*
Mutter
Alt ist sie geworden,
gezeichnet vom langen Leben.
Faltig ihr Gesicht und grau die Haare,
knorrig, ihre Hände – von vieler Arbeit.
Sie hat gegeben, so viel im Leben,
und ist dennoch Mensch geblieben.
Es war nicht immer leicht mit ihr,
doch wir lieben und brauchen sie.
So manche Nacht hat sie durchwacht,
stets zuletzt an sich gedacht.
Für andere war sie immer da,
ohne Rast und Ruh.
Ein langes Leben geht zu Ende,
sanft und still bist du gegangen.
Du hast uns all deine Liebe gegeben,
in unseren Herzen lebst du weiter fort.
Dieter Geißler,geboren 1954 in Weimar, Ausbildung zum Koch, danach Studium an der Fachschule für Gaststätten- und Hotelwesen Leipzig. Heute lebt der Rentner in Frankenheim, in der „Hohen Rhön“. Durch eine Krankheit kam er mit 57 Jahren zum Schreiben. Er verfasst Gedichte und Kindergeschichten. In verschiedenen Verlagen wurden von ihm Gedichte und Kindergeschichten veröffentlicht.
*
Meine Mutter und ich
Eigentlich war ich nicht geplant, nicht vorgesehen. Aber wir werden nicht gefragt, wie und von wem wir gezeugt und geboren werden möchten. Du nicht, ich nicht. Das Leben hat uns auf dramatische Weise verstrickt und verwoben, Blutsbande halten uns lebenslänglich zusammen, dich und mich. Dein Schicksal hat dich zu meiner Mutter werden lassen, mich zu deinem Kind. Aus zunächst unfreiwilliger Distanz heraus haben wir unsere Leben über einen sehr langen Zeitraum fremdbestimmter Wege verfolgt, weil wir sehr früh voneinander getrennt wurden. Doch über alle Entfernungen und die Köpfe anderer Menschen hinweg haben wir doch miteinander kommuniziert, nonverbal. Denn es gibt keine Nichtkommunikation. Die Gedanken sind frei und auch Schweigen ist eine Aussage.
Wanderten unsere Gedanken oft zu der jeweils anderen? Wie wären unsere Leben als Mutter und Tochter verlaufen, wenn du zum Zeitpunkt meiner Geburt glücklich gewesen wärest, dich über meine Entstehung und Existenz hättest unbeschwert freuen können? Aber du warst noch ein Kind, das zu früh und nicht freiwillig Mutter wurde. Wie gerne hätte ich dich durch alle Phasen deines Lebens begleitet, dir beigestanden an glücklichen und traurigen Tagen. Für dich und mich gekämpft.
Es gab vieles, was ich gerne mit dir erlebt, nicht nur erlitten hätte. Immer habe ich geglaubt, ja, war überzeugt, dass es möglich wäre, ja, möglich sein müsste, erlittene Gewalt zu überwinden und miteinander zu heilen, statt sich zu verbieten, zu verbiegen, zu verletzen, sich zu verlieren. Herz für Herz. Seele für Seele. Eine Überzeugung, von der ich nie abgewichen bin, wofür manche Menschen mich geliebt, manche mich gehasst haben.
Mutter zu werden und Kind zu sein, hört nie auf. Ein Leben lang nicht. Lebenslänglich gibt es dich und mich. Als Mutter und Tochter. Wie gerne hätte ich erlebt, gewusst, ob du stolz über meinen Weg bist. Diese letzte Gewissheit gehabt. Vielleicht bin ich dir ja so viel ähnlicher, so viel näher, so viel verbundener, als es dir bewusst ist. Mich konntest du nicht einfach abschütteln und so tun, als wäre nichts gewesen.
Das Leben hat dich vergewaltigt, nicht ich dich. Jetzt, in diesen Zeiten, entstehen wieder viele Kinder in einem Krieg, den sie selber gar nicht angezettelt oder verursacht haben. Die Zeit fragt einfach nicht nach Krieg oder Frieden, Gewalt und Verbrechen sind an der Tagesordnung, auch wenn wir dies nicht wahrhaben wollen.
Ulrike M. Dierkes
*
Liebe Mama ...
Liebe Mama,
nachdem du tapfer unter Schmerzen
mich gebracht hast auf die Welt,
war schon Liebe in deinem Herzen,
denn schon vor Monaten hatte ich mich zu dir gesellt.
Nach dieser langen Wartezeit
war es dann endlich so weit:
Ich sah dich an mit großen, neugierigen Augen,
noch konnte ich nur am Daumen saugen.
Doch nahmst du mich gerne an die Hand,
machtest mich mit unserer Familie bekannt.
Und so wurde ich warm und geborgen
voller Liebe großgezogen.
Kraft und Mühe hat es dich gekostet,
da du des Nachts oft aufstehen musstest.
Und neben Windelwechsel und Babybrei
gab’s viel Geplärre und Geschrei.
Doch irgendwann war auch das vorbei,
ich lernte laufen, sprechen, doch nebenbei
habe ich sicherlich auch viel Unfug gemacht
und dich um so manchen Nerv gebracht.
Aber so ist es mit jedem Kind –
ein jedes viel in Anspruch nimmt.
Jedoch schenkt es dir auch viel Glück,
gibt dir dein Lächeln und deine Liebe zurück.
Bringt dich unbewusst zum Lachen,
wenn’s macht verrückte, niedliche Sachen.