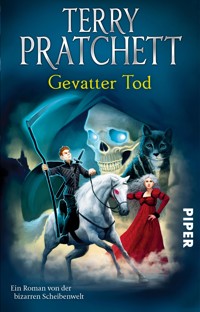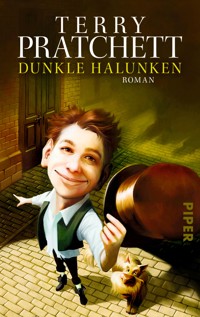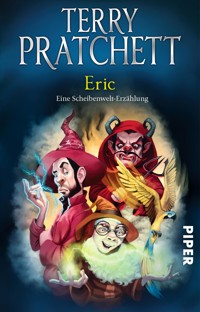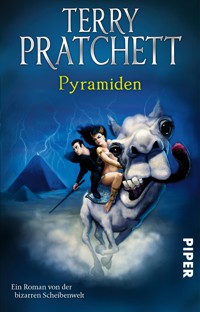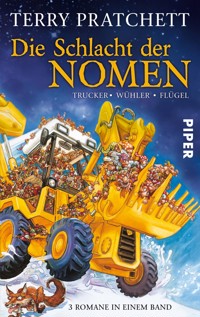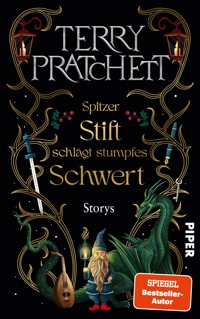8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Opernhaus von Ankh-Morpork huschen maskierte Gestalten durch die Kulissen und führen Niederträchtiges im Schilde. Wer den sterbenden Schwan auf der Bühne mimt, der lebt gefährlich. Es spukt, und als auch noch ein Mord geschieht, ist es höchste Zeit für den Auftritt zweier erdnussfutternder Damen mit bemerkenswerten Hüten. Es sind Oma Wetterwachs und Nanny Ogg, die berühmtesten Hexen der Scheibenwelt. Anlässlich ihres Besuchs steht dem Musentempel ein Riesenwirbel ins Haus – und mörderisch gute Abendunterhaltung ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Im Opernhaus von Ankh-Morpork huschen maskierte Gestalten durch die Kulissen und führen Niederträchtiges im Schilde. Wer den sterbenden Schwan auf der Bühne mimt, der lebt gefährlich. Es spukt, und als auch noch ein Mord geschieht, ist es höchste Zeit für den Auftritt zweier Erd-nüsse futternder Damen mit bemerkenswerten Hüten. Es sind Oma Wetterwachs und Nanny Ogg, die berühmtesten Hexen der Scheibenwelt. Anlässlich ihres Besuchs steht dem Musentempel ein Riesenwirbel ins Haus – und mörderisch gute Abendunterhaltung …
Weitere Informationen zu Terry Pratchett sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Terry Pratchett
–––––––––––––––
Mummenschanz
Ein Scheibenwelt-Roman
Aus dem Englischen neu übersetztvon Regina Rawlinson
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Maskerade« bei Victor Gollancz Ltd., London.
Die vorliegende Ausgabe ist eine Neuübersetzung des erstmals 1997 im Wilhelm Goldmann Verlag auf Deutsch erschienenen Romans.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Taschenbuchausgabe März 2017
Copyright © der Originalausgabe 1995 by Terry & Lyn Pratchett
First Published by Victor Gollancz Ltd., London
Discworld ® is a trademark registered by Terry Pratchett
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1997 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und Gestaltung der Umschlaginnenseiten: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Sebastian Wunnicke
Redaktion: Uta Rupprecht
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-14766-2V002
www.goldmann-verlag.de
Ich danke allen, die mir gezeigt haben, dass die Oper noch seltsamer ist, als ich sie mir je hätte vorstellen können. Für ihre Hilfe kann ich mich am besten revanchieren, indem ich sie hier nicht namentlich erwähne.
Der Sturm heulte. Es wetterleuchtete über den Bergen. Blitze fuhren in die Felsenklüfte wie der Zahnstocher eines alten Mannes, der in seinem Gebiss nach einem feststeckenden Brombeerkern prockelt.
Zwischen den fauchenden Ginsterbüschen brannte ein Feuer, die Flammen loderten im Wind.
Eine schaurige Stimme kreischte: »Wann treffen wir … zwei … wieder zusammen?«
Es donnerte.
Eine eher nüchterne Stimme sagte: »Was plärrst du denn so? Jetzt ist mir das Röstbrot ins Feuer gefallen.«
Nanny Ogg setzte sich wieder hin.
»’tschuldige, Esme. Es kam einfach über mich … in Erinnerung an die alten Zeiten. Aber richtig glatt geht es mir immer noch nicht über die Lippen.«
»Wo die Scheibe gerade so schön knusprig wurde.«
»’tschuldige.«
»Deswegen musst du doch nicht so plärren.«
»’tschuldige.«
»Ich bin ja nicht taub. Die normale Lautstärke tut es auch. Und dann sag ich: Nächsten Mittwoch.«
»’tschuldige, Esme.«
»Und jetzt schneid mir noch eine Scheibe ab.«
Nanny Ogg nickte und drehte den Kopf. »Magrat, schneid Oma noch eine … ach. Wo bin ich bloß mit meinen Gedanken? Dann muss ich wohl selber Hand anlegen.«
»Ha!«, machte Oma Wetterwachs und starrte ins Feuer.
Eine Zeit lang waren nur das Tosen des Windes und die Geräusche des Brotsäbelns zu hören. Nanny Ogg stellte sich dabei ungefähr so geschickt an wie jemand, der versucht, eine Matratze mit der Kettensäge zu zerlegen.
»Ich dachte, unser Ausflug heitert dich ein bisschen auf«, sagte sie nach einer Weile.
»Tatsächlich.« Das war keine Frage.
»Ich wollte, dass du mal aus deinem Schneckenhaus rauskommst«, fuhr Nanny fort. Sie ließ ihre Freundin nicht aus den Augen.
»Hm?« Oma Wetterwachs stierte weiterhin trübsinnig in die Flammen.
Ach Gottchen, dachte Nanny, das hätte ich nicht sagen dürfen.
Die Sache war nämlich die: Nanny Ogg machte sich Sorgen. Große Sorgen. Sie befürchtete, dass ihre Freundin … gewissermaßen … oder auch sozusagen … schwarz wurde.
Bei einer mächtigen Hexe konnte das durchaus passieren. Und Oma Wetterwachs war verdammt mächtig. Wahrscheinlich besaß sie sogar noch mehr Kräfte als die berüchtigte Schwarze Aliss, und welches Ende es mit der genommen hatte, war allseits bekannt: von zwei Kindern in den eigenen Backofen gestopft. Und alle waren heilfroh darüber gewesen, obwohl es eine ganze Woche gedauert hatte, die Schweinerei zu beseitigen.
Denn bis zu jenem schlimmen Tag war Aliss der Schrecken der Spitzhornberge gewesen. Sie beherrschte die Magie so gut, dass in ihrem Kopf nichts anderes mehr Platz hatte.
Angeblich konnte man ihr mit Waffen nichts anhaben. Klingen seien an ihr abgeprallt. Und ihr irres Gelächter habe man noch auf eine Meile Entfernung hören können. Für Notfälle war natürlich jede Hexe mit einer irren Lache ausgestattet, aber nicht mit einer geisteskranken irren Lache, wie Aliss eine hatte. Außerdem sollte sie Leute in Lebkuchen verwandelt und in einem Haus aus Fröschen gewohnt haben. Ja, es hatte ein sehr hässliches Ende mit ihr genommen. So war es immer, wenn Hexen auf Abwege gerieten.
Manchmal allerdings gerieten sie gar nicht auf Abwege. Sondern einfach nur … sonst wohin.
Oma Wetterwachs’ Verstand brauchte Beschäftigung. Langeweile konnte sie nicht ertragen. Wenn es ihr allzu öde wurde, legte sie sich ins Bett und schickte ihren Geist zum Borgen aus. Sie schlüpfte in den Kopf eines Waldtiers und bediente sich seiner Ohren und Augen. Dagegen war an sich nichts einzuwenden, bloß, dass sie es damit übertrieb. Nanny Ogg hatte noch nie von einer Hexe gehört, die länger fortbleiben konnte als sie.
Womöglich kam sie eines Tages überhaupt nicht mehr zurück … vor allem jetzt, in dieser Jahreszeit, wenn die Wildgänse mit schrillem Schrei durch die Nacht rauschten und die frische Herbstluft lockte. Dieser Versuchung hatte Oma Wetterwachs kaum etwas entgegenzusetzen.
Nanny Ogg konnte sich vorstellen, woran das lag.
Sie räusperte sich.
»Bin vor ein paar Tagen Magrat über den Weg gelaufen«, sagte sie mit einem vorsichtigen Seitenblick auf die Freundin.
Keine Reaktion.
»Sie macht sich prächtig. Das Königinsein steht ihr gut.«
»Hm?«
Nanny stöhnte in sich hinein. Wenn Esme sich noch nicht mal zu einer gehässigen Bemerkung aufschwingen konnte, musste Magrat ihr wirklich sehr fehlen.
Fast unglaublich, aber wahr: Magrat Knoblauch, das nasse Handtuch, hatte doch tatsächlich in einem Punkt recht gehabt: Die ideale Zahl für einen Hexenzirkel war die Drei.
Und nun hatten sie die Dritte im Bunde verloren. Wobei »verloren« nicht ganz stimmte. Magrat war ja jetzt Königin, und eine Königin verschusselt man nicht so leicht. Doch sei’s drum … sie waren nur noch zu zweit.
Magrat war eine richtig gute Friedensstifterin gewesen, wenn es mal Streit gab. Ohne sie gingen sich Nanny Ogg und Oma Wetterwachs gehörig auf die Nerven. Mit ihr waren sie dem Rest der Welt auf den Nerven rumgetrampelt, was wesentlich mehr Spaß machte.
Und sie würden Magrat auch nicht wiederkriegen. Jedenfalls noch nicht.
Für den idealen Hexenzirkel genügte es nicht, zu dritt zu sein, es kam schon auf die richtige Zusammensetzung an. Drei bestimmte Hexentypen mussten darin vertreten sein.
Nanny Ogg schämte sich, auch nur darüber nachzudenken, und so etwas kam bei ihr wahrhaftig nicht alle Tage vor, war Scham ihr doch normalerweise genauso fremd wie einer Katze der Altruismus.
Als Hexe glaubte sie natürlich nicht an irgendwelchen okkulten Unsinn. Aber tief unter dem Urgestein der Seele ruhten Wahrheiten, denen man sich stellen musste, und dazu gehörte leider auch die Sache mit der … äh … Jungfrau, der Mutter und dem … dem … der anderen.
Na also. Jetzt hatte sie es tatsächlich in Worte gekleidet.
Natürlich war das nur ein alter Aberglaube aus den unaufgeklärten Zeiten, als die Begriffe »Jungfrau« oder »Mutter« oder … das andere … noch jedes weibliche Wesen einschlossen, das älter als zwölf war, abgesehen von ungefähr neun Lebensmonaten. Heutzutage konnte ein Mädchen, das des Zählens mächtig war und Nannys Ratschläge beherzigte, immerhin einen dieser Zustände hübsch lange hinausschieben.
Trotzdem … es war ein alter Aberglaube – älter als Bücher, älter als die Schrift. Und ein solcher Glaube lastete als schweres Gewicht auf dem Gummilaken der menschlichen Erfahrung und zog die Menschen in seine Umlaufbahn.
Und Magrat war jetzt seit drei Monaten verheiratet. Demnach war sie der ersten Kategorie inzwischen entwachsen. Zumindest – Nanny Ogg vollzog einen gedanklichen Kurswechsel – gehörte sie höchstwahrscheinlich nicht mehr dazu. Doch, doch, ganz bestimmt. Jung Verenz hatte sich ein nützliches Handbuch kommen lassen. Mit Bildern und nummerierten Körperteilen. Das wusste Nanny deshalb, weil sie eines Tages ins königliche Schlafgemach geschlichen war und sich zehn lehrreiche Minuten lang damit vergnügt hatte, einigen Figuren Schnurrbärte und Brillen anzumalen. Sogar Verenz und Magrat mussten mittlerweile … Doch, doch, ganz bestimmt hatten sie es ausgetüftelt, auch wenn Nanny zu Ohren gekommen war, dass Verenz Erkundigungen eingezogen hatte, wo man falsche Schnurrbärte kaufen konnte. Selbst wenn die beiden extrem langsame Leser waren, würde es nicht mehr lange dauern, bis Magrat sich für die zweite Kategorie qualifizierte.
Oma Wetterwachs konnte noch so sehr darauf herumreiten, wie unabhängig und selbstständig sie war, aber es fehlte ihr einfach jemand, an dem sie ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit auslassen konnte. Menschen, die keine Menschen brauchen, brauchen Menschen, denen sie zeigen können, dass sie Menschen sind, die keine Menschen brauchen.
Mit den Eremiten war es das Gleiche. Wozu sollte man sich, während man mit dem Unendlichen kommunizierte, auf einem Berg die Eier abfrieren, wenn man nicht darauf bauen durfte, dass ab und zu ein leicht zu beeindruckendes junges Ding des Weges kam und »Ist ja irre!« sagte?
Sie brauchten wieder eine Dritte im Bunde. Zu dritt war das Leben viel spannender. Streitereien, Abenteuer und Sachen, die Oma Wetterwachs auf die Palme brachten. Denn sie war nur glücklich, wenn sie sich aufregen konnte. Nanny Ogg hatte sogar das Gefühl, dass sie überhaupt nur auf besagter Palme ganz Oma Wetterwachs war.
Ja. Sie mussten eine dritte Hexe finden.
Andernfalls … würde es mit grauen Schwingen in der Nacht enden … oder mit dem Zuschlagen einer Backofentür …
Herr Ziegenbalg hatte das Manuskript kaum in die Hand genommen, da zerfiel es auch schon in seine Einzelteile: leere Zuckertüten, alte Briefumschläge und abgelaufene Kalenderblätter.
Mit einem Knurren wollte er eine Handvoll der modrigen Zettel ins Feuer befördern.
Da sprang ihm ein Wort ins Auge.
Wie unter einem Zwang verschlang er erst den dazugehörigen Satz und dann die Seite, bis ganz zum Ende.
Manche Absätze musste er mehrmals lesen, bis er seinen Augen traute.
Er blätterte vor. Er blätterte zurück. Er las weiter. Irgendwann nahm er ein Lineal aus der Schreibtischschublade und betrachtete es mit nachdenklichem Blick.
Ziegenbalg öffnete seinen Getränkeschrank. Als er sich mit bebender Hand einschenkte, klirrte die Flasche lustig gegen das Glas.
Versonnen starrte er durch das Fenster auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo eine kleine Gestalt die Treppe des Opernhauses fegte.
Und dann sagte er: »Du lieber Himmel.«
Schließlich streckte er den Kopf zur Tür hinaus und rief: »Könnte ich Sie kurz sprechen, Herr Reinfall?«
Der Leiter der Druckerei kam herein, einen Stapel Druckfahnen in der Hand. »Herr Kratzgut muss die Seite II noch mal neu gravieren«, sagte er düster. »Er hat Hunger mit sieben Buchstaben geschrieben.«
»Lesen Sie das«, befahl Ziegenbalg.
»Ich wollte gerade Mittag machen.«
»Lesen Sie.«
»Aber laut Gildentarif …«
»Es kann gut sein, dass Ihnen der Appetit vergangen ist, wenn Sie das hier gelesen haben.«
Herr Reinfall bequemte sich, Platz zu nehmen und einen Blick auf die erste Seite zu werfen.
Im Handumdrehen war er auf der zweiten.
Nach einer Weile zog er die Schreibtischschublade auf, holte ein Lineal heraus und sah es abschätzend an.
»Sie sind wohl gerade bei der Bananensuppenüberraschung«, sagte Ziegenbalg.
»Aber hallo!«
»Abwarten. Gegen den Gefleckten Pfriem ist das noch gar nichts.«
»Bei meiner Oma gab es manchmal auch Gefleckten Pfriem …«
»Aber nicht nach diesem Rezept«, gab Ziegenbalg im Brustton der Überzeugung zurück.
Reinfall blätterte aufgeregt weiter. »Du liebe Güte! Ob die Gerichte tatsächlich wirken?«
»Wen juckt’s? Laufen Sie sofort zur Gilde und heuern Sie jeden Graveur an, den Sie kriegen können. Am besten solche, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind.«
»Aber ich sitze doch noch am Almanach für nächstes Jahr, an den Vorhersagen für Gruni, Juni, August und Spuni.«
»Vergessen Sie’s. Nehmen Sie alte.«
»Das fällt doch auf.«
»Bis jetzt ist es noch nie wem aufgefallen«, sagte Herr Ziegenbalg. »Ist schließlich immer dieselbe Leier: unerwarteter Curryregen in Klatsch, plötzlicher Tod des Serifen von Iieeh, Wespenplage im Wiewunderland. Das hier ist wichtiger.«
Wieder starrte er mit leerem Blick aus dem Fenster.
»Wesentlich wichtiger.«
Und er träumte den Traum all derer, die Bücher verlegen, nämlich, so viel Gold in den Taschen zu haben, dass man zwei menschliche Hosenträger anheuern musste.
Vor ihr erhob sich das mit Säulen und Wasserspeierfratzen geschmückte Opernhaus von Ankh-Morpork.
Agnes Depp – oder zumindest der größte Teil von ihr – blieb stehen. Sie war so voluminös, dass ihre äußeren Regionen erst nach einer Weile zum Stillstand kamen.
Sie war am Ziel. Endlich. Reingehen oder weitergehen, das war hier nicht nur die Frage, sondern auch eine sogenannte Lebensentscheidung. Und mit so etwas hatte sie es noch nie zu tun gehabt.
Nachdem Agnes so lange reglos dagestanden hatte, dass eine Taube mit dem Gedanken spielte, sich auf ihrem riesigen und ziemlich lädierten schwarzen Schlapphut niederzulassen, ging sie die Treppe hinauf.
Ein junger Bursche tat so, als ob er die Stufen fegte. Doch in Wahrheit schubste er den Schmutz nur mit dem Besen hin und her, um ihm ein bisschen Abwechslung zu gönnen und Gelegenheit zu geben, neue Freundschaften zu schließen. Er trug einen langen Mantel, der ihm eine Spur zu eng war, und auf seinen schwarzen Strubbelhaaren saß rätselhafterweise eine Baskenmütze.
»Dürfte ich mal?«, fragte Agnes.
Wie von einem Schlag getroffen, fuhr der Bursche herum und stolperte erst über seine Beine und dann über den Besen.
Agnes schlug sich erschrocken die Hand vor den Mund. Dann bückte sie sich zu ihm hinunter.
»Entschuldigung! Tut mir leid!«
Seine Hand fühlte sich so klebrig und klamm an, dass jeder, der sie ergriff, sich sofort nach einem Stück Seife sehnte. Er entzog sie Agnes eilig, strich sich die fettigen Strähnen aus der Stirn und lächelte furchtsam. Nanny Ogg wäre für sein Gesicht das Wort »halbgar« eingefallen: klitschig und bleich.
»Nichts passiert, Fräulein!«
»Hast du dir wehgetan?«
Er rappelte sich auf, verkantete den Besenstiel zwischen seinen Knien und landete ein zweites Mal unsanft auf dem Hosenboden.
»Äh … soll ich solange den Besen halten?«, bot Agnes ihm an.
Nach mehreren Fehlversuchen gelang es ihr, ihm aus dem Gliederknäuel heraus und wieder auf die Beine zu helfen.
»Arbeitest du an der Oper?«, wollte Agnes wissen.
»Ja, Fräulein!«
»Äh, kannst du mir vielleicht sagen, wie ich zum Vorsingen komme?«
Er schaute wild um sich. »Bühneneingang! Ich zeig’s Ihnen!«, schoss es aus ihm heraus, als müsste er die Wörter alle auf einmal abfeuern, damit sie ihm nicht entwischen konnten.
Er riss ihr den Besen aus der Hand, stapfte die Treppe hinunter und bog um die Ecke des Opernhauses. Sein Gang war einzigartig. Als würde sein Körper mit Gewalt vorwärtsgezerrt, und seine schlackernden Beine müssten selbst zusehen, wie sie hinterherkamen. Es war weniger ein Gehen als ein unendlich verzögertes Insichzusammenkrachen.
Agnes folgte den schlenkernden Schritten durch einen Nebeneingang in das Gebäude.
Dort fand sie sich vor einem kleinen, an einer Seite halb offenen Verschlag mit einer Theke wieder. Bei der Gestalt, die dahinter stand und die Tür im Auge behielt, musste es sich wohl um einen Menschen handeln, da Walrösser nun mal keine Jacken tragen. Der junge Schlacks war in den dunklen Tiefen der Oper verschwunden.
Agnes blickte sich hilflos um.
»Ja, Fräulein?«, sagte der Walrossmann. Sein mehr als imposanter Schnurrbart wucherte so üppig, dass für den Rest des Körpers offenbar kein Wachstum mehr übrig geblieben war.
»Es geht um das … äh … Vorsingen«, stammelte Agnes. »Ich habe eine Anzeige gelesen, dass man hier vorsingen kann.«
Sie lächelte. Das Gesicht des Pförtners verriet, dass er ein verzweifeltes Lächeln schon häufiger unbeeindruckt an sich hatte abprallen lassen, als Agnes in ihrem Leben warme Mahlzeiten verspeist hatte. Und das wollte etwas heißen.
Er legte ihr ein Klemmbrett und einen Bleistiftstummel hin. »Da unterschreiben«, sagte er.
»Wer war der … Junge, der vor mir reingekommen ist?«
Ein Zucken des Schnurrbarts deutete auf ein gut verborgenes Schmunzeln hin. »Na, das war doch unser Walter Plinge.«
Mehr schien er nicht preisgeben zu wollen.
Agnes griff nach dem Bleistift.
Die wichtigste Frage lautete: Wie sollte sie sich nennen? Obwohl an ihrem Namen kaum etwas auszusetzen war, konnte man auch nicht behaupten, dass er einem perlend über die Lippen floss. Im Gegenteil. Erst klebte er am Gaumen, und nach hinten raus verpuffte er.
Leider fiel ihr keiner ein, der sich elegant von der Zunge rollen ließ.
Höchstens Katharina.
Oder … Perdita. Damit hatte sie es schon in Lancre versucht. Bis man ihr den Namen madigmachte. In Perdita schwang etwas Geheimnisvolles, Verruchtes mit, das an Ränkespiele denken ließ und, wie es der Zufall wollte, auch an eine gertenschlanke Gazelle. Außerdem hatte sie sich damals zwischen Vor- und Nachnamen ein X zugelegt, was so viel wie »eine Frau mit einem schicken und rätselhaften zweiten Vornamen« bedeuten sollte.
Die Mühe hätte sie sich sparen können. Zu ihrem Leidwesen waren die Menschen in Lancre gegen alles Schicke immun. In ihrer Heimat kannte man sie nur als »die Agnes, die sich Perditax nennt.«
Sie hatte nie den Mut besessen, sich zu dem vollständigen Namen zu bekennen, der ihr vorschwebte: Perdita X. Traum. Das wäre ihren Landsleuten viel zu hochgestochen gewesen. Agnes hätte damit nur Bemerkungen geerntet wie: »Du bildest dir ein, das wäre der richtige Name für dich? Und wieso steht dann bei dir im Zimmer noch alles mit Plüschtieren voll?«
Hier konnte sie noch einmal bei null anfangen. Aber nicht als Null. Denn sie war gut. Und das wusste sie genau.
Den Traum musste sie sich wohl trotzdem abschminken.
Dafür würde wohl der Depp an ihr kleben bleiben.
Nanny Ogg ging in der Regel früh schlafen. Sie war schließlich nicht mehr die Jüngste. Manchmal legte sie sich sogar schon um sechs Uhr morgens ins Bett.
Es war so kalt, dass ihr Atem kleine Wölkchen bildete, während sie durch den Wald stapfte. Das Laub knirschte unter ihren Stiefeln. Der Wind hatte sich gelegt, wolkenlos spannte sich der weite Himmel über ihr – ideal für den ersten Frost im Jahr, eine klirrende Kälte, die die Blütenblätter abzwickte und das Obst schrumpeln ließ. Da wusste man plötzlich wieder, warum die Natur den Beinamen »Mutter« trug.
Eine dritte Hexe, dachte Nanny Ogg.
Drei Hexen konnten sich die Arbeit besser teilen.
Jungfrau, Mutter und … altes Weib. Na also, es ging doch!
Das Problem war, dass Oma Wetterwachs alle drei Typen in sich vereinigte. Soweit Nanny wusste, war sie Jungfrau, und sie gehörte, zumindest was den Jahrgang anging, in die Gruppe der alten Weiber. Und was die zweite Kategorie betraf, nun … wer sich mit ihr anlegte, wenn sie mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden war, der kam sich vor wie eine Blüte bei Nachtfrost.
Es müsste sich doch eine Kandidatin für den frei gewordenen Posten finden lassen. In Lancre gab es schließlich genügend junge Mädchen, die vom Alter her infrage kamen.
Leider war diese Tatsache auch den jungen Burschen in Lancre bekannt. Nanny, die im Sommer des Öfteren einen Spaziergang durch die Heuwiesen unternahm, besaß ein Überhorizontgehör, dem nichts entging. Was ebenso für ihre überaus scharfen Augen galt – auch wenn sie in der Regel mindestens eins davon zudrückte. Violetta Frottisch hatte etwas mit Arglist Fuhrmann am Laufen, wobei sich das, was die beiden verband, weniger in der Senkrechten abspielte als vielmehr im rechten Winkel dazu. Bevor Bonnie Quarney im Mai mit Willi Simpel zum Nüssesammeln in den Wald gegangen war, hatte sie sich in weiser Voraussicht an Nanny gewandt und konnte sich nun bei ihr bedanken, dass sie im Februar weder fruchtbar sein noch sich mehren würde. Und für die Mutter von Mildred Kesselflicker wurde es höchste Zeit, mit dem Vater ihrer Tochter Klartext zu reden, damit der sich seinen Freund Schuster und dieser sich seinen Sohn Hob zur Brust nahm, worauf dann – nach dem einen oder anderen blauen Auge – Hochzeit gefeiert werden konnte, wie unter zivilisierten Zeitgenossen üblich.1 Ein Lächeln verklärte Nanny Oggs Züge: Keine Frage, in einem heißen Lancre-Sommer hatte der Stand der Unschuld einen besonders schweren Stand.
Und mit einem Mal kristallisierte sich aus all den Namen ein weiterer heraus. Ach ja. Die. Wieso hatte Nanny Ogg nicht schon früher an sie gedacht? Andererseits war es nur allzu verständlich. Sie kam einem einfach nicht in den Sinn, wenn man die weibliche Jugend aus Lancre vor sich Revue passieren ließ. Und wenn doch, sagte man sich: »Ach ja, die ist ja auch noch da. Patente Person. Guter Charakter. Und schöne Haare. Doch, doch.«
Sie war klug, und sie hatte Talent. In mehr als einer Hinsicht. Zum Beispiel, was ihre Stimme anging. Ihre Kräfte brachen sich mittels ihrer Stimme Bahn. Und als patente Person besaß sie, wie bereits gesagt, einen guten Charakter, weshalb keine Gefahr bestand, dass sie sich für die ihr zugedachte Rolle … disqualifizierte.
Gut, das wäre also entschieden. Oma Wetterwachs brauchte eine neue Hexe zum Schikanieren und Imponieren, und Agnes würde es ihr schon irgendwann danken.
Nanny Ogg war erleichtert. Ein Hexenzirkel brauchte mindestens drei Mitglieder. Zwei Hexen, das war nur Zwietracht.
Sie öffnete die Tür ihres Häuschens und ging die Treppe hinauf ins Schlafzimmer.
Auf dem Bett lag ihr Kater Greebo, hingegossen wie eine graue Fellpfütze. Er wachte noch nicht einmal auf, als Nanny – inzwischen im Nachthemd – ihn hochhob, um unter die Decke zu schlüpfen.
Zum Schutz gegen böse Träume genehmigte sie sich einen Schluck aus einer Flasche, der ein Geruch nach Äpfeln und Schnapsseligkeit entströmte. Sie klopfte sich ihr Kopfkissen zurecht, dachte noch einmal »Ach ja … die« und döste ein.
Bald darauf wachte Greebo auf. Er reckte und streckte sich, gähnte und sprang geräuschlos auf den Boden. Dann verschwand das tückischste und listigste Fellknäuel, das jemals die Intelligenz besessen hat, mit einer Scheibe Brot auf der Nase und aufgesperrtem Maul vor einem Vogelhäuschen zu hocken, durch das offene Fenster.
Als wenige Minuten später der Hahn im Nachbargarten den Kopf hob, um den neuen Tag zu begrüßen, kam er gerade noch bis zum »Kikeri …«, dann war er tot.
Vom Licht geblendet starrte Agnes in das höhlenartige Dunkel. In einem langen Wassertrog knapp unterhalb des Bühnenrands schwammen große flache Kerzen, die einen grellen gelben Schein verbreiteten, heller als alles, was sie von den Petroleumlampen daheim kannte. Dahinter gähnte der Zuschauerraum wie der Rachen eines riesigen, ausgehungerten Tiers.
Hinter dem Licht hervor sagte eine Stimme: »Wir wären dann so weit, Kind.«
Die Stimme war nicht einmal unfreundlich. Sie wollte nur, dass Agnes ihr Stück sang und wieder abtrat.
»Ich hätte da ein, äh, Lied mitgebracht, es ist ein …«
»Du hast Fräulein Stolzig die Noten gegeben?«
»Äh, es gibt keine Begleitmusik, es …«
»Ach. Dann ist es wohl ein Volkslied, hm?«
Im Dunkeln wurde gewispert, jemand lachte leise.
»Na, dann mal los … Perdita. Das ist doch richtig, ja?«
Agnes stimmte das Igellied an. Spätestens beim siebten Wort war ihr klar, dass sie sich das falsche Stück ausgesucht hatte. Es gehörte in ein Wirtshaus, es brauchte Leute, die mitjohlten und dazu ihre Bierkrüge auf den Tisch knallten. Die helle große Leere verschluckte es einfach und ließ ihre Stimme stocken und kieksen.
Nach der dritten Strophe brach sie ab. Sie wurde knallrot, angefangen bei den Knien. Sobald die Röte ihr Gesicht erreicht hatte – und bis dahin konnte es noch ein Weilchen dauern, weil auf dem Weg dorthin ausgedehnte Hautflächen zu überwinden waren –, würde Agnes glühen wie eine Tomate.
Wieder wurde im Zuschauerraum getuschelt. Agnes hörte unter anderem das Wort »Timbre« heraus. Es fiel auch der Ausdruck »imposante Erscheinung«, was sie nicht weiter überraschte. Dass sie nicht gerade schmächtig war, wusste sie selber. Und schließlich war das Opernhaus ebenfalls eine »imposante Erscheinung«. Aber deswegen musste ihr dieses Etikett noch lange nicht gefallen.
Die Stimme sagte: »Ich vermute, du hast keinen Unterricht bekommen, mein Kind?«
»Nein«, antwortete Agnes wahrheitsgemäß. Die einzige andere namhafte Sängerin in Lancre war Nanny Ogg, die beim Singen einen ballistischen Ansatz verfolgte. Sie visierte mit der Stimme das Ende der Strophe an und schmetterte dann einfach munter drauflos.
Tuschel, tuschel.
»Wir würden gern ein paar Leitern hören, Kind.«
Die Röte stieg bis auf Brusthöhe und überspülte die wogenden Weiten …
»Leitern? Hören?«
Getuschel. Gedämpftes Gelächter.
»Do re mi? Tonleitern, Kind. Von unten nach oben. La-la-lah?«
»Ach so. Ja.«
Während ihr die rote Flut der Scham schon bis zum Hals stand, senkte Agnes die Stimme so tief wie möglich ab und legte los.
Sie konzentrierte sich auf die einzelnen Töne und arbeitete sich vom Meeresspiegel bis in schwindelerregende Bergeshöhen empor, ohne sich davon stören zu lassen, dass anfangs ein vibrierender Stuhl über die Bühne wanderte oder zuletzt auch noch irgendwo ein Glas zersprang und ein paar Fledermäuse aus dem Gebälk fielen.
In der großen Leere des Zuschauerraums herrschte Totenstille, die nur vom Plumpsen einer weiteren Fledermaus und einem kristallischen Klirren hoch oben unter der Decke unterbrochen wurde.
»Ist das … dein gesamter Umfang, Kind?«
Rechts und links der Bühne hatten sich Grüppchen von Gaffern gebildet, die Agnes neugierig bestaunten.
»Nein.«
»Nein?«
»Wenn ich höher raufgehe, fallen die Leute in Ohnmacht«, sagte Agnes. »Gehe ich tiefer runter, wird ihnen schwummerig.«
Tuschel, tuschel. Tuschel, tuschel, tuschel.
»Und, äh, sonst …?«
»Ich kann mit mir selber in der Terz singen. Nanny Ogg meint, das hat nicht jeder drauf.«
»Wie bitte?«
»Na, zum Beispiel do mi. Gleichzeitig.«
Tuschel, tuschel.
»Lass hören, Kind.«
𝅘𝅘𝅥Laaaaaa 𝅘𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅘
Aus den Kulissen drang aufgeregtes Stimmengewirr.
Die Stimme aus dem Dunkeln sagte: »Und die Reichweite?«
»Wenn’s weiter nichts ist«, knurrte Agnes. Allmählich reichte es ihr. »Wie weit hätten Sie’s denn gerne?«
»Wie bitte? Ich meinte doch …«
Agnes knirschte mit den Zähnen. Sie war gut. Und das würde sie ihnen beweisen.
»Dahin?«
»Oder dorthin?«
»Oder bis nach da drüben?«
Eigentlich war es keine besondere Kunst. Einer Puppe, die man im Arm hielt oder auf dem Schoß sitzen hatte, die eigene Stimme in den Mund zu legen, wie man es manchmal auf dem Jahrmarkt sah, konnte sehr beeindruckend sein. Aber schwierig wurde es erst über eine größere Entfernung hinweg. Ein ganzer Zuschauerraum ließ sich nicht so leicht täuschen.
Nachdem sie sich inzwischen an das Dämmerlicht gewöhnt hatte, konnte sie auch die ungläubigen Gesichter erkennen, mit denen die Leute vor ihr einander ansahen.
»Wie heißt du noch mal, mein Kind?« Die Stimme, in der vorhin noch ein Anflug von Herablassung mitgeschwungen hatte, klang jetzt eindeutig fix und fertig.
»Agn… Per… Perdita«, sagte Agnes. »Perdita Depp. Perdita X. … Depp.«
»Ich fürchte nur, bei dem Depp wird es wohl nicht bleiben können.«
Die Tür des Häuschens öffnete sich wie von Zauberhand.
Jori Weber zögerte. Aber Oma Wetterwachs war nun mal eine Hexe. Man hatte ihn vorgewarnt, dass so etwas passieren könnte.
Es gefiel ihm nicht. Doch sein Rücken gefiel ihm auch nicht, was spürbar auf Gegenseitigkeit beruhte. Da hörte sich wirklich alles auf, wenn sich die eigenen Wirbel gegen einen verschworen.
Mit schmerzverzerrtem Gesicht schleppte er sich auf seinen Krücken ins Haus.
Die Hexe saß mit dem Rücken zur Tür im Schaukelstuhl.
Jori blieb stehen.
»Komm rein, Jori Weber«, sagte Oma Wetterwachs. »Ich habe ein Mittel für deinen Rücken.«
Der Schreck fuhr ihm in die Glieder und löste im Gürtelbereich eine weißglühende Explosion aus.
Oma Wetterwachs verdrehte die Augen und seufzte. »Kannst du dich hinsetzen?«
»Nein, Frau Wetterwachs. Ich kann mich höchstens auf einen Stuhl sacken lassen.«
Oma Wetterwachs zog ein schwarzes Fläschchen aus ihrer Schürzentasche und schüttelte es kräftig durch. Jori sah sie entgeistert an.
»Das haben Sie schon für mich vorbereitet?«, fragte er.
»Ja«, antwortete Oma Wetterwachs wahrheitsgemäß. Sie hatte sich schon lange damit abgefunden, dass die Kranken ein Fläschchen mit einer seltsam gefärbten, klebrigen Flüssigkeit von ihr erwarteten. Dabei kam es bei einer Behandlung gar nicht auf die Medizin an, sondern, wenn man so wollte, auf den Löffel.
»Es ist eine Mixtur aus seltenen Kräutern und anderem«, fuhr sie fort. »Darunter auch Sacher-Rose und Ackwa.«
»Donnerwetter«, staunte Jori.
»Trink was davon.«
Er gehorchte. Es schmeckte leicht nach Lakritz.
»Bevor du ins Bett gehst, nimmst du noch einen Schluck. Danach gehst du dreimal um einen Kastanienbaum.«
»… dreimal um einen Kastanienbaum …«
»Und … du legst ein Brett unter deine Matratze. Aber es muss von einer zwanzig Jahre alten Kiefer sein, hörst du?«
»… zwanzig Jahre alte Kiefer …«, wiederholte Jori. Er wollte auch etwas zu dem Gespräch beitragen: »Damit die Verknotungen aus meinem Rücken in das Brett wandern?«
Oma Wetterwachs war beeindruckt. Diesen abenteuerlichen Erklärungsversuch musste sie sich merken.
»Du hast es erfasst«, sagte sie.
»War das etwa schon alles?«
»Wieso? Was hattest du dir denn noch erwartet?«
»Na, Tänze und Beschwörungen und so.«
»Das hab ich alles schon erledigt, bevor du bei mir anklopfen wolltest«, sagte Oma Wetterwachs.
»Donnerwetter. Ja, aha. Und was die … Bezahlung angeht …?«
»Du brauchst mich nicht zu bezahlen. Geld anzunehmen bringt Unglück.«
»Na, wenn das so ist …« Jori strahlte.
»Aber falls deine Frau vielleicht … ein paar abgelegte Kleider hätte … Ich trage Größe zwölf, Lieblingsfarbe Schwarz. Oder wenn sie einen Kuchen backt … allerdings ohne Dörrpflaumen, davon kriege ich Blähungen. Oder ihr habt mal ein Stück vom Braten übrig. Oder du schlachtest bald mal wieder ein Schwein. Ein schönes Lendenstück wäre auch nicht zu verachten, genauso wenig wie ein Schinken und ein paar Haxen … also eigentlich alles, was dabei so abfällt. Ist natürlich rein freiwillig. Bloß weil ich eine Hexe bin, würde ich doch keinen zu irgendwas zwingen. Bei dir zu Hause ist alles wohlauf, ja? Alles bei bester Gesundheit, will ich hoffen?«
Sie sah zu, wie es in ihm arbeitete. »So, und jetzt helfe ich dir noch nach draußen«, sagte sie.
Was als Nächstes geschah, hat Weber seiner Lebtag nicht ganz begriffen. Auf dem Weg zur Tür stolperte die sonst so trittsichere Oma Wetterwachs über eine der Krücken, kippte nach hinten, klammerte sich an seine Schultern, riss das Knie hoch und traf ihn mitten ins Kreuz. Es machte klick …
»Aaah!«
»’tschuldigung!«
»Mein Rücken! Mein Rücken!«
Nun gut, sie ist schließlich eine alte Frau, dachte Jori auf dem Heimweg. Aber eins stand fest: Auch wenn sie langsam tatterig wurde und schon immer ein bisschen gesponnen hatte, braute sie gute Heiltränke. Die auch noch ungeheuer schnell anschlugen. Als er zu Hause ankam, trug er die Krücken unterm Arm.
Oma Wetterwachs blickte ihm kopfschüttelnd nach.
Die Menschen waren mit Blindheit geschlagen. Sie ließen sich lieber irgendwelchen Humbug weismachen, als an Chiropraktik zu glauben.
Das konnte ihr nur recht sein. Es kam ihr sehr gelegen, wenn ihre Besucher Bauklötze staunten, weil sie anscheinend, ohne hinzusehen, wusste, wer da zu ihr unterwegs war, statt sich zusammenzureimen, dass man von ihrem Häuschen aus einen sehr günstigen Blick auf die nächste Wegbiegung hatte. Das Gleiche galt auch für den Trick mit dem Türriegel und der schwarzen Schnur.2
Aber was war nur über sie gekommen? Einen harmlosen alten Trottel so reinzulegen?
Eine Oma Wetterwachs, die es schon mit Zauberern, Ungeheuern und Elfen aufgenommen hatte, lachte sich ins Fäustchen, weil sie Jori Weber ausgetrickst hatte, einen Mann, der bei der Wahl zum Dorfdeppen schon zweimal wegen Überqualifikation gescheitert war.
War das der Anfang vom Ende? Wenn sie nicht aufpasste, würde sie bald gackeln und brabbeln und Kinder in ihren Backofen locken. Und das, obwohl sie Kinder noch nicht mal mochte!
Jahrelang war Oma Wetterwachs mit den Herausforderungen, die ihr das Dorfleben zu bieten hatte, zufrieden gewesen. Doch seit sie eine Reise unternommen und etwas von der Welt gesehen hatte, erfüllte sie eine innere Unruhe, vor allem zu dieser Jahreszeit, wenn der Zug der Wildgänse begann und in den tieferen Tälern die ersten Nachtfröste unschuldige Blätter meuchelten.
Sie blickte sich in der Küche um. Müsste mal wieder ausgefegt werden. Der Abwasch türmte sich ebenfalls. Die Wände waren schmuddelig. Es gab so viel zu tun, dass sie sich zu überhaupt nichts aufraffen konnte.
Hoch über ihr rauschte unter schrillem Geschrei eine zerfranste V-Formation über die Lichtung.
Die Gänse waren auf dem Weg in wärmere Gefilde, die Oma Wetterwachs nur vom Hörensagen kannte.
Sie konnte der Versuchung kaum widerstehen.
Das Auswahlkomitee tagte im Büro von Emil Eimer, dem neuen Besitzer des Opernhauses. Neben ihm gehörten dem Gremium noch Generalmusikdirektor Salzella und Chorleiter Dr. Unterschacht an.
»Dann kommen wir jetzt zu … mal sehen … ja, zu Christine«, sagte Herr Eimer. »Unglaubliche Bühnenpräsenz, was? Und erst die Figur!« Er zwinkerte Dr. Unterschacht zu.
»Ja, sie ist schon was fürs Auge«, gab der ungerührt zurück. »Bloß singen kann sie nicht.«
»Ihr Künstlertypen kapiert einfach nicht, dass wir im Jahrhundert des Flughunds leben«, sagte Eimer. »Eine Oper ist auch Show und nicht nur Geträller.«
»Das sagen Sie. Aber …«
»Die Vorstellung, dass eine Sopranistin aus einem gewaltig wogenden Busen und einem Helm mit Hörnern zu bestehen hat, ist Schnee von gestern.«
Salzella und Unterschacht wechselten einen verständnisinnigen Blick. Mit so einer Sorte von Besitzer würden sie es also zu tun bekommen …
»Leider ist die Vorstellung, dass eine Sopranistin über eine einigermaßen passable Singstimme verfügen sollte, noch immer hochaktuell«, sagte Salzella säuerlich. »Christine hat eine gute Figur, das schon. Und sie besitzt tatsächlich das … gewisse Etwas. Aber sie kann nicht singen.«
»Und wenn man es ihr beibringt?«, fragte Eimer. »Ein paar Jährchen im Chor und …«
»Aber sicher doch. Wenn ich das die paar Jährchen überlebe, schaffe ich es vielleicht, sie von ungenügend auf mangelhaft zu hieven«, knurrte Unterschacht.
»Äh, meine Herren«, sagte Eimer. »Ähem. Na gut. Spielen wir mit offenen Karten. Ich bin nur ein einfacher Mann. Bei mir wird nicht lange auf den Busch geklopft, um den heißen Brei herumgeredet oder mit irgendwas hinterm Berg gehalten …«
»Sprechen Sie sich ruhig offen aus«, ermunterte ihn Salzella. Ja, wahrhaftig, die Sorte von Besitzer. Einer, der es aus eigener Kraft zu etwas gebracht hatte und stolz darauf war. Der ruppige Ehrlichkeit nicht von grober Unhöflichkeit unterscheiden konnte. Der Generalmusikdirektor hätte einen Dollar darauf verwettet, dass Eimer glaubte, den Charakter eines Menschen am Händedruck erkennen zu können – und nach einem festen Blick in seine Augen.
»Ich habe mir alles im Leben hart erarbeitet«, begann Eimer. »Nur deshalb stehe ich heute da, wo ich stehe …«
Nämlich uns im Weg rum, dachte Salzella.
»… doch ich muss auch, äh, ein gewisses finanzielles Interesse eingestehen. Christines Vater, der mir, äh, für den Kauf dieses Gebäudes, äh, eine schöne Stange Geld geliehen hat, ist bezüglich seiner Tochter mit einer zutiefst väterlichen Bitte an mich herangetreten. Wenn ich mich recht an den, äh, genauen Wortlaut entsinne, lautete er: ›Zwingen Sie mich nicht, Ihnen die Beine zu brechen.‹ Von Ihnen als Künstler kann ich dafür vermutlich kein Verständnis erwarten. Aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Hilf dir selbst, dann helfen dir die Götter, das ist meine Devise.«
Salzella steckte die Hände in die Westentaschen, lehnte sich zurück und pfiff leise vor sich hin.
»Schon klar.« Unterschacht nickte. »Ist alles schon vorgekommen. Aber normalerweise geht es natürlich um eine Ballerina.«
»Nein, nein, die Sache liegt völlig anders«, sagte Eimer hastig. »Es ist nur so: Keine Kohle ohne Christine. Und Sie müssen doch auch zugeben, dass sie wirklich toll aussieht.«
»Na gut«, willigte Salzella ein. »Schließlich gehört die Oper ja Ihnen. Und nun zu … Perdita …?«
Die Männer schmunzelten.
»Perdita!«, rief Eimer. Er war erleichtert, dass sich das Problem mit Christine so schnell von selbst gelöst hatte. Endlich konnte er wieder ruppig und ehrlich sein.
»Perdita X.«, berichtigte Salzella.
»Was diese Mädchen sich aber auch alles einfallen lassen.«
»Ich glaube, sie wäre ein echter Gewinn für uns«, sagte Unterschacht.
»Auf jeden Fall, wenn wir irgendwann mal die Oper mit den Elefanten aufführen.«
»Dieser Umfang … dieser unfassbare Umfang …«
»Eben. Was Sie für Augen gemacht haben …«
»Ich meinte doch ihren Stimmumfang, Salzella. Was für ein Volumen! Stellen Sie sich doch nur vor, wie der Chor davon profitieren würde.«
»Sie ist ein Chor. Wir könnten alle anderen auf die Straße setzen. Götter, sie singt sogar mehrstimmig mit sich selbst. Aber ist sie in einer Hauptrolle vorstellbar?«
»Gute Güte, nein. Wir würden uns zum Gespött der Leute machen.«
»Genau. Dafür scheint sie zum Glück sehr … fügsam zu sein.«
»Ja, patente Person. Guter Charakter. Und natürlich schöne Haare.«
So einfach hatte sie es sich nicht vorgestellt …
Wie in Trance hörte sich Agnes an, wie hoch ihre Gage ausfallen würde (nicht sehr hoch), wie viel Unterricht sie nehmen musste (ganz schön viel) und wo sie untergebracht werden sollte (der Chor wohnte in der Oper, ganz oben unterm Dach, juchhe).
Anschließend stand sie mehr oder weniger unbeachtet in der Gegend herum. Vom Bühnenrand aus sah sie zu, wie die Mädchen, die fürs Ballett vortanzten, zierlich die Beinchen hoben.
»Du hast eine wahnsinnig tolle Stimme!«, sagte eine Stimme hinter ihr.
Sie drehte sich um. Wie Nanny Ogg einmal so treffend bemerkt hatte: Es war jedes Mal wieder ein Aha-Erlebnis, wenn Agnes sich umdrehte. Zwar war sie durchaus flink auf den Beinen, aber wegen des Trägheitsmoments bekamen die äußeren Regionen ihres Körpers immer erst mit geraumer Verzögerung mit, wo vorne und hinten war.
Das Mädchen, dem die Stimme gehörte, ein schon nach normalen Maßstäben zierliches Persönchen, gab sich die größte Mühe, noch schlanker zu erscheinen. Sie hatte langes blondes Haar und trug das zufriedene Lächeln eines weiblichen Wesens zur Schau, das genau weiß, wie schlank und blond es ist.
»Ich heiße Christine!«, sagte sie. »Ist das nicht alles spannend hier?!«
Mit einem wie angeschraubt wirkenden aufgeregten Kiekser konnte sie eine Frage so klingen lassen, als wäre sie mit einem Ausrufezeichen garniert.
»Äh, ja«, antwortete Agnes.
»Auf diesen Tag habe ich jahrelang gewartet!«
Bei Agnes waren es ungefähr vierundzwanzig Stunden gewesen. Seit sie den Anschlag am Opernhaus gelesen hatte. Aber das behielt sie lieber für sich.
»Bei wem hast du deine Ausbildung gemacht?!«, fragte Christine. »Ich war drei Jahre bei Madame Venturi auf dem Konservatorium in Quirm!«
»Äh, ich war bei …« Agnes zögerte. Sie probierte den Satz, der ihr auf der Zunge lag, erst mal in Gedanken aus. »… bei Dame Ogg. Aber Konserven hatte sie keine. Sie kocht alles frisch.«
Christine hakte nicht weiter nach. Was sie nicht auf Anhieb verstand, ignorierte sie einfach.
»Im Chor verdient man nicht viel, oder?!«, fragte sie.
»Nein.« Da brachte sogar das Schrubben von Fußböden einiges mehr ein. Und warum? Weil einem, wenn man einen dreckigen Fußboden hatte, nicht gleich Hunderte Putzwillige die Bude einrannten.
»Aber das Singen war schon immer mein sehnlichster Wunsch! Und wir bekommen ja auch noch Ruhm und Ehre dazu!«
»Wird wohl so sein.«
»Ich hab mir schon unsere Zimmer angesehen! Sie sind winzig! Welche Nummer hast du?!«
Agnes warf einen abwesenden Blick auf den Schlüssel, den sie bekommen hatte, begleitet von zahlreichen strengen Anweisungen wie Keine Männerbesuche und einem abschätzigen Blick, der besagte: Die Warnung kann ich mir bei dir ja wohl sparen.
»Äh … 17.«
Christine klatschte in die Hände. »Famos!«
»Wie bitte?«
»Ich freu mich so!! Du wohnst neben mir!!«
Agnes war perplex. Sie hatte sich schon lange damit abgefunden, im großen Spiel des Lebens immer als Letzte in eine Mannschaft gewählt zu werden.
»Hm … ja … sieht so aus«, sagte sie.
»Was für ein Glückspilz du bist!! Mit dieser majestätischen Opernfigur!! Und deiner schicken Hochsteckfrisur!! Übrigens, Schwarz steht dir ganz ausgezeichnet!!«
Majestätisch? Dieses Wort wäre Agnes im Traum nicht eingefallen. Und Schwarz trug sie nur deshalb, weil sie in Weiß wie eine Wäscheleine im Wind aussah.
Agnes folgte ihrer neuen Sangesschwester zu den Unterkünften. Wenn man sich mit dieser Christine über längere Zeit in einem Raum aufhielt, war es sicher ratsam, ein Fenster aufzumachen, um nicht Gefahr zu laufen, in Satzzeichen zu ertrinken.
Aus dem Bühnendunkel sah ein heimlicher Beobachter den Mädchen unbemerkt nach.
Die meisten Menschen freuten sich, Nanny Ogg zu sehen. In ihrer Gegenwart fühlte man sich auch im eigenen Heim gleich wie zu Hause.
Aber da sie nun einmal eine Hexe war, verstand sie sich darauf, immer gerade dann aufzutauchen, wenn die Kuchen aus dem Backrohr oder die Würste aus dem Kessel kamen. Für den Fall, dass ihr jemand etwas »schenken« wollte, hatte Nanny Ogg in dem einen Bein ihres knielangen Schlüpfers normalerweise ein Einkaufsnetz dabei.
»Und, Frau Depp?«, bemerkte sie nach dem circa dritten Teilchen und der vierten Tasse Tee. »Wie geht es denn Ihrer Tochter so? Ich meine Ihre Agnes.«
»Ach, wussten Sie das noch gar nicht, Frau Ogg? Sie ist doch nach Ankh-Morpork gegangen, um Sängerin zu werden.«
Nanny Ogg wurde das Herz schwer.
»Wie schön«, sagte sie. »Sie ist ja auch eine gute Sängerin. Ich hab ihr ein paar Tipps gegeben. Man konnte sie immer im Wald singen hören.«
»Das kommt von unserer frischen Bergluft. Die stärkt die Brust.«
»Wofür Agnes das beste Beispiel ist. Dann ist sie … äh … also nicht mehr … da?«
»Sie kennen doch unsere Agnes. Ist ein stilles Wasser. Ich glaube, es war ihr hier einfach zu langweilig.«
»Langweilig? In Lancre?«
»Das war genau meine Rede«, sagte Frau Depp. »Dass wir die herrlichsten Sonnenuntergänge zu bieten haben. Und einmal im Jahr die Seelenkuchendienstagskirmes.«
Nanny Ogg ließ sich Agnes durch den Kopf gehen. Eine nicht zu unterschätzende Leistung bei diesem Umfang.
Lancre hatte von jeher starke, tüchtige Frauen hervorgebracht. Ein Bauer brauchte ein Weib, dem es nichts ausmachte, einen Wolf mit der Schürze zu erschlagen, wenn sie zum Holzholen aus dem Haus ging. Zwar interessierten sich die Männer anfangs mehr fürs Küssen als fürs Kochen, doch wenn sich ein strammer Bursche aus Lancre verheiraten wollte, nahm er sich den Rat seines Vaters zu Herzen, wonach der Küsse Glut über kurz oder lang erkaltete, die Kochkunst aber mit den Jahren immer besser wurde, und suchte sich eine Braut aus einer Familie, der man ansah, dass sie herzhafte Hausmannskost zu schätzen wusste.
Agnes war auf eine ausladende Art durchaus ansehnlich, ein Prachtexemplar Lancrescher Weiblichkeit. An jedem anderen Ort hätte sie sogar für zwei Prachtexemplare gereicht.
Nanny hatte sie als eher nachdenklich und scheu in Erinnerung, als ob sie von der Welt nicht allzu viel an sich heranlassen wollte.
Aber Agnes ließ auch Anzeichen von magischem Talent erkennen. Wie wohl nicht anders zu erwarten. Nichts eignete sich schließlich besser dafür, die magischen Nerven zu stimulieren, als das Gefühl, nicht dazuzugehören; darum war Esme ja auch so eine große Hexe. Bei Agnes manifestierte sich dieses Gefühl darin, dass sie sich weiß schminkte, schlabbrige schwarze Spitzenhandschuhe trug und sich Perdita nannte – plus einen Buchstaben vom Arsch des Alphabets. Nanny war bis jetzt davon ausgegangen, dass es mit diesen Anwandlungen vorbei wäre, sobald Agnes genügend magische Erfahrung gesammelt hatte. Und das würde nicht lange dauern. Sie war zwar schwer, aber nicht schwer von Begriff.
Warum hatte sie nicht besser zugehört, wenn Agnes von der Musik schwärmte? Die magischen Kräfte fanden immer ein Ventil …
Musik und Magie besaßen viele Gemeinsamkeiten. Beide fingen mit M an, beide waren weiblich. Und sie schlossen einander aus.
Mist. Nanny hatte so große Hoffnungen in das Mädchen gesetzt.
»Agnes hat sich aus Ankh-Morpork dauernd Noten kommen lassen«, sagte Frau Depp. »Sehen Sie, hier.« Sie drückte ihr mehrere Stapel Papier in die Hand.
Liedblätter kannte man natürlich auch in den Spitzhornbergen, und das Singen in geselliger Runde galt als die drittbeste Freizeitbeschäftigung für einen langen, dunklen Abend. Aber Nanny erkannte auf den ersten Blick, dass es sich hier nicht um stinknormale Noten handelte. Dafür waren die Blätter viel zu vollgeschrieben.
»Die Meistersinger von Skrote«, las sie vor. »Così fan Hita.«
»Das ist ausländisch«, verkündete Frau Depp stolz.
»Und wie.«
Agnes’ Mutter sah Nanny gespannt an.
»Ja?«, sagte die. Und dann: »Ach so.«
Frau Depps Blick wanderte zu ihrer leeren Teetasse und wieder zurück.
Seufzend legte Nanny Ogg die Liedblätter aus der Hand. Ausnahmsweise musste sie ihrer Freundin Esme Wetterwachs recht geben. Die Menschen erwarteten einfach zu wenig von einer Hexe.
»Aber immer wieder gerne doch.« Sie rang sich so etwas Ähnliches wie ein Lächeln ab. »Dann wollen wir mal sehen, was das Schicksal in Form von vertrockneten Blattkrümeln für uns bereithält.«
Sie setzte eine angemessen okkulte Miene auf und senkte den Blick in die Tasse.
Die in der nächsten Sekunde auf dem Fußboden landete und in tausend Stücke zersprang.
Es war eine kleine Kammer. Beziehungsweise eine halbe kleine Kammer, da in der Mitte eine dünne Wand eingezogen war. Der Chornachwuchs rangierte in der Hierarchie der Oper noch ein gutes Stück unter den Kulissenschieberlehrlingen.
Es gab gerade genug Platz für ein Bett, einen Kleiderschrank, eine Frisierkommode und – so seltsam es anmuten mochte – für einen riesigen Spiegel, der so groß war wie die Tür.
»Ein Wahnsinnsteil, was?!«, sagte Christine. »Man kann ihn nicht abnehmen, er ist in die Wand eingelassen!! Der wird uns bestimmt noch gute Dienste leisten!!«
Agnes schwieg. In ihrem Zimmerchen, der anderen Hälfte von Christines Kammer, gab es keinen Spiegel. Was sie ganz und gar nicht störte. Sie betrachtete nicht automatisch jeden Spiegel als ihren Freund. Und das lag nicht nur an den Bildern, die sie darin zu sehen bekam. Spiegel hatten etwas … Beunruhigendes an sich. Das hatte sie schon immer so empfunden. Es war, als starrten sie einen an. Und Agnes ließ sich nicht gern anstarren.
Christine stellte sich in die sehr kleine Zimmermitte und drehte eine Pirouette. Es machte Spaß, ihr dabei zuzusehen. Sie besaß eben das gewisse Etwas. Alles an ihr ließ an Pailletten denken.
»Ist das nicht schön?!«, sagte sie.
Wer Christine nicht mochte, der mochte auch keine niedlichen, flauschigen Schmusetiere. Denn genauso wirkte sie: wie ein niedliches, flauschiges Schmusetier. Ein Kaninchen vielleicht. Auf jeden Fall hatte sie an neuen Ideen lange zu knabbern. Sie konnte sie nur in zurechtgemümmelten Häppchen verarbeiten.
Agnes warf erneut einen Blick in den Spiegel. Ihr Spiegelbild starrte sie an. Sie wäre jetzt gern allein gewesen. Es war alles so schnell gegangen. Und irgendwie war ihr die ganze Oper auch unheimlich. Wenn sie ein bisschen Zeit für sich haben könnte, würde es ihr gleich besser gehen.
Christine hörte auf, sich zu drehen. »Alles in Ordnung?!«
Agnes nickte.
»Erzähl mir was von dir!!«
»Äh … tja.« Agnes freute sich über die Aufforderung, sie konnte nicht anders. »Ich komme aus einem Dorf in den Bergen, von dem du bestimmt noch nie gehört hast …«
Sie brach ab. Christines Blick war glasig geworden. Agnes hätte genauso gut gegen eine Wand reden können. Die neue Kollegin interessierte sich kein bisschen für sie; sie hielt es bloß nicht aus, nichts zu sagen. Also fuhr Agnes fort: »Mein Vater ist der Kaiser von Klatsch und meine Mutter ein kleines Tablett mit Puddingschälchen.«
»Faszinierend!« Christine sah in den Spiegel. »Findest du, meine Frisur sitzt?!«
Wäre Christine fähig gewesen, länger als ein, zwei Sekunden zuzuhören, hätte Agnes ihr Folgendes erzählt:
Dass sie eines Morgens mit der schrecklichen Erkenntnis aufgewacht war, mit einem guten Charakter geschlagen zu sein. Ach ja, und natürlich mit schönen Haaren. Damit war eigentlich alles gesagt.
Dabei störte sie nicht so sehr der Charakter, sondern das Aber, das die Leute davorstellten oder hinten dranhängten. Aber sie hat einen guten Charakter, hieß es immer über sie. Nein, am meisten wurmte es sie, dass man ihn ihr einfach aufs Auge gedrückt hatte. Vor ihrer Geburt hatte sie keiner gefragt, ob sie einen guten Charakter haben wollte oder nicht vielleicht doch lieber einen schwierigen, der in einem Körper mit Konfektionsgröße 36 steckte. Stattdessen musste sie sich dauernd sagen lassen, dass nicht nur das Äußere zählte – als ob sich jemals ein Mann in ein attraktives Nierenpaar verguckt hätte.
Agnes sah eine Zukunft vor sich, die sich wie eine bleierne Decke auf sie niedersenkte.
Sie hatte sich schon dabei ertappt, dass sie »huch!« und »hoppla!« sagte, wenn sie eigentlich fluchen wollte. Und rosa Briefpapier benutzte sie auch.
Ihr ging der Ruf voraus, bei jedem Notfall einen kühlen Kopf zu bewahren und ruhig zu bleiben.
Wenn sie nicht aufpasste, würde sie schon bald genauso gute Plätzchen und Apfelkuchen backen wie ihre Mutter. Dann war sie endgültig verloren.
Deshalb hatte sie Perdita erfunden, ihr Alter Ego mit dem schlechten Charakter. So wie ja angeblich auch in jeder dicken Frau eine dünne steckt, die raus will.3 In Perdita konnte sie all die Gedanken unterbringen, die sie sich wegen ihres guten Charakters als Agnes nicht erlauben durfte. Sie schrieb, wenn irgend möglich, auf schwarzes Briefpapier und fiel durch hinreißende Blässe auf statt durch eine knallrote Birne. Perdita gab sich als faszinierende verlorene Seele mit pflaumenfarbenem Lippenstift, auch wenn Agnes manchmal den Verdacht hatte, dass sie genauso dumm war wie sie.
Waren die Hexen ihre letzte Rettung? Ihr schwante schon länger, dass sie sich für sie interessierten. Es war ein unbestimmtes Gefühl, so ähnlich, wie wenn man glaubte, beobachtet zu werden. Was nicht heißen sollte, dass sie Nanny Ogg nicht tatsächlich schon dabei erwischt hatte, wie sie ein kritisches Auge auf sie warf. Ganz so, als wäre Agnes ein gebrauchter Gaul.
Agnes war klar, dass sie Talent hatte. Manchmal wusste sie vorher, dass etwas geschehen würde, wenngleich dieses Wissen natürlich derart verworren daherkam, dass es vollkommen nutzlos war. Und ihre Stimme war auch nicht ganz von dieser Welt. Sie hatte schon immer gern gesungen, und ihre Stimme machte einfach alles mit, was sie von ihr verlangte.
Andererseits sah sie, wie die Hexen lebten. Wobei … Nanny Ogg war in Ordnung, eine richtig nette alte Schachtel. Aber die Übrigen waren sonderbar. Sie lagen irgendwie mit der Welt über Kreuz statt auf einer Linie wie jeder an-dere Mensch. Muhme Dismass zum Beispiel, die in die Vergangenheit und in die Zukunft blicken konnte, in der Gegenwart aber stockblind durch die Gegend taperte, oder Millie Hüpfgut drüben in Schnitte mit ihrem Gestotter und den laufenden Ohren, und dann erst Oma Wetterwachs …
Aber sicher doch. Der beste Beruf der Welt? Eine verbiesterte Alte ohne Freunde zu sein?
Und immer suchten sie nach Frauen, die genau solche Sonderlinge waren wie sie selbst.
Tja, nach ihr konnten sie lange suchen.
Angewidert von Lancre, den Hexen und vor allem davon, Agnes Depp zu sein, hatte sie … die Flucht ergriffen.
Nanny Ogg sah nicht wie die geborene Läuferin aus, aber das täuschte. Sie war so wieselflink, dass das Laub unter ihren schweren Stiefeln in dichten Wolken emporstob.
Trötend zog eine Schar Wildgänse über sie hinweg, dem Sommer so pfeilschnell auf den Fersen, dass sich ihre Flügel anscheinend kaum bewegten.
Oma Wetterwachs’ Häuschen sah nicht nur leer, sondern regelrecht verlassen aus.
Nanny hastete zur Hintertür, stürmte hindurch, polterte die Treppe hinauf, erblickte die hagere Gestalt im Bett, kam auf der Stelle zu einem alarmierenden Schluss, schnappte sich den Wasserkrug vom Waschtisch, stürzte zum Bett und …
Eine Hand fuhr hoch und hielt ihren Arm fest.
»Ich mach doch nur ein Nickerchen.« Oma Wetterwachs schlug die Augen auf. »Gytha, du altes Trampeltier, ich konnte dich schon aus einer halben Meile Entfernung spüren …«
»Wir brauchen sofort eine Tasse Tee!«, japste Nanny, der vor Erleichterung fast die Beine wegsackten.
Oma Wetterwachs war mehr als nur klug genug, keine Fragen zu stellen.
Aber eine gute Tasse Tee braucht ihre Zeit. Während ihre Freundin das Feuer anfachte, die kleinen Frösche aus dem Eimer fischte, das Wasser aufsetzte und den Aufguss gut durchziehen ließ, zappelte Nanny unruhig herum.
»Ich sage nichts«, sagte sie und setzte sich endlich hin. »Schenk ein, dann siehst du’s schon.«
In der Regel hielten Hexen nichts davon, in Teeblättern zu lesen. Teeblätter sind bei Weitem nicht einzigartig darin zu wissen, was die Zukunft bringt. Sie bieten lediglich den Augen Halt, während der Verstand die eigentliche Arbeit verrichtet. Theoretisch eignete sich alles Mögliche dafür: die Blasen auf einer Pfütze, die Haut auf der Vanille-soße … Gott weiß was. Nanny Ogg konnte die Zukunft in der Schaumkrone auf einem Bier erkennen. Fast immer sah sie dann voraus, dass sie in Bälde ein kühles Blondes zischen würde, ohne dafür bezahlen zu müssen.
»Du kennst doch Agnes Depp?«, fragte Nanny, während die Hausherrin nach der Milch suchte.
Oma Wetterwachs antwortete nicht gleich. »Die sich Perditax nennt?«
»Perdita X.« Nanny gestand jedem Menschen das Recht zu, sich neu zu erfinden.
Ihre Freundin zuckte mit den Schultern. »Dickes Mädchen. Viele Haare. Geht übern dicken Onkel. Singt im Wald vor sich hin. Gute Stimme. Liest Bücher. Sagt huch, statt zu fluchen. Wird rot, wenn man sie ansieht. Trägt schwarze Spitzenhandschuhe mit abgeschnittenen Fingern.«
»Wir hatten doch mal überlegt, ob sie nicht vielleicht für uns infrage kommen könnte.«
»Auf jeden Fall hat sie einen Knacks in der Seele, das stimmt«, meinte Oma Wetterwachs. »Aber dieser unselige Name …«
»Ihr Vater hieß Terminus«, sagte Nanny Ogg nachdenklich. »Er war einer von drei Brüdern: Primus, Sekundär und Terminus. Mit Bildung hatte die Familie anscheinend nie viel am Hut.«
»Ich meinte doch Agnes«, knurrte Oma Wetterwachs. »Bei dem Namen muss ich immer an Wollmäuse denken.«
»Wahrscheinlich nennt sie sich deswegen Perdita.«
»Umso schlimmer.«
»Hast du sie im Kopf?«, fragte Nanny.
»Doch, ja.«
»Gut. Dann guckst du dir jetzt die Teeblätter an.«
Oma Wetterwachs senkte den Blick.
Nachdem Nanny es so spannend gemacht hatte, fiel die Reaktion ihrer Freundin nicht besonders dramatisch aus. Aber immerhin zischte sie leise durch die Zähne.
»So, so. Das ist ja ein Ding«, sagte sie.
»Siehst du’s? Siehst du’s?«
»Ich seh’s.«
»So was wie ein … Totenschädel?«
»Ich seh’s.«
»Und die Augen! Ich hätte mir fast in den Schlüpfer ge … Äh, die haben mich doch sehr überrascht.«
Vorsichtig stellte Oma Wetterwachs die Tasse ab.
»Frau Depp hat mir die Briefe gezeigt, die Agnes nach Hause geschrieben hat«, fuhr Nanny fort. »Ich habe sie hier. Ich mach mir Sorgen, Esme. Womöglich ist sie in Gefahr. Ein Mädel aus Lancre. Eine von uns. Wie sage ich immer? Für unsere Jugend darf uns keine Mühe zu groß sein.«
»Der Tee kann die Zukunft nicht vorhersagen«, murmelte Oma Wetterwachs. »Das weiß doch jeder.«
»Bloß der Tee nicht.«
»Wer käme denn auch auf die Schnapsidee, seine Geheimnisse einer Handvoll getrockneter Blätter anzuvertrauen?«
Nanny Ogg betrachtete Agnes’ Briefe. Sie waren in akkuraten, runden Buchstaben geschrieben, als hätte die Verfasserin das Schreiben durch Abmalen von Buchstaben auf einer Schiefertafel gelernt und später nie ausreichend Übung bekommen, um ihre Schrift noch weiterzuentwickeln. Die Briefbögen waren dünn mit Bleistift liniert.
Liebe Mama, wie geht es Dir? Mir geht es gut. Ich bin jetzt in Ankh-Morpork, und Du brauchst Dir keine Sorgen zu machen. Ich bin noch nicht geschändet worden!! Ich wohne in der Sirupminenstraße 4 und komme gut zurecht …
Oma Wetterwachs nahm sich den nächsten Brief vor.
Liebe Mutti, ich hoffe, es geht Dir gut. Mir geht es auch gut, aber das Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. Ich singe in Wirtshäusern, aber ich verdiene nicht viel. Ich hab mich schon bei der Näherinnengilde beworben und ein paar Probestücke zum Vorzeigen mitgenommen. Du würdest staunen, mehr verrate ich nicht …
Und noch einen:
Liebe Mutter, endlich gute Nachrichten. Nächste Woche gibt es in der Oper einen Termin zum Vorsingen …
»Was ist denn eine Oper?«
»So was wie ein Theater, bloß mit Gesang«, antwortete Nanny.
»Ha! Theater!«
»Unser Nev hat mir davon erzählt. Da singt man auf ausländisch. Er konnte kein Wort verstehen.«
Oma Wetterwachs legte die Briefe weg.
»Gut, aber euer Nev versteht ja auch sonst nicht viel. Was wollte er überhaupt in diesem Operntheater?«
»Das Blei vom Dach klauen.« Nanny klang fast ein bisschen stolz. Wenn ein Ogg so etwas machte, zählte es nicht als Diebstahl.
»Die Briefe verraten nicht viel, außer, dass sie was für ihre Bildung getan hat«, sagte Oma. »Was aber noch nicht viel …«
Es klopfte zaghaft an der Tür: Jorick Ogg, Nannys Jüngster, der den gesamten Beamten- und Dienstleistungsapparat des Königreichs Lancre in sich vereinigte. Heute trug er das Abzeichen des Briefträgers, dessen Aufgabe darin bestand, den per Kutsche angelieferten Postsack vom dafür vorgesehenen Haken zu nehmen und die Briefe und Päckchen in den abgelegenen Gehöften zuzustellen, sobald er es zeitlich einrichten konnte. Wobei ihm viele Bürger die Arbeit abnahmen. Sie kramten sich lieber selbst eine Sendung aus dem Sack, die ihnen gefiel.
Jorick grüßte Oma Wetterwachs mit einem respektvollen Tippen an den Helm.
»Ich hab hier ’nen Haufen Briefe, Mama«, sagte er zu Nanny Ogg. »Äh. Sie sind alle für, äh … nun ja. Am besten wirfst du mal einen Blick drauf, Mama.«
Er drückte ihr den dicken Packen in die Hand.
»An die Lancre-Hexe«, las Nanny Ogg vor.
»Die wären dann ja wohl für mich.« Schon hatte Oma Wetterwachs das Bündel an sich gerissen.
»Ja, ich wollte sowieso gerade gehen.« Nanny schob sich rückwärts zur Tür.
»Kann mir nicht vorstellen, wieso mir einer schreiben wollen würde«, sagte Oma, während sie den ersten Umschlag aufschlitzte. »Aber andererseits … Man spricht sich rum.« Sie beugte sich über den Brief.
»›Liebe Hexe‹«, las sie. »›Ich wollte Ihnen nur mitteilen, wie dankbar ich Ihnen für das berühmte Austernpastetenrezept bin. Mein Mann …‹«
Nanny Ogg hatte es schon fast bis zum Gartentor geschafft, als ihre Stiefel plötzlich so schwer wurden, dass sie sie nicht mehr vom Boden hochbekam.
»Gytha Ogg, du kommst sofort wieder rein!«
Agnes probierte es noch einmal. Sie war in Ankh-Morpork mutterseelenallein und brauchte einfach einen Menschen, mit dem sie reden konnte, auch wenn der ihr nicht zuhörte.
»Aber vor allem bin ich wohl wegen der Hexen von zu Hause weg«, sagte sie.
Christine drehte sich um, die Augen weit aufgerissen. Den Mund ebenfalls. Ihr Gesicht sah aus wie eine niedliche Bowlingkugel.
»Hexen?!«, hauchte sie.
»Hm, ja«, sagte Agnes matt. Natürlich, alle Menschen fanden Hexen faszinierend. Sie sollten bloß mal versuchen, mit ihnen zusammenzuleben.
»Hexen, die zaubern können und auf dem Besen reiten?!«
»Genau.«
»Kein Wunder, dass du weggelaufen bist!«
»Was? Ach was … darum geht es doch gar nicht. Sie sind nicht böse oder so. Es ist viel … schlimmer.«
»Schlimmer als böse?!«
»Sie bilden sich ein, dass sie wissen, was für einen das Beste ist.«