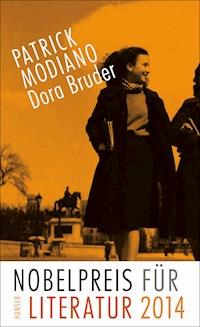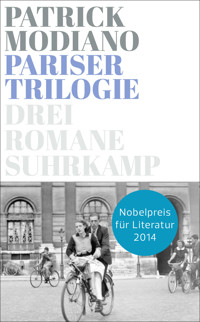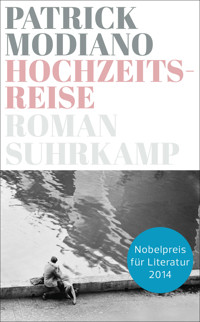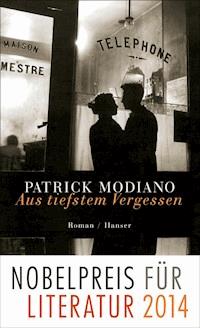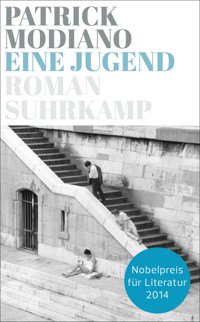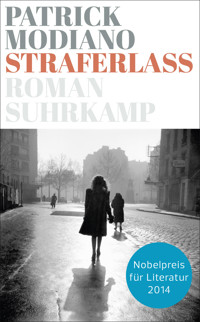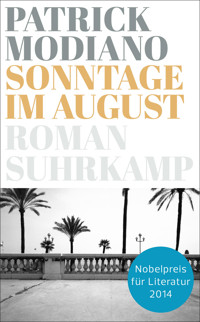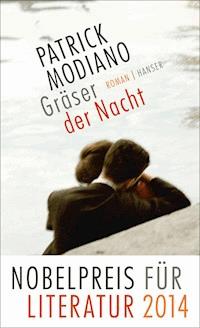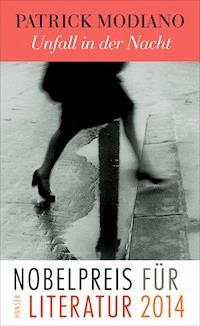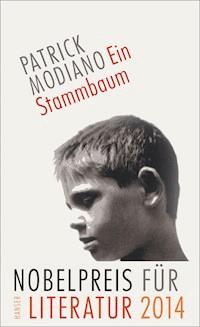Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junger Mann, Raphael Schlemilovitch, in Paris zur Zeit des Nationalsozialismus. In seiner fingierten Autobiografie ziehen kaleidoskopartig die Lebensentwürfe der Juden im besetzten Frankreich vorüber: Mal ist er "Kollaborationsjude" und Liebhaber von Eva Braun, mal "Feld-und-Flur-Jude" in der tiefsten Provinz, bald emigriert er mit falschen Papieren und wird der Judenverfolgung dennoch nicht entgehen. Bis er bei Doktor Freud auf der Couch liegt, der dem halluzinierenden Held eine "jüdische Neurose" attestiert. Modianos brillantes Erstlingswerk ist einer der aufregendsten Romane über das von Deutschen besetzte Paris und ein stilistisches Meisterstück zugleich, hier von Elisabeth Edl zum ersten Mal übersetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Patrick Modiano
Place de l’Étoile
Roman
Aus dem Französischenund mit einem Nachwortvon Elisabeth Edl
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe La Place de l’Étoile
erschien 1968 bei Gallimard in Paris.
Die Übersetzung folgt der Édition revue et corrigée von 2004.
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die großzügige Unterstützung.
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des französischen Außenministeriums, vertreten durch die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin.
ISBN 978-3-446-24878-6
© Éditions Gallimard 1968
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2010/2014
Cover: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung eines Fotos © mauritius-images/Photo Alto
Satz: Gaby Michel, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Der Erzähler, Raphaël Schlemilovitch, ist ein halluzinierender Held. Durch seine Gestalt wandern und kreisen auf rasenden Bahnen tausend Leben, die seine eigenen sein könnten, in einer aufwühlenden Phantasmagorie. Tausend widersprüchliche Identitäten unterwerfen ihn dem Wirbel des Wortwahns, wo der Jude mal König, mal Märtyrer ist und sich die Tragödie hinter Narrenpossen verbirgt. Und so sehen wir reale und fiktive Personen vorüberziehen: Maurice Sachs und Otto Abetz, Lévy-Vendôme und Doktor Louis-Ferdinand Bardamu, Brasillach und Drieu la Rochelle, Marcel Proust und die Killer der französischen Gestapo, Hauptmann Dreyfus und Pétains Admiräle, Freud, Rebekka, Hitler, Eva Braun und so viele andere, Karussellfiguren vergleichbar, die sich wie verrückt drehen in Raum und Zeit. Doch wenn das Buch wieder zuklappt, erscheint die Place de l’Étoile genau im Mittelpunkt der »Hauptstadt der Schmerzen«.
Für Rudy Modiano
Im Juni 1942 tritt ein deutscher Offizier auf einen jungen Mann zu und sagt: »Pardon, monsieur, où se trouve la place de l’Étoile?«
Der junge Mann zeigt auf die linke Seite seiner Brust.
(Jüdische Geschichte)
I
Es war in jener Zeit, da ich mein venezolanisches Erbe verschleuderte. Manch einer redete nur von meiner strahlenden Jugend und meinen schwarzen Locken, andere gossen Hohn über mich. Ich las ein letztes Mal den Artikel, den mir Léon Rabatête in einer Sondernummer von Ici la France gewidmet hatte: »… Wie lange noch müssen wir uns die Spielchen dieses Raphaël Schlemilovitch bieten lassen? Wie lange noch soll dieser Jude ungestraft seine Neurosen und epileptischen Anfälle überall zur Schau stellen dürfen, von Le Touquet bis Cap d’Antibes, von La Baule bis Aixles-Bains? Ich frage zum letzten Mal: Wie lange noch sollen Hergelaufene seines Schlags die Söhne Frankreichs beleidigen dürfen? Wie lange noch müssen wir uns ständig die Hände waschen wegen dem jüdischen Gesindel? …« In der gleichen Zeitung rülpste Doktor Bardamu über mich: »… Schlemilovitch? … Oh! dieser zum Himmel stinkende Schimmelpilz aus dem Ghetto! … Scheißschwächling! … Schlappschwanzvorhaut! … libanesisch-kanakischer Dreckfink! … Rumtata … Rums! … Schaut ihn euch an, diesen jiddischen Gigolo … diesen hemmungslosen Arschficker kleiner Arierinnen! … ungeheuer negroide Fehlgeburt! … dieser tollwütige Abessinier und junge Nabob! … Zu Hilfe! … schlitzt ihm den Bauch auf … kastriert ihn! … Erlöst den Doktor von so einem Schauspiel … ans Kreuz mit ihm, Himmelherrgott! … exotischer Hochstapler auf infamen Cocktailpartys … Judensau internationaler Paläste! … auf Sexorgien made in Haifa! … Cannes! … Davos! … Capri und tutti quanti! … durch und durch verjudete Grandbordells! … Erlöst uns von diesem beschnittenen Stutzer! … seinen mosesgrünen Maseratis! … seinen See-Genezareth-Jachten! … seinen Sinai-Krawatten! … Seine arischen Sklavinnen sollen ihm die Eichel abzwicken! … mit ihren hübschen einheimischen Beißerchen … ihren niedlichen Händen … ihm die Augen auskratzen! … los, ran an den Kalifen! … Aufstand im christlichen Harem! … Schnell! Schnell … Weigerung, ihm die Eier zu lecken! … ihm schönzutun gegen Dollars! … Befreit euch! … zeig Mumm, Madelon! … sonst muss der Doktor weinen! … sich verzehren! … grausame Ungerechtigkeit! … Komplott des Sanhedrins! … Man trachtet dem Doktor nach dem Leben! … glaubt mir! … die Kultusgemeinde! … die Rothschild-Bank! … Cahen d’Anvers! … Schlemilovitch! … Mädels, unterstützt Bardamu! … Hilfe! …«
Der Doktor konnte mir meinen Entlarvten Bardamu nicht verzeihen, den ich ihm aus Capri geschickt hatte. In dieser Studie offenbarte ich das Entzücken eines jungen Juden, mein eigenes Entzücken, als ich mit vierzehn Die Reise des Bardamu und Die Kindheiten des Louis-Ferdinand in einem Zuge gelesen hatte. Ich verschwieg auch seine antisemitischen Pamphlete nicht, wie es die braven Christenleutchen tun. Über sie schrieb ich: »Doktor Bardamu widmet ein Gutteil seines Werkes der Judenfrage. Das ist nicht weiter verwunderlich: Doktor Bardamu ist einer von uns, er ist der größte jüdische Schriftsteller aller Zeiten. Genau darum spricht er mit solcher Leidenschaft von seinen Rassenbrüdern. In seinem Romanwerk erinnert Doktor Bardamu an unseren Rassenbruder Charlie Chaplin, durch seine Vorliebe für schäbige kleine Details, die rührenden Gestalten Verfolgter … Der Satzbau des Doktor Bardamu ist noch viel ›jüdischer‹ als der gewunden-verschnörkelte Satzbau von Marcel Proust: eine sanfte, weinerliche Musik, ein bisschen ranschmeißerisch, ein klein wenig schmierenkomödiantisch …« Ich schloss mit: »Nur Juden können einen der ihrigen wirklich verstehen, nur ein Jude kann nach bestem Wissen und Gewissen über Doktor Bardamu sprechen.« Als Antwort schickte mir der Doktor einen Brief voller Beschimpfungen: ihm zufolge führte ich mit Hilfe von Sexpartys und Millionen die jüdische Weltverschwörung. Auf der Stelle sandte ich ihm meine Psychoanalyse von Dreyfus, mit der ich schwarz auf weiß die Schuld des Hauptmanns bewies: Das war von Seiten eines Juden apart. Ich hatte folgende These entwickelt: Alfred Dreyfus liebte das Frankreich von Ludwig dem Heiligen, Jeanne d’Arc und den Chouans leidenschaftlich, was seine militärische Berufung erklärt. Frankreich hingegen wollte von dem Juden Alfred Dreyfus nichts wissen. Darum hatte er es verraten, so wie man sich an einer herablassenden Frau mit Sporen in Lilienform rächt. Barrès, Zola und Déroulède begriffen nichts von dieser unglücklichen Liebe.
Eine solche Interpretation brachte den Doktor wohl aus der Fassung. Ich hörte nichts mehr von ihm.
Das Gezeter von Rabatête und Bardamu wurde übertönt durch die Lobreden, die Gesellschaftskolumnisten auf mich hielten. Die meisten von ihnen zitierten Valery Larbaud und Scott Fitzgerald: Man verglich mich mit Barnabooth, man nannte mich »The Young Gatsby«. Die Photographien der Illustrierten zeigten mich stets mit leicht geneigtem Kopf, in die Ferne schweifendem Blick. Meine Melancholie war sprichwörtlich in den Spalten der Klatschblätter. Den Journalisten, die mir vor dem Carlton, dem Normandy oder dem Miramar Fragen stellten, verkündete ich unermüdlich mein Judentum. Außerdem stand mein Tun und Treiben im Gegensatz zu jenen Tugenden, die man bei den Franzosen pflegt: Zurückhaltung, Sparsamkeit, Arbeit. Von meinen orientalischen Vorfahren habe ich die schwarzen Augen, den Hang zu Exhibitionismus und Pomp, die chronische Faulheit. Ich bin kein Kind dieses Landes. Marmeladekochende Großmütter, Familienportraits oder Religionsstunden habe ich nie gekannt. Und doch höre ich nicht auf, von einer Kindheit in der Provinz zu träumen. Meine eigene ist bevölkert von englischen Gouvernanten und spielt in der Eintönigkeit verkommener Strände: In Deauville hält mich Miss Evelyn an der Hand. Mama vernachlässigt mich zugunsten von Polospielern. Abends kommt sie und küsst mich im Bett, manchmal spart sie sich aber auch die Mühe. Dann warte ich auf sie, lausche nicht mehr Miss Evelyn und den Abenteuern von David Copperfield. Jeden Morgen bringt mich Miss Evelyn in den Poney Club. Dort nehme ich Reitstunden. Ich werde einmal der berühmteste Polospieler der Welt sein, um Mama zu gefallen. Die kleinen Franzosen kennen alle Fußballmannschaften. Ich denke nur an Polo. Ich sage mir magische Worte vor: »Laversine«, »Cibao la Pampa«, »Silver Leys«, »Porfirio Rubirosa«. Im Poney Club werde ich ständig mit der jungen Prinzessin Laïla, meiner Verlobten, photographiert. Am Nachmittag kauft uns Miss Evelyn Schokoregenschirmchen bei der »Marquise de Sévigné«. Laïla mag lieber Lutscher. Die von der »Marquise de Sévigné« sind länglich und haben einen hübschen Stiel.
Es kommt vor, dass ich Miss Evelyn entwische, wenn sie mich an den Strand bringt, aber sie weiß, wo sie mich finden kann: bei dem Ex-König Firouz oder bei Baron Truffaldine, zwei Erwachsenen, die meine Freunde sind. Der Ex-König Firouz spendiert mir Pistazieneis und ruft: »Genau so ein Leckermaul wie ich, dieser kleine Raphaël!« Baron Truffaldine sitzt immer allein und traurig in der Bar du Soleil. Ich gehe an seinen Tisch und pflanze mich vor ihm auf. Dann erzählt mir der alte Herr endlose Geschichten, deren Heldinnen Cléo de Mérode, Otéro, Émilienne d’Alençon, Liane de Pougy oder Odette de Crécy heißen. Sicher Feen wie in Andersens Märchen.
Die anderen Requisiten, mit denen meine Kindheit angefüllt ist, sind die orangefarbenen Sonnenschirme am Strand, der Pré-Catelan, der Cours Hattemer, David Copperfield, die Comtesse de Ségur, die Wohnung meiner Mutter am Quai Conti und drei Photos von Lipnitzky, auf denen ich neben einem Weihnachtsbaum stehe.
Dann kommen die Schweizer Privatschulen und meine ersten Flirts in Lausanne. Der Duesenberg, den mein venezolanischer Onkel Vidal mir zum achtzehnten Geburtstag geschenkt hat, gleitet in den blauen Abend. Ich fahre durch ein Tor, anschließend durch einen Park, der sanft zum Genfer See abfällt, und stelle meinen Wagen vor die Freitreppe einer erleuchteten Villa. Ein paar junge Mädchen in hellen Kleidern erwarten mich auf dem Rasen. Scott Fitzgerald hat besser, als ich es vermag, von diesen »Partys« erzählt, bei denen die Abenddämmerung zu lieblich ist, zu grell das Gelächter und das Funkeln der Lichter, als dass sie Gutes verheißen könnten. Ich rate Ihnen also, diesen Schriftsteller zu lesen, und Sie werden eine genaue Vorstellung von den Festen meiner Jugend bekommen. Zur Not können Sie auch Fermina Marquez von Larbaud nehmen.
Zwar teilte ich die Vergnügungen meiner kosmopolitischen Freunde aus Lausanne, doch war ich ihnen nicht vollkommen ähnlich. Ich fuhr häufig nach Genf. In der Stille des Hôtel des Bergues las ich die griechischen Bukoliker und bemühte mich, die Äneis elegant zu übersetzen. Bei einem dieser Aufenthalte lernte ich einen jungen Aristokraten aus der Touraine kennen, Jean-François Des Essarts. Wir hatten das gleiche Alter, und seine Bildung verblüffte mich. Gleich bei unserer ersten Begegnung empfahl er mir bunt durcheinander Délie von Maurice Scève, die Komödien von Corneille, die Erinnerungen des Kardinals von Retz. Er machte mich vertraut mit der Anmut und dem Euphemismus der Franzosen.
Ich entdeckte bei ihm kostbare Eigenschaften: Takt, Hochherzigkeit, sehr großes Feingefühl, beißende Ironie. Ich erinnere mich, dass Des Essarts unsere Freundschaft mit jener verglich, die Robert de Saint-Loup und den Erzähler von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit verband. »Sie sind Jude wie der Erzähler«, sagte er zu mir, »und ich bin ein Vetter der Noailles, der Rochechouart-Mortemarts und der La Rochefoucaulds, wie Robert de Saint-Loup. Erschrecken Sie nicht; seit einem Jahrhundert hat die französische Aristokratie ein Faible für Juden. Ich werde Ihnen ein paar Seiten von Drumont zu lesen geben, in denen uns der gute Mann deswegen bittere Vorwürfe macht.«
Ich beschloss, nicht mehr nach Lausanne zurückzukehren, und opferte Des Essarts ohne Gewissensbisse meine kosmopolitischen Freunde.
Ich kratzte alles zusammen, was in meinen Taschen war. Ich hatte gerade noch hundert Dollar. Des Essarts besaß keinen roten Heller. Ich riet ihm dennoch, seine Stelle als Sportredakteur bei der Gazette de Lausanne aufzugeben. Mir war nämlich eingefallen, dass ein paar Kameraden mich während eines englischen Weekends auf einen Landsitz bei Bournemouth geschleppt hatten, um mir eine Oldtimersammlung zu zeigen. Ich erinnerte mich wieder an den Namen des Sammlers, Lord Allahabad, und verkaufte ihm meinen Duesenberg für vierzehntausend Pfund Sterling. Mit dieser Summe konnten wir ein Jahr lang anständig leben, ohne die telegraphischen Postanweisungen meines Onkels Vidal in Anspruch zu nehmen.
Wir zogen ins Hôtel des Bergues. Diese erste Zeit unserer Freundschaft habe ich in wundervollster Erinnerung. Morgens spazierten wir zu den Antiquaren der Genfer Altstadt. Des Essarts steckte mich an mit seiner Leidenschaft für Bronzeskulpturen von 1900. Wir kauften etwa zwanzig, mit denen wir unsere Zimmer vollstopften, insbesondere eine grünliche Allegorie der Arbeit und zwei herrliche Rehe. Eines Nachmittags verkündete mir Des Essarts, er habe einen Bronzefußballer erstanden:
»Bald werden sich die Pariser Snobs für teures Geld um all diese Dinge reißen. Das sage ich Ihnen schon jetzt, mein lieber Raphaël! Würde es nur von mir abhängen, der Albert-Lebrun-Stil käme wieder zu Ehren.«
Ich fragte ihn, warum er Frankreich verlassen habe:
»Der Militärdienst«, erklärte er mir, »war nichts für meine zarte Konstitution. Darum bin ich desertiert.«
»Da lässt sich was machen«, sagte ich ihm; »ich verspreche Ihnen, dass ich in Genf einen geschickten Handwerker finde, der Ihnen falsche Papiere herstellt: dann können Sie unbesorgt nach Frankreich zurückkehren, wann immer Sie wollen.«
Der klandestine Drucker, mit dem wir in Verbindung traten, fertigte uns eine Schweizer Geburtsurkunde aus und einen Schweizer Pass auf den Namen Jean-François Lévy, geboren in Genf am 30. Juli 194…
»Jetzt bin ich Ihr Rassenbruder«, sagte Des Essarts, »ein Goi zu sein langweilte mich.«
Sogleich beschloss ich, den linken Pariser Tageszeitungen eine anonyme Erklärung zu übermitteln. Sie lautete folgendermaßen:
»Seit November letzten Jahres bin ich der Fahnenflucht schuldig, aber die französischen Militärbehörden halten es für klüger, Stillschweigen über meinen Fall zu bewahren. Ich habe ihnen erklärt, was ich heute öffentlich erkläre. Ich bin JUDE, und die Armee, die Hauptmann Dreyfus’ Dienste verschmäht hat, wird ohne die meinen auskommen müssen. Man verurteilt mich, weil ich meine Wehrpflicht nicht erfülle. Einst hat das gleiche Gericht Alfred Dreyfus verurteilt, weil er, ein JUDE, es gewagt hatte, sich für die militärische Laufbahn zu entscheiden. Solange man mir diesen Widerspruch nicht begreiflich macht, weigere ich mich, als Soldat zweiter Klasse in einer Armee zu dienen, die bis auf den heutigen Tag von einem Marschall Dreyfus nichts wissen will. Ich fordere die jungen französischen Juden auf, meinem Beispiel zu folgen.«
Ich unterzeichnete: JACOB X.
Die französische Linke stürzte sich mit Feuereifer auf den Gewissenskonflikt des Jacob X, wie ich es mir gewünscht hatte. Das war Frankreichs dritte Judenaffäre nach der Dreyfus-Affäre und der Finaly-Affäre. Des Essarts fand Gefallen an dem Spiel, und wir verfassten gemeinsam ein meisterhaftes »Bekenntnis des Jacob X«, das in einer Pariser Wochenzeitschrift erschien: JacobX war von einer französischen Familie aufgenommen worden, die er ungenannt lassen wollte. Sie bestand aus einem Oberst Pétains, aus seiner Frau, einer ehemaligen Marketenderin, und aus drei Jungs: der älteste hatte sich für die Gebirgsjäger entschieden, der zweite für die Marine, der jüngste war soeben in die Militärakademie von Saint-Cyr eingetreten.
Diese Familie wohnte in Paray-le-Monial, und Jacob X verbrachte seine Kindheit im Schatten der Basilika. Die Portraits von Gallieni, Foch, Joffre, das militärische Ehrenkreuz von Oberst X und mehrere Francisques der Vichy-Regierung zierten im Salon die Wände. Unter dem Einfluss seiner Angehörigen verehrte der junge Jacob X die französische Armee über alle Maßen: auch er bereitete sich vor auf Saint-Cyr und wollte Marschall werden wie Pétain. Im Gymnasium kam Monsieur C., der Geschichtslehrer, auf die Dreyfus-Affäre zu sprechen. Monsieur C. bekleidete vor dem Krieg einen wichtigen Posten im P.P.F. Er wusste genau, dass Oberst X die Eltern von Jacob X bei den deutschen Behörden denunziert hatte und ihm die Adoption des kleinen Juden bei der Befreiung mit knapper Not das Leben rettete. Monsieur C. verachtete den von Saint-Sulpice beeinflussten Pétainismus der Familie X: Er freute sich bei dem Gedanken, in dieser Familie Zwietracht zu säen. Nach dem Unterricht winkte er Jacob X zu sich und flüsterte ihm ins Ohr: »Ich bin sicher, dass Ihnen die Dreyfus-Affäre großen Kummer bereitet. Ein Jude wie Sie fühlt sich durch diese Ungerechtigkeit betroffen.« Mit Grausen erfährt Jacob X, dass er Jude ist. Er hat sich mit Marschall Foch, mit Marschall Pétain identifiziert, plötzlich merkt er, dass er Hauptmann Dreyfus gleicht. Doch er wird nicht versuchen, sich durch Verrat zu rächen wie Dreyfus. Er erhält seinen Einberufungsbefehl und sieht keinen anderen Ausweg als Desertion.
Dieses Bekenntnis schuf Zwietracht unter den französischen Juden. Die Zionisten rieten Jacob X, nach Israel auszuwandern. Dort könne er mit gutem Recht den Marschallstab anstreben. Die verschämten und assimilierten Juden behaupteten, Jacob X sei ein Agent provocateur im Dienste der Neonazis. Die Linke verteidigte den jungen Deserteur voller Leidenschaft. Sartres Artikel Saint Jacob X, Komödiant und Märtyrer eröffnete die Offensive. Die schärfste Passage ist unvergesslich: »Von nun an wird er Jude sein wollen, aber Jude in der Niedertracht. Unter den gestrengen Blicken von Gallieni, Joffre und Foch, deren Portraits im Salon an der Wand hängen, wird er wie ein gewöhnlicher Deserteur handeln, er, der seit seiner Kindheit beharrlich die französische Armee, die Offiziersmütze des alten Bugeaud und Pétains Francisques verehrt. Kurzum, er wird die köstliche Scham empfinden, sich als der Andere zu fühlen, das heißt, als das Böse.«
Mehrere Manifeste waren in Umlauf, welche die triumphale Rückkehr von Jacob X forderten. In der Mutualité fand ein Meeting statt. Sartre flehte Jacob X an, aus der Anonymität zu treten, aber das hartnäckige Schweigen des Deserteurs entmutigte auch die Wohlgesinntesten.
Wir nehmen unsere Mahlzeiten im Bergues ein. Nachmittags arbeitet Des Essarts an einem Buch über das russische Kino vor der Revolution. Und ich, ich übersetze die alexandrinischen Dichter. Wir haben die Hotelbar gewählt, um diesen kleinen Arbeiten nachzugehen. Ein Glatzkopf mit feurigen Augen setzt sich regelmäßig an den Nachbartisch. Eines Nachmittags richtet er das Wort an uns, sein Blick ist durchdringend. Plötzlich zieht er einen alten Pass aus der Tasche und hält ihn uns unter die Nase. Überrascht lese ich den Namen Maurice Sachs. Der Alkohol macht ihn gesprächig. Er erzählt uns von seinen Missgeschicken seit 1945, dem Datum seines angeblichen Todes. Er war nacheinander Gestapoagent, GI, Viehhändler in Bayern, Makler in Antwerpen, Bordellwirt in Barcelona, Clown in einem Mailänder Zirkus unter dem Spitznamen Lola Montès. Schließlich hat er sich in Genf niedergelassen, wo er eine kleine Buchhandlung betreibt. Wir trinken bis drei in der Früh, um diese Begegnung zu feiern. Ab diesem Tag weichen wir Maurice nicht mehr von den Fersen und geloben ihm feierlich, das Geheimnis seines Überlebens zu wahren.
Tagaus tagein sitzen wir hinter Bücherstapeln im letzten Winkel seines Ladens und hören ihm zu, wenn er 1925 für uns wiederaufleben lässt. Mit alkoholrauher Stimme erzählt Maurice von Gide, Cocteau, Coco Chanel. Der Jüngling der Années folles ist nur mehr ein dicker Herr, der wild herumfuchtelt bei der Erinnerung an die Hispano-Suizas und an das Bœuf sur le Toit.
»Seit 1945 überlebe ich mich«, vertraut er uns an. »Ich hätte im richtigen Augenblick sterben sollen, wie Drieu la Rochelle. Bloß: Ich bin Jude, ich habe die Zählebigkeit von Ratten.«
Ich merke mir diese Äußerung, und am nächsten Tag bringe ich Maurice mein Drieu und Sachs, wohin falsche Wege führen. Ich zeige in dieser Studie, wie sich zwei junge Leute von 1925 aus Charakterschwäche ins Verderben gestürzt haben: Drieu, ein hochgewachsener junger Mann, Sciences-Po-Absolvent, französischer Kleinbürger, den Kabrioletts, englische Krawatten, junge Amerikanerinnen faszinierten und der sich als Held von 1914-18 ausgab; Sachs, ein junger charmanter Jude von zweifelhaftem Lebenswandel, Produkt einer verkommenen Nachkriegszeit. Um 1940 bricht über Europa die Tragödie herein. Wie werden unsere beiden Stutzer reagieren? Drieu erinnert sich, dass er im Cotentin geboren ist und singt vier Jahre lang mit Fistelstimme das Horst-Wessel-Lied. Für Sachs ist das besetzte Paris ein Garten Eden, wo er sich begeistert ins Verderben stürzt. Dieses Paris liefert ihm prickelndere Gefühle als das Paris von 1925. Man kann Schleichhandel mit Gold treiben, Wohnungen mieten, deren Mobiliar man anschließend verkauft, zehn Kilo Butter gegen einen Saphir tauschen, den Saphir zu Alteisen machen usw. Nacht und Nebel verhindern, dass man Rechenschaft geben muss. Doch vor allem, was für ein Glück, sein Leben auf dem Schwarzmarkt zu kaufen, jeden einzelnen Herzschlag zu stehlen, sich als Ziel einer Treibjagd zu fühlen! Sachs kann man sich nur schlecht in der Résistance vorstellen, wie er mit kleinen französischen Beamten um die Wiederherstellung von Moral, Legalität und Tageslicht kämpft. Um 1943, als er spürt, dass ihn die Meute und die Rattenfallen bedrohen, meldet er sich freiwillig zum Arbeitsdienst in Deutschland und wird aktives Mitglied der Gestapo. Ich will Maurice nicht verdrießen: Ich lasse ihn 1945 sterben und übergehe seine verschiedenen Reinkarnationen zwischen 1945 und heute mit Stillschweigen. Ich schließe folgendermaßen: »Wer hätte gedacht, dass dieser charmante junge Mann von 1925 zwanzig Jahre später in einer Ebene Pommerns von Hunden zerfleischt würde?«
Nachdem Maurice meine Studie gelesen hat, sagt er:
»Das ist sehr hübsch, Schlemilovitch, diese Parallele zwischen Drieu und mir, aber eine Parallele zwischen Drieu und Brasillach wäre mir doch lieber. Wissen Sie, neben diesen beiden war ich nur ein Witzbold. Also schreiben Sie bis morgen Früh etwas, und ich sage Ihnen, was ich davon halte.«
Maurice ist hocherfreut, einen jungen Mann beraten zu können. Wahrscheinlich erinnert er sich an die ersten Besuche, die er mit klopfendem Herzen Gide und Cocteau abstattete. Mein Drieu und Brasillach gefällt ihm sehr. Ich habe versucht, eine Antwort auf folgende Frage zu geben: Aus welchen Gründen haben Drieu und Brasillach kollaboriert?
Der erste Teil dieser Studie trägt die Überschrift: »Pierre Drieu la Rochelle oder das ewige Paar von SS-Mann und Jüdin.« Ein Thema kehrte in Drieus Romanen häufig wieder: das Thema der Jüdin. Gilles Drieu, dieser stolze Wikinger, hatte keine Hemmungen, Jüdinnen zu verschachern, zum Beispiel eine gewisse Myriam. Man kann die Anziehungskraft, die Jüdinnen auf ihn ausübten, auch so erklären: Seit Walter Scott gilt es als ausgemacht, dass Jüdinnen liebenswürdige Kurtisanen sind, die sich allen Launen ihrer arischen Herrn und Gebieter unterwerfen. Bei Jüdinnen ergab Drieu sich der Illusion, ein Kreuzfahrer zu sein, ein teutonischer Ritter. So weit war nichts an meiner Studie originell, denn Drieus Kommentatoren betonen allesamt das Thema der Jüdin bei diesem Schriftsteller. Aber Drieu als Kollaborateur? Das erkläre ich mühelos: Drieu faszinierte die dorische Virilität. Im Juni 1940 fallen die wahren Arier, die wahren Krieger über Paris her: Eilig zieht Drieu das Wikingerkostüm aus, das er sich geliehen hatte, um die jüdischen Mädchen von Passy zu misshandeln. Er findet zu seiner wahren Natur zurück: Unter dem metallblauen Blick der SS-Männer wird er weich, schmilzt, fühlt plötzlich orientalische Sehnsüchte in sich aufkeimen. Schon bald liegt er in den Armen der Sieger. Nach ihrer Niederlage opfert er sich. Eine solche Passivität, ein solcher Hang zum Nirwana erstaunen bei einem Normannen.
Der zweite Teil meiner Studie trägt die Überschrift: »Robert Brasillach oder das Fräulein von Nürnberg«. »Wir waren einige, die sich mit Deutschland ins Bett gelegt haben«, gestand er, »und wir werden uns stets gern daran erinnern.« Seine Spontaneität lässt an die jungen Wienerinnen beim Anschluss denken. Die deutschen Soldaten defilierten auf dem Ring, und die Mädchen hatten eigens neckische Dirndlkleider angezogen, um ihnen Rosen zuzuwerfen. Anschließend gingen sie mit diesen blonden Engeln im Prater spazieren. Und dann kam die zauberische Dämmerung im Stadtpark, wo man einen jungen SS