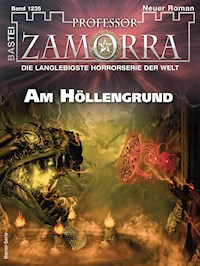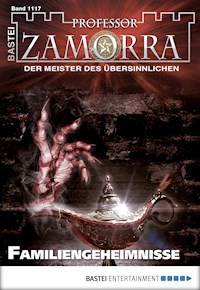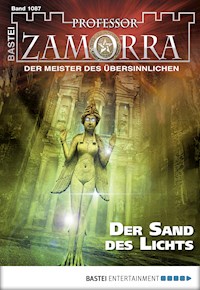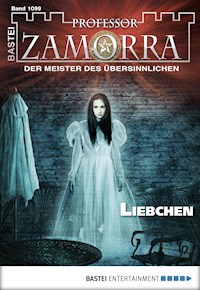1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Eigentlich hatte Willem van Kamp, Studienfreund Zamorras, Arzt in Südspanien und Dämonenjäger wie er, den Dschinn Ahtan besiegt zu haben. Doch der Thejadendolch - die einzige Waffe, die einen Dschinn von Ahtans Rangordnung töten kann, wurde beim Kampf gegen den Mariden zerstört. Und was noch schlimmer ist: Ahtan hat grausam verstümmelt überlebt! Nun ist klar, der Dschinn sinnt auf Rache.
Willem kann nur hoffen, dass im ganz sicher vor ihm liegenden Kampf nicht der Unterlegene ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Dreizehn Schwestern
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Arndt Drechsler
Datenkonvertierung eBook: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-5344-0
www.bastei-entertainment.de
Dreizehn Schwestern
Von Stephanie Seidel
Willem van Kamp rannte um sein Leben. Durch ein unbekanntes Labyrinth, an Wänden entlang, deren Abstand sich immer weiter verringerte. Schwefelgeruch lag in der Luft und feiner, salziger Staub. Er brannte in der Lunge und machte jeden Atemzug zur Qual.
Der Dschinnjäger hielt sich geduckt, um den scharfkantigen Vorsprüngen zu entgehen, die überall aus der Gewölbedecke ragten und nur darauf zu warten schienen, dass er sie streifte. Es würde ihn den Kopf kosten. Buchstäblich.
Willem konnte sich nicht daran erinnern, wie er in diese Todesfalle geraten war. Sein Gedächtnis musste ausgesetzt haben, anders ließ sich der schlagartige Situationswechsel nicht erklären. Eben noch war die Welt in Ordnung gewesen, bunt und hell, ohne besondere Vorkommnisse.
Jetzt war sie fort, Willems Welt, und er selber ein Gefangener der Hölle …
Mai 2017
Verzweifelt kämpfte Willem gegen die Panik an, die ihn zu überwältigen drohte angesichts der Tatsache, dass er sich plötzlich unter der Erde befand, irgendwo in fremden Gefilden und ohne zu wissen, warum.
Der Schein seiner Taschenlampe tanzte vor ihm her, doch er holte nichts Tröstliches aus der Dunkelheit. Keinen Ausweg. Keine Weite, keinen Freund. Nur diesen endlosen schwarzen Höhlengang, der hinauf und hinabführte, mal nach rechts, mal nach links. Mit Nischen und Sackgassen, in denen man beim Zurücklaufen den letzten Rest von Orientierung verlor.
Die Enge und Abgeschiedenheit der düsteren Unterwelt gaben Willem das Gefühl, lebendig begraben zu sein – an einem Ort, den niemand kannte. Nicht einmal er selbst.
Und da war noch mehr.
Willem keuchte vor Anstrengung; sein Körper schien mit Gewichten behängt zu sein, die es ihm schwerer und schwerer machten, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Er musste es trotzdem tun.
Denn jemand folgte ihm, und Willem floh, auch wenn der Ausgang dieser diabolischen Treibjagd bereits feststand. In der Dunkelheit hinter ihm erklang ein gleichmäßiges Stampfen, wie der Laufschritt einer großen Gestalt. Zügig, aber ohne besondere Eile. Als hegte sein Verfolger nicht den Hauch eines Zweifels daran, dass er am Ende Beute schlagen würde.
Der Dschinnjäger wusste, wer ihm da auf den Fersen war. Fieberhaft suchte er nach dem einen, passenden Abwehrzauber, der die bösartige Kreatur aufhalten würde. Doch nichts half. Kein Bannspruch, keine Vertreibungsformel, kein orientalischer Fluch. Die dumpfen Laufgeräusche veränderten sich nicht.
Klump-Klump-Klump.
Willem gab nicht auf. Atemlos hetzte er weiter, spulte dabei sein ganzes, beachtliches Repertoire an magischen Beschwörungen ab, das er sich im Laufe der Jahre angeeignet hatte. Sogar einen hochgeheimen Zauber der Shenniden keuchte er heraus, den nur dieser Geheimbund kannte und – wenn überhaupt – als letztes Mittel bei seiner gefährlichen Jagd auf Geistwesen einsetzte. Denn der Zauber besaß ein Eigenleben und entschied selber, wen er zu vernichten gedachte.
Und plötzlich …
Stille.
Beim Laufen schwenkte Willem die Taschenlampe herum und leuchtete zurück in den Gang. Das Licht streifte leere, schwarze Wände. Staubpartikel tanzten in der Luft. Sonst rührte sich nichts. Hatte der Shennidenzauber funktioniert?
Misstrauisch blieb er stehen. Zum Aufatmen war es zu früh – vielleicht lauerte sein Widersacher doch noch im schützenden Dunkel hinter der Biegung des Ganges. Gönnte sich eine Verschnaufpause vor dem finalen Angriff. Oder hoffte, dass Willem den Fehler begehen und nachsehen würde, ob er wirklich verschwunden war.
»Darauf kannst du lange warten«, knurrte der Dschinnjäger, drehte sich um … und fuhr entsetzt zurück.
Vor ihm schwebte das personifizierte Grauen: Ahtan, der ehemalige Thronanwärter der Sudan-Maride. Willem hatte ihn im Kampf geschlagen; so endgültig, dass sich Ahtans Machtpläne in alle Winde zerstreut hatten. Seitdem war der hochrangige Dschinn auf Rache aus. Und Rache bedeutete in seinen Kreisen nichts anderes als einen möglichst langsamen, furchtbaren Tod.
»Willem?«
Von irgendwo drang eine körperlose Stimme an sein Ohr, fremd und doch seltsam vertraut. In Zeitlupe kamen Ahtans Krallenhände hoch. Willem wollte zurückweichen, doch er konnte sich nicht bewegen. Keinen Millimeter. Die riesigen, schwarzen Facettenaugen des Dschinn hielten ihn fest mit ihrem unwirklichen Funkeln und diesem bohrenden Blick, kälter als Eis.
Wie ein Kaninchen vor der Schlange stand Willem da, während der düstere Dschinn den Kopf zurückbog, um Platz zu schaffen für das Öffnen seines schrecklichen Mauls. Der Unterkiefer sank und sank, hunderte nadelspitzer Reißzähne verließen ihre Liegeposition und richteten sich knisternd auf. Zäher Schleim troff an ihnen herunter. Gleich, jeden Moment, würde Ahtan sie mit paranormaler Kraft in Willems Fleisch schlagen und es ihm von den Knochen fetzen.
Willem wusste, dass er verloren war. Mit dem Thejadendolch hätte er sein Schicksal noch abwenden und Ahtan töten können. Doch die sagenumwobene Waffe aus dem All, die fünfte der Dreizehn Schwestern, lag für immer zerstört am Grund eines Sees.
»Willem!«
Wieder diese Stimme. Woher kam sie? Wem gehörte sie? Eilte in letzter Sekunde Hilfe herbei? Zammy vielleicht? Oder Rhannoud? Doch selbst der, obwohl ebenfalls ein Dschinn, wäre nicht schnell genug, um Ahtans Angriff jetzt noch abzuwehren.
Willem glaubte den unsäglichen Schmerz schon zu spüren, den der machtvolle Biss und das Ausreißen seines lebenden Fleisches verursachen würde. Er war am Ende, doch der Tod würde sich Zeit lassen, ihn zu erlösen. Willem begann zu schreien. Fühlte sich an der Schulter gepackt, von einer Hand, die nicht da war und ihn trotzdem zu schütteln schien.
»Habibi!«, gellte ihm jemand ins Ohr.
Eigentlich nichts Weltbewegendes, nur ein arabisches Wort, das Liebling bedeutete. Und doch war es in jenem Moment die stärkste Zauberformel des Universums.
Willem fuhr hoch – keuchend, schweißgebadet, desorientiert. Licht durchflutete den Raum mit seinen weißen Wänden und seiner Weite, die das Atmen so leicht machte. Da war das Bogenfenster, hinter dem die Sterne des Nachthimmels ins Schlafzimmer der van Kamps blinkten. Das Bett, weich und sicher.
Und da war Hayat, seine geliebte Frau. Das Schönste und Beste, was der Orient je hervorgebracht hatte. Mitleidig strich sie ihm übers Haar.
»Wieder dieser Albtraum?«, fragte sie.
Willem nickte. »Ich sollte Miete von dem Kerl verlangen! Er wohnt ja schon praktisch hier.«
»Wirf ihn raus!« Hayat schlug die leichte Satindecke zurück und erhob sich. »Das muss aufhören, habibi! Es bricht mir das Herz, mitansehen zu müssen, wie Ahtan dich quält.«
»Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe«, sagte Willem zerknirscht, doch seine Frau winkte ab.
»Darüber mach dir keine Gedanken. Es ist nicht deine Schuld.« Hayat griff nach ihrem Morgenmantel, der über einem Stuhlrücken neben dem Bett hing. »Aber du sprichst im Schlaf, und ich habe das Gefühl, inzwischen sämtliche Beschwörungsformeln der Dschinnjäger zu kennen.«
Sie hielt kurz inne und bedachte Willem mit einem Vorwurfsblick. »Inklusive einiger arabischer Flüche, die eine anständige Frau niemals hören sollte!«
»Ich muss mir unbedingt angewöhnen, auf Niederländisch zu träumen«, überlegte der Mann aus Scheveningen laut.
»Maak dat«, antwortete Hayat prompt und verließ den Raum.
»Wo gehst du hin?«, rief ihr Willem überrascht hinterher.
»In die Küche. Kaffee kochen.«
»Jetzt?« Er warf einen Blick auf seine neue Armbanduhr mit dem Logo der Rolling Stones auf dem Ziffernblatt. Sie war ein Geburtstagsgeschenk von Nicole und Zamorra gewesen. »Hayat – es ist mitten in der Nacht!«
Die schöne Marokkanerin erschien im Türrahmen. »Ja, und Ramadan. Ich habe jetzt Lust auf etwas anderes als Wasser. Und wacher als wach kann ich nicht werden. Möchtest du auch einen?«
»Gern.« Willem stand auf, fischte seine vor dem Bett in Knitterhaltung dösende Jeans vom Boden und zog sie an.
Ramadan! Ein Wort mit zwei Bedeutungen. Für Muslime bezeichnet es den heiligen Fastenmonat zwischen Mai und Juni, der nach dem Mondstand berechnet wird und mal 29, mal 30 Tage währt. Die Gebote des Propheten verlangen, dass man in dieser Zeit enthaltsam lebt, sich mit Höflichkeit begegnet und nach spiritueller Reinigung strebt. Lügen und Fluchen ist verboten. Ebenso die Aufnahme von Speisen oder Getränken (außer Wasser) zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang.
Doktor Hayat van Kamp war keine fanatische Muslima. Sie trug westliche Kleidung, suchte eher selten eine Moschee auf, betete nicht alle paar Stunden gen Mekka und verbarg ihr wundervolles, hüftlanges Haar nur während der Arbeit unter einem Kopftuch. Aus Hygienegründen. Dennoch verehrte sie ihren Gott, denn sie glaubte fest daran, dass Allah für all die Wunder verantwortlich war, die ihr Leben bereicherten.
Für Doktor Willem van Kamp hingegen hatte das Wort Ramadan eine gänzlich andere Bedeutung, nämlich: »Miese Tage des sehnsüchtigen Wartens auf iftar«. Der ehemalige Katholik hatte das Beten schon lange eingestellt, hielt sich aber an die Formel »in guten wie in schlechten Zeiten«. Und weil er seine Frau innig liebte, machte er diese alljährliche göttliche Gemeinheit mit und verzichtete tagsüber, zumindest in Hayats Anwesenheit, auf alles, was gut und lecker war. Gebratene Thunfisch-Steaks. Andalusischer Wein, Zigaretten und das stressabbauende F-Wort.
Und Hayat war oft anwesend, denn das Ehepaar teilte sich eine Gemeinschaftspraxis in Tarifa.
Willem verließ das Schlafzimmer. Die unheimliche Verfolgungsjagd wirkte noch immer nach, darum wollte er seinen Nerven etwas Gutes tun. Im Flur, auf der Kommode, lag ein Tabakbeutel. Den nahm er an sich.
»Ich geh mal kurz nach draußen«, rief er Richtung Küche, wo Hayat gerade Wasser in die Kaffeemaschine füllte.
»Ist gut«, scholl es zurück.
Doch nichts war gut. Willem hatte die Haustür fast erreicht, als er plötzlich kehrt machte und eiligen Schrittes ins Wohnzimmer ging. Da war ein großer, schöner Kamin altspanischer Bauart, der an kühlen Winterabenden, mit Pinienholz befeuert, eine märchenhafte Atmosphäre verbreitete. Er wurde von zwei verschließbaren Bücherschränken flankiert, die auf ihre eigene Art ebenfalls etwas Märchenhaftes hatten.
Sie waren Attrappen. Bis zu den verglasten Türen in die Wand eingelassen, gaukelten sie dem Betrachter eine umfangreiche Sammlung wissenschaftlicher Werke vor. Dabei klebten hinter den Scheiben lediglich Buchrücken. Tatsächlich bewahrte Willem in diesen Verstecken seine Waffen für den Kampf gegen die orientalischen Mächte des Bösen auf.
Schweigend öffnete er einen der Schränke. Im mittleren Fach lag ein mit dunkelblauem Samt beschlagenes Kästchen. Es trug, aus Gold gefertigt, das Zeichen der Shenniden und enthielt Willems Aufnahmegeschenk, zwei siebenschüssige Peacemaker. Jedes Mitglied des Geheimbundes verfügte über solche langläufigen Revolver, die mit Silbermunition bestückt wurden und für jeden Mann extra gefertigt waren. Sie mussten fest in der Hand liegen, denn bei einer Konfrontation mit dämonischen Wesen konnte man nicht lange nachfassen. Da zählte jede Sekunde.
Willem nahm eine der Waffen an sich. Auf dem Weg in den Flur prüfte er, ob sie geladen und schussbereit war. Erst dann verließ er das Gebäude.
***
Das Casa de los caminos, Willems geheimnisumranktes Atriumhaus, stand auf einer einsamen Steilküste westlich der Lagune von Los Caños de Meca. Sein Grundstück reichte bis an den Rand der hochgelegenen Küstenstraße. Es war grasbewachsen, mit ein paar alten Bäumen darauf, wurde gelegentlich geschoren, ansonsten aber sich selbst überlassen.
Der letzte Schnitt war schon eine Weile her, was besonders die andalusischen Grillen erfreute. Eine ganze Armee der kleinen Insekten verbarg sich im wogenden Grün; die Männchen zirpten aus Leibeskräften, die Weibchen dachten sich ihren Teil.
Am Straßenrand, jenseits der kiesbedeckten Garagenzufahrt, wiegte ein knorriger Olivenbaum sein Blätterdach im Wind. Unter ihm parkte die Minimalausführung einer Sitzbank: zwei Findlinge mit aufliegender Steinplatte. Sie lud nicht wirklich zum Platznehmen ein, wurde sie doch regelmäßig vom Baum und seinen gefiederten Besuchern mit Dingen beworfen, die sie nicht mehr brauchten: tote Blätter, verschrumpelte Oliven, Vogelkot …
Andererseits hatte man von dieser Bank aus den besten Blick auf das malerische Panorama, von dem die van Kamps seinerzeit so beeindruckt gewesen waren, dass sie sich trotz aller Bedenken wegen des sehr heruntergekommenen, leerstehenden Casa de los caminos zum Kauf entschlossen hatten – was sie bis heute nicht bereuten.
Gedankenversunken trat Willem an die Bank heran. Unter ihr war ein Handfeger deponiert. Mit ihm und ein paar energischen Wischbewegungen scheuchte er die ahnungslose Bankbelegschaft fort. Dann setzte er sich.
Doch das entspannende Gefühl, das ihn normalerweise an diesem Ort überkam, wo Pinienwälder mit dem Atlantik um die Wette rauschten und in der Ferne das Lichtermeer Marokkos funkelte, stellte sich heute nicht ein. Willems Blick blieb misstrauisch, und er lauschte den Geräuschen der Nacht ganz anders als sonst. Die Nachtigall auf dem Dachrand des Casa interessierte ihn nicht, das Zirpen der Grillen aber umso mehr. Sie würden verstummen, wenn sich jemand näherte. Und raschelte da etwas am Straßenrand? Knackte ein Zweig in den Bäumen?
Der Dschinnjäger schalt sich einen Narren, seine Waffe legte er trotzdem weg. Nur mal kurz quer über die Beine, um den Tabakbeutel zu öffnen. Willem hatte eine schlechte Angewohnheit aus den Sechzigern beibehalten. Damals konnte man in holländischen Coffeeshops getrocknete Krümel kaufen, die eine Zigarette zum Erlebnis-Inhalator aufpeppten. Und das, obwohl es den Begriff noch gar nicht gab! Farben wurden laut, und Musik wurde bunt, wenn man sich nur lange und dicht genug zunebelte.
Auch eine zu große Anspannung ließ sich damit lockern. Es existierten Filmaufnahmen aus jener Zeit, die das belegten. Von langhaarigen Typen, die träge ihre Hand zum Victory-Zeichen hochhielten und mit seligem Direktblick ins Nirwana ungefähr Richtung Kamera verkündeten: »Peace, man!«
Willem hatte den Haschischkonsum seiner Sturm- und Drangzeit schon lange auf ein Minimum heruntergefahren. Inzwischen wusste man ja, dass Rauchen nur für Romanhelden ohne gesundheitliche Folgen blieb. Doch hin und wieder, so wie jetzt, gönnte er sich ein paar Züge. Um das Echo des Albtraums verstummen zu lassen, das noch immer in ihm nachhallte.
So konnte es nicht weitergehen, das wusste er. Nur wie er diesen Zustand beenden sollte, das wusste er nicht. Sein unerschrockener Freund Zamorra hatte schon angeboten, ihn und die Shenniden in den Sudan zu begleiten und die dortigen Maride auszumerzen. Den ganzen Stamm.
Doch bei der Herrscherklasse der Dschinn verhielt es sich ähnlich wie bei Zamorras Erzdämonen: Man würde schwere Geschütze auffahren müssen, um sie besiegen zu können. Zudem war es sehr gewagt, in ein Land zu reisen, selbst auf geheimen Pfaden, das von Unruhen und bewaffneten Konflikten erschüttert wurde. Das hohe Risiko einer solchen Aktion wäre nur dann akzeptabel gewesen, hätte man wenigstens halbwegs sicher sein können, dass der Eine, um den es ging, überhaupt vor Ort war. Was nach der Sache in Frankreich zweifelhaft erschien: Mitte März hatte der Shennidenführer Ibrahim Choukri herausgefunden, dass ein Sudan-Marid namens Ahtan auf dem Weg nach Paris war, um einen hochgefährlichen Lampengeist zu befreien.
Dieser Lampengeist, ebenfalls ein Marid, hatte über hundert Menschen auf dem Gewissen und nicht mehr alle Sinne beisammen. Deshalb war er verbannt worden. Ahtan wollte ihn zurückholen, damit er den Bezwinger der Bar’baale für ihn aufspürte.
Das Volk der Dschinn war beunruhigt ob des nicht identifizierten Menschenmannes, denn er besaß einen Thejadendolch. Wer von dieser magischen Waffe getroffen wurde, verbrannte von innen heraus. Wie die Bar’baale. Wer also den Besitzer dieser Waffe zur Strecke brachte – was sie zerstören würde – konnte sich berechtigte Hoffnungen auf den Thron seines jeweiligen Ranges im siebenstufigen Machtgefüge der Dschinn machen. Ahtan gehörte zu den Mariden. Sie waren die Herrscher.
Willem und sein Dauerbegleiter Rhannoud, ein fluchbeladener Dschinn aus den Reihen der Sila, waren Ahtan nach Paris gefolgt, um ihn aufzuhalten. Mit dem Thejadendolch, denn der unbekannte Waffenbesitzer war niemand anderer als Willem van Kamp.
Am 18. März 2017 gegen 03.00 Uhr morgens kam es im winterkalten Bois de Boulogne zum Showdown. Ahtan hatte den eingemauerten, brandgefährlichen Lampengeist tatsächlich gefunden und befreien können. Allerdings nur aus seinem Wandverlies, nicht aus der Öllampe. Sie war mit dem Salomonischen Siegel verschlossen, das sich allein im Heiligen Land öffnen ließ. Ahtan war auf dem Weg dorthin, als Willem und Rhannoud ihn stellten.
Über dem vereisten Lac Inférieur schleuderte Willem den Dolch auf Ahtan. Die Klinge durchbohrte dessen Hand und nagelte sie an der Öllampe fest. Sofort entzündete sich das tödliche Feuer, und dem Marid blieb keine andere Wahl, als seinen eigenen Arm abzubeißen, wenn er nicht sterben wollte. Er fiel samt Dolch und Lampengeist in den See.
Dort löste der unverträgliche, geballte Gegensatz aus schwarzer und weißer Magie eine mächtige Unterwasserexplosion aus. Als die Wogen sich endlich glätteten, war der Lampengeist tot und der Thejadendolch in eine Wolke aus Metallpartikeln zerfallen. Sie trieben mit den Wellen davon.
Hier hätte die Geschichte ein halbwegs gutes Ende gefunden, denn Ahtan musste fliehen, schwer verwundet und aller Hoffnung auf den Thron beraubt. Doch leider blickte er zurück im Zorn … und erkannte Rhannoud! Ahtans älterer Bruder hatte den Sila einst mit einem Fluch belegt, so grausam und außergewöhnlich, dass man in Maridenkreisen noch heute davon sprach.
Und das war Willems Problem.
Ahtan hatte geschworen, ihn zu töten, hatte ihn allerdings nur ein einziges Mal gesehen, und zwar in Frankreich. Er wusste weder, wie Willem hieß, noch, wo er wohnte. So hätte es nur mäßigen Grund zur Sorge gegeben, und überhaupt keinen Grund, sich mit wiederkehrenden Albträumen herumzuquälen … wäre da nicht Rhannoud gewesen.
Ihn konnte Ahtan aufspüren. Ziemlich mühelos sogar, denn im Reich der Dschinn waren viele Spione unterwegs.
Deshalb hatte Willem den schönen Sila über die Zeitschwelle im Casa de los caminos nach Mekkinsh geschickt, einer zauberhaften Wüstenoase. Sie existierte nur noch dort, nicht im Hier und Jetzt, und man erreichte sie nur zur gleichen Zeit, wenn man synchron über die magische Schwelle trat. Die kleinste Verzögerung im Diesseits konnte am Ziel einen Unterschied von Jahrhunderten ausmachen. So war Mekkinsh das perfekte Versteck für alle, die unter keinen Umständen gefunden werden durften.
»Verdorrie! Ich will mein altes Leben zurück!«, stieß Willem gereizt aus.
»Dein Leben oder Rhannoud?« Hayat trat hinzu, zwei Tassen in den Händen und ein Lächeln im Gesicht. Sie setzte sich neben Willem und reichte ihm den Kaffee.
»Gib es zu: Du vermisst ihn!«
»Den Schönling? Pfff!« Willem schnippte seine Zigarette in die Dunkelheit. Als der Funkenbogen erloschen war und von Hayat noch immer keine Reaktion kam, warf er einen Blick auf sie. Sterne spiegelten sich in ihren dunklen Augen; es war faszinierend anzusehen, wie überhaupt die ganze Frau mit ihrem reichen, langen Haar und dem geheimnisvollen Lächeln, das zum Dahinschmelzen war. Willem tat es.
»Na gut«, gestand er. »Ich vermisse ihn. Nicht übermäßig, und sicher mehr, als Rhannoud uns vermisst. Du hast die Mädchen von Mekkinsh ja gesehen. Alles lecker meisjes