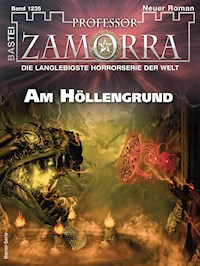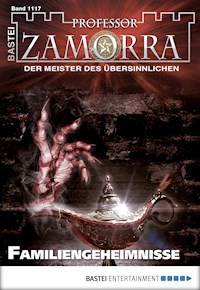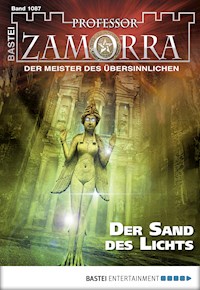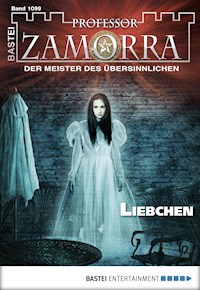1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Die Nacht war erfüllt von ihren drohenden Stimmen, vom Wiehern der Pferde. Es musste eine ganze Horde sein, die da in hohem Tempo herankam. Professor Zamorra konnte den unheimlichen Rächern nicht mehr entfliehen. Sie waren schon zwischen den Häusern. Das Echo dumpfen Hufschlags hallte von den Fassaden wider. Kurz wagte sich Zamorra aus der Deckung, spähte hinaus auf die mondhelle Straße. Was er sah, ließ ihn erstarren. Es gab nur diese eine Straße in Shanooka. Und sie war leer ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Nachts in Shanooka
Leserseite
Kurzgeschichte
Vorschau
Impressum
Nachts in Shanooka
von Stephanie Seidel
Die Nacht war erfüllt von ihren drohenden Stimmen, vom Wiehern der Pferde. Es musste eine ganze Horde sein, die da in hohem Tempo herankam.
Professor Zamorra konnte den unheimlichen Rächern nicht mehr entfliehen. Sie waren schon zwischen den Häusern. Das Echo dumpfen Hufschlags hallte von den Fassaden wider.
Kurz wagte sich Zamorra aus der Deckung, spähte hinaus auf die mondhelle Straße. Was er sah, ließ ihn erstarren.
Es gab nur diese eine Straße in Shanooka.
Und sie war leer ...
Rom
Dunkle Wolken verdeckten den Himmel über der Ewigen Stadt. Regen fiel, und vom nahen Tiber wehte ein unangenehmer, kalter Wind heran.
Trotz des schlechten Wetters waren auch heute wieder zahlreiche Gläubige auf dem Petersplatz unterwegs. Fröstelnd, unter schwankenden Schirmen, pilgerten sie ihrem Sehnsuchtsort entgegen, dem mächtigen, ehrfurchtgebietenden Dom am Rande des Vatikans.
Weiter rechts, etwa zweihundert Meter hinter den Mauern des Kirchenstaates, ragte ein schmuckloses graues Gebäude auf. Dort saß Kurienkardinal Lucien Devaudan soeben in seinem Büro, das Bild des Heiligen Vaters an der holzgetäfelten Wand gegenüber und vor sich auf dem Schreibtisch die Morgenpost.
Zuoberst lag ein roter DIN-A4-Umschlag, der den Stempel »Vertraulich« trug und mit einem Klebestreifen versiegelt war. Auf Briefen dieser Art stand nie ein Absender, und sie wurden den immer gleichen acht Empfängern zugestellt.
Lucien musterte sein Exemplar mit gemischten Gefühlen.
Der 57-Jährige war Vizepräfekt des Vatikanischen Apostolischen Archivs, wie sein Ressort seit 2019 hieß. Der Papst hatte die Umbenennung damals angeordnet, weil die ursprüngliche Bezeichnung Vatikanisches Geheimarchiv irreführend gewesen war, was man allerdings nicht jedem begreiflich machen konnte.
Das hatte sich besonders nach der Veröffentlichung von Dan Browns Roman Illuminati gezeigt. Das Buch war kaum erschienen, da brach ein nie gekannter Ansturm auf das Archiv los. Alle wollten herausfinden, welch unerhört düstere Mysterien sich noch in den 85 Regalkilometern Akten versteckten.
Tatsächlich lagerte dort überwiegend diplomatische oder kircheninterne Korrespondenz. Echte Geheimnisse waren das nicht; die befanden sich im Luogo del Silenzio1, einer doppelt und dreifach gesicherten riesigen Halle unterhalb des Archivs, die es offiziell gar nicht gab.
Sogar im Vatikan selber wurde die Existenz dieses Ortes verschwiegen. Zu groß war die Sprengkraft der brisanten Sammlung darin, zu hoch die Gefahr, die von den ultrageheimen Relikten, Dokumenten und bösartigen Kreaturen ausging.
Nur der Papst und acht ausgewählte Mitglieder der Kurie wussten umfänglich Bescheid. Männer wie Lucien Devaudan, die neben ihrer eigentlichen Tätigkeit noch ein weiteres Amt ausübten. Eines, das in keiner Stellenbeschreibung auftauchte und die nichtssagende Bezeichnung Außerordentlicher Sonderbeauftragter trug.
Diesen Acht oblag die Verantwortung für das verborgene Archiv, womit nicht etwa das gelegentliche Abstauben der Relikte oder der Austausch verbrannter Glühbirnen gemeint war. Sondern ein bis heute aktives, stilles Abkommen zwischen Rom und Jerusalem aus dem späten Mittelalter.
Damals, auf dem Höhepunkt der Reliquienverehrung, blühte in der gesamten christlichen Welt das Geschäft mit angeblich echten Dornenkronen, Märtyrerknochen und garantiert wundertätigen Statuen.
Dabei ging natürlich auch die ernst zu nehmende Forschung weiter, und so kamen neben der Schwemme an gefälschten Objekten auch relevante Funde ans Licht, zum Beispiel das 1712 in Äthiopien entdeckte und vermutlich als Geschenk an seinen Sohn Menelik gesandte Schwert König Salomons.
Immer, wenn sich bei einem solchen Fund die Frage stellte, für welche der beiden Religionen er von größerer Bedeutung wäre – oder größeren Schaden anrichten würde, sollte seine Existenz bekannt werden – griff das stille Abkommen zwischen Rom und Jerusalem.
Dann trafen sich die Sonderbeauftragten mit Vertretern der zuständigen israelischen Behörde zu einer Konferenz hinter verschlossenen Türen, um über den weiteren Verbleib des Objekts zu verhandeln. Natürlich auch über dessen Wert.
Am Ende wurde es entweder der jeweils anderen Partei nach einer als Aufwandsentschädigung deklarierten Einmalzahlung überlassen oder als Tauschobjekt genutzt, wie die am Toten Meer gefundene Schriftrolle, deren Inhalt problematisch war: Ein unbekannter Korintherbrief, in dem die Rolle Maria Magdalenas anders dargestellt wurde, als es der Katholischen Kirche behagte.
Der Preis dafür, dass dieses unangenehme Enthüllungsschreiben für immer im Luogo del Silenzio verschwinden konnte, war Salomons Schwert gewesen.
Lucien erinnerte sich noch gut an die Reaktion des Papstes auf den erfolgreichen Abschluss jener Aktion. »Glaube gedeiht auf den Feldern der Beständigkeit«, hatte er gesagt. »Veränderungen sind das Unkraut, das den Boden vergiftet und die Menschen schwach werden lässt.«
Mit anderen Worten: Sorgt dafür, liebe Sonderbeauftragte, dass alles so bleibt, wie es ist!, dachte Lucien lächelnd, während er nach dem roten Umschlag griff.
Er enthielt nur wenige Dokumente, und keines davon war eine Überraschung. Trotzdem verblasste Luciens Lächeln bei der flüchtigen Durchsicht. Da war die Terminbestätigung der Dringlichkeitssitzung der Sonderbeauftragten, die in zwei Tagen stattfinden sollte; dazu die Kopie eines alten Schreibens der israelischen Regierung sowie drei farbig ausgedruckte Satellitenaufnahmen.
Bei dem Schreiben handelte es sich um die offizielle Ausfuhrgenehmigung einer antiken Steintafel, die israelische Archäologen am Berg Sinai gefunden hatten. Laut Radiokarbonmethode datierte sie auf die Zeit Mose. Die Schriftzeichen darauf mussten unter ungeheurer Hitzeeinwirkung entstanden sein, und was sie darstellten, war ein Schock gewesen.
Das elfte Gebot. Der Befehl Gottes an sein Volk, niemals nach den Sieben Grenzen zu suchen, die seine Schöpfung vor dem Zugriff Satanaels bewahrten. Dem gefallenen Erzengel. Urquell des Bösen.
Es hatte schon immer Gerüchte gegeben, Andeutungen, versteckte Hinweise in der Kabbala und anderen Geheimschriften, dass dieses Gebot existieren könnte. Und mit ihm Satanaels Versprechen auf Reichtum und Macht im Überfluss für denjenigen, der bereit wäre, die Sieben Grenzen zu zerstören, die er selber nicht zu überschreiten vermochte.
Schon nach der ersten Sichtung war man sich damals einig gewesen, dass diese Gebotstafel unter Verschluss bleiben musste. Am besten im Luogo del Silenzio, der sich noch besser für die Aufbewahrung besonders gefährlicher Objekte eignete als sein Pendant in den Katakomben von Jerusalem.
Ewig lange hatte die Tafel dort gelegen, gut gesichert, unbeachtet. Beinahe vergessen.
Bis Archäologen bei der Erforschung einer historischen Stätte nahe Jerusalem auf das Grab eines Teilnehmers am Ersten Kreuzzug stießen2. Was er bei sich hatte, war so unheimlich, dass es die Behörden auf den Plan rief.
Noch in der Nacht wurde das stille Abkommen aktiviert. Per Videokonferenz berichteten Vertreter der Rabbinischen Kommission den erschrockenen Sonderbeauftragten, dass sie bei dem Toten etwas gefunden hatten, das eigentlich gar nicht existieren konnte: ein fast tausend Jahre altes Pergament mit der Zeichnung des siebenstrahligen Morgensterns darauf.
Wer immer sie erstellt hatte, musste die Gebotstafel gesehen haben, lange bevor sie entdeckt wurde, denn die Zeichnung war eine exakte Kopie des eingebrannten Originals.
Luciens nachdenklicher Blick wanderte über die Sitzungsunterlagen.
»Dieses Grab hätte nie geöffnet werden dürfen«, murmelte er. »Irgendwas ist da freigekommen, und ich frage mich, ob es möglich ist, dass die Tafel darauf reagiert! Gott hat sie erschaffen, und wir wissen, dass der göttliche Funke in ihr noch immer brennt. Was, wenn etwas diese Energie nutzt, um das unselige Versprechen zu verbreiten von Reichtum und Macht für die Zerstörung der Sieben Grenzen?«
Er seufzte.
Sogar mein Bruder war kurzfristig daran interessiert. Zum Glück konnte ich es ausreden.
So glaubte er. Lucien sah zum Bürofenster hin, das der Wind mit immer neuen Salven glitzernder Regentropfen bewarf.
Draußen, über den träge dahinziehenden Wolken, schwebte ein Grauschleier am Himmel. Er war zwei Wochen nach dem Grabfund in Israel aufgetaucht. Und er bedeckte den gesamten Kontinent.
Wo er herkam, war ein Rätsel, ebenso seine Zusammensetzung. Man wusste nur, dass er in der Stratosphäre lag, deutlich oberhalb der Flughöhen militärischer und ziviler Luftfahrzeuge.
Anfangs waren noch die üblichen Verdächtigen als Auslöser betrachtet worden: Klimawandel, Waldbrände im Mittelmeerraum, Vulkanausbrüche.
Doch vor Kurzem hatte sich ein zweiter Grauschleier gebildet, und jetzt sogar ein dritter. Sie lagen flächendeckend über Asien und Afrika. Mit jedem neuen Schleier verdunkelten sich alle um einen Hauch, und allmählich wurde das Ganze bedrohlich.
Erste Medien spekulierten bereits über eine unbekannte Massenvernichtungswaffe; Sektenprediger verkündeten, die Reiter der Apokalypse seien im Anmarsch, und die Aluhütchenträger müllten das Internet zu mit ihren angeblichen UFO-Sichtungen in Flottenverbandsgröße.
Man hätte darüber lachen können, wäre da nicht die wachsende Verunsicherung der Menschen gewesen – und die Ahnung der Kirchenfürsten, dass hinter dem rätselhaften Phänomen etwas steckte, das in ihren Zuständigkeitsbereich fiel.
Da ist was Böses am Werk! dachte Lucien und bekreuzigte sich.
Mehrfach hatten er und die anderen Sonderbeauftragten schon darum gebeten, sich der Sache annehmen zu dürfen. Doch der Papst, der es nach wie vor ablehnte, in den Grauschleiern etwas anderes zu sehen als ein ungewöhnliches Naturschauspiel, verweigerte seine Erlaubnis. Er argumentierte, dass es nicht Aufgabe der Kirche sei, das Wetter zu erforschen, und dass allein die Wissenschaft dafür zuständig wäre.
Übermorgen auf der Sitzung werde ich meinen Verdacht vortragen, dass wir gerade den Beginn einer satanischen Aktivität erleben, und dass die Grauschleier ihre Begleiterscheinung sind!
Luciens Hand lag auf den ausgebreiteten Dokumenten. Nervös trommelte er auf dem Deckblatt herum.
Wenn ich Seine Heiligkeit nur davon überzeugen könnte, dass eine Verbindung besteht zwischen den Schleiern am Himmel, der Gebotstafel und dem Pergament aus dem Grab! Aber wie soll ich das beweisen? grübelte er.
Ein Klingeln zerschrillte seine Konzentration.
Unwillig wandte sich Lucien dem Telefon zu. Das Display zeigte die Durchwahl seines Privatsekretärs Matteo Perini, der nebenan im Vorzimmer saß und eigentlich strikte Anweisungen hatte.
»Ich wollte nicht gestört werden, Matteo«, erinnerte ihn Lucien.
»Verzeihen Sie, Eminenz! Aber ich habe hier einen Professor Zamorra aus Frankreich in der Leitung, der sagt, er müsse Sie dringend sprechen. Es geht um Ihren Bruder.«
Der Kurienkardinal erschrak.
»Gaspard? Ist ihm was passiert?«
»Das... das weiß ich nicht.«
»Schon gut, Matteo. Stellen Sie ihn durch!«
»Professor Zamorra! Was kann ich für Sie tun?«, fragte Lucien, während er seine Sitzungsunterlagen beiseite schob. Sie lenkten ihn zu sehr ab.
»Ich möchte um Ihre Hilfe bitten, Eminenz!«, scholl es warm und freundlich zurück. »Ich versuche seit Wochen, Ihren Bruder zu erreichen, aber er antwortet nicht.«
Lucien nickte.
»Gaspard hat sich Urlaub genommen, soweit ich weiß, und wahrscheinlich will er nicht gestört werden. Fragen Sie mal an seinem Institut nach. Da sind seine Kontaktdaten hinterlegt für den Notfall. Wenn es einer ist, wird man sie Ihnen geben.«
»Es ist einer, und ich habe mit dem Institut gesprochen«, erwiderte Zamorra. »Aber die hatten nur seine private Handynummer. Deshalb bin ich zur Wohnung Ihres Bruders gefahren, und dort erzählte mir die Concierge, er sei auf Dienstreise. In Afrika!«
Lucien runzelte die Stirn.
»Afrika? Das muss ein Irrtum sein! Gaspard forscht über die Großen Kreuzzüge, was sollte er da in Afrika?«
»Ja, oder in Deutschland und in China, wo er unmittelbar vorher war, angeblich ebenfalls dienstlich«, ergänzte Zamorra. »Aber an der Sorbonne hat man mir gesagt, dass von Doktor Devaudan keine Dienstreisen beantragt wurden. Das Ganze ist sehr merkwürdig, und ich mache mir ernsthaft Sorgen.«
Luciens Stirnrunzeln vertiefte sich. Der Mann am Telefon klang aufrichtig, und er redete wie ein guter Freund, dem Gaspards Wohlergehen am Herzen lag.
Aber er war kein Freund. Er war ein Fremder.
»Sie sagten, Sie wären ein Kollege Gaspards?«, fragte Lucien skeptisch.
»Wir haben in unterschiedlichen Fächern promoviert, aber gemeinsame Interessen«, antwortete Zamorra ausweichend. »Einer meiner Vorfahren, Leonardo deMontagne, war Teilnehmer am Ersten Kreuzzug. Ihr Bruder hatte mich nach seiner Rückkehr aus Israel kontaktiert, um Informationen über ihn einzuholen.«
»Israel«, murmelte Lucien.
»Da wurde doch dieses Grab entdeckt. Bestimmt haben Sie davon gehört. Ein französischer Knappe, der ein hohles Bronzekreuz bei sich hatte, mit dem Papst Urban II. seinerzeit den geheimen Aufruf zum Ersten Kreuzzug verschickt hat. Ihr Bruder war bei der Laboruntersuchung der Funde zugegen.«
Zamorra klang völlig unaufgeregt, und Lucien lief ein Schauer über den Rücken. Wenn er bis eben noch geglaubt hatte, sein Gesprächspartner wäre nur ein unbedarfter Akademiker, der sich nach Gaspard erkundigte, dann wusste er es jetzt besser.
»Wer sind Sie, Professor Zamorra?«, fragte er. »Und was wollen Sie wirklich von mir?«
Einen Moment herrschte Stille in der Leitung. Der Anrufer schien um eine Entscheidung zu ringen.
Und er traf sie.
»Lassen Sie mich offen sprechen, Eminenz«, bat Zamorra. »Ich weiß, dass Sie von dem Grab wissen, von dem Kreuz und dem Pergament darin.«
»Gaspard hat die Zeichnung nie gesehen«, platzte Lucien heraus. Zu spät biss er sich auf die Lippen.
Was verrate ich da? dachte er entsetzt.
»Das wäre möglich«, hörte er Zamorra sagen. »Es könnte ein Zufall sein, dass er drei Kontinente hintereinander besucht und jedes Mal direkt nach seiner Abreise ein weiterer Grauschleier aufzieht. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Bruder ohne Grund die halbe Welt bereist? Einfach so, zum Vergnügen?«
»Ich... äh....«. Fieberhaft suchte Lucien nach einer Antwort.
Zamorra kam ihm zuvor.
»Etwas geschieht hier, das nicht geschehen sollte, Eminenz«, sagte er ruhig. »Und ich befürchte, Ihr Bruder schwebt in großer Gefahr!«
»Wie kommen Sie darauf?«, fragte Lucien verunsichert.
»Das möchte ich am Telefon nicht erläutern«, erwiderte Zamorra. »Die Sache ist zu heikel. Wäre es Ihnen recht, wenn ich nach Rom käme für ein Gespräch unter vier Augen? Ich will Ihren Bruder retten, aber dafür brauche ich Ihre Hilfe.«
Luciens Gedanken überschlugen sich.
»Einen Moment, bitte!«, sagte er schließlich, drückte die Pausentaste und rief seinen Privatsekretär an.
»Matteo! Dieser Professor Zamorra – wissen Sie was über ihn?«
»Jawohl, Eminenz!«, war die überraschende Antwort. »Es gibt einen Eintrag über ihn in unserer Datenbank. Der Mann ist ein hochgeachteter Wissenschaftler und Mitglied der Parapsychological Association3, zu deren Jahrestreffen wir immer einige Beobachter entsenden. In ihren Protokollen steht, dass Zamorra dort von seinen Erfolgen berichtet im Kampf gegen das Böse, und die sind außergewöhnlich.«
»Kann man ihm vertrauen?«