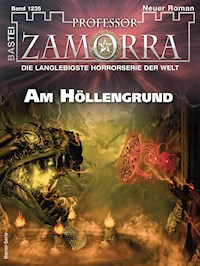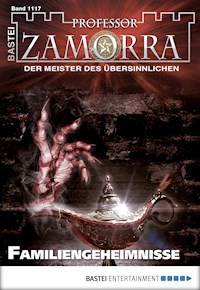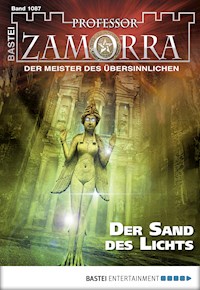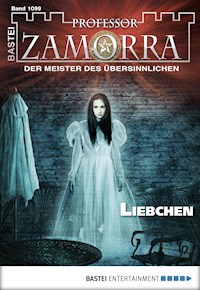1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Es sind nur Indizien, die Willem van Kamp nach Äthiopien reisen lassen: Bei ihrer Hexenjagd in Essaouira hatten Ibrahim Choukri und er auf dem Wandbild einer versunkenen Synagoge etwas entdeckt, das ein Thejadendolch sein könnte. Anscheinend wurde er der Herrscherin von Saba überreicht - von König Salomon, seinem ursprünglichen Besitzer. Das Thema Ahtan hingegen scheint erledigt: der verstoßene Marid wurde seit Anfang des Jahres nicht mehr gesehen. Gut möglich also, dass er gar nicht mehr lebt. Glaubt Willem ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Verwunschene Wasser
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Arndt Drechsler
Datenkonvertierung eBook: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-5557-4
www.bastei-entertainment.de
Verwunschene Wasser
von Stephanie Seidel
Zamorra schaute aufmerksam auf den Monitor, als der grobkörnige Schwarzweiß-Film anlief. Im Museum brannte nur die Nachtbeleuchtung: kleine Deckenstrahler, die den freien Raum zwischen Glasschränken und Exponaten mit Schattenstreifen belegten. Die Vitrine, in der sich das rätselhafte Buch befand, war gut zu erkennen, trotz der schlechten Bildqualität.
Minuten vergingen. Nichts bewegte sich, und Zamorra tränten schon die Augen. Doch dann, urplötzlich, begann der Spuk.
Die kostbaren, altersbrüchigen Buchseiten gerieten in Bewegung. Eine unsichtbare Hand schien sie zu ergreifen, anzuheben, umzuschlagen. Als suche sie etwas.
»Das ist kein harmloser Poltergeist«, sagte der. »Nie im Leben …«
7. Juli 2017Marokko
Abendstimmung lag über der Küste. Das Meer glitzerte wie kostbares Geschmeide, und ganz Marokko war in rotgoldenes Licht getaucht, bis hinauf zu den schneebedeckten Gipfeln des fernen Atlasgebirges.
Um diese Tageszeit bot die Hafenstadt Essaouira einen schier magischen Anblick. Das seewärts gerichtete Stadttor und die hohen Festungsmauern mit ihren Türmen und Erkern waren vom Alter gezeichnet und eigentlich längst überflüssig. Auch die großen Kanonen, von den Portugiesen einst in langer Reihe an die Schießscharten gestellt, hatten seit Ewigkeiten nichts mehr zu tun gehabt. Denn es kamen keine Feinde mehr. Nur noch Touristen.
Doch wenn das Streiflicht der sinkenden Sonne auf das Bollwerk traf, dann war es, als flammte ein Feuerschein um die schweigenden Waffen, als verschwänden an den Mauern alle Wunden der Zeit. Und sie wurden ein weiteres Mal mächtig und uneinnehmbar.
Natürlich mit Bogenschützen an den Zinnen. Denn wenn die Flut nahte, so wie jetzt, und aus dem Rauschen der Wellen donnernde Brandung wurde, konnte man sich sehr gut vorstellen, dass gleich eine großartige Schlacht entbrennen würde.
Zumindest, wenn man ein kleiner Junge war.
Selbstverständlich ging es bei der Schlacht nicht um das echte Essaouira, nein. Sondern um Astapor, die Sklavenstadt aus Game of Thrones.
Mustafa Dhakil seufzte.
Der 7-Jährige war dabei gewesen, als auf der Hafenskala gedreht worden war. Er hatte damals einen Platz an der Absperrung ergattert und von dort aus staunend zugesehen, wie sich die breite Promenade, auf der sonst nur Touristen und Straßenverkäufer unterwegs waren, in ein Märchen verwandelte.
Erst war es nur eine geheimnisvolle Baustelle gewesen. Da wurden Mauern und Torbögen herangeschoben, die aus magischem Gestein sein mussten, denn sie ließen sich so leicht bewegen wie Handkarren. Scheinwerfer wurden angebracht, Kabel abgerollt und Schienen verlegt, auf denen statt einer Eisenbahn ein merkwürdiges … Ding fuhr, mit einer Kamera darauf. Unglaublich viele Leute liefen herum, alle schwer beschäftigt. Es wurde gehämmert und gesägt, Verkleidungen über die denkmalgeschützten Kanonen gebaut, weil man sie nicht entfernen durfte, und ein riesiger Thron aufgestellt.
Am Ende, als alles fertig war, verschwanden die normalen Leute. Auf den abgedeckten Kanonen standen jetzt Sklaven an einem Pfahl; Krieger marschierten durch das Stadttor heran, und ein König nahm Platz auf dem Thron. Dann gingen die Lichter an. Alle Gespräche verstummten, jemand rief ein geheimes Wort (»Action!«) … und das schönste Mädchen der Welt erschien!
Mustafa konnte sich noch genau an das Kribbeln erinnern, das der Anblick dieser zarten, fremdartigen Gestalt in ihm ausgelöst hatte. Ihr Name sei Daenerys, hatte ihm jemand zugeflüstert. Als sie zu sprechen begann, so fremd und wohlklingend, da war es wie ein Zauber gewesen, der ihn, Mustafa, in seinen Bann schlug und ihn mitnahm auf die Reise in eine Wunderwelt.
Seitdem hoffte der Junge darauf, dass die Leute zurückkehrten, die seine Fantasie so befeuert hatten. Mustafa verstand ihre Sprache nicht. Er konnte auch nicht lesen, aber er war ein aufgewecktes Kind, das die richtigen Fragen stellte. Und wie aufregend war es gewesen, herauszufinden, dass Daenerys eine Königin war und mit Drachen sprach, die außer Mustafa zum Glück auch kein anderer am Set sehen konnte. Dass sie ein gutes Herz hatte und arme Leute befreite, die immer nur arbeiten mussten. Daenerys, die Herrliche. Mit den silberweißen Haaren und den blauen Augen.
»Mustafa!«
Die Stimme seiner Mutter riss den Jungen aus seinen Träumen. Er hatte mit ihr und seinen fünf Geschwistern am Strand bei den Felsen gesessen, weit entfernt von den Touristen, damit die sich nicht belästigt fühlten.
Denn die Dhakils gehörten nicht zu den Wasser-, Andenken- und Eisverkäufern, die den ganzen Tag lang zwischen ölig glänzenden Sonnenanbetern herumliefen, um ihre Waren anzupreisen.
Mustafa und seine Familie waren Aufräumer. Es blieb immer etwas liegen, wenn die Badegäste nach Hause gingen, und waren sie erst einmal fort, verfiel auch ihr Besitzanspruch. Nicht dass ihn jemand erhoben hätte auf leere Flaschen oder undichte Schwimmreifen. Doch es fanden sich auch andere Dinge im zerwühlten Sand.
Das Meiste konnte man zu Geld machen. Geld, das eine arme Familie dringend benötigte. Deshalb gingen die Dhakils allabendlich an den Strand. Sie wohnten in der Mellah, dem ehemaligen Judenviertel am Rande der Medina. Und während in der Altstadt das bunte Leben pulsierte, mit Bars und Restaurants und Cafés und einer unglaublichen Vielzahl an Geschäften, die alles anboten, was das Herz begehrte, gab es in der Mellah, zwei Straßenzüge weiter, nur eines: Ruinen.
Einsturzgefährdet, ohne Wasser und Strom. Mit leeren Fensterhöhlen, durch die der Wind pfiff und nicht selten auch ein Regenguss hereinkam. Mellah war die Schattenseite der reichen Stadt. Und des Lebens. Wer einmal in den Ruinen gelandet war, ob hineingeboren oder durch tragische Umstände dort hin verschlagen, der kam nie wieder hinaus.
Mustafa nahm die zerknitterte Plastiktüte entgegen, die seine Mutter ihm hinhielt, und rutschte von den Felsen herunter.
Inzwischen hatte sich der Strand geleert, und auch die letzten Nachzügler brachen soeben auf. Da wurden Handtücher ausgeschlagen, Kinderspielzeug eingesammelt und Campingtaschen gepackt. Sonnenschirme gab es ebenfalls. Allerdings nur selten und nur bei den hellhäutigen Neuankömmlingen, die noch nicht verinnerlicht hatten, warum Essaouira die Stadt der Winde genannt wurde.
Der Junge gähnte ungeniert, als er neben seiner Mutter hertrottete. Es war ein langer Tag gewesen, und wie gern hätte Mustafa ihn auch einmal mit gemütlichem Nichtstun verbracht, den Kopf voller Träume.
Doch an so etwas war nicht zu denken. Alle aus der Familie mussten arbeiten, bis auf den Kleinen, den die Mutter auf der Hüfte trug. Mustafas ältere Brüder verdienten ihr Geld als Karrenschieber. Das bedeutete: raus aus den Decken, sobald es dämmerte, und schnell hinunter zum Hafen. Wenn die Fischer ihren Nachtfang hereinbrachten, wurden immer Helfer gesucht, die das glitschige Viehzeug auf Handkarren verluden und zum Fischmarkt hinauf schoben. Eine Festanstellung gab es nicht. Wer zuerst kam, erhielt den Auftrag. Das galt auch für alle anderen ihrer Gelegenheitsjobs.
Die Mädchen und die Mutter stellten Schmuck aus Muscheln und bunten Steinen her. Die sammelten sie in der Morgendämmerung am Strand, wenn die Flut zurückgegangen war. Zu Hause wurden die Funde geputzt, durchbohrt und auf gebrauchte Angelschnüre gezogen, die man bei den Fischern abstauben konnte.
Der Vater, Khalid Dhakil, arbeitete auf dem Bau, wenn irgendwo zusätzliche Hände gebraucht wurden. Ansonsten hütete er den Verkaufsstand. Gleich vor der Haustür, bestehend aus zwei Campingtischen, die sie mal am Strand gefunden hatten. Khalid war auch sehr geschickt mit dem Schnitzmesser, er stellte Möwen und Eleonorenfalken her, die sich ganz gut verkaufen ließen. Das Material dafür – Treibholz – stammte ebenfalls vom Strand.
Diese Waren bot er Touristen an, wenn sie durch das nahegelegene Osttor in die Mellah kamen. Mustafa hatte nie verstanden, warum Leute aus fernen Ländern anreisten, um sich kaputte Häuser anzusehen. Und mehr gab es nicht im alten Judenviertel. Ruinen, Staub, Schutt, wilde Hunde, etwas Unkraut und noch mehr Ruinen.
Trotzdem wäre Mustafa heute gern zu Hause geblieben. Denn in seinem sonst so langweiligen Viertel war die Polizei unterwegs!
»Da vorne liegt noch eine Flasche, Junge!«, erinnerte ihn seine Mutter mit einem Fingerzeig.
»Ja, ja!«, sagte Mustafa ungeduldig.
»Da-da«, ahmte ihn das Baby nach, und er lachte.
Doch sobald er die Pfandflasche in seiner Tüte verstaut hatte, wandte sich Mustafa innerlich wieder den wichtigen Dingen zu. Die Polizei war in der Mellah! Nicht nur die hiesigen Beamten, sondern obendrein noch eine Spezialeinheit aus der großen Küstenstadt Safi! Mit Leichenspürhunden!
Das ist so gemein!, dachte er. Da ist ein Mal was los, und ich darf nicht dabei sein!
Natürlich hatte er alles versucht, um seinen Eltern die Erlaubnis abzuringen, an der spannenden Suchaktion teilzunehmen. Immerhin hatte der Polizeichef Ali Yasman alle Männer um Unterstützung gebeten, und es waren auch etliche seinem Aufruf gefolgt. Sogar Doktor Choukri, der bedeutende Gelehrte, den man nicht einfach ansprechen durfte, wenn man zu Hause keinen Ärger bekommen wollte. Er wohnte am Rande der Medina, in der Rue Abdelaziz El Fachtali, gleich hinter dem Osttor. Wo Straßenbäume kühlenden Schatten warfen und vornehme Stille herrschte.
Ibrahim Choukri kam des Öfteren in die Mellah. Niemand wusste, wonach der graubärtige Herr dort suchte, und warum er immer diese altmodische Laterne mitbrachte. Vielleicht hatte es etwas mit dem Museum zu tun, für das er arbeitete.
Zum Glück war Doktor Choukri ein freundlicher Mann, der sich Zeit nahm für Kinder, die ihn unbedingt etwas fragen wollten. Selbst wenn man nur ein 7-jähriger Junge aus der Ruinenstadt war.
Und fragen musste man ihn! Wie sonst hätte man herausfinden sollen, ob Daenerys womöglich in seinem schönen, großen Haus wohnte? Wenn in Essaouira gedreht wurde, und das war oft der Fall, nicht nur für Game of Thrones, dann wurde Doktor Choukri meistens als Berater hinzugezogen. Weil er sich so gut auskannte mit der Vergangenheit.
Und er vermietete Zimmer an die Fremden!
Choukri hatte gelacht, als Mustafa ihn todesmutig darauf ansprach. Nein, hatte er geantwortet, bei ihm würden nur die einfachen Leute aus dem Filmteam wohnen. Eine Königin wie Daenerys sei auch besser in ihrem hiesigen Schloss aufgehoben, dem Hotel Gonatouki. Das war ein roter Prachtbau am Meer, der tatsächlich aussah wie ein orientalisches Schloss.
Doch am nächsten Abend hatte er die Dhakils aufgesucht, um Mustafa das Geschenk seines Lebens zu überreichen: ein Foto der wundervollen Drachengebieterin, auf dem sie lächelte wie ein Engel und auf dem etwas geschrieben stand.
To Mustafa! Love, Daenerys, hatte Doktor Choukri ihm vorgelesen.
In Liebe! Stand das da wirklich? Das schönste Mädchen der Welt schrieb so etwas an ihn? Mustafa hatte fast geweint vor Glück. Hatte Doktor Choukri angefleht, ihm jeden einzelnen Buchstaben zu erklären. Wie man ihn aufmalte. Und Worte daraus machte, um Daenerys wissen zu lassen, dass er gern ihr Drachenhüter werden würde. Sie müsste ihm nur zeigen, wo die unsichtbaren Dinger waren.
Daraufhin hatte sich der Doktor an Vater Khalid gewandt.
Der Junge sollte zur Schule gehen, hatte er gesagt. Mustafa sei klug und wissbegierig, das dürfe man nicht verkümmern lassen.
Schule können wir uns nicht leisten, war die knappe Antwort des Vaters gewesen. Das sagte er immer, wenn dieses Thema zur Sprache kam. Und immer mit einem Ausdruck tiefster Traurigkeit in den Augen.
So war die Königin seines Herzens abgereist, ohne zu erfahren, was Mustafa ihr so gerne mitgeteilt hätte. Aber eines Tages würde sie zurückkehren, hatte Doktor Choukri ihm lächelnd versprochen, und dann könnte man ja mal sehen, ob Daenerys Zeit hätte, ihren Fan zu empfangen. Was immer das Wort Fan bedeuten mochte.
Zunächst jedoch galt es, das düstere Rätsel zu lösen, das sich anscheinend in der Mellah verbarg und selbst Doktor Choukri umtrieb.
Vier Männer waren verschwunden. Spurlos! Alle im Verlauf der letzten zwei Wochen, ohne ersichtlichen Grund, ohne Erklärung.
Wohliger Grusel ließ den Jungen erschauern. Hier im windumtosten Abendrot, an der Seite seiner Mutter, fühlte sich Mustafa sicher. Es war noch hell am Strand, und von den wenigen Schatten am Boden war keiner groß genug, um einem Toten zu gleichen. Deshalb konnte man entspannt über die Sache nachdenken, die ganz Essaouira in Aufruhr versetzt hatte.
Mustafas Vater vermutete, dass sich ein Verrückter in der Stadt herumtrieb, der Jagd auf Muslime machte. Die verschwundenen Männer waren ausnahmslos Einheimische, da konnte es tatsächlich sein, dass der Mörder ein Ungläubiger war. Ein Tourist. Und getötet hatte er sie bestimmt, denn es gab keine Lösegeldforderung.
Aber wo waren die Leichen?
Hoffentlich sind sie noch da, wenn wir nach Hause kommen! Ich will auch mal eine sehen! Der 7-Jährige bückte sich nach einem vergessenen Feuerzeug. Es funktionierte noch, und er steckte es ein.
Ein herrenloser Hund kam über den Strand heran. Er hoffte wahrscheinlich, dass in den halbvollen Plastiktüten der Dhakils etwas Essbares war, das sich abstauben ließ, wenn man die Menschen nur ausdauernd genug anbettelte.
Doch Mustafas Mutter hatte Angst um ihren Jüngsten, dem das große Tier selber nicht geheuer zu sein schien, wie sich an seinem weinerlichen Gesichtchen ablesen ließ. Darum bückte sie sich nach einer Handvoll Sand und scheuchte den Streuner davon.
Papa sagt, Polizeihunde werden auf eine Schule geschickt, wo sie lernen, tote Leute zu finden, selbst wenn die ganz tief vergraben sind!
Mustafa presste die Lippen zusammen. Er wollte auch zur Schule gehen und etwas lernen! Nicht unbedingt, wie man tote Leute fand; aber Lesen und Schreiben, das wäre gut. Warum durften selbst Hunde dahin und er nicht?
Der kleine Träumer warf einen Blick hinauf zur Hafenmauer. Hunderte Möwen besetzten die Zinnen; von Drachen keine Spur. Auch das magische Abendrot, das den alten Steinen für kurze Zeit ihre einstige Stärke und Vollkommenheit zurückgegeben hatte, verblasste bereits.
Mustafa schaute an seiner Mutter vorbei aufs Meer: Die Sonne hatte den Horizont erreicht. Nur ein feuriges Band flammte noch über den Wellen, das zusehends kleiner wurde.
»Wir sollten bald nach Hause gehen, Mama!«, sagte er unsicher. »Wenn die Sonne weg ist, fängt die Zeit der Dämonen an!«
Seine Mutter seufzte. »Lass mich raten: Das hat dir Najima erzählt.«
Najima war ein zahnloses altes Weib, das tagein, tagaus schwarz verhüllt auf dem alten Judenfriedhof herumspukte und grässliche Schauergeschichten kannte. Die Mellah-Jungen liebten sie.
Mustafa nickte eifrig. »Und sie hat auch gesagt, dass übermorgen bei Vollmond die Nacht der Hexen beginnt. Da müssen alle Kinder zu Hause sein, hinter verschlossenen Türen und Fenstern. Sonst werden sie gefressen. Denn wenn der Sahara-Mond aufgeht, dann schlüpft eine neue Hexenbrut.«
»Oh Allah! Was für ein Unsinn!« Die Muslima schüttelte den Kopf. »Lass dir von dieser dummen Frau keine Angst machen, mein Sohn! Alle Geister, ob gut oder böse, gehören dem Einen Gott, und er beschützt uns Gläubige, darauf kannst du dich verlassen. Und Hexen gibt es gar nicht.«
Mustafa vertraute seiner Mutter. Sie hatte ihn noch nie belogen.
Also brauchte er auch nicht weiter diese merkwürdige Fledermaus zu beobachten, die zwischen den kreisenden Möwen aufgetaucht war und im Zickzack-Kurs hinausflog aufs Meer. Richtung Mogador, der geheimnisvollen Insel draußen vor Essaouira, die niemand betreten durfte, weil da seltene Raubvögel nisteten. Najima hatte behauptet, das wäre eine Ausrede, und in Wahrheit wollte man die Menschen von etwas ganz Anderem fernhalten.
Aber was wusste sie schon. Wenn Mama sagte, alles sei gut, dann war auch alles gut, und auf Mogador lebten nur Eleonorenfalken. Keine Hexen …
***
Sahara. Ein kleines Wort, das große Bilder hervorruft. Von unendlichen Weiten, goldenen Sanddünen, Kamelkarawanen. Bilder märchenhafter Oasen und eines sternenübersäten Nachthimmels, zu dem die Gluthitze des Tages aufsteigt, um Platz zu machen für Temperaturstürze bis zu minus 10 Grad und Bodenfrost.
So faszinierend die Sahara einerseits ist, so lebensfeindlich ist sie auf der anderen Seite. Darum passt der Name auch so gut. Denn das kleine arabische Wort bedeutet nichts anderes als … Hexen.
Allerdings sind damit keine hässlichen, krummnasigen Lebkuchenhausbesitzerinnen gemeint. Hexen des Abendlandes kommen im Orient nicht vor. Seine paranormalen Wesen, und derer gibt es viele, zählen überwiegend zu den Dschinn, die vor vier Milliarden Jahren aus den Tiefen des Alls eintrafen. Der Protoplanet Theia, dem die Entstehung unseres Mondes zu verdanken ist, hatte ihre Urform beim Zusammenprall mit der noch jungen Erde auf dem späteren afrikanischen Kontinent abgeliefert.
Aus den Bar’baalen, eben jener Urform, gingen im Laufe der Evolutionsgeschichte sieben verschiedenen Dschinnarten hervor. Alle, von den rangniedrigsten Ashbah bis zu den brandgefährlichen Mariden, halten sich überwiegend in einer Art Parallelwelt auf, die den Orient überlappt. Ein beständiger Kontakt zu bzw. mit Menschen ist die Ausnahme.
Denn Dschinn erachten Menschen als das, was die Menschen in Tieren sehen: untergeordnete Lebewesen, die man auch essen kann. Wer gewisse Regeln einhält und Vorsicht walten lässt, vermag durchaus eine halbwegs friedliche Koexistenz mit den uralten Geistwesen zu führen. Ashbah sind ohnehin nur lästige Plagegeister, die sich verscheuchen lassen, und selbst Maride töten nicht ununterbrochen und in großer Zahl.
Doch es gibt eine Ausnahme zu alledem, und das ist Rang Nummer Vier: die Sahara.
Hexen ernähren sich von Kindern. Durchgehend.
Der Dschinn-Experte Doktor Ibrahim Choukri aus Marokko hatte 2003 im Rahmen eines Forschungsprojekts mit einem Team der Parapsychological Association, der auch Professor Zamorra angehört, das fortgesetzte, rätselhafte Verschwinden kleiner Kinder im Orient untersucht. Das Ergebnis erstaunte selbst die Wissenschaftler. In 36% der Fälle konnten Menschen als Täter ausgeschlossen und stattdessen Spuren paranormaler Aktivitäten nachgewiesen werden. Indizien deuteten darauf hin, dass es Hexen gewesen waren, die sich der Kleinen bemächtigt hatten.
Und Choukri fand noch etwas anderes heraus. Sahara existieren, wie andere Hexen auch, nur in der weiblichen Form. Alle fünf Jahre werden sie fruchtbar, und zwar in der Zeit zwischen Sommersonnenwende und dem darauffolgenden Vollmond. Choukris Forschung erbrachte den Nachweis, dass genau in dieser Zeitspanne, ebenfalls alle fünf Jahre, die Zahl der geraubten Kinder sprunghaft anstieg.
Und immer dann hatte der erste Vollmond nach der Sommersonnenwende eine unheimliche, blutrote Aura.
Sie ist nur über dem Orient zu sehen, nirgends sonst. Meteorologen vermuten als Verursacher ein wiederkehrendes Windphänomen, das den rötlichen Saharasand wie einen Schleier in höhere Luftschichten trägt. So könnte der Eindruck entstehen, die eigentlich normale Aura des Mondes habe sich verfärbt.
Wissenschaftler nannten dieses Phänomen folgerichtig Sahara-Mond.
Sie hatten keine Ahnung, wie zutreffend der Name war.
***
Der Junge am Strand passte in ihr Beuteschema. Wäre er allein gewesen, hätte sie ihn sich geholt, denn sie verspürte Lust auf eine warme Mahlzeit.
Doch er war mit sieben anderen Menschlingen unterwegs, im Schein der sinkenden Sonne, weithin sichtbar. Zu früh, zu hell, zu aufsehenerregend. Was auch für sie selbst galt, weshalb die Sahira[1] um diese Zeit normalerweise gar nicht draußen gewesen wäre: Orientalische Hexen zogen es vor, den Tag zu verschlafen. An verborgenen Orten, und meist in Gesellschaft von Fledermäusen, deren Aussehen sie als Gestaltwandler mühelos annehmen konnten.
Auch heute hatte sie eigentlich vorgehabt, bis zur Abenddämmerung in ihrem Versteck zu bleiben, einer dunklen Zimmerflucht in der Ruinenstadt. Zwölf Tage lang war sie dort sicher gewesen, als Fledermaus getarnt inmitten eines großen Schwarms, und nichts hatte darauf hingedeutet, dass sich daran während der letzten beiden Tage noch etwas ändern könnte.