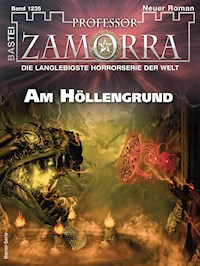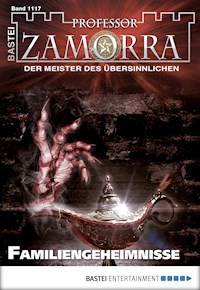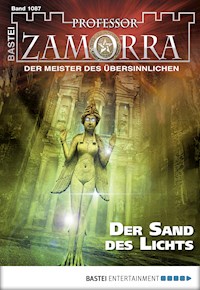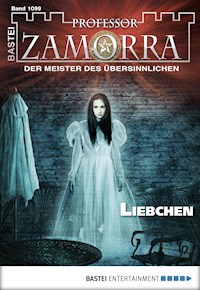1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
"Doktor Goldman!" Helle Aufregung lag in der Stimme der jungen Archäologin.
Der Grabungsleiter reagierte verhalten. Vor ihm auf einem Tisch unter dem schattigen Zeltdach lagen einige Fundstücke.
"Was ist los, Sarah?"
"Wir sind auf ein Grab gestoßen!"
Goldman runzelte die Stirn. "Römisch?"
Sarah hielt ihm eine antike Münze hin. "Das könnte ein Denier sein! Aber französisches Geld am Herodes-Palast? Das passt nicht zusammen! Und der Tote sitzt noch auf seinem Pferd ..."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Stern des Bösen
Leserseite
Vorschau
Impressum
Stern des Bösen
(Teil 1)
von Stephanie Seidel
»Doktor Goldman!« Helle Aufregung lag in der Stimme der jungen Archäologin.
Der Grabungsleiter reagierte verhalten. Vor ihm auf einem Tisch unter dem schattigen Zeltdach lagen einige Fundstücke, die er durch seine Lupe betrachtete.
»Was ist los, Sarah?«
»Wir sind auf ein Grab gestoßen!«
Goldman nickte. »So was passiert schon mal an antiken Stätten.«
»Ja, natürlich!«, erwiderte Sarah ungeduldig. »Aber dieses müssen Sie sich ansehen. Unbedingt! Jetzt!«
»Weil?«
»Es ist kein jüdisches Grab!«
Goldman runzelte die Stirn. »Römisch?«
»Auch nicht.« Sarah hielt ihm eine antike Münze hin. »Das könnte ein Denier sein! Aber französisches Geld am Herodes-Palast? Das passt nicht zusammen! Und der Tote wurde offenbar eilig verscharrt! Er sitzt noch auf seinem Pferd! Mit Brandspuren am Schädel wie von einem Blitzschlag.«
Goldman warf die Lupe auf den Tisch.
»Ich komme!«, sagte er.
Frankreich, Paris
Es war noch früh, als Gaspard Devaudan seine Wohnung in der Rue Danton verließ. Über den Dächern ging die Sonne auf; Berufsverkehr schob sich durch die Straßen, laut und stockend wie immer. Passanten hasteten zur nahen Metrostation.
Alle hatten es eilig, selbst das Heer der Stadttauben, das unter schwindelerregendem Dauernicken den Boden nach verwertbaren Resten abklopfte. Pick, Pick, Pick –ob kalte Pommes, Kronkorken oder Devaudans Schuhspitze, die Devise lautete: Schlucken oder fallen lassen. Für etwas anderes fehlte die Zeit.
Devaudan war die morgendliche Hektik zuwider. Er kam aus der deutlich kleineren Universitätsstadt Avignon, wo es beschaulicher zuging und er vielleicht noch heute leben würde, wäre er nicht an die Sorbonne berufen worden – mit einem Forschungsauftrag zu den Kreuzzügen, seinem Fachgebiet.
Inzwischen wohnte Devaudan bereits mehrere Jahre in Paris. Doch angekommen war der 55-Jährige bis heute nicht. Die quirlige Metropole mit ihrem grellbunten Nachtleben, den zahllosen Veranstaltungen, Demonstrationen und der immerwährenden Lärmkulisse passte nicht zu ihm und er nicht zu ihr.
Sein Zuhause war die Stille, dieses unverkennbare, beredte Schweigen, das im Halbdunkel zwischen Regalwänden voller Bücher und alter Dokumente vorherrscht, in Archiven, Klöstern und den Katakomben der Museen. Überall dort, wo die stummen Zeugen der Vergangenheit lagerten, fühlte er sich wohl. Denn der blasse, unscheinbare Mann aus Avignon konnte sie zum Sprechen bringen.
Am Boulevard Saint Michel schaltete die Fußgängerampel punktgenau bei Devaudans Eintreffen auf Rot. Er blieb stehen, und während er geduldig wartete, ging er in Gedanken das heutige Arbeitspensum durch. Ein Treffen mit dem Rektor stand auf dem Plan, Klausuren mussten geprüft und eine Vorlesung erarbeitet werden, die der Historiker für einen coronakranken Kollegen halten sollte. Solche Aufgaben fielen eigentlich nicht in seinen Bereich, er übernahm sie aber trotzdem, weil sie das Gehalt ein wenig aufstockten.
Und Geld konnte Gaspard Devaudan gut gebrauchen. Sein Job an der Uni war zwar für die nächsten Jahre gesichert; man hatte ihm ein eigenes Büro und sogar einen Assistenten zur Verfügung gestellt. Gelegentlich wurden ihm auch Dienstreisen gewährt – solange das magere Budget des Instituts es hergab. Alles in allem kam er zurecht mit seinem Leben. Nur glücklich machte es ihn nicht.
Devaudan seufzte, als er sich in Bewegung setzte. Wie oft hatte er davon geträumt, frei und finanziell unabhängig zu sein! Etwas Großes leisten zu können auf seinem Gebiet. An versunkenen Kulturstätten zu forschen, weltweit, wo faszinierende Geheimnisse darauf warteten, enthüllt zu werden. Doch er wusste, es würde eines Wunders bedürfen, um diesen Traum zu verwirklichen. Und auf Wunder sollte man nicht hoffen. Schon gar nicht als Wissenschaftler.
Wenig später erreichte Devaudan sein Ziel am Place du Panthéon. Vor dem Eingang des Instituts standen ein paar Studentinnen, die sich laut und recht vergnügt unterhielten. Ein knappes »Bonjour!« umwehte ihn, während er an ihnen vorbeiging. Mehr war den hübschen Französinnen der Mann nicht wert, der so wenig attraktiv wirkte mit seinem grauen Jackett, der stets ordentlich gerichteten Krawatte und der abgewetzten braunen Aktentasche, die man bestenfalls als Vintage bezeichnen konnte, eher jedoch als ... uralt.
Devaudan nahm es gelassen hin. Er war nie ein Frauenschwarm gewesen und würde auch nie einer werden. Anerkennung forderte er nur für seine Arbeit ein.
Ohne Eile betrat er das Institut. Die Flure mit ihren hohen Fenstern und den Schmutzstreifen entlang der ehemals weißen Wände benötigten keine Alarmanlage, um Bewegungen anzuzeigen. Sie waren selber eine. Devaudans Schritte hallten auf den Bodenfliesen, als wäre er in Militärstiefeln unterwegs.
Im Vorbeigehen schob er die schief an der Wand hängende, gerahmte Hausordnung in senkrechte Position zurück. Dann blieb er stehen.
Gaspard Devaudan, Ph.D. stand auf dem Schild neben der Tür, darunter, eine Schriftgröße kleiner: Raoul Mérot, Asst.
Devaudan runzelte die Stirn, als er merkte, dass sein Büro unverschlossen war. Er erwartete nicht, seinen Assistenten zu dieser frühen Stunde anzutreffen. Mérot, ein Historiker wie er, nur ohne Doktortitel, tauchte gewöhnlich erst gegen zehn Uhr auf. Meistens unausgeschlafen.
Der 35-Jährige hatte zusätzlich Informationsverarbeitung studiert und konnte am Computer Dinge bewerkstelligen, die Devaudan zum Staunen brachten. Er selber kam zwar durchaus zurecht mit Laptop & Co, doch er zog es vor, das Notizbuch zu bemühen, wenn es darum ging, wichtige Informationen festzuhalten. Papier fragte nicht nach Passwörtern, die man sich merken musste, wenn man seinen Text noch einmal sehen wollte, es verlangte keine Sicherungskopie und stürzte auch nicht ab mitten im Satz.
Devaudan überließ es Mérot, seine Notizen zu digitalisieren. Und weil er sicher sein konnte, dass diese Aufgabe genauso schnell und gewissenhaft erledigt wurde wie alle anderen, drückte er stets ein Auge zu, wenn sein Assistent mal wieder zu spät zum Dienst erschien.
Heute war das offenbar nicht nötig.
»Ich krieg dich, du Hurensohn!«, scholl es Devaudan hasserfüllt entgegen, als er die Tür öffnete. Es war eindeutig Mérots Stimme. Die Frage war nur, ob der junge Mann eine merkwürdige Unterhaltung am Telefon führte oder den Verstand verloren hatte.
Devaudan wollte kein Risiko eingehen. Mit der Tür als Schutzschild bewegte er sich einen Schritt in den Raum hinein. Argwöhnisch sah er hinüber zu Mérots Arbeitsplatz.
Ein Halbkreis aus drei großen Monitoren überragte das Chaos auf der Schreibtischplatte. Vor dem mittleren saß Raoul Mérot. Er schien jede Verbindung zur realen Welt verloren zu haben, tippte wie besessen auf der Tastatur herum und starrte dabei den Bildschirm an. Eine befremdliche Actionszene war zu sehen.
Da rannte ein im Renaissance-Stil gekleideter Assassine mit gezücktem Dolch über die Dächer von Venedig, vor sich einen schwarz ummantelten Kapuzenträger, der zu fliehen versuchte. Es war eine wilde Verfolgungsjagd, mal drohte der eine abzustürzen, mal stolperte der andere über einen Ziegel am Dachfirst.
Verwundert musterte Devaudan seinen Assistenten. Mérot drehte ihm den Rücken zu; sein T-Shirt wies Schwitzflecken auf, und er atmete schwer. Als jagte er selber den digitalen Bösewicht.
»Sag deinem Leben au revoir!«, keuchte Mérot, während der Assassine auf dem Monitor zum tödlichen Dolchstoß ausholte.
Devaudan verzog das Gesicht.
»Sie wissen aber schon, dass das nur ein Computerspiel ist, oder?«
»Was? Ja, ja.« Mérot winkte hastig ab. »Ich mach auch gleich Feierabend.«
»Feierabend ist gut«, spottete Devaudan, ließ die schützende Tür los und nahm Kurs auf seinen Schreibtisch. »Sehen Sie mal auf die Uhr, Raoul!«
»Jetzt nicht! Ich muss ...«
»Sofort!«
Der scharfe Ton zeigte Wirkung: Mérot ließ sich ablenken, nahm die Hand von der Tastatur, schaute flüchtig auf seine SmartWatch – und schon sprang der finstere Kapuzenträger mit einem Satz aus dem Bild.
»Ach, verdammt!«, fluchte Mérot. Dann erreichte eine Erkenntnis sein überreiztes Hirn, und er fuhr erschrocken herum. Seine Augen waren rotgerändert.
»Es tut mir leid, Gaspard!«, sagte er kleinlaut. »Ich wollte gestern nach der Arbeit nur mal kurz eine neue Strategie ausprobieren. Dann habe ich irgendwie die Zeit vergessen.«
»Die Zeit, aha. Und wohl auch die Weisung, Ihren Dienstcomputer nicht zu privaten Zwecken zu nutzen!« Devaudan stellte die Aktentasche ab, öffnete sie und entnahm ihr eine Thermoskanne.
»Was ist das überhaupt für ein Spiel, das Sie so fasziniert?«
»Es heißt Assassin's Creed. Und ich hatte schon welchen gekocht«, sagte Mérot, während Devaudan nach seinem Kaffeebecher griff, einem Souvenir aus der Zeit seiner Auslandssemester in Israel. Hebrew University stand darauf.
Der Historiker folgte Mérots Fingerzeig zu dem halbhohen Aktenschrank neben der Tür. Die Kaffeemaschine darauf war eingeschaltet. In der Glaskanne schwitzte ein zwei Zentimeter hoher, rabenschwarzer Rest vor sich hin.
»Danke für das Angebot, Raoul. Aber ich bevorzuge Kaffee. Flüssiger Teer ist eher was zum Abdichten von Hausdächern.« Devaudan lächelte beim Anblick seines Assistenten. Mérot wirkte zerknirscht. Versöhnlich hielt er ihm die Thermoskanne hin.
»Auch welchen?«
»Ja, gern!«
Mérot drehte sich um und kramte gähnend nach dem Kaffeebecher. Zwischen hohen, mit bunten Klebezetteln gespickten Aktenstapeln und Computermagazinen, unter einer Zehnerpackung USB-Sticks und umringt von verknäuelten Kabeln wurde er schließlich fündig.
Mit dem Becher in der Hand trottete Mérot hinüber zu Devaudans Bürohälfte, wo Bücherschränke die Wände verdeckten und ein Schreibtisch stand, auf dem man niemals etwas suchen musste. Nicht mal einen Stift, weil alles in passende Kästchen sortiert war.
»Mon dieu! Sie sehen aus wie ein wandelnder Leichnam!«, sagte Devaudan, während er seinem übernächtigten Assistenten frischen Kaffee einschenkte. Doch er ahnte schon, dass das nicht ausreichen würde, um Mérots Lebensgeister in Schwung zu bringen.
Gehen Sie nach Hause, Raoul, und schlafen Sie sich aus! wollte er deshalb hinzufügen. Aber just in dem Moment klingelte das Telefon.
»Ah! Das wird der Rektor sein! Wir sind gleich verabredet.« Devaudan stellte die Kanne ab und griff nach dem Hörer.
»Bonjour, monsieur le recteur!«, hörte Mérot, während er an seinen Platz zurückkehrte.
Er hätte mich ruhig nach Hause schicken können! dachte er mürrisch. Müde ließ er sich auf den Bürostuhl sinken.
»Was? Oh, Doktor Goldman! Welch schöne Überraschung am frühen Morgen.«
Mérot nickte. Dass Jonah Goldman aus Israel anrief, kam tatsächlich selten vor.
»Wie geht es Ihnen, verehrter Kollege?«
Bestimmt besser als mir! Mérot nippte probeweise an seinem Kaffee, dann stellte er den Becher weg. Die dünne Plürre mochte als Schlaftrunk taugen, aber gewiss nicht als Muntermacher!
»Kann ich was für Sie tun?«, fragte Devaudan in den Hörer.
Ja! Schick mich heim! dachte Mérot.
Normalerweise interessierte ihn alles, was der jüdische Archäologe zu sagen hatte, nur nicht in seiner momentanen Verfassung. Doktor Goldman arbeitete für das israelische Nationalmuseum in Jerusalem. Zweimal im Jahr fuhr er mit seinem Team ins Westjordanland, um Grabungen auf dem Areal einer Festungs- und Palastanlage König Herodes' vorzunehmen. Offenbar sprach er mit Devaudan über einen neuen Fund, wie sich aus dessen Kommentaren erkennen ließ.
»Ein Skelett! Aha. Mit Pferd. Wie eigenartig!«
Geistesabwesend griff Mérot nach seinem Heftklammernentferner, während er Devaudans knappen Antworten lauschte. Ließ die vier Metallspitzen rhythmisch auf und zu klappen. Wie ein Wolfsgebiss, das kaltherzige Vorgesetzte bestrafte.
Plötzlich hielt er inne.
»Denier? Sagten Sie Denier?«, hörte er Devaudan ungläubig fragen. »Wie kommt denn der an Ihre Grabungsstätte? Das passt doch gar nicht zusammen!«
Mérot drehte sich ihm zu; ihre Blicke begegneten sich kurz. Devaudan hielt den Hörer so fest umklammert, dass seine Knöchel weiß wurden. Das Telefon auf Laut zu stellen, während Jonah Goldman anscheinend etwas Wichtiges sagte, fiel ihm leider nicht ein.
»Aber gern!«, rief Devaudan wenig später enthusiastisch. Er nickte mehrmals. »Sicher! Das ist überhaupt kein Problem! Mein Assistent bereitet alles vor. Ich gebe Ihnen so bald wie möglich Bescheid. Und vielen Dank für die Einladung!«
Dann legte er auf. Begeistert wandte er sich an Mérot.
»Haben Sie schon was vor am Wochenende, Raoul?«
»Äh – ja. Ich ...«
»Vergessen Sie's!«, unterbrach ihn Devaudan. »Wir fliegen nach Israel! Goldman hat ein rätselhaftes Grab geöffnet. Es könnte französischen Ursprungs sein, das wird gerade geprüft, und er will uns dabei haben! Mit viel Glück datiert es in die Zeit der Kreuzzüge!«
»Cool!«, bestätigte Mérot. »Wann wollen Sie denn aufbrechen?«
»Morgen.«
»Morgen?« Mérots müde Augen weiteten sich. Irritiert breitete er die Arme aus. »Aber ... der Reiseantrag! Es dauert Wochen, bis der genehmigt wird.«
»Egal.« Devaudan griff nach seiner Thermoskanne, deren Inhalt mittlerweile abgekühlt war, weil er vergessen hatte, den Deckel wieder zuzuschrauben. »Ich werde die Kosten vorstrecken. Füllen Sie den Antrag aus, legen Sie ihn mir zur Unterschrift hin und buchen Sie uns den Flug.«
Er sah auf.
»Und dann gehen Sie nach Hause, Raoul! Ich brauche Sie fit und ausgeschlafen in Jerusalem!«
Devaudan lächelte versonnen.
»Ein Kreuzritter fernab vom Geschehen! Wenn sich das bestätigen würde, wären wir womöglich einer großen Sache auf der Spur!«
Die Sache war tatsächlich groß. Viel größer, als der Historiker ahnte. Und höllisch gefährlich ...
Israel, Tel Aviv
Die Nachmittagssonne tauchte den Flughafen Ben Gurion in goldenes Licht, als El Al LY 320 aus Paris kommend pünktlich zur Landung ansetzte.
Raoul Mérot und Doktor Devaudan waren mit leichtem Gepäck unterwegs. Drei Tage hatte ihnen der überrumpelte und wenig erfreute Rektor zugestanden. Mehr nicht. Devaudan hatte noch aushandeln können, dass der Anreisetag nicht mitgezählt wurde, denn nach der Landung und den anschließenden Sicherheitskontrollen stand auch noch die Weiterfahrt ins über fünfzig Kilometer entfernte Jerusalem an. Da blieb kaum Zeit für wissenschaftliche Arbeiten.
Wüstenwind streifte die beiden Franzosen, als sie das Terminal verließen.
Mérot sah sich um.
»Sind Sie sicher, dass Doktor Goldman uns abholt?«
»Ja.« Devaudan nickte. »Er hat gesagt, dass er hier draußen auf uns warten wird.«
Lautes Hupen erscholl von den Reisebussen weiter links, die abfahrbereit auf ihren Plätzen standen. Einem der großen Vehikel versperrte ein SUV den Weg. Ein Mann mit rotblondem Haar stieg aus, in Jeans und blauem Hemd, die Ärmel hochgekrempelt. Jonah Goldman ignorierte den wütenden Protest des Busfahrers und marschierte los.
»Willkommen in Israel!«, sagte er vergnügt, als er seine Gäste erreichte. Kurzes Händeschütteln, dann wandte er sich wieder um und winkte. »Folgen Sie mir! Ich muss den Wagen da wegfahren, bevor der Mann noch völlig die Nerven verliert. Unsere Busfahrer sind bewaffnet! Aber das wissen Sie ja sicher.«
Sie wussten es tatsächlich, hatten es aber verdrängt. Devaudan und Mérot tauschten verunsicherte Blicke, als sie sich in Bewegung setzten. Goldman schritt voran, zügig und entspannt.
Unterwegs erzählte der Archäologe, dass er und sein Team gestern eine Nachtschicht eingelegt hatten, um den Inhalt des rätselhaften Grabes zu bergen und ins Nationalmuseum abzutransportieren, weil ein Wolkenbruch angekündigt worden war, der wertvolle Spuren vernichtet hätte.
Kaum waren die drei am SUV angelangt, kurbelte besagter Busfahrer das Seitenfenster herunter, beugte sich hinaus und brüllte Goldman an: »Bist meschugge, du Schmock?«
Goldman antwortete mit einer jiddischen Verwünschung. Dann wechselte er ins Hebräische, das seine Begleiter sehr gut beherrschten.
»Vorschlag«, sagte er, während er ihnen half, das Gepäck zu verstauen. »Ich kann Sie jetzt zum Museum bringen. Bis wir da sind, werden meine Mitarbeiter aber schon auf dem Heimweg sein, das heißt, die Laborgeräte sind deaktiviert. Mehr als einen Blick auf die Funde werfen ist heute nicht mehr möglich.«
»Und was wäre die Alternative?«, fragte Devaudan.
»Ich zeige Ihnen die Grabungsstelle. Wir fragen uns immer noch, wie der Tote da hingekommen sein könnte. Vielleicht haben Sie ja eine Idee!« Goldman lächelte. »Auf dem Rückweg gehen wir was essen. Ich lade Sie ein.«
Israel, Westjordanland
Die Fahrt zum Herodium im besetzten Westjordanland zog sich hin, doch langweilig wurde es den Wissenschaftlern nicht. Jonah Goldman wusste viel über die zweitausend Jahre alte Anlage und ihren berühmten Bauherrn*; er konnte sogar mit historischen Details aufwarten, die gar nicht offiziell bekannt waren.
Als er von der staubigen Landstraße auf einen Feldweg abbog, wurden sie von einem Militärposten gestoppt. Die israelische Regierung hatte das ganze Areal zum Naturreservat erklärt, um das Herodium besser vor Grabräubern und illegalen archäologischen Expeditionen schützen zu können. Goldman besaß einen Passierschein.
Nach kurzer Fahrt parkte er den Geländewagen am Rand seiner jüngsten Grabungsstätte, gleich neben einem Pavillon. Unter dem weißen Zeltdach lagen Gerätschaften, die sein Team vor dem Regen in Sicherheit gebracht hatte.