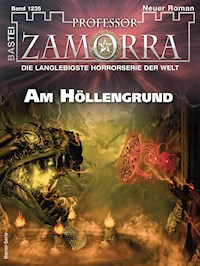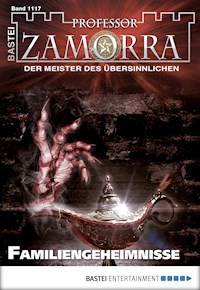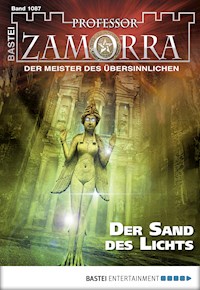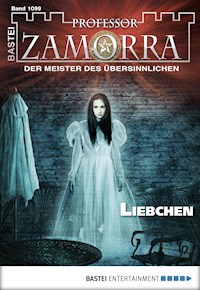1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Der Platz vor den Hütten im Königskraal war umstellt. Rhythmische Schläge hallten durch die Tropennacht. Finster dreinblickende Zulu-Krieger schlugen ihre Speere an die Schilde.
Ein Mann trat in den Feuerkreis. Der Widerschein züngelnder Flammen tanzte über sein bemaltes Gesicht.
Todesangst erfasste die Gefangenen, und sie begannen zu schreien, als der Umthakathi herankam. Gnadenlos packte er dem Ersten in die Haare, bog dessen Kopf zurück. Dann griff der Zauberer mit der freien Hand nach hinten.
An das Messer im Lendenschurz...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Fluch von KwaZulu-Natal
Leserseite
Vorschau
Impressum
Der Fluch vonKwaZulu-Natal
von Stephanie Seidel
Der Platz vor den Hütten im Königskraal war umstellt. Rhythmische Schläge hallten durch die Tropennacht. Finster dreinblickende Zulu-Krieger schlugen ihre Speere an die Schilde.
Ein Mann trat in den Feuerkreis. Der Widerschein züngelnder Flammen tanzte über sein bemaltes Gesicht.
Todesangst erfasste die Gefangenen, und sie begannen zu schreien, als der Umthakathi herankam. Gnadenlos packte er dem ersten von ihnen in die Haare, bog dessen Kopf zurück. Dann griff der Zauberer mit der freien Hand nach hinten.
An das Messer im Lendenschurz ...
Amsterdam
Abenddämmerung lag über der Stadt. Auf der Vijzelgracht beendeten Ausflugsboote soeben die letzte Fahrt des Tages und entließen ihre Gäste ins lärmende Getümmel vor den Pubs und Coffeeshops entlang der Uferpromenade. Musik hallte über den Kanal, bunte Lichter spiegelten sich an den Wellen.
Ganz anders verhielt es sich ein paar Ecken weiter in der Paulus Potterstraat. Stille umgab die vornehmen, alten Backsteingebäude mit ihren Erkern und Türmchen. Vereinzelt brannte Licht in den oberen Etagen, und gelegentlich ging jemand am Fenster vorbei. Ebenerdig jedoch, in den nur tagsüber und nach Anmeldung besuchbaren Geschäften, rührte sich nichts mehr.
Sie alle trugen große Namen, wie Royal Coster Diamonds. Und alle waren gesichert wie Fort Knox. Aus gutem Grund, denn hier residierten die Juwelenhändler von Amsterdam.
Einer von ihnen war Henk Witteboom.
Der Mittvierziger hatte gerade sein Haus verlassen. Hinter ihm sanken noch die schweren Rollgitter vor den Schaufenstern herunter, per Knopfdruck gesteuert vom Nachtdienstmitarbeiter der Security. Man sah ihn schemenhaft im Halbdunkel der Verkaufsräume.
Witteboom nickte dem Mann flüchtig zu, bevor er sich abwandte und durch den Eingangsbereich des Grundstücks auf seine wartende Limousine zuging. Für die kurze Strecke zum Waldorf Astoria an der Herengracht hätte er sie eigentlich nicht gebraucht, doch vor dem Luxushotel konnte er unmöglich zu Fuß aufkreuzen.
Immerhin war er dort mit Unterhändlern aus Katar verabredet, deren reicher Auftraggeber eine Sammlung seltener Diamanten besaß und weitere Exemplare hinzukaufen wollte. Preis und Herkunft der Steine hatten die Herren schon beim ersten Kontakt nicht interessiert, und für diese Art von Geschäften war Henk Witteboom genau der Richtige.
Natürlich ging er nicht allein zu dem Treffen. Einer seiner Mitarbeiter begleitete ihn: Pieter Heuvel, ein gelernter Goldschmied, der fließend Arabisch sprach. Pieter würde mitbekommen, was die Katari sagten, wenn sie während der üblicherweise auf Englisch geführten Verhandlungen in ihre Muttersprache wechselten.
Witteboom, der im Allgemeinen sehr vorsichtig agierte, mochte den jungen Mann und vertraute ihm weit über dubiose Geschäfte hinaus. Pieter war der einzige Mensch, der eine Rolle spielte im einsamen Leben des Juweliers. Und der einzige, der sein dunkles Geheimnis kannte.
Als Witteboom den Bürgersteig erreichte, warf er Heuvel die Fahrzeugschlüssel zu. Der fing sie auf, entriegelte die Limousine und eilte voraus, um die hintere Wagentür zu öffnen. In Bodyguard-Manier sah er sich dabei nach allen Seiten um.
Und stutzte.
»Da huscht einer rum!«, sagte er leise.
Stirnrunzelnd folgte Witteboom dem flüchtigen Fingerzeig.
Im Lichtkegel der Straßenlaternen, mitten auf der breiten Paulus Potterstraat, war ein buckliger alter Mann unterwegs. Er hatte einen Metallkoffer bei sich, ähnlich denen, die Witteboom für den Transport seiner Juwelen benutzte. Bedächtig setzte er einen Fuß vor den anderen.
»Huschen ist gut, Pieter! Der Bursche zockelt dahin wie ein Brauereipferd«, spottete Witteboom und ließ sich in den Wagen sinken.
»Den meinte ich nicht. Da ist noch ein Zweiter!«, sagte Heuvel.
Witteboom verzog das Gesicht. Widerstrebend erhob er sich noch einmal.
»Ich sehe nichts!«, murrte er.
»Weiter hinten, auf der anderen Straßenseite. Er steht unter dem Torbogen am Haus neben den Costers.«
Undurchdringliches Dunkel herrschte an der genannten Stelle, und Witteboom hielt sich nicht lange damit auf, sie anzustarren. Pieter hatte bestimmt nur jemanden gesehen, der dort wohnte. Oder einen streunenden Hund.
»Fahren wir!«, befahl er und ließ sich zurück in den Wagen sinken.
Eigentlich hätte Heuvel jetzt die Seitentür schließen müssen. Doch das tat er nicht. Verwundert wollte sich Witteboom ihm zuwenden; dabei fiel sein Blick durch die Frontscheibe – und blieb hängen.
Die Straße war leer.
»Wo ist der Alte hin, Pieter?«
Keine Antwort.
»Pieter?«, fragte Witteboom und fuhr zusammen, als er draußen auf dem Bürgersteig etwas sah, das eigentlich unmöglich war. Neben Heuvel, der sich keinen Millimeter bewegte, stand der bucklige Mann. Seine Hand sank soeben von Heuvels Schulter herab.
Witteboom stieg aus dem Wagen.
»Sind Sie noch bei Trost? Was haben Sie mit meinem Angestellten gemacht?«
Der Alte schwieg.
»Antworten Sie gefälligst!«, schnappte Witteboom, ohne einen Blick von Heuvel zu lassen. Der schien ihn nicht zu bemerken, starrte abwesend in ferne Sphären. Wie ein hypnotisiertes Kaninchen.
»Pieter? Pieter, was ist mit Ihnen?«
»Er nimmt eine Auszeit«, sagte der Alte gleichgültig. »Ich will was Geschäftliches mit dir besprechen, und dazu brauche ich ihn nicht. Los, gehen wir ins Haus!«
Witteboom schnappte nach Luft.
Hatte er eben noch geschwankt zwischen seiner Sorge um Heuvel und dem Ärger über die Arroganz des Fremden, überwog jetzt Letzteres. Witteboom stemmte die Fäuste in die Seiten und rief empört: »Wie reden Sie mit mir? Das ist unerhört! Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind?«
»Ich bin Beliam«, sagte der Alte.
Der Juwelier verlor alle Farbe, ließ die Arme sinken.
»Beliam!«, flüsterte er erschrocken.
»So ist es.« Der Alte nickte. »Und? Können wir?«
»Ja. Ja, natürlich.« Witteboom hastete los. Hielt inne, drehte sich wieder zurück und wies mit zitternder Hand auf Pieter Heuvel.
»Bitte! Er darf hier nicht so stehen bleiben! Erlauben Sie ihm, sich in den Wagen zu setzen.«
Beliam seufzte genervt. Er ließ sich Zeit, bevor er Heuvel anstieß.
»Ab ins Körbchen!«, befahl er.
Sofort setzte sich der Mann in Bewegung. Er wirkte desorientiert, als wäre er aus tiefem Schlaf erwacht. Hilfesuchend sah er sich nach Witteboom um.
»Maak je geen zorgen, Pieter!«, beruhigte ihn der Juwelier, während er sein Handy zog und die Kurzwahl des Security-Beamten drückte. »Es wird alles gut. Ich bin gleich wieder bei Ihnen.«
Auf dem Weg zum Haus meldete er sein Kommen an, und wie gern hätte er die für Notfälle vereinbarte Losung Sperren Sie die Hunde weg! hinzugefügt. Dann wäre der Beamte gewarnt gewesen, dass ein unliebsamer Besucher nahte, und hätte sich vorbereitet. Denn es gab keinen Hund im Juweliergeschäft.
Doch Witteboom blieb stumm. Widerstand war zwecklos in diesem Fall, und gefährlich obendrein. Mit Kriminellen wäre der Beamte fertig geworden, selbst wenn sie bewaffnet waren. Das hatte er schon einmal bewiesen.
Aber jemanden wie Beliam konnte man nicht aufhalten. Er war zu mächtig, zu... anders. Witteboom sah ihn heute zum ersten Mal, doch er wusste von den anderen Anderen, die bisweilen bei ihm auftauchten, wer Beliam war. Und wie sehr sie ihn fürchteten.
Verstohlen blickte Witteboom zur Seite. Nichts an der grauhaarigen, unscheinbaren Gestalt, die mit müden Schritten neben ihm herging, wirkte auch nur im Mindesten verdächtig. Beliams Tarnung als betagter Mensch war perfekt.
Die gedimmten Strahler im Juweliergeschäft erhellten sich, als Witteboom den Eingang erreichte. Ein deutliches Klack! erscholl, dann begann sich ratternd das Rollgitter zu heben. Hinter der Tür stand der Security-Beamte, dunkel gekleidet, eine Hand am Schalter. Das Glas vor ihm wirkte wie ein Spiegel.
Witteboom sah sein eigenes Konterfei darin: schlank, elegant, sympathisches Gesicht. Einziger Wermutstropfen war das Toupet, das er tragen musste. Ein teures, sandfarbenes Ding, das sich nur durch die unnatürlich dichte Haartolle verriet. Sie bedeckte die komplette Stirn bis zu den Augenbrauen.
Als das Rollgitter stoppte, entriegelte der Beamte die Eingangstür und zog sie auf.
»Alles okay, Chef?«, fragte er argwöhnisch, während er zur Seite trat.
»Ja, ja. Ich muss nur schnell was erledigen«, sagte Witteboom und fügte hinzu: »Bleiben Sie hier! Ich gehe mit dem Herrn ins Büro.«
Der Beamte war irritiert ob des ungewohnt scharfen Tons, doch er nickte zustimmend.
Witteboom setzte sich in Bewegung. Zügig durchquerte er den Verkaufsraum mit seinen Schaukästen und Vitrinen, den schönen, hohen Zimmerpflanzen und der großen Wohlfühl-Oase, wo die Kundschaft auf exquisiten weißen Ledermöbeln Platz nehmen und frisch gebrühten besten Arabica genießen konnte.
Überall glitzerte und funkelte es wie im Märchen. Juwelen aller Art, Schmuck und kostbare Uhren füllten die Auslagen; ein Anblick, der nur selten seine Wirkung verfehlte. Dass jemand Wittebooms Jewellery Store mit leeren Händen verließ, kam so gut wie nie vor.
Beliam jedoch ging an den schimmernden Pretiosen vorbei, ohne auch nur ein einziges Mal hinzusehen. Witteboom konnte sich nicht erklären, was sein Begleiter hier wollte.
Bis er die Tür zum Büro öffnete.
Auch dort war alles darauf ausgelegt, Besucher zu beeindrucken. Ein großer, edler Perserteppich aus Seide bedeckte den Boden, das antike Mobiliar hatte einst Amsterdamer Kaufleuten der Ostindien-Kompanie gehört.
Schöne alte Schiffsmodelle standen auf den Wandregalen. An prominenter Stelle hing ein langer Schaukasten, der den Gewinnungssprozess von Diamanten in seinen einzelnen Phasen zeigte, vom unscheinbaren, dunklen Kimberlit-Gesteinsbrocken bis zum hochkarätigen, geschliffenen Juwel.
Doch selbst der riesige Amethyst auf dem Eckpodest, rückseitig noch im Vulkangestein steckend und gut 3000 Euro wert, interessierte Beliam kein bisschen.
Hinter ihm schloss sich noch die Tür, da trat er bereits an den Schreibtisch. Schwungvoll stellte er seinen Metallkoffer ab, schrammte ihn in Position und ließ die Verschlüsse aufschnappen.
Im nächsten Moment war die Zimmerdecke übersät mit funkelnden Lichtpunkten. Wie ein Sternenhimmel.
Witteboom sank der Unterkiefer herunter.
»Was... was...«, stammelte er.
Hunderte Diamanten füllten den Koffer, alle etwa gleich groß, alle tropfenförmig. Wittebooms erster Gedanke war, dass sie aus einem Collier herausgelöst worden waren, doch den verwarf er gleich wieder. Das Schmuckstück hätte ein enormes Ausmaß haben müssen, und ein ebensolches Gewicht.
Verwundert sah er Beliam an.
»Woher haben Sie die?«
»Aus China1«, sagte Beliam und ließ den Kofferdeckel fallen. Witteboom konnte gerade noch rechtzeitig die Finger zurückziehen.
»China«, wiederholte er nachdenklich. »Wie eigenartig. Das Diamantenvorkommen dort ist minimal.«
»Wen interessiert's?« Beliam tippte auf den Koffer. »Ich will, dass du die Dinger zu Geld machst.«
»Das geht aber nicht von heute auf morgen!«
»Hatte ich das verlangt?« fragte Beliam. »Jetzt hör zu! Die Diamanten gehören zwei meiner Diener: Gaspard Devaudan und Raoul Mérot. Merk dir die Namen! Du wirst das Geld für sie aufbewahren. Sie melden sich bei dir, wenn sie es brauchen.«
Witteboom fuhr hoch.
»Aber...«.
»Kein Aber«, fiel ihm Beliam ins Wort. »Du tust, was ich dir sage! In den nächsten Wochen kommt noch mehr von dem Kram, und...« –
»Aber ich kann den Markt nicht mit Diamanten überfluten! Dann fällt der Wert in den Keller«, protestierte Witteboom aufgebracht.
Beliams Augen wurden schmal.
»Welchen Teil von Du tust, was ich dir sage! hast du nicht verstanden?«, knurrte er. Dabei schob er sich näher an Witteboom heran. Der wich zurück, hob abwehrend die Hände.
»Bitte! Ich helfe Ihren Leuten immer, das wissen Sie doch sicher. Aber Geld verwalten ist nun wirklich nicht meine Aufgabe! Ich bin Juwelier, kein Banker.«
Ein einzelner Schweißtropfen perlte unter seinem Toupet hervor. Witteboom wollte ihn wegwischen, doch Beliam war schneller.
Schlangengleich schoss er vor, packte den überraschten Mann an der Gurgel und stemmte ihn hoch. Mühelos.
Witteboom lief rot an, rang nach Luft. Er begann zu strampeln, zerrte an der Hand des Buckligen, um sich zu befreien. Es gelang ihm nicht.
Beliam hielt ihn eisern fest. Dabei erschienen feine, dunkle Streifen in seinem alten Gesicht, wie Adern.
Kaltes Grauen erfasste Witteboom, als er sah, wie sie sich bewegten, breiter wurden. Und platzten.
Unter ihnen zeichnete sich ein zweites Gesicht ab – das wahre Antlitz Beliams. Vernarbt, verbrannt, furchtbar entstellt. Der Anblick war kaum zu ertragen.
»Damit das klar ist«, sagte Beliam schneidend. »Du hilfst meinen Leuten nicht, du dienst ihnen. Ohne Wenn und Aber. Und solltest du noch ein Mal vergessen, wem du gehörst, du Wurm, dann holen wir dich ab!«
Seine Augen funkelten tückisch.
»Glaub mir, das würde dir nicht gefallen. Und jetzt beweg dich gefälligst!«
Mit diesen Worten stieß er Witteboom fort.
Haltlos stürzte der Juwelier nach hinten, schrammte im Fallen an der Schreibtischkante entlang und touchierte mit dem Kopf ein Stuhlbein, bevor er hart auf dem Rücken aufschlug.
Einen Moment blieb er still liegen. Witteboom dröhnte der Schädel; rote Sterne pulsierten vor seinen Augen. Er zitterte am ganzen Leib. Trotzdem fühlte er sich erleichtert.
Beliam war fort.
Hätte ich mich nur nicht auf sie eingelassen! dachte er bitter, während er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Boden erhob.
Sie, das waren die Anderen, wie Witteboom die unheimlichen Besucher nannte, die gelegentlich in seinem Büro erschienen. Meist kurz nach Ladenschluss und immer durch die Wände.
Dass sie keine Menschen waren und nichts Gutes im Schilde führten, wusste er. Aber mehr auch nicht. Mehr wollte er auch gar nicht wissen. Witteboom hatte genug andere Dinge im Kopf, die ihn beschäftigten. Ein 9-mm-Geschoss, zum Beispiel.
Missmutig schob er den Finger unter sein Toupet und betastete die kreisrunde Narbe an der Stirn, die so verräterisch nach einer Schussverletzung aussah, dass er nicht anders konnte, als sie mit falschen Haaren zu kaschieren.
Witteboom hatte alles versucht, um die Narbe loszuwerden: Laserbehandlung, Gesichtschirurgie... sogar eine Formveränderung durch eine darübergelegte, selbst beigebrachte Verletzung. Nichts hatte funktioniert. Das verspukte Ding war immer wieder zurückgekehrt. Wie ein Kainsmal. Und noch heute sah es exakt so aus wie damals, am Tag nach seinem Tod.
Der hatte ihm 2001 in seiner Heimatstadt Köln einen Überraschungsbesuch abgestattet.
Witteboom, der eigentlich Josef Sträder hieß, besaß zu jener Zeit ein kleines Juweliergeschäft in der Schildergasse, nahe des Doms. Die Umsätze waren weniger glänzend als das Gold in Sträders Vitrinen, doch am Hungertuch nagte er nicht. Denn er hatte noch eine zweite, geheime Einnahmequelle.
Das reiche Köln bot viele Auf- und Einstiegsmöglichkeiten, besonders für dunkle Gestalten, die des Nachts fremde Häuser durchwühlten. Manchmal nahmen sie dabei auch Schmuckstücke mit, die sich im Nachhinein als unverkäuflich erwiesen, weil sie zu auffällig waren. Die brachten sie dann zum Juweliergeschäft Sträder.
Dort wurden sie umgearbeitet und weiterveräußert. Eine Hälfte des Verkaufspreises bekamen die »Lieferanten«, die andere Hälfte wanderte an der Ladenkasse und dem Finanzamt vorbei in Sträders Privatschatulle.
Lange Zeit ging alles gut. Die Geschäfte florierten, und das würden sie vielleicht noch heute tun, hätte der letzte Einbrecher sich nur in einem anderen Haus bedient!
Er kam am 21. Februar, kurz vor Ladenschluss; ein hagerer, ärmlich gekleideter Osteuropäer, der ein goldenes Medaillon zum Kauf anbot. Altmodisch floral graviert, mit einem großen Rubin auf der Vorderseite. Ein Erbstück, behauptete er.
Sträder wusste sofort, dass der Mann log und keine Ahnung hatte, was er da in Händen hielt, denn er verlangte einen lächerlich geringen Preis dafür. Dabei war allein der feurige, hochkarätige Rubin ein kleines Vermögen wert.
Der Juwelier beschloss, das Medaillon einzuschmelzen und dem Stein einen anderen Schliff zu verpassen. Noch in der Nacht führte er diese Arbeiten aus. Diebesgut herumliegen zu lassen, wäre gefährlich gewesen, zumal in den nächsten Tagen niemand im Geschäft sein würde. Denn am nächsten Morgen begann das Highlight des Jahres: der Kölner Karneval.
Und so nahm das Unglück seinen Lauf.