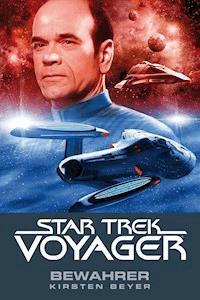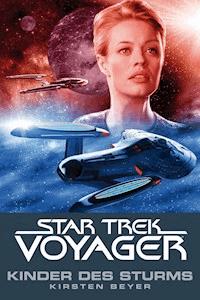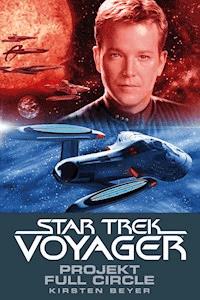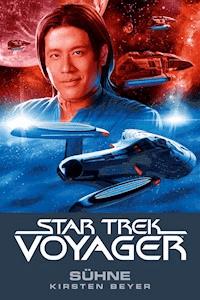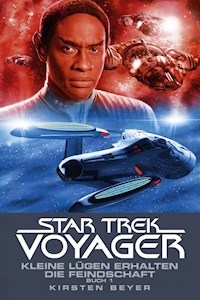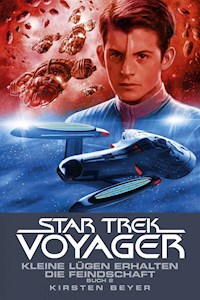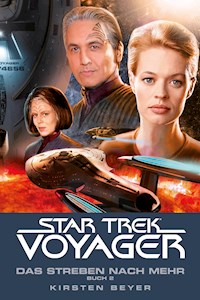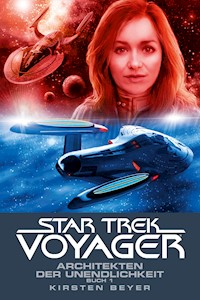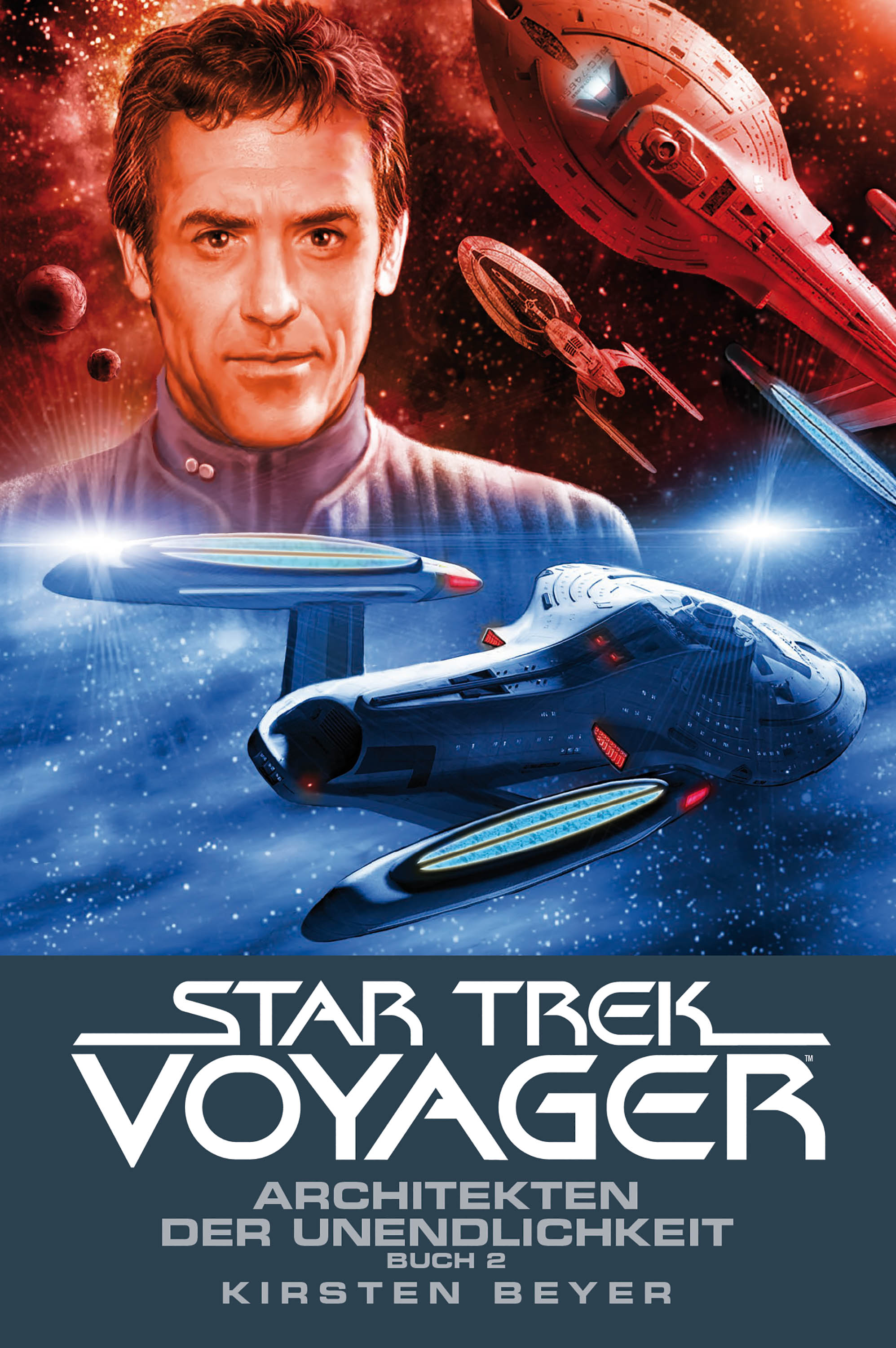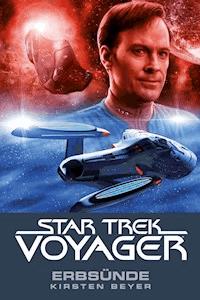
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Star Trek - Voyager
- Sprache: Deutsch
Admiral Kathryn Janeway soll diplomatische Beziehungen zur Konföderation der Welten des Ersten Quadranten aufnehmen, eine Zivilisation, deren Macht es durchaus mit der Föderation aufnehmen kann. Doch obwohl Chakotay, der Captain der Voyager, der Interstellaren Flotte der Konföderation dankbar ist, dass sie sie vor einer fremden Armada gerettet hat, kann er nicht vergessen, auf welchen unfassbaren Gräueltaten die Konföderation gegründet wurde …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ERBSÜNDE
KIRSTEN BEYER
Based onStar Trekcreated by Gene RoddenberryandStar Trek: Voyagercreated by Rick Berman & Michael Piller & Jeri Taylor
Ins Deutsche übertragen vonRené Ulmer
Die deutsche Ausgabe von STAR TREK – VOYAGER: ERBSÜNDEwird herausgegeben von Amigo Grafik, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg. Herausgeber: Andreas Mergenthaler und Hardy Hellstern, Übersetzung: René Ulmer; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde; Lektorat: Wibke Sawatzki und Gisela Schell; Satz: Rowan Rüster/Amigo Grafik; Cover Artwork: Martin Frei; Print-Ausgabe gedruckt von CPI Moravia Books s.r.o., CZ-69123 Pohorelice. Printed in the Czech Republic.
Titel der Originalausgabe: STAR TREK – VOYAGER: ACTS OF CONTRITIONGerman translation copyright © 2017 by Amigo Grafik GbR.
Original English language edition copyright © 2014 by CBS Studios Inc. All rights reserved.
™ & © 2017 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
This book is published by arrangement with Pocket Books, a Division of Simon & Schuster, Inc., pursuant to an exclusive license from CBS Studios Inc.
Print ISBN 978-3-95981-204-7 (April 2017) · E-Book ISBN 978-3-95981-205-4 (April 2017)
WWW.CROSS-CULT.DE · WWW.STARTREKROMANE.DE · WWW.STARTREK.COM
Für meinen Jack
Inhalt
HISTORISCHE ANMERKUNG
PROLOG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
EPILOG
DANKSAGUNGEN
HISTORISCHE ANMERKUNG
Milliarden durch die Hände der Borg gestorben, Hunderte Raumschiffe zerstört, eine neue Bedrohung in Form des Typhon-Paktes – aber die Vereinigte Föderation der Planeten will sich davon nicht vorschreiben lassen, wer sie ist und was sie tut. Das Oberkommando der Sternenflotte wird die Mission der Full-Circle-Flotte fortsetzen (STAR TREK – TYPHON PACT»Bestien«).
Das Raumschiff Vesta, die Testplattform für den neuen Slipstream-Antrieb, wurde der Full-Circle-Flotte zugeteilt. Der neue befehlshabende Offizier der Flotte ist dafür bekannt, auch mit eingeschränkten Mitteln Erfolge zu erzielen: Vice Admiral Kathryn Janeway.
Die stetig steigenden Verluste aufgrund einer heimtückischen neuen Krankheit führen die Medizinische Abteilung der Sternenflotte zu der Annahme, dass das Leben jedes einzelnen Föderationsbürgers von einer catomischen Seuche bedroht sein könnte. Um zu helfen, kehren Seven und Doktor Sharak zusammen mit Commander Paris zur Erde zurück.
Zeitgleich werden die Voyager, die Galen und die Demeter im Delta-Quadranten von der Konföderation der Welten des Ersten Quadranten freundlich willkommen geheißen. Captain Chakotay ist für den Empfang dankbar, aber da er die Gräueltaten kennt, die bei der Gründung der Konföderation verübt wurden, vertraut er ihnen nicht vorbehaltlos (STAR TREK – VOYAGER»Bewahrer«).
Die Geschichte beginnt Ende Januar 2382 und spielt bis Ende Februar desselben Jahres.
»Die Geister unserer törichten Taten verfolgen uns,ob wir sie bereuen oder nicht.«
– Gilbert Parker
PROLOG
U.S.S. GALEN
»Tut mir leid, Reg, aber ich erkenne einfach nicht, worauf Sie hinauswollen«, gestand Vice Admiral Janeway.
Lieutenant Reginald Barclay widerstand dem Verlangen, die Kommunikationskonsole zu packen und zu schütteln. Der amtierende Captain der Galen, Commander Clarissa Glenn, ermahnte ihre Besatzung oft, in stressigen Situationen tief durchzuatmen. Barclay beherzigte diesen Rat, bevor er dem neuen befehlshabenden Offizier der Full-Circle-Flotte antwortete. Einem Offizier, den er seit Jahren kannte und respektierte.
»Als die Voyager Neu-Talax zum ersten Mal besucht hat, hat sie Sektor JLX-16 von SB-11989 mit ihren astrometrischen Sensoren gescannt.«
»Reg, das ist über vier Jahre her. Die Auflösung der Sensordaten des Sektors, von dem Sie sprechen, reicht gerade mal aus, um topografische Grunddaten zu erkennen. Details haben uns damals nicht interessiert.«
»Trotzdem«, fuhr Barclay fort, »gab es auf dem fraglichen Asteroiden zum Zeitpunkt dieser Scans keinerlei Anzeichen einer Bearbeitung.«
»Auf Tausenden anderen auch nicht«, unterbrach ihn Janeway. »Aber seit damals haben Nocona und die Talaxianer auf Hunderten der örtlichen Asteroiden Rohstoffe abgebaut und ihre Oberflächen drastisch verändert.«
Barclay ließ sich davon nicht beirren. »Im Sektor JLX-16 sind nun sechs kleine Löcher, weniger als fünf Meter tief und mit einem Durchmesser von weniger als einem halben Meter, zu erkennen. Das passt nicht zu Bergbauarbeiten.«
»Man kann sie kaum als Löcher bezeichnen, Reg. Ich stimme Ihnen zu, dass sie, wenn das, was wir sehen, der Wahrheit entspricht, nicht natürlichen Ursprungs sind. Aber wir kennen weder Noconas Schürfmethoden noch die Spezifikationen seiner Schiffe.«
»Ich könnte Neelix nach den Spezifikationen fragen«, schlug Barclay vor. »Er betreibt schon seit Jahren Handel mit Noconas Volk. Ich bin sicher, er hat aktuelle Informationen.«
»Nein.« Janeways Ton machte klar, dass sie keinen Widerspruch duldete. »Wir treffen uns in weniger als einer Stunde mit der Demeter im Raum der Konföderation. Wir sind außerhalb der Kommunikationsreichweite zu Neu-Talax, und das wird auch die nächsten Wochen so bleiben. Wir haben bereits die Information, dass sich einige Voth nah genug an Neu-Talax befinden, um mich nervös zu machen. Wenn Sie Neelix nach etwas fragen, wird er den Grund wissen wollen. Ich kann ihm nichts mehr verbieten, und da seine Neugierde immer größer als sein Selbsterhaltungstrieb sein wird, würde er zu dem Asteroiden fliegen und selbst nachsehen. Wir können keine Begegnung riskieren, die Neelix keinesfalls überleben würde, während wir zu weit entfernt sind, um auf einen Notruf reagieren zu können.«
»Die Galen könnte zurückfliegen, nur für ein paar Stunden, und die Messungen bestätigen.« Barclay riskierte jetzt alles. »Wenn Meegan dort war und wenn sie die sechs Neyser-Kanister auf diesem Asteroiden vergraben hat, könnte sich noch einer oder mehr dort befinden. Wenn wir dort eintreffen, bevor sie zurück ist …«
»Das sind drei große Wenns, Reg«, erwiderte Janeway geduldig. »Ich verstehe, wie wichtig Ihnen das ist. Und wie ich Ihnen bereits versichert habe, plane ich, die Suche nach Meegan zu einer Priorität zu machen. Unsere Befehle besagen allerdings, dass wir uns darauf konzentrieren sollen, diplomatische Beziehungen zu einer interstellaren Konföderation aufzubauen, die ein wichtiger Verbündeter der Föderation im Delta-Quadranten werden könnte. Sobald wir die potenzielle Durchführbarkeit einer solchen Allianz sichergestellt haben, habe ich auch die Freiheit, Ressourcen zur Bestätigung Ihrer Hypothese zu erübrigen. Bis es so weit ist, ist das Thema vom Tisch.«
Barclay neigte den Kopf in der Hoffnung, seine Enttäuschung verbergen zu können.
»Sollten Sie noch etwas finden, informieren Sie mich auf der Stelle. Und versuchen Sie sich nicht zu viele Gedanken zu machen, Reg. Irgendwann werden wir sie finden. Das verspreche ich Ihnen.«
»Selbstverständlich. Danke, Admiral.«
Nachdem sein befehlshabender Offizier die Verbindung beendet hatte, stand Barclay hinter dem Schreibtisch in seinem kleinen Quartier auf und ging in dem Raum auf und ab. Es bestand die Möglichkeit, dass Admiral Janeway recht hatte. Könnte sein, dass er in Sektor JLX-16 sechs Löcher sah, weil er sie sehen wollte, um Beweise für Meegans Aktivitäten zu haben, seit sie in einem gestohlenen Shuttle von der Voyager geflüchtet war. Sie hatte sieben Kanister mitgenommen, in denen sich die Bewusstseine von Individuen befunden hatten, die nach Meinung der Neyser eine permanente Inhaftierung verdient hatten. Sollten diese Kanister geöffnet worden sein und die Bewusstseine nun die Macht über andere übernommen haben, so wie es bei Meegan – dem fortschrittlichsten Hologramm, das Barclay und Lewis Zimmerman jemals erschaffen hatten – geschehen war, war der Schaden, den sie anrichten könnten, unvorstellbar.
Und egal, was Admiral Janeway auch sagte, dieser Schaden wäre alleine seine Schuld.
1
U.S.S. VESTA
Commander Liam O’Donnell hatte noch nie auf einem Schiff von der Größe der Vesta gedient. Er schätzte, die Demeter – das Spezialschiff der Full-Circle-Flotte, über das er das Kommando hatte – würde ungefähr zwanzigmal hineinpassen. Auf dem Weg von der Shuttlerampe zu Admiral Kathryn Janeways Quartier hatte er sich dreimal verlaufen.
Es war auch möglich, dass er sich weniger verlaufen hatte, sondern sich viel mehr davor fürchtete, dem neuen kommandierenden Offizier der Flotte seine Bitte vorzutragen. Nachdem er ihre Tür erreicht hatte, wartete er fast eine ganze Minute, bevor er das Türsignal aktivierte, um sich anzukündigen.
»Herein«, rief der Admiral.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
»Commander O’Donnell«, begrüßte ihn Janeway, als er über die Schwelle in ihr persönliches Büro und Quartier an Bord der Vesta trat. Er hatte sie vorher schon mal gesehen, während der Trauerfeier auf Neu-Talax, und an dem Abend hatten sie kein Wort miteinander gewechselt. Sie war kleiner, als er sie in Erinnerung hatte – geradezu winzig –, aber ihr Äußeres war das Einzige, was an ihr klein war. Als sie auf ihn zukam, erstrahlte auf ihren hübschen Zügen ein aufrichtiges, herzliches Lächeln. Sie reichte ihm die rechte Hand und umschloss seine mit festem Griff. Ihre Präsenz füllte mit Leichtigkeit den Raum, verlieh ihm eine freundliche, gemütliche Atmosphäre. Sie schaffte es sogar, die unglaublich einengende Galauniform, die sie trug, bequem wirken zu lassen.
»Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, Commander«, teilte sie ihm mit, während sie noch immer seine Hand schüttelte. »Ich freue mich sehr, Sie endlich kennenzulernen, und brenne darauf, von Ihnen zu erfahren, was Sie die letzten Wochen in der Konföderation erlebt haben. Ich muss nicht extra betonen, dass Ihre bisherige Arbeit mit der Flotte, Ihre Bemühungen, eine Kommunikation mit den Kindern des Sturms herzustellen und den vor Kurzem entdeckten Wellenformen zu helfen, vorbildhaft gewesen ist. Ich vertraue darauf, diese Einsatzbereitschaft auch in Zukunft von Ihnen zu sehen.«
Als O’Donnell ihre Hand losließ, seufzte er. Niemand, der ihn kannte, hatte sich jemals so sehr darüber gefreut, ihn zu sehen.
»Danke, Admiral«, erwiderte er unbehaglich. Er beobachtete, wie ihr Lächeln nachließ, und ergänzte die Liste, die er im Kopf von Janeways Eigenschaften angefertigt hatte, um scharfe Beobachtungsgabe.
»Offensichtlich werden wir nicht die Zeit für einen vollständigen Bericht haben«, begann Janeway.
»Nein«, stimmte er ihr zu.
»Die Willkommensfeierlichkeiten fangen in weniger als einer Stunde an.«
»Ja … Was das angeht …«, fiel ihr O’Donnell ins Wort.
Janeway trat einen Schritt zurück und betrachtete ihn eingehend, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken.
Ganz Diplomatin, fügte O’Donnell seiner Liste hinzu.
»Gibt es ein Problem?«, fragte Janeway schließlich.
»Kommt darauf an.«
»Worauf?«
»Wie Sie den Begriff definieren, Admiral«, verdeutlichte O’Donnell.
»Sprechen Sie weiter.«
»Ich bitte um Erlaubnis, dem Empfang heute Abend fernbleiben zu dürfen, Admiral.«
»Warum?«
»Ich bin auf Feiern nicht zu gebrauchen.«
Mit verschmitztem Blick verschränkte Janeway die Arme vor der Brust.
»Das ist nicht einfach irgendeine Feier, Commander. Das ist eine diplomatische Mission.«
»Noch ein Grund mehr, warum Sie mich nicht dort haben wollen«, beharrte O’Donnell.
»Sie waren fast zwei Wochen lang der führende Vertreter der Föderation in der Konföderation. War es ein Fehler, Sie darum zu bitten, diese Aufgabe zu übernehmen?«
»Nein, Admiral«, versicherte er ihr. »Treffen zu zweit, kleine Gruppen, damit kann ich leben. Wenn ich ein bestimmtes Problem zu lösen habe, kaue ich Ihnen mit Freuden ein Ohr ab. Aber in großen Gruppen wie dieser weiß ich nie, was ich tun soll.«
»Also ist ihr Problem das zwanglose Plaudern?«
»Hätte meine Frau es zugelassen, hätte ich mich vor meinem eigenen Hochzeitsempfang gedrückt.«
Janeway kicherte. Sie schien darüber nachzudenken, Gnade vor Recht walten zu lassen, aber dann verschwand die Belustigung schlagartig von ihren Zügen.
»Bitte abgelehnt, Commander«, sagte sie endgültig.
»Admiral …«
»Sie gehören zu der Handvoll Offiziere, die viele der heute Abend anwesenden Diplomaten bereits kennen. Man wird erwarten, dass Sie die Vorstellungen übernehmen. Und auf jeden Fall würde man Ihre Abwesenheit bemerken und möglicherweise als Beleidigung auffassen.«
»Ist es nicht wahrscheinlicher, dass mein deutliches Unbehagen und mein Unmut, daran teilnehmen zu müssen, als Beleidigung aufgefasst wird?«
»Das wird es bestimmt, wenn Sie zulassen, dass man es bemerkt. Also werden Sie Ihr Bestes geben, heute Abend äußerst umgänglich zu sein. Muss ich daraus einen ausdrücklichen Befehl machen?«
»Das würde nicht helfen, Admiral. Ich habe diese Bitte nicht leichtfertig gestellt. Ich bin nicht nur deswegen hier, weil ich glaube, ich könnte die Zeit sehr viel produktiver nutzen, als sie bei diesem Empfang zu verschwenden. Obwohl ich das tatsächlich glaube. Ich kann nicht so tun, als wäre ich etwas, das ich nicht bin. Das ist eine wertvolle Fähigkeit, aber keine, über die ich verfüge. Ob ich will oder nicht, man wird mir deutlich ansehen, wie ich mich fühle. Ich würde uns allen die damit verbundenen Peinlichkeiten gerne ersparen. Commander Fife ist bereit, meinen Platz einzunehmen, und wird unseren Interessen sehr viel dienlicher sein als ich.«
Janeway wandte kurz den Blick ab, dachte über seine Worte nach. Schließlich sagte sie: »Vor ein paar Monaten wurde Ihr Schiff von den Kindern des Sturms gekapert. Sie hatten keine Telepathen an Bord, also konnten Sie nicht mit ihnen direkt kommunizieren. Allein aus dem Verhalten der Kinder haben Sie die Schlussfolgerung gezogen, dass ihr Hauptinteresse an der Demeter der Beobachtung der Wachstumszyklen der botanischen Lebensformen an Bord galt. Sie waren bereit Ihr Schiff, Ihre Besatzung und Ihr eigenes Leben für diese intuitive Einschätzung zu riskieren. Um das Vertrauen der Kinder zu gewinnen, haben Sie Ihr Schiff in einem Druckanzug verlassen. Sie haben ein ungetestetes Werkzeug benutzt, um eine von Ihnen geschaffene hybride Lebensform in eines der Kinder einzubringen, mit nichts weiter als der Hoffnung, dass sie dort wachsen würde.«
Der Blick aus Janeways klaren blauen Augen suchte O’Donnells. »Habe ich den Bericht falsch verstanden oder falsch in Erinnerung?«
»Nein, Admiral.«
»Sie haben Ihr Leben für diesen Erstkontakt riskiert, Commander. Warum sind Sie nicht bereit, in diesem Fall ein weitaus geringeres Risiko einzugehen?«
O’Donnell hielt Janeways Blick stand. »Die Kinder haben sich meinen Respekt und mein Mitgefühl verdient. Trotz all unserer offensichtlichen Unterschiede waren wir im Geiste verwandt. Von der Konföderation kann ich das nicht behaupten.«
»Warum nicht?«
O’Donnell zuckte mit den Schultern. »Sie sind reich. Sie sind mächtig. Sie sind davon überzeugt, das Zentrum des zivilisierten Universums zu sein. Ihre Reize und sozialen Umgangsformen sind formvollendet bis zur völligen Selbstaufgabe. Sie sind bisher nur einer Spezies begegnet, die gegen ihre Gastfreundlichkeit immun und von ihren technologischen Errungenschaften unbeeindruckt war … den Borg. Das wird sich ändern. Und während ich einerseits neugierig darauf bin, wie sie auf diese Erkenntnis reagieren, weiß ich andererseits jetzt schon, wie diese Geschichte enden muss.«
»Und wie, Commander?«
»Mit Enttäuschung.«
Janeway dachte über seine Worte nach, dann sagte sie: »Diese Möglichkeit besteht immer. Aber diejenigen von uns, deren Aufgabe es ist, Erstkontakte herzustellen, müssen sich stets eines vor Augen halten: Wo es Gemeinsamkeiten gibt, besteht immer die Möglichkeit, Enttäuschung zu überwinden und zu gegenseitigem Verständnis und Akzeptanz zu gelangen.«
»Selbstverständlich, Admiral«, stimmte O’Donnell zu.
»Wir sehen uns um 1800 in der Shuttlerampe.« Damit entließ sie ihn.
»Aye, Admiral.«
U.S.S. VOYAGER
Commander B’Elanna Torres fluchte leise, als ihr beim Versuch, die Galauniform zu schließen, zum fünfzehnten Mal die Knöpfe durch die Finger rutschten. Ihre Tochter Miral beobachtete sie mit Argusaugen und machte sich einen Spaß daraus, jedes Wort ihrer Mutter zum unpassendsten Zeitpunkt zu wiederholen.
Komm schon. Torres knirschte mit den Zähnen, wischte sich die schweißnassen Finger an der Hose ab und strengte sich noch mehr an.
»Noch hast du Zeit, eine neue zu replizieren«, schlug Lieutenant Nancy Conlon, die Chefingenieurin der Voyager und eine von B’Elannas besten Freunden, vor. Conlon nahm nicht an dem Empfang teil und hatte angeboten, mit Miral zu spielen, bis diese ins Bett musste. Beide lagen inmitten von magnetischen Bauklötzen auf dem Boden von Torres’ Quartier, aber beide hatten nur Augen dafür, wie B’Elanna versuchte, sich in ihre Galauniform zu zwängen.
»Ich brauche keine neue«, beharrte Torres. »Die hier ist schon eine ganze Nummer größer als die, die ich sonst trage.« Sie atmete tief aus, zog den Bauch so weit wie möglich ein und weigerte sich, wieder einzuatmen. Endlich gab die Jacke klein bei.
»Seht ihr?« Torres hob die Hände und posierte für die beiden.
Conlon biss sich auf die Lippen, um ihr Lächeln zu verstecken.
»Was?«
»Es ging doch darum, deine Schwangerschaft zu verstecken, oder?«
»Ja.«
»Spiegel«, schlug Conlon vor.
B’Elanna ließ die Arme sinken und trottete mit gesenktem Haupt in ihr Schlafzimmer, betrachtete dort ihr Abbild in dem neben der Tür an der Wand angebrachten Ganzkörperspiegel. Die Jacke war nun zwar definitiv geschlossen, aber der Stoff spannte sich wenig schmeichelhaft über ihren Bauch. Hinzu kam der kurze Schnitt, wodurch der untere Bund der Jacke ihren gerundeten Bauch eher betonte, als davon abzulenken.
»Verdammt«, sagte Torres, ohne darüber nachzudenken.
»Verdammt«, wiederholte Miral im Wohnzimmer augenblicklich.
»Miral Paris«, sagte Torres, als sie ins Wohnzimmer zurück und zum Replikator ging, mit einem deutlich warnenden Ton in der Stimme.
»Entschuldige, Mommy«, erwiderte Miral sofort.
Torres bestellte sich hastig eine neue Uniformjacke, eineinhalb Nummern größer als normal und extra lang. Dabei stellte sie sich die Frage, ob der Erfinder dieser Folterinstrumente jemals die Möglichkeit in Betracht gezogen hatte, dass eine schwangere Offizierin sie mal tragen müsste. Miral stellte sich neben ihre Mutter, sah zu ihr auf und fragte: »Ist das Baby immer noch ein Geheimnis, Mommy?«
Torres legte ihrer Tochter eine Hand auf die Schulter und zog sie an sich. »Nein, Liebling. Ist es nicht mehr.«
Miral drehte sich zu Conlon um. »Ich bekomme einen kleinen Bruder.«
Conlon lachte amüsiert. »Ich weiß. Aufregend, nicht wahr?«
»Und ich bringe ihm alles bei, was ich weiß.«
»Das wirst du bestimmt«, stimmte Conlon zu.
»Und ich werde die Mami sein und er das Baby.«
»Mooomentchen mal, Schätzchen.« Torres zog sich die neue Jacke an, erleichtert, wie viel wohler sie sich darin im Vergleich zur ersten fühlte. »Ich werde immer die Mami sein.«
»Aber wenn du und Daddy nicht da seid, dann darf ich die Mami sein«, beharrte Miral.
»Du darfst die große Schwester sein«, korrigierte Torres sie freundlich.
»Das ist viel Verantwortung«, sagte Conlon. »Weißt du, ich war auch mal eine große Schwester.«
»Du hast einen kleinen Bruder?«
»Eine kleine Schwester.«
»Wo ist sie?«
»Zu Hause.«
»Mein Daddy ist nach Hause gegangen.« Miral wirkte auf einmal sehr traurig.
Vollends angezogen und in der Lage zu atmen, ging Torres auf ein Knie hinunter und sah ihrer Tochter in die Augen. »Das stimmt, Schätzchen. Aber er kommt sehr bald wieder zurück.«
»Noch bevor das Baby kommt?«
»Auf jeden Fall«, versicherte ihr Torres.
Miral seufzte. Sie tat das Möglichste, was eine Dreieinhalbjährige tun konnte, die plötzliche Abreise ihres geliebten Vaters zu akzeptieren. Er war seit über einer Woche weg, und am schlimmsten war ihre Traurigkeit kurz vor dem Zubettgehen und gleich nach dem Aufstehen. »Ich will meinen Daddy«, gestand sie schließlich leise.
»Ich weiß.« Torres schloss sie fest in die Arme.
»Ich habe mir überlegt, anstatt heute Abend hier zu spielen, könnte ich dich auf dem Holodeck in eine meiner Lieblingseisdielen mitnehmen«, schlug Conlon vor, als sie aufstand und zu Miral ging.
»Eis?«, fragte Miral.
»Magst du heiße Karamellsoße?«
Miral nickte mit großen Augen.
»Ich auch«, erwiderte Conlon zwinkernd. »Bist du bereit?«
»Ja.«
Torres sagte lautlos und aufrichtig »Danke« in Conlons Richtung, während diese ihre Tochter zur Tür führte. Die Chefingenieurin der Voyager nickte verständnisvoll, beugte sich dann hinunter und flüsterte Miral etwas zu.
Miral drehte sich zu Torres um. »Du bist hübsch, Mommy.«
Das Kompliment brachte sie fast zum Weinen. »Danke, Schätzchen. Ich liebe dich.«
»Lieb dich«, antwortete Miral, während sie Conlon durch die Tür zerrte.
Vor zehn Tagen hätte Tom ihr Aussehen gelobt. Torres hätte seine Worte genossen, da sie wusste, dass er ihren immer größer werdenden Bauch tatsächlich wunderschön fand. Mittlerweile war er zurück auf der Erde und bereitete sich darauf vor, seiner Mutter in einer Reihe von angeordneten Schlichtungssitzungen gegenüberzutreten. Dabei ging es um ihre Eignung als Eltern und darum, wer letztendlich das Sorgerecht für Miral und ihren ungeborenen Bruder bekommen würde.
Torres und er hatten sich gestritten, bevor er gegangen war. Die Erinnerung schmerzte noch immer, das einzige Lebenszeichen in einem ansonsten einsamen Herzen. Kurz davor war Torres’ Leben perfekt gewesen. Das war ihr selbstverständlich nicht klar gewesen. Das war es nie, bis es vorbei war.
Nichts passte mehr zusammen.
Sie verdrängte diese niederschmetternden Gedanken mit aller Kraft, zog die Schultern hoch und machte sich auf den Weg zur Shuttlerampe.
Counselor Hugh Cambridge wurde an der Shuttlerampe erwartet, um zur Ersten Welt der Konföderation der Welten des Ersten Quadranten zu fliegen. Zu spät zu kommen bedeutete, den Unmut seines kommandierenden Offiziers, Captain Chakotay, und den der neuen Flottenbefehlshaberin, Admiral Janeway, zu riskieren.
Das war ihm egal.
Der Computer hatte ihn darüber informiert, dass der Doktor auf der Voyager eingetroffen war, und für die nächsten Minuten konnten seine Pflichten warten.
Cambridge hatte vor ein paar Tagen erfahren, dass er Seven für immer verloren hatte. Es bestand die Möglichkeit, dass er seinen nachvollziehbaren Ärger und die Enttäuschung über Seven auf den Doktor projizierte.
Aber das bezweifelte er. Der Doktor hatte bei den Ereignissen, die zu Sevens Abreise von der Flotte geführt hatten, eine zentrale Rolle gespielt. Der Counselor pflegte für gewöhnlich nicht mit dem Rest der Besatzung über seine Privatangelegenheiten zu sprechen. Seine Position erforderte eine wohlüberlegte Distanz. In diesem Fall jedoch hatte er beschlossen, eine Ausnahme zu machen. Er schuldete dem Doktor Schmerz, und sobald er dieser Verpflichtung nachgekommen war, würde sein eigener bestimmt nachlassen.
Er fand den Doktor in seinem kleinen Büro, wo er sich mit einer Pflegerin unterhielt. Obwohl er während der Mission der Flotte zur Besatzung der Galen gehörte, hatte man den Doktor vorübergehend auf die Voyager versetzt. Der leitende medizinische Offizier der Voyager, Doktor Sharak, hatte den Befehl erhalten, Seven zur Erde zu begleiten. Cambridge hatte den Doktor zwei Monate lang weder gesehen noch mit ihm gesprochen.
In dem Moment, als der Doktor ihn sah, schickte er die Pflegerin weg. Die Tür hatte sich kaum zugeschoben, als Cambridge sagte: »Sie konnten sich einfach nicht beherrschen, nicht wahr?«
Der Doktor seufzte theatralisch. »Sie haben mir auch gefehlt, Counselor.«
»Seven hat sie ausdrücklich darum gebeten, dass Sie Ihre Nachforschungen über ihre Catome vertraulich behandeln. Bevor die Galen Admiral Janeway zurück zur Erde gebracht hat, hat sie mir noch von Ihrem Durchbruch erzählt. Sie war erstaunt, dass Sie es tatsächlich geschafft haben, ein Catom bildlich darzustellen. Aber diese brillante Entdeckung hat Sie nicht von Ihren ethischen Verpflichtungen als ihr Arzt oder ihr Freund entbunden.«
»Counselor …«
»Sie hatten nicht das Recht, mit irgendwem ohne ihre Zustimmung über diesen Durchbruch zu reden. Aber Sie mussten, nicht wahr? Sie konnten es nicht ertragen, dass man Ihr Genie nicht anerkennt. Sie wussten, was man mit ihr tun würde, sobald man ihren potenziellen Nutzen erkennt. Aber das war Ihnen egal.«
Der Doktor wirkte kurz erschrocken, dann lag einen winzigen Augenblick lang eine sonderbare Gelassenheit auf seinen Zügen. Er näherte sich Cambridge, stellte sich vor ihn und richtete einen medizinischen Trikorder auf ihn.
»Was tun Sie da?«, wollte Cambridge wissen
»Es geht Ihnen offensichtlich nicht gut, Counselor. Ich schlage vor, Sie bleiben dem Empfang heute Abend fern und unterziehen sich stattdessen hier einer medizinischen Behandlung.«
Fassungslos trat Cambridge einen Schritt zurück. »Was, verflucht noch mal, stimmt nicht mit Ihnen?«
»Mit mir? Da ist alles in Ordnung. Seven hat darum gebeten, dass ich meine Forschung vertraulich behandle. aber kurz nach meiner Ankunft im Beta-Quadranten und nachdem ich mit der Behandlung der ehemaligen Borg-Drohne namens Axum begonnen hatte, wurde mir von meinen Vorgesetzten von der Medizinischen Abteilung der Sternenflotte befohlen, ihnen alles über meine Arbeit mit Seven und ihren Catomen zu berichten. Selbstverständlich hatte ich moralische Bedenken wegen dieser Befehle, aber Admiral Janeway hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass es eine Verletzung meiner Pflichten als Sternenflottenoffizier wäre, mich dem ausdrücklichen Befehl zu widersetzen. Und nachdem mir klar war, welche Art von medizinische Bedrohung diese neue ›catomische Seuche‹ ist, die gerade einige Föderationswelten heimsucht, war ich davon überzeugt, dass Seven mir erlaubt hätte, darüber zu sprechen. Möglicherweise kennen Sie sie nicht so gut wie ich, Counselor.«
Nicht zum ersten Mal wünschte sich Cambridge, er könnte das Hologramm schlagen.
»Und die experimentelle Therapie, die Sie bei Axum angewendet haben? Sie haben ihm welche von Sevens Catomen gegeben?«
»Axum lag im Sterben. Seine Catome waren inaktiv. Ohne die Infusion wäre er gestorben. Auch so war es noch knapp.«
»Haben Sie auch nur einen Moment lang in Betracht gezogen, dass das Mischen dieser Catome zu dem unbeabsichtigten Effekt führen könnte, dass Seven dazu gezwungen wird, seine Gedanken mitzuerleben?«
»Habe ich nicht«, gab der Doktor zu. »Ich war überrascht, als mir Seven von dieser Entwicklung berichtet hat. Aber Doktor Sharak war es möglich, diese Symptome weitestgehend zu mindern.«
»Bis es endlich so weit war, hat sie sehr gelitten, Doktor.«
»Seven hat auch viel erfahren, und das wird ihr ohne Zweifel bei ihrer Arbeit mit der Medizinischen Abteilung helfen.«
»Also raubt Ihnen das nicht den Schlaf, was?«
»Ich schlafe nicht, Counselor«, korrigierte ihn der Doktor. »Aber wenn, hätten meine Taten drauf keinen Einfluss.«
Cambridge betrachtete ihn abschätzend. Wäre er so menschlich, wie er aussah, wäre es ein Leichtes, eine Diagnose zu erstellen. Aber das war er nicht. Er war ein hoch entwickeltes holografisches Programm, das »Experten« zufolge seine Grundfunktionen überwunden und ein Bewusstsein erlangt hatte. Er glich mehr einer neuen Lebensform. Einer, von der Cambridge bis zu diesem Moment gedacht hatte, dass er sie durchschaut hätte.
»Ist Ihnen klar, dass Seven wegen dem, was Sie getan haben, niemals zu dieser Flotte zurückkehren wird?«
Unerwartet wurde der Doktor wütend. »Ich habe getan, was ich tun musste. Ich bin nicht für die Seuche verantwortlich, die zu dieser Kette von Ereignissen geführt hat. Ich mache Seven keinen Vorwurf, dass sie denen helfen will, die an einer Heilung für die Opfer arbeiten, und Sie sollten das auch nicht tun. Zehntausende sind bereits tot, und bis man eine Behandlungsmethode gefunden hat, werden Hunderttausende folgen. Ich weiß, dass Seven sehr darunter leiden würde, tatenlos zuzusehen, während so viele ihre Hilfe benötigen. Ich würde mich nie einer ihrer Entscheidungen in den Weg stellen. Und weil mir wichtiger ist …«
Cambridge wartete, da der Doktor sich selbst mitten im Satz unterbrach. Seine Wut wich Verwirrung, und fast augenblicklich dieser seltsamen, unheimlichen Gelassenheit.
»Doktor?«, fragte Cambridge schließlich.
»Sobald man ihre Hilfe bei der Medizinischen Abteilung der Sternenflotte nicht mehr benötigt, wird Seven zur Flotte zurückkehren. Ich werde mein Möglichstes tun, diese Rückkehr zu beschleunigen, indem ich selbst ohne Unterlass an einer Heilung für diese Seuche arbeite«, sagte der Doktor so ruhig, als wäre ihm der Gedanke gerade erst gekommen.
»Wie lange arbeiten die intelligentesten Leute der Sternenflotte nun bereits erfolglos daran?«
»Über ein Jahr. Aber sie sind nicht Seven. Sie sind nicht ich. Hätte man uns früher zurate gezogen, wäre diese Seuche bereits nichts weiter als eine schmerzhafte Erinnerung.«
»Unglaublich«, bemerkte Cambridge.
»Nur für diejenigen, denen es an Vorstellungskraft mangelt.«
»Axum war ihre erste Liebe. Sie wissen so gut wie ich, was das bedeuten kann. Ob die Seuche nun geheilt wird oder nicht, sie wird ihn nicht noch einmal im Stich lassen.«
»Ich könnte durchaus verstehen, sollte sie sich so entscheiden. Ich würde mich für sie freuen. Sie etwa nicht?«
Cambridge war ratlos. Er wusste, dass der Doktor Seven mal geliebt hatte. Er wusste, dass ihn ihre ein paar Monate zurückliegende Entscheidung, eine intime Beziehung mit dem Counselor einzugehen, angewidert hatte. Er hatte angenommen, dass der Doktor, da er sie nicht bekommen konnte, alles tun wollte, um sicherzustellen, dass das, was sie mit Cambridge hatte, sich nie weiterentwickeln konnte – und sei es, sie in Axums Arme zu treiben. Aber nun klang der Doktor so, als spräche er über ein beliebiges Mitglied der Besatzung. Der Wechsel zwischen vehementem Protest und klinischer Zurückhaltung war verblüffend.
Es ergab keinen Sinn.
»Chakotay an Counselor Cambridge.«
Cambridge berührte seinen Kommunikator. »Sprechen Sie, Captain.«
»Wir warten, Counselor.«
»Ich bin auf dem Weg.«
Cambridge warf dem Doktor noch einen Blick zu, drehte sich dann um und eilte in Richtung Shuttlerampe. Dabei fragte er sich, ob der Doktor wirklich jemals der Mann gewesen war, für den ihn so viele hielten.
DIE ERSTE WELT
Der Raum, in den man Captain Chakotay und seine Besatzung führte, um auf die anderen Offiziere zu warten, die an dem Empfang teilnehmen würden, wurde offensichtlich nicht oft für diesen Zweck genutzt. Man hatte einen kleinen Metallschreibtisch in eine Ecke geschoben und eine Pflanze dazugestellt, deren ausladende lavendelfarbene Blätter in einer unscheinbaren Vase steckten. Offensichtlich sollte die Pflanze vom Arbeitsplatz ablenken. An drei der vier Wände waren Stühle aufgereiht, und auf einem kleinen Tisch in der Mitte stand eine Karaffe mit Wasser, um die herum Becher gestapelt waren.
Chakotay vermutete, dass sie nicht lange hier bleiben würden. Weder er noch jemand von seiner Mannschaft – Flottenchefingenieurin B’Elanna Torres, Lieutenant Harry Kim, Lieutenant Kenth Lasren oder Counselor Hugh Cambridge – nahm Platz.
»Was denkst du, wofür dieser Raum normalerweise benutzt wird?«, fragte Kim Torres. Die Frage schien sie zu reizen, und sie zuckte lediglich mit den Schultern. Chakotay wusste den Versuch seines amtierenden Ersten Offiziers, die Situation normal scheinen zu lassen, zu würdigen. Aber ihm war klar, dass die Anspannung, unter der die meisten von ihnen standen, nur schwer zu lösen war.
Vor zehn Tagen war Torres unter höchst schmerzlichen Umständen von ihrem Mann, dem Ersten Offizier der Voyager, Commander Tom Paris, getrennt worden. Lieutenant Lasren war der einzige reinrassige Betazoid an Bord der Voyager. Man hatte ihn für die Teilnahme an dem Empfang in der Hoffnung ausgesucht, dass sich seine empathischen Fähigkeiten für Admiral Janeway als nützlich erweisen würden, während sie offizielle diplomatische Beziehungen mit der Konföderation aufnahm. Lasren setzte seine besonderen Fähigkeiten nicht sehr häufig ein, und der zu erwartende Stress zeichnete sich bereits auf dem Gesicht des jungen Manns ab. Für gewöhnlich konnte man darauf zählen, dass Counselor Cambridge die Stimmung lockerte, aber seit er von Sevens Abreise erfahren hatte, war er die ganze Zeit schlecht gelaunt. Chakotay wusste, dass er früher oder später mit Cambridge sprechen musste, aber seitdem die Voyager in Begleitung der Galen und der Vesta in den Raum der Konföderation zurückgekehrt war, hatte er keine Gelegenheit dazu gehabt.
Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Chakotay seit ihrer Kommandoübernahme über die Full-Circle-Flotte erst ein paar Mal mit Kathryn gesprochen hatte. Keine dieser Unterhaltungen war so verlaufen, wie er sie sich von der Frau erhofft hatte, mit der er den Rest seines Lebens verbringen wollte. Er konnte kaum erwarten, sie heute Abend zu sehen, obwohl er wusste, dass alles rein dienstlich verlaufen würde. Ihrer bevorstehenden Ankunft jedoch sah er mit einer gewissen Beklommenheit entgegen.
»B’Elanna, Harry, Kenth, Hugh«, sagte Chakotay und zog damit sofort die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich, »ich weiß, dass die letzte Woche alles drunter und drüber gegangen ist. Es gab viele Veränderungen zu verarbeiten, und das war nicht immer leicht. Aber die nächsten Stunden müssen wir das alles hinter uns lassen. Heute Abend sind wir die Ehrengäste der Führung einer Konföderation von Planeten, die, soweit ich das beurteilen kann, das Erste ist, dem wir im Delta-Quadranten begegnet sind, das unserer Föderation nahekommt. Commander O’Donnells erste Berichte deuten unter anderem an, dass man unglaublich aufgeregt ist, uns zu treffen und über die Möglichkeit einer Allianz zwischen unseren Völkern zu sprechen. Ich muss Ihnen nicht sagen, was für einen Nutzen eine solche Allianz für unsere Flotte und die Föderation darstellen würde.
Seit der Entwicklung unseres Slipstream-Antriebs scheint die Galaxis noch ein wenig kleiner geworden zu sein. Die von der Konföderation benutzten ›Ströme‹, mit denen sie durch den von ihnen beanspruchten Raum reisen – Subraumkorridore, die riesige Distanzen überbrücken – hatten hier eine ähnliche Wirkung. Noch vor ein paar Jahren hätte die Vorstellung, mit einer so weit entfernten Zivilisation Beziehungen herzustellen, wahrscheinlich keinerlei Potenzial für den sinnvollen Austausch von Informationen oder Rohstoffen beinhaltet. Das ist nicht länger der Fall. Die wichtigste Aufgabe der Sternenflotte ist es, als Botschafter für alle warpfähigen Kulturen in der Galaxis zu fungieren. Heute Abend stehen wir vor dieser Aufgabe. Das Ansehen der Föderation hängt davon ab, wie wir uns verhalten.
Ich brauche Ihnen wohl kaum zu befehlen, sich vorbildlich zu verhalten. Ich bitte Sie einfach darum, nicht zu vergessen, was hier alles auf dem Spiel steht, und daran zu denken, dass sich uns solche Gelegenheiten viel zu selten bieten. Unsere ganzen Probleme werden morgen früh immer noch vorhanden sein. Heute Abend amüsieren wir uns, in Ordnung?«
»Gut gesprochen, Captain«, stellte eine vertraute Stimme fest.
Als er sich umdrehte, sah Chakotay, dass Admiral Janeway während seines Vortrags hereingekommen war. Wie immer stand rechts von ihr ein schlanker Vulkanier, Lieutenant Decan, Kathryns persönlicher Assistent. Der kommandierende Offizier der Galen Commander Clarissa Glen, der leitende medizinische Offizier der Vesta Doktor El’nor Sal und ihr Captain Regina Farkas folgten Janeway zusammen mit Commander Liam O’Donnell von der Demeter. Letzterer wirkte, als wäre er auf einer Beerdigung, aber als er Chakotays Blick bemerkte, nickte er dem Captain zu.
»Admiral an Deck«, verkündete Kim zackig.
Admiral Janeway verkniff sich ein Lachen, als sie befahl: »Rühren.« Dann ging sie zu Kim und sagte leise: »Ich weiß die Geste zu schätzen, Lieutenant Kim, aber wenn wir unter uns sind, wollen wir es mit den Formalitäten nicht so genau nehmen.«
»Selbstverständlich, Admiral«, bestätigte Kim.
Als sie Chakotay ansah, lächelte sie noch breiter. »Captain.« Sie hielt kurz den Blickkontakt, und ein guter Teil der Sorgen, die er sich vor ihrer Ankunft gemacht hatte, schwand.
»Admiral«, entgegnete er freundlich, beugte sich zu ihr hinunter und flüsterte: »Du siehst atemberaubend aus.«
Janeway nahm sein Kompliment mit einem Nicken an, ging dann zu den anderen Offizieren der Voyager und begrüßte jeden einzelnen. Sie nahm B’Elanna kurz beiseite und umarmte sie fest; offenbar hatte Janeway die Gelegenheit genutzt, Torres zu ihrer Schwangerschaft zu gratulieren. Alte Freunde und Bekannte fingen an, sich leise zu unterhalten. Doktor Sal, eine große Frau in ihren Achtzigern, näherte sich schnell Chakotay und hakte sich ohne Vorwarnung bei ihm ein.
»Ich hoffe, das stört Sie nicht, Captain«, sagte sie mit einem verschmitzten Lächeln.
»Überhaupt nicht.«
»Ich betrete einen Raum gerne am Arm des bestaussehenden Manns, den ich finden kann«, scherzte Sal.
»Heute Abend werden Sie sich wohl mit mir begnügen müssen«, entgegnete Chakotay ebenso neckisch.
»Belästigt Sie mein leitender medizinischer Offizier, Captain?«, fragte Farkas, die sich zu ihnen gesellte.
»Nein«, versicherte er ihr.
»Ich habe ihr befohlen, sich zu benehmen. Wenn sie zu weit geht, haben Sie meine Erlaubnis, sie zu erschießen.«
»Dazu wird es bestimmt nicht kommen, Captain«, sagte Chakotay.
»Seien Sie da nicht so sicher«, riet Sal.
»Sieht so aus, als wären wir vollzählig«, verkündete Admiral Janeway, wobei sie die Stimme über die leisen Unterhaltungen erhob. Alle Gespräche verstummten augenblicklich.
Sie warf einen Blick auf die Anwesenden, mit strahlenden Augen und vor Aufregung gerötetem Gesicht, dann sagte sie: »Ich freue mich sehr auf diesen Abend. Wenn man sich den Ablaufplan ansieht, haben sich unsere Gastgeber große Mühe gegeben, uns heute Abend zu beeindrucken. Ermöglichen wir es ihnen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sich so große Zusammenkünfte unpersönlich anfühlen und anstrengend werden können. Denken Sie nur daran: Wir sind die ersten Bürger der Föderation, die diese Welt betreten. Unsere Anwesenheit ist ein Geschenk von denen, die das Universum vor uns bereist haben, die zuerst den Mut aufgebracht haben, sich in unerforschten Raum zu wagen, um mehr über das Universum zu erfahren. Ich behaupte nicht, bereits zu wissen, wie sich die kommenden Verhandlungen entwickeln werden. Im Moment ist das unwichtig. Akzeptieren Sie diesen Augenblick als das, was er ist, und kosten Sie ihn voll aus. Dies ist eine Erfahrung, die sich nur einmal im Leben bietet. Genießen Sie sie.«
Das allgemeine Nicken um sie herum schien Janeway zufriedenzustellen, als sich die Tür aufschob und ein großer Humanoide in einer langen Tunika eintrat, die aus reinem Gold gesponnen zu sein schien. Der Faltenwurf bei seinen Bewegungen ließ mehr an eine Flüssigkeit als an Stoff denken. Über der Schulter trug er eine breite, lange Kette aus dunklem Metall, die den Effekt noch verstärkte, indem sie den Eindruck erweckte, auf der Oberfläche des Stoffs zu schwimmen. Chakotay wusste, dass dies ein Leodt war, eine der beiden wichtigsten Gründerspezies der Konföderation. Die andere waren die Djinari. Die Haut des Leodt war tiefbraun, seine Augen pechschwarz, aber das Auffälligste in seinem Gesicht war der Ring spitzer Zähne, den seine dünnen Lippen nicht verbergen konnten. Janeway ging augenblicklich auf ihn zu.
»Repräsentanten der Föderation«, begrüßte er sie mit aufrichtiger Freundlichkeit. »Ich bin Premierkonsul Lant Dreeg. Ich habe die Ehre, Sie auf der Ersten Welt willkommen zu heißen.«
»Es ist uns eine Ehre, von Ihnen empfangen zu werden«, erwiderte Janeway, eindeutig eine einstudierte Antwort, auf die man sich wahrscheinlich während der Gespräche, die zu diesem Moment geführt hatten, geeinigt hatte.
»Wenn Sie mir bitte folgen würden?«, fragte Dreeg.
Chakotay und Sal gingen gleich hinter Janeway, während die anderen ihre zuvor festgelegten Positionen für ihr Erscheinen auf dem Empfang einnahmen.
Jetzt geht es los, dachte Chakotay.
2
MEDIZINISCHE ABTEILUNG DER STERNENFLOTTE, SAN FRANCISCO
Wie gewünscht war Seven um 0600 Uhr am Eingang zur Medizinischen Abteilung der Sternenflotte eingetroffen. Sobald sie sich dem diensthabenden Offizier gegenüber identifiziert hatte, war durch eine versteckte Tür im Atrium ein Sicherheitsoffizier erschienen. Dieser hatte sie mit ihrer Meinung nach halsbrecherischer Geschwindigkeit Flure entlang, durch Labore und an Büros vorbei geführt. Doktor Sharak war praktisch dazu gezwungen gewesen, ihr und dem schweigsamen Offizier im Laufschritt zu folgen.
Zwei Turbolifte und einige weitere nichtssagende Flure später führte man Seven und Sharak in ein geräumiges Labor, in dem acht Personen arbeiteten. Nur eine hob bei ihrem Eintreten den Blick von ihrer Datenkonsole. Sofort berührte sie ihren Kommunikator und sagte: »Doktor Frist, sie sind da.«
»Ist jeder bei diesem Projekt so unfreundlich?«, murmelte Sharak Seven zu.
»Soweit ich gehört habe, schon«, erwiderte Seven leise.
Sekunden später kam durch die Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Raums eine Trill. Sie trug ihr brünettes Haar zurückgekämmt, wodurch die Flecken zu erkennen waren, die an der Stirn begannen und ihren Hals hinabliefen. Über der herkömmlichen blauen Uniform trug sie einen hellgelben Kittel.
»Seven of Nine«, sagte sie und reichte ihr die Hand. »Ich bin Doktor Pauline Frist. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.«
»Ich bevorzuge ›Seven‹«, korrigierte diese. »Der Rest meiner früheren Bezeichnung stimmt schon seit Jahren nicht mehr.«
»Oder ›Miss Seven‹«, schlug Sharak vor.
»Ebenso zutreffend.« Seven nickte.
»Und Sie sind?«, fragte Frist an Sharak gewandt.
»Ich bin Doktor Sharak, leitender medizinischer Offizier des Föderationsraumschiffs Voyager und ein Kind von Tama.«
»Ich habe von Ihnen gehört.« Frist nickte leicht. »Der erste Tamarianer, der in der Sternenflotte dient, nicht wahr?«
»Ja.«
»Willkommen.« Frist reichte auch ihm die Hand.
Nachdem Sharak sie wieder losgelassen hatte, konzentrierte sich Frist wieder auf Seven. »Ich nehme an, Sie wissen, warum Sie hier sind?«
»Admiral Janeway hat mich über Ihre Bemühungen informiert, eine neue Krankheit zu heilen, die zum ersten Mal vor fast einem Jahr auf Coridan aufgetreten ist. Sie deutete an, dass Sie glauben, sie wäre catomischen Ursprungs.«
»Wir wissen, dass sie catomischen Ursprungs ist«, widersprach Frist.
Seven nickte, auch wenn sie sich erst dann eine Meinung bilden würde, wenn sie Zugang zu den aktuellen Forschungsergebnissen der Einrichtung bekam.
»Als die Krankheit zum ersten Mal auftrat, hatten wir keine Ahnung, womit wir es zu tun hatten. Wir brauchten Monate, um die potenzielle Verbindung zwischen catomischer Materie und der Krankheit zu erkennen. Der Commander, der im Moment unsere Untersuchungen leitet, kam zu diesem Schluss. Nachdem wir das erkannt hatten, wurde es für uns zur höchsten Priorität, unser Verständnis von Catomen zu erweitern. Wir haben sehr gehofft, dass es nicht nötig werden würde, Sie von Ihrer derzeitigen Arbeit mit der Full-Circle-Flotte abzuziehen. Aber so wie es aussieht …« Frist hob die Hände.
»Ich wünschte, Sie hätten mich früher um Rat gebeten.«
»Jetzt sind Sie hier«, entgegnete Frist. »Das ist alles, was zählt.«
»Ich würde jetzt gerne sofort zu dem Patienten gebracht werden, den sie die letzten Monate untersucht haben«, forderte Seven. »Man hat mir zugesagt, dass ich ihn sehen dürfte, bevor ich mit meiner Arbeit beginne.«
»Patient C-1, ja.« Frist nickte.
»Axum«, beharrte Seven.
»Bevor Sie in das Labor können, müssen wir Sie erst einer vollständigen körperlichen Untersuchung unterziehen.«
Seven sah sich bestürzt um. »Das ist nicht das Labor?«
»Nein. Ich arbeite mit Teams von der Medizinischen Abteilung der Sternenflotte und dem Gesundheitsamt der Föderation an einer Untersuchung über die Verbreitung der Seuche, die Infektionsrate und unseren Eindämmungsmethoden. Diejenigen, die an einer Heilung arbeiten, befinden sich in einem Labor einige Stockwerke über uns, für das man besondere Freigaben benötigt. Die meisten haben sich dort vor ein paar Monaten eingerichtet. Sie verlassen oder betreten das Labor nicht einfach so. Es wurde jede notwendige Vorkehrung getroffen, um sicherzustellen, dass ihre Arbeit mit dieser hochgradig gefährlichen Substanz sicher und unter Kontrolle ist. C-1 – entschuldigen Sie – Axum ist auch dort.«
»Er ist Ihr Gefangener?«, fragte Seven.
»Keinesfalls.« Frist schien allein der Gedanke zu beleidigen. »Er ist ein ehemaliges Mitglied einer feindlichen Streitmacht, das sich bereit erklärt hat, uns zu helfen, indem er uns die Catome in seinem Körper untersuchen lässt. Ich versichere Ihnen, seit er hier ist, wurde ihm kein Leid angetan.«
Sevens mentale Verbindung zu Axum während der letzten Monate ließ anderes vermuten, aber vorläufig behielt sie das für sich.
»Wie lange wird diese Untersuchung dauern?«
»Nicht lange. Je früher wir anfangen, umso schneller können Sie zu Axum«, erwiderte Frist.
Seven nickte. »Nun gut.«
»Ich werde die Untersuchung überwachen«, verkündete Sharak.
»Selbstverständlich«, stimmte Frist lächelnd zu.
Die Untersuchung war die gründlichste, die Doktor Sharak jemals erlebt hatte. Sie war weit umfassender als eine herkömmliche Untersuchung eines Patienten, der nicht in Lebensgefahr schwebte, oder eine Mannschaftsuntersuchung. Zusätzlich zu den üblichen Scans entnahm man Seven mehrere Gewebe- und Catomproben. Es wurde eine vollständige genetische Analyse durchgeführt sowie ein subatomarer Scan. Während der Untersuchung sagte Seven, dass der leitende medizinische Offizier der Galen, der Doktor, vor ein paar Monaten ähnliche Scans durchgeführt habe. Frist antwortete, dass seine Arbeit für den Commander und sein Team von entscheidender Bedeutung gewesen war, einzelne Catome auszumachen. »Wir haben ihm alle viel zu verdanken«, merkte sie an. Seven schien ihr nicht zu glauben. Das wunderte den Tamarianer nicht, immerhin hatte der Doktor berichtet, dass Frist und ihre Kollegen ihn recht gleichgültig behandelt hatten.
Bevor er zusammen mit Seven den Delta-Quadranten verlassen hatte, hatte Sharak kurz mit dem Doktor gesprochen. Obwohl ihm die mannigfaltigen Bedenken des MHNs bekannt waren, war Sharak entschlossen, diesen Leuten und ihren Methoden unvoreingenommen zu begegnen. Es würde Seven nicht helfen, voreilige Schlüsse zu ziehen. Der Doktor hatte seine Erfahrungen gemacht. Aber Sharak würde nicht zögern, einzugreifen, sollte etwas Unangebrachtes vorgeschlagen werden.
Einige Stunden später wurde für die ganze Belegschaft ein leichtes Mittagessen repliziert, und man lud Seven und ihn ein, mitzuessen. Das taten sie auch, obwohl Seven nicht viel Appetit zu haben schien.
Gerade als sie ihre Mahlzeit beendeten, betrat eine stämmige Frau das Labor und kam direkt auf sie zu. Ihr blauer Teint und der kahle Kopf machte ihre bolianische Herkunft deutlich. Frist beeilte sich, sie vorzustellen.
»Seven, Doktor Sharak, darf ich Ihnen Ensign J’Ohans vorstellen? Sie gehört zum Team des Commanders und wird Seven in den zugangsbeschränkten Teil unseres Labors bringen, wo sie bis zum Ende ihrer Zusammenarbeit mit uns bleiben wird.«
»Der Ensign wird uns beide ins Labor bringen«, korrigierte Sharak Frist.
»Tut mir leid, Doktor Sharak«, antwortete J’Ohans. »Nur das Team des Commanders hat Zutritt zu der zugangsbeschränkten Abteilung. Unsere Mittel sind begrenzt und wir können niemanden dort unterbringen, der für unsere Arbeit nicht unbedingt notwendig ist.«
»Doktor Sharak hat mich begleitet, um mich bei Bedarf zu überwachen und zu unterstützen«, widersprach Seven. »Für mich ist er unbedingt notwendig.«
»Das verstehe ich«, lenkte J’Ohans ein. »Und ich wünschte wirklich, wir könnten seinem Wunsch nachkommen. Aber was das angeht, sind unsere Vorschriften eindeutig.«
»Bestimmt kann uns Doktor Sharak für die Dauer Ihres Aufenthalts hier behilflich sein«, unterbrach Frist den Ensign. »Auch wenn wir nicht direkt mit dem Virus arbeiten, ist unsere Arbeit an seiner Epidemiologie ebenso wichtig. Sicherlich wird uns seine Erfahrung von sehr großem Nutzen sein.«
»Ich nehme an, ich kann jederzeit mit Doktor Sharak sprechen?«, fragte Seven.
»Natürlich«, bestätigte J’Ohans.
»Das ist inakzeptabel«, verkündete Sharak ernst.
J’Ohans sah Frist flehend an.
Seven schien kurz darüber nachzudenken, dann bat sie Frist und J’Ohans, ihr einen Ort zur Verfügung zu stellen, wo sie ungestört mit Sharak sprechen konnte.
Frist führte sie in ein kleines Büro und ließ sie alleine.
»Sie dürfen der Bitte, uns zu trennen, nicht nachgeben«, beharrte Doktor Sharak.
»Ich bezweifle, dass einer von uns über die notwendige Autorität verfügt, zu verlangen, dass sie ihre Vorschriften ändern«, entgegnete Seven.
»Ich wurde hergeschickt, um Ihre Interaktionen mit ihnen zu beobachten. Das kann ich nicht, wenn Sie in einem zugangsbeschränkten Labor eingesperrt sind, wo ich Sie nicht erreichen kann.«
»Nur wenn ich in das Labor gehe, kann ich Axum sehen«, wandte Seven ein.
»Solange man mir nicht gestattet, Sie zu begleiten, sollten Sie dieses Labor nicht betreten.«
»Ich kann auf mich aufpassen. Ich habe mich bereits freiwillig in gefährlichere Situationen als diese begeben.«
»Sie haben dieses Labor nicht gesehen«, widersprach Sharak. »Sie wissen nicht, wie gefährlich es sein könnte. Haben Sie dem Doktor und Counselor Cambridge nicht gesagt, dass man Axum Ihrer Meinung nach gefoltert hat?«
»Ja. Und falls man das noch immer tut, kann ich ihm von hier aus nicht helfen.«
»Sie haben während der vergangenen Wochen jederzeit den neuralen Inhibitor getragen, den ich Ihnen gegeben habe. Gehen Sie heute Abend noch nicht in das Labor. Ich werde Sie beobachten, während Sie den Inhibitor abschalten. Es ist möglich, dass Sie Verbindung mit Axum aufnehmen und die aktuelle Bedrohung für ihn besser beurteilen können.«
»Doktor, ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, aber meine Entscheidung, herzukommen, beruht zum Großteil darauf, dass ich mich vergewissern will, dass es Axum gut geht. Ich werde keine weitere Nacht warten, um seinen derzeitigen Zustand in Erfahrung zu bringen.«
»Ist Ihnen nicht in den Sinn gekommen, dass es vielleicht einen Grund gibt, weswegen man uns trennen möchte?«
»Selbstverständlich ist es das. Aber es gibt keine Alternative.«
»Sie haben sich so lange geduldet«, sagte Sharak beschwörend. »Es ist eindeutig, dass man Ihre Mitarbeit hier benötigt. Machen Sie das davon abhängig, dass ich Sie begleiten darf. Machen Sie deutlich, dass Sie sofort gehen werden, falls man sich weigert; vielleicht überlegt man es sich dann bis morgen. Wenn nicht, haben Sie zumindest jede Möglichkeit ausgeschöpft.«
»Die heute durchgeführten Scans haben bereits sämtliche Daten geliefert, die man von mir und meinen Catomen benötigt«, entgegnete Seven. »Sollte ich zu diesem Zeitpunkt Schwierigkeiten machen, kann es sein, dass man zu der Entscheidung gelangt, mich nicht mehr zu benötigen. In einem solchen Fall wäre meine Gelegenheit, Axum zu sehen, vertan.«
»Das ändert nichts am Risiko.«
»Ich bin bereit, es in Kauf zu nehmen.«
Malra auf Bethaom.
Er könnte ihr die Geschichte erzählen. Er könnte die umständlichen Worte der Föderation verwenden, sie vor den Gefahren zu warnen, die es barg, seinem Herzen nachzugeben, obwohl es der Verstand besser wusste. Ein Kind von Tama hätte augenblicklich begriffen, wie gefährlich es war, Malras Beispiel zu folgen. Sie hätten die Intensität von Sharaks Angst in einem einzigen Bild zusammengefasst: ein gerade zur Frau erblühtes Mädchen, das sich einen Dolch ins Herz rammte, um den brennenden Schmerz der Reue zu beenden. Ihr lebloser Körper, wie er auf Jescha lag, jenem Jungen/Mann, dem sie vertraut und den sie zu retten gehofft hatte.
Ohne Zweifel gab es auch in der Föderation Weisheit. Sie führten präzise Aufzeichnungen über ihre Vergangenheit, aber die unüberschaubare Menge der dadurch verfügbaren Daten gestaltete es schwierig, die einfachsten und wichtigsten Wahrheiten der Vergangenheit zu erkennen. Die Kinder von Tama hatten kein Wort für »Forschung«. Sie gaben ihre Wahrheiten zukünftigen Generationen in aussagekräftigen Bildern weiter, die erst ihr Herz und dann ihren Verstand ansprachen. Alles, was man wissen musste, lernte man, indem man sprechen lernte. Die wirkungsvollsten Beispiele jedes Fehlers, den man machen konnte, waren mit ihren alltäglichen Leben verwoben.
Aber wie sollte er Miss Seven das mitteilen? Wie kann ich es ihr begreiflich machen?
Ungeduldig sagte Seven: »Ich werde mich bei Ihnen melden, sobald ich Gewissheit über Axums Zustand habe. Ich werde Sie über alle Bedenken informieren, und sollte ich mir Sorgen um meine Sicherheit machen, werde ich darauf mit der notwendigen Härte reagieren.«
»Wenn Sie bereits damit rechnen, dass solche Maßnahmen notwendig werden könnten, wären Sie gut beraten, noch einmal darüber nachzudenken.«
»Ich habe meine Entscheidung getroffen, Doktor.«
»Und ich kann Sie nicht von den damit verbundenen Gefahren überzeugen?«
»Ich nehme Ihre Besorgnis zur Kenntnis. Aber ich kann nicht anders handeln.«
»Manche Lehren müssen wir selbst ziehen«, sagte Sharak traurig.
»Manche Informationen kann man nur aus erster Hand erlangen.«
»Kiteo. Seine Augen geschlossen.«
»Doktor?«
»Sie sprechen von Informationen, ich von der Wahrheit.«
Seven seufzte frustriert.
Sharak neigte den Kopf. »Bitte lassen Sie mich so bald wie möglich wissen, ob es Ihnen gut geht.«
»Sie haben mein Wort.«
Zu viele davon, stimmte Sharak schweigend zu.
Der Commander wartete ungeduldig darauf, dass sich die zweite Luftschleuse öffnete. Als sie endlich mit einem lauten Zischen aufglitt, das durch den Empfänger seines Schutzanzugs kaum zu hören war, trat er vorsichtig über die Schwelle des Türrahmens, wobei er sich auf beiden Seiten festhielt.
Man sollte meinen, dass er nach so vielen Monaten der Arbeit unter diesen Umständen gelernt hätte, mit den damit verbundenen Unannehmlichkeiten zurechtzukommen, aber das war nicht der Fall. Jeder Schritt war kostbar und barg das Potenzial tödlicher Schwierigkeiten.
Naria saß in dem kleinen Zimmer aufrecht auf dem Biobett. Auf der langen Seite ließ sie die Beine herunterbaumeln, wobei ihr das papierdünne Kleid gerade bis zu den Knien reichte. Der Rücken war kerzengerade. Ihre Haltung beeindruckte ihn jedes Mal aufs Neue.
Ihr glattes schwarzes Haar fiel ihr fast bis zu den Hüften herab. Ihre Haut war heute Nachmittag lavendelfarben. Die Farbe deutete neugierige Gelassenheit an. Wenn sie aufgeregt war, zeigten sich schwarze Linien, die sich von ihrem Hals aus über den ganzen Körper erstreckten und sich kaskadenförmig zu Wirbeln zusammenfanden, die auf ein ungeübtes Auge fast wie Kalligrafie wirkten. Wenn sie wütend war, wurde das Lavendel zu einem leuchtenden Lila, das der Commander fürchtete. Trotz des Vertrauens, das sie ihm entgegenbrachte, hatte er nur selten erlebt, dass ihre Haut das zarte Rosa annahm, das uneingeschränkte Ruhe bedeutete.
Das konnte er ihr nicht zum Vorwurf machen.
»Guten Tag, Naria«, begrüßte der Commander sie.
»Hallo, Jefferson.«
Er überprüfte ihre Vitalwerte, die auf der einzelnen Anzeige des Raums dargestellt wurden, die wiederum auf einem kleinen, in die Wand links von ihm eingelassenen Regal stand. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie optimal waren, bat er Naria, sich hinzulegen.
»Das wird doch nicht wehtun, oder?«, fragte sie.
»Nicht mehr als sonst«, antwortete er ehrlich.
Naria kam seiner Bitte nach, und nachdem sie es sich gemütlich gemacht hatte, nickte sie ihm zu.
Der Commander hatte einen stabilen Plastikbehälter dabei, den er wie eine Umhängetasche über der Schulter trug. Er platzierte ihn in der Vertiefung im Regal, die dafür vorgesehen war, öffnete die Versiegelungen und holte ein Hypospray heraus.
Er ging ans Kopfende des Biobetts und lächelte Naria an. Wahrscheinlich konnte sie es durch den klobigen Helm auf seinem Kopf nicht einmal sehen. Er drückte den Injektor des Hyposprays an ihren Oberarm und löste es aus.
Der Effekt trat augenblicklich ein.
Noch bevor der Commander auf seinen medizinischen Trikorder sehen konnte, plärrte auf der Diagnosekonsole der Alarm los. Naria riss die Augen auf und schloss sie dann fest, als könnte sie den Schmerz aussperren, wenn sie die Augen davor verschloss.
Sofort aktivierte er die Gurte des Betts, um sie ruhig zu halten.
Dann lief der Commander zu seinem Behälter zurück, aus dem er ein zweites Hypospray holte. Ihr Herzschlag war bereits gefährlich hoch; ihr Blutdruck deutete auf ein bevorstehendes schweres Gefäßversagen hin. Er sah wieder zu ihr und bemerkte, dass die Haut um den Injektionspunkt herum tiefschwarz geworden war und an Festigkeit zu verlieren begann.
Die nächsten Minuten arbeitete er hektisch daran, den von ihm angerichteten Schaden zu beheben.
WATERFRONT, SAN FRANCISCO
Lieutenant Commander Thomas Eugene Paris war spät dran. Das Waterfront Cafe war gut besucht von Leuten, die zu Mittag essen wollten, viele davon in Uniform. Sein Vertreter für die bevorstehende Schlichtung, Lieutenant Garvin Shaw, hatte ihm eine Nachricht hinterlassen, ihn dort zur Mittagszeit zu treffen. Paris hatte die Mitteilung gesehen, als er mitten in der Nacht in seinem vorläufigen Quartier in San Francisco angekommen war. Die neun Stunden, die seitdem vergangen waren, hatten nicht gereicht, sich an die Zeitverschiebung anzupassen. Die Sonne war bereits aufgegangen, als er endlich in einen unruhigen Schlaf gefallen war. Erst um elf Uhr dreißig hatte es der automatische Weckruf des Computers geschafft, ihn zu wecken.
Paris ließ den Blick über die Kunden schweifen, suchte verzweifelt nach einem menschlichen Mann mit dunklem Haar, bis ihn einer der Kellner des Lokals nach seinem Namen fragte und zu einem kleinen Tisch führte, der sich auf einer Terrasse mit Ausblick auf die Bucht befand.
Als Paris näher kam, stand Shaw auf. »Commander Paris«, begrüßte er ihn und reichte ihm die Hand.
Paris ergriff sie. Der feste Händedruck vermittelte augenblicklich Zuversicht. Hätte Shaw älter als fünfzehn ausgesehen, wäre Paris vielleicht zu dem Schluss gekommen, dass die Juristische Abteilung der Sternenflotte eine gute Wahl getroffen hatte.
»Lieutenant Shaw«, erwiderte Paris. Kommt dein Vater noch, und kann es sein, dass er der Lieutenant Shaw ist, der sich um meinen Fall kümmern soll? Paris nahm auf dem einzigen freien Stuhl Platz und wurde sofort von einem Kellner nach seiner Bestellung gefragt.
»Erst mal nur Wasser.«
»Sie sollten etwas essen«, schlug Shaw vor.
»Das werde ich, sobald ich Appetit habe.«
»Hier macht man unglaubliche Sachen mit Shrimps«, versicherte ihm Shaw, »Sachen, die wahrscheinlich nicht legal sein sollten.«
»Ich hoffe, Ihre rechtlichen Kenntnisse beschränken sich nicht nur auf Schalentiere.«
Shaw lehnte sich zurück und sah Paris aus zusammengekniffenen Augen an. »Gibt es ein Problem, Commander?«
»Wann haben Sie Ihren Abschluss gemacht, Lieutenant?«
»Ich diene seit sechzehn Jahren in der Juristischen Abteilung der Sternenflotte.«
Paris war verblüfft. »Haben Sie Ihr Jura-Studium gleich nach dem Kindergarten angefangen?«
Shaw lachte leise. »Gute Gene. Und ich versuche, nicht zu viel Zeit in der Sonne zu verbringen. Was das angeht, sind meine Pflichten sehr hilfreich.«
»Sind Sie ein Experte im Familienrecht?«
»Ja.«
»Wie oft haben Sie es mit Fällen wie meinem zu tun?«
»Häufiger, als Sie vielleicht glauben, Commander.« Shaw schwieg, beugte sich über den Tisch. »Als die Sternenflotte damit angefangen hat, Familien zu gestatten, auf unseren größeren Schiffen zusammen zu dienen, hat man gehofft, die Sorgerechtsstreitigkeiten zwischen Zivilisten und Offizieren würden zurückgehen.«
»Sind sie nicht?«
»Das Leben auf einem Raumschiff ist schon für diejenigen schwierig, die es freiwillig tun. Für die, auf die das nicht zutrifft, ist es noch schwieriger, selbst wenn sie versuchen, für ihre Kinder so was wie ein normales Leben einzurichten. Die Masse der Sorgerechtsstreitigkeiten nahm zu, genau wie die Scheidungen.«
Paris’ leerer Magen schlug Salti. Er hatte B’Elanna und sich monatelang versucht weiszumachen, dass sie etwas völlig Alltägliches taten. Viele Offiziere hatten Familien, während sie ihren Dienst versahen. Er hatte nie den Gedanken zugelassen, wie viele Familien dieser Dienst zerstört haben mochte.
»Trotzdem hat Ihre Mutter ein hartes Stück Arbeit vor sich«, fuhr Shaw fort. »Beide Elternteile Ihrer Tochter sind gesund und munter und dienen auf demselben Schiff. Auch wenn Ihre Akten nicht blütenweiß sind, haben Sie und Commander Torres einen tadellosen Dienst versehen, seit Sie sich von ihren jeweiligen kriminellen Leben abgewandt und der Voyager angeschlossen haben. Es ist deutlich für mich, dass jede Entscheidung, die Sie seit der Geburt Ihrer Tochter getroffen haben, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, zu ihrem Besten war. Ungeachtet der Opfer, die dies Ihnen und Ihrer Frau abverlangt hat. Mit einer Ausnahme.«
»Mit einer Ausnahme?«
»Commander Torres hat Miral ein paar Wochen nach ihrer Geburt alleine gelassen, um nach Boreth zu gehen.«
»Sie hat Miral bei mir gelassen.« Paris spürte, wie ihm das Blut in die Wangen schoss.
»Berichten zufolge war ihre Mutter, Miral Torres, tot. Die Schlichter werden wissen wollen, warum die Bergung der sterblichen Überreste ihrer Mutter nicht hätte warten können, bis ihre Tochter etwas älter war, oder warum sie das Baby nicht mitgenommen hat.«
»B’Elannas Mutter war nicht tot. Eben weil B’Elanna beschlossen hat, zu diesem Zeitpunkt nach Boreth zu gehen, konnte sie sie noch mal sehen. Es war für beide wichtig. Und haben Sie auch nur die geringste Vorstellung davon, was eine klingonische Prüfung des Geistes alles beinhaltet? Da kann man keine Säuglinge mitnehmen.«
»Als sie diese Entscheidung getroffen hat, wusste Commander Torres nicht, dass ihre Mutter noch am Leben war.«
»Es gab eine Nachricht von ihrer Mutter und eine Karte«, beharrte Paris. »Es bestand durchaus die Möglichkeit …«
»Eine Nachricht und eine Karte, die beide über zwei Jahre alt waren? Für wie wahrscheinlich hätte eine vernünftige Person es gehalten, dass Miral Torres nach zwei Jahren auf Boreth noch am Leben war?«
Darauf fiel Paris keine gute Antwort ein.
»Ihre Mutter wird behaupten, dass sich Ihre Frau von Anfang an nicht für das Kind interessiert hat. Sie hat ihre eigenen Bedürfnisse über die von Miral gestellt.«
»Das ist eine Lüge!«
»Ich habe nie das Gegenteil behauptet. Und wenn Sie schon nicht ertragen können, es aus meinem Mund zu hören, dann haben wir ein Problem.«
Paris atmete tief durch.
Shaws Blick klebte förmlich an seinem. »Übrigens, wenn Sie das nächste Mal das Bedürfnis verspüren, jemanden der Lüge zu bezichtigen, sollten Sie bis zehn zählen und die Worte dann runterschlucken.«
Paris nickte.
»Schon besser.«
»Wir sind noch nicht mal bei den aktuellen Ereignissen, und Sie klingen schon so, als hätte meine Mutter bereits gewonnen.«
»Sie hat nicht mal ansatzweise gewonnen. Sie können verlieren, aber solange Sie das nicht tun, wird sie nicht gewinnen.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Ihre Mutter ist diejenige, die die Anklage vorbringt. Es liegt an ihr, zwei Dinge zu beweisen: dass Sie und Ihre Frau als Eltern ungeeignet sind und dass sie geeignet ist, Miral aufzuziehen.«
»Vom ersten Teil einmal ganz abgesehen«, sagte Paris, »sie hat bereits drei Kinder großgezogen. Meine Schwestern sind beide Spitzenreiter auf ihren jeweiligen Gebieten, und abgesehen von ein paar früheren Rückschlägen bin ich auch ganz gut geraten. Ich glaube nicht, dass es meiner Mutter schwerfallen wird, irgendwem zu beweisen, was für eine gute Mutter sie ist.«
Shaw lächelte leicht. »Indem sie den Fall vor Gericht bringt, gibt sie zu, bei Ihnen versagt zu haben.«
»Ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen. Sie hat bei mir ihr Bestes versucht. Etwas anderes würde ich nie behaupten.« Er schwieg einen Moment und sprach dann weiter: »Ich muss nur mit ihr reden. Das alles liegt nur an schlechtem Timing und ihrer Trauer. Würde mein Vater noch leben, würde sie das nicht tun.«
»Sind Sie sicher?«
Paris nickte. »Sie hält mich nicht für ungeeignet. Sie ist nur wütend, weil ich sie angelogen habe.«
Shaw schwieg lange. Schließlich sagte er: »Ein paar Grundregeln. Sie werden unter gar keinen Umständen außerhalb unserer angesetzten Schlichtungssitzungen mit Ihrer Mutter Verbindung aufnehmen. Sie werden mit niemandem außer mir über sie sprechen. Sie werden nicht mit alten Freunden oder Familienmitgliedern über diesen Fall sprechen, es sei denn, ich weise Sie ausdrücklich dazu an. Und sollte es dazu kommen, werden Sie nur genau das sagen, was ich Ihnen erlaube zu sagen.«
»Ich denke wirklich …«
»Sie werden gar nichts denken, ohne dass Sie zuerst mit mir darüber sprechen.«
»Hören Sie zu …«
»Nein, Sie hören zu«, fiel ihm Shaw ins Wort. »Sie sind hier, weil Sie Ihrer Mutter, Ihrer Familie und Ihren engsten Freunden erzählt haben, dass Ihre Frau und Tochter tot sind, obwohl Sie ganz genau wussten, dass sie leben. Das kommt dabei raus, wenn Sie denken. Sie hätten andere Entscheidungen treffen können, aber so wie es aussieht, ist Ihnen nichts anderes eingefallen. Sie werden nicht mehr denken. Die Entscheidung, ob Sie es besser wissen, liegt nicht länger bei Ihnen. Es sei denn, Sie sind bereit, Miral morgen in die Obhut Ihrer Mutter zu übergeben.«
Paris’ Wangen brannten wieder. Sein Magen war ein einziger nervöser Klumpen, und seine Schultern waren so verspannt, dass sie steinhart waren.
»In Ordnung«, stimmte er schließlich zu.
»Sie werden gewinnen, Tom. Aber es wird schwer, und Sie müssen mir vertrauen.«
»In Ordnung.«
»Erzählen Sie mir mehr über Ihre Mutter.«
Paris wusste nicht, warum er zögerte.
Er dachte an seine Mutter, wie sie alleine in ihrem Bett aufwachte, Frühstück für eine Person zubereitete und den ganzen Tag alleine in dem riesigen Haus zugange war. Er dachte daran, wie sie ihn gehalten hatte, als er noch ein Junge gewesen war, der gerade aus einem Albtraum aufgewacht war. Er dachte an den Stolz in ihrem Blick, als sie ihn nach der Rückkehr der Voyager von ihrem Jungfernflug das erste Mal gesehen hatte.
Er dachte an B’Elanna.
Er dachte an Miral.
Er dachte an seinen ungeborenen Sohn.