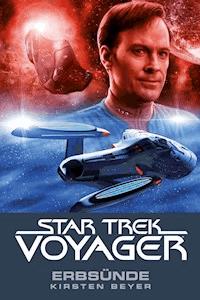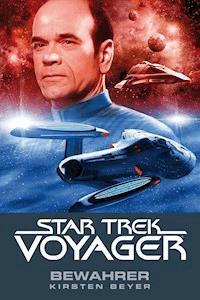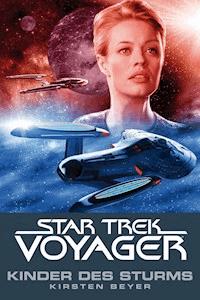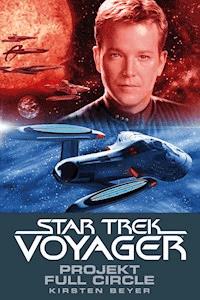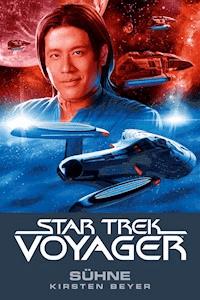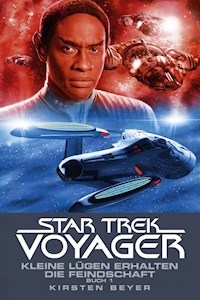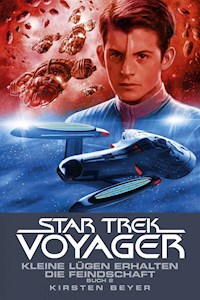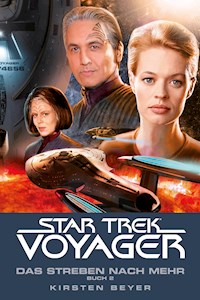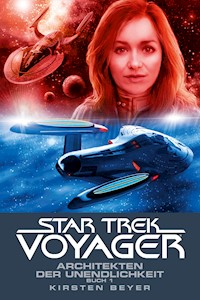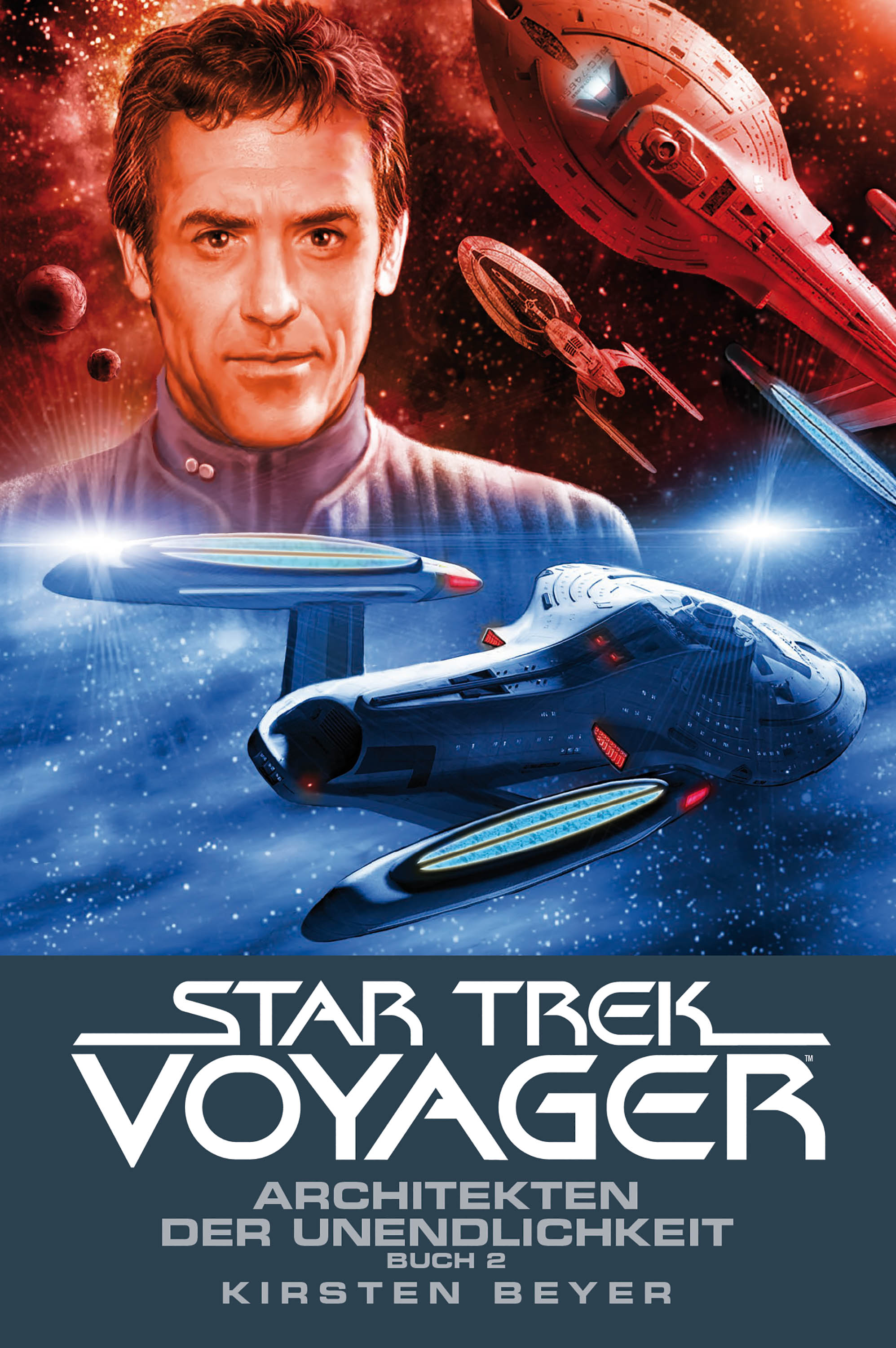Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Star Trek - Voyager
- Sprache: Deutsch
Die Borg, die größte Plage der Menschheit, sind verschwunden. Doch ist das so? Kann diese tödliche Bedrohung, die der Menschheit über Jahrzehnte angehaftet hat, wahrhaftig verschwunden sein? Die Föderation beschließt, dass sie es genau wissen muss und die Sternenflotte erhält den Befehl, es herauszufinden. Das Raumschiff Voyager führt eine Flotte in eine Weltraumregion, die seit Generationen in Furcht vor der plötzlichen Auslöschung lebt: die Heimat der Borg, der Delta-Quadrant. Afsarah Eden, der neue Captain der Voyager, soll Antworten und neue mögliche Verbündete finden sowie alte Feindseligkeiten überwinden. Seit Seven of Nine zurückgelassen wurde, lebt sie ein Schattendasein, sie ist weder Borg noch Mensch. Das Geflüster des Kollektivs, ein beruhigendes Gemurmel, das schon immer dagewesen war, ist durch eine Stimme tief in ihrem innern ersetzt worden, die darauf besteht, dass sie Annika Hansen ist. Verliert sie langsam den Verstand?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STAR TREK
VOYAGER™
UNWÜRDIG
KIRSTEN BEYER
Based onStar Trekcreated by Gene RoddenberryandStar Trek: Voyagercreated by Rick Berman & Michael Piller & Jeri Taylor
Ins Deutsche übertragen vonRené Ulmer
Die deutsche Ausgabe von STAR TREK – VOYAGER: UNWÜRDIG
wird herausgegeben von Amigo Grafik, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg. Herausgeber: Andreas Mergenthaler und Hardy Hellstern, Übersetzung: René Ulmer; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde; Lektorat: Wibke Sawatzki und Gisela Schell; Satz: Rowan Rüster/Amigo Grafik; Cover Artwork: Martin Frei; Print-Ausgabe gedruckt von CPI Morvia Books s.r.o., CZ-69123 Pohorelice. Printed in the Czech Republic.
Titel der Originalausgabe: STAR TREK – VOYAGER: UNWORTHY
German translation copyright © 2015 by Amigo Grafik GbR.
Original English language edition copyright © 2009 by CBS Studios Inc. All rights reserved.
™ & © 2015 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
This book is published by arrangement with Pocket Books, a Division of Simon & Schuster, Inc., pursuant to an exclusive license from CBS Studios Inc.
Print ISBN 978-3-86425-423-9 (März 2015) · E-Book ISBN 978-3-86425-470-3 (März 2015)
WWW.CROSS-CULT.DE · WWW.STARTREKROMANE.DE · WWW.STARTREK.COM
Für Marco Palmieri
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Danksagungen
Romane Bei Cross Cult
»Vollendung ist furchtbar, sie kann keine Kinder haben.«
– Sylvia Plath,
»Die Münchner Mannequins«
1
»Warnung. Quantenphasenintegrität liegt bei sechsundneunzig Komma sieben fünf eins Prozent, fallend.«
»PetaQ!«, krähte Miral fröhlich von dem Sitz aus, der für den Navigator vorgesehen war. Um ihre dreieinhalb Jahre alte Tochter während des Fluges zu schützen, hatte B’Elanna ihn mit einem eigens gefertigten Kindersitz ausgestattet.
»Computer«, sagte sie, und ihre Geduld war bedrohlich nahe daran, zu zerreißen, »berechne erneut die Phasenvarianz und passe die Deflektorkontrolle an.« Sie drehte sich zu Miral um. »Das Wort sagen wir nicht, Schätzchen.«
»Berechnungen abgeschlossen. Modifiziere Deflektortelemetrie«, informierte sie der Computer.
»Computer, berechne die neue Phasenintegrität.«
»PetaQ!«, sagte Miral erneut, dieses Mal mit einem wilderen Tonfall.
»Phasenintegrität liegt bei neunundneunzig Komma neun zwei fünf Prozent.«
»Danke«, antwortete B’Elanna. Früher hätte sie mit einem Schiffscomputer nicht so freundlich gesprochen. Aber da der Computer eine der wenigen erwachsenen Stimmen war, die sie während der letzten vierzehn Monate regelmäßig gehört hatte, betrachtete sie ihn mittlerweile als Freund und Verbündeten.
Sie drehte ihren Sessel, um Miral anzusehen, und sagte strenger: »Miral Paris, was bedeutet es, wenn ich dir sage, dass wir bestimmte Worte nicht benutzen?«
Miral ließ den Kopf hängen und konzentrierte sich auf die Überreste ihres Moosbeeren-Riegels. Möglicherweise hatten es Teile des nachmittäglichen Snacks in ihren Magen geschafft. Andererseits ließen die großen Stücke aus gepressten Körnern, Nüssen und Beeren, die ihre klebrigen Wangen, Finger und den Overall bedeckten, darauf schließen, dass sie in der vergangenen Stunde mehr mit ihrer Mahlzeit gespielt hatte, als sie zu essen.
»Weiß nich«, antwortete Miral schmollend.
»Sieh mich an!«, befahl B’Elanna. Die Jahre, in denen sie das Kommando im Maschinenraum der Voyager geführt hatte, hatten sie darauf vorbereitet, kritische Systemausfälle zu bewältigen, ebenso wie gefährliche Begegnungen mit feindlichen fremden Spezies und Raumanomalien. Während all dieser Zeit war sie jedoch nie gezwungen gewesen, den Ton anzuschlagen, den sie bei Miral am häufigsten benutzte. Andererseits hatten ihre Untergebenen im Maschinenraum sie selten, wenn überhaupt, direkt angelogen.
»Miral Paris, sieh mich an«, forderte sie erneut.
Miral blickte sie flüchtig an, bevor sie sich so viel wie möglich vom Rest des Riegels in den Mund stopfte.
»Miral«, schnappte B’Elanna.
Damit hatte sie endlich die Aufmerksamkeit des Kindes. Toms blaue Augen, so groß wie Untertassen, sahen B’Elanna an, um Vergebung bettelnd. Darunter blähten sich Mirals volle Wangen, während ihre Zähnchen hinter geschlossenen Lippen kauten.
B’Elanna musste sich beherrschen, um nicht zu lächeln. Sie hatte Wochen damit zugebracht, Miral Tischmanieren beizubringen, und so wie es aussah, war das Einzige, was hängen geblieben war, dass man mit geschlossenem Mund kaute.
Zumindest etwas, gestand sich Torres ein. Sie nahm sich fest vor, Miral die Angewohnheit auszutreiben, die Worte zu wiederholen, die B’Elanna selbst in Momenten der Frustration von sich gab und die für ein Kind völlig unangemessen waren. Sie vermutete, dass Miral es nur tat, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Es wäre dennoch unpassend, wenn sie ihren Vater in etwas mehr als zwei Wochen mit »Hallo, petaQ!« begrüßte, nachdem sie ihn über ein Jahr nicht mehr gesehen hatte.
»Doch, du weißt es«, beharrte B’Elanna etwas freundlicher.
»Sind wir bald da?«, fragte Miral und spuckte dabei ein paar Krümel.
»Wechsel nicht das Thema.« B’Elanna durchschaute den kläglichen Versuch ihrer Tochter, sie abzulenken. »Es gibt bestimmte Worte, die Kinder nicht sagen sollten, auch wenn Erwachsene es manchmal tun. Du musst noch viele Worte lernen, und sobald du sie alle gelernt hast, darfst du dir aussuchen, welche du benutzen willst. Bis es so weit ist, liegt diese Entscheidung bei mir. Hast du das verstanden?«
»Tschuldigung.« Miral seufzte, und es war deutlich, dass sie diese Regelung unglaublich ungerecht fand.
»Ich liebe dich, Schätzchen.«
»Lieb dich auch, Mommy«, entgegnete Miral eher aus Gewohnheit. »Mommy, singsu mir das Gutenacht-Sterne-Lied?«
»Willst du nicht warten, bis es Schlafenszeit ist?«
»Nein, du singen. Kula singt schlecht.«
Kula war der holografische Babysitter, den B’Elanna programmiert hatte, damit er sich während des langen Fluges um Miral kümmerte, wenn die Systeme des Shuttles B’Elannas volle Aufmerksamkeit verlangten. Mirals Beschwerde legte nahe, dass sie ein wenig an Kulas Stimmroutinen arbeiten musste.
B’Elanna nickte. »In Ordnung, Schätzchen, du fängst an.«
Stern, Stern, hell in der Nacht,
Es ist Zeit, deine Augen zu schließen.
B’Elanna hatte das Gefühl, ihr Herz würde schmelzen; das kleine Mädchen setzte nun seinen ganzen Charme ein, und ihre Stimme überschlug sich vor Freude.
Stern, Stern, habe keine Furcht,
morgen erwache ich, und du wirst dort sein.
»Warnung«, unterbrach sie die Stimme des Computers.
Stern, Stern …
»Leise, Schätzchen«, sagte B’Elanna hastig.
»Quantenphasenintegrität liegt bei fünfundneunzig Komma neun sechs neun Prozent und fallend.«
Ein unangenehmer Adrenalinschub durchfuhr B’Elanna. Das war das letzte Stück einer Reise, die vor zweieinhalb Jahren ihren Anfang genommen hatte. Eine abtrünnige klingonische Sekte hielt Miral für die Kuvah’magh, die klingonische Erlöserin, und diese Sekte hatte beschlossen, dass die beste Methode, die Katastrophe abzuwenden, die Mirals Geburt ankündigte, war, sie zu töten. Seitdem hatten B’Elanna und ihr Ehemann Tom ihr persönliches Glück geopfert, um ihre einzige Tochter zu schützen. In etwas mehr als zwei Wochen sollten sie endlich wieder mit Tom vereint sein.
Umso erstaunlicher war, dass dieses langersehnte Wiedersehen im Delta-Quadranten stattfinden würde. B’Elanna hatte geglaubt, nie wieder dorthin zurückzukehren, nachdem es der Besatzung der Voyager nach sieben langen Jahren gelungen war, wieder nach Hause zu gelangen. Aber erst vor ein paar Tagen hatte sie von Tom die Koordinaten des Treffpunkts erhalten. Sie bestätigten, dass die Sternenflotte die Voyager erneut in den Delta-Quadranten schickte. Tom diente auf dem Schiff als Erster Offizier.
Tatsächlich gefiel B’Elanna der Gedanke nicht, den Rest ihres gemeinsamen Lebens in einem der unangenehmsten Gebiete des bekannten Weltraums, die sie jemals gesehen hatte, zu verbringen. Allerdings traten ihre wohlbegründeten Ängste in den Hintergrund, da sie einsah, dass der Delta-Quadrant so weit wie nur irgend möglich von den Kriegern von Gre’thor – der abtrünnigen klingonischen Sekte – entfernt war.
B’Elanna befürchtete, dass sie dem Quanten-Slipstream-Antrieb gut würde zureden müssen, um die fünfundvierzigtausend Lichtjahre weite Reise zu bewältigen. Das Shuttle mit der offiziellen Bezeichnung Unregistriertes Schiff 47658, das sie persönlich Home Free getauft hatte und das seit etwas mehr als einem Jahr Mirals und ihr Zuhause war, war ein technologisches Wunderwerk. Zusätzlich zum Slipstream-Antrieb verfügte es über den Prototyp einer Benamit-Rekristallisierungsmatrix, über eine Kommunikationsanlage, die die größerer Schiffe in den Schatten stellte, über von Borg-Systemen inspirierte und weit über die Norm verbesserte Navigations- und Sensorsysteme und über das kleinstmögliche Holodeck für Miral.
Bisher hatte B’Elanna den Slipstream-Antrieb nur für kurze Sprünge benutzt, von denen keiner länger als dreißig Sekunden gedauert hatte. Die Reise in den Delta-Quadranten würde etwas mehr als zwei Stunden dauern. Da sie stets damit rechnete, dass der schlimmste Fall tatsächlich eintrat, hatte B’Elanna ihren Kurs so kalkuliert, dass sie auf dem Flug zahlreiche Zwischenstopps für Korrekturen einlegen konnte.
Während der letzten beiden Stunden hatte sie immer wieder die Meldung erhalten, dass der Slipstream-Korridor zusammenbrach. Diese Ankündigungen kamen derart regelmäßig – ungefähr alle fünfzehn Minuten – dass sie sich mittlerweile daran gewöhnt hatte. Aber seit der letzten Warnung waren erst ein paar Minuten vergangen, und das deutete darauf hin, dass es ernsthafte Probleme gab.
»Kula«, rief B’Elanna und aktivierte damit den holografischen Babysitter, einen ergrauten alten klingonischen Krieger, dessen Aussehen auf einem verstorbenen, guten Freund basierte. Als das Hologramm erschien, deutete B’Elanna mit dem Kopf auf Miral und ging dann in der Hauptkabine die paar Stufen in die Triebwerkssektion des Shuttles hinunter.
Sie erkannte, dass die Werte der Deflektorkontrollen – eine der Hauptkomponenten des Slipstream-Antriebs – weit über den maximalen Toleranzgrenzen lagen.
»Verdammter …« Sie beherrschte sich gerade noch rechtzeitig und schluckte den Rest des Satzes herunter. Miral musste heute nicht noch mehr neue Worte lernen.
B’Elanna rekonfigurierte die Einstellungen manuell und ging dabei so geduldig wie möglich vor, selbst nachdem die Phasenintegrität erbarmungslos unter neunzig Prozent gefallen war. Ungefähr bei fünfundachtzig Prozent, plus minus null Komma zwei Prozent, würde sich der Slipstream-Korridor völlig destabilisieren, und beim Austritt würde das Shuttle höchstwahrscheinlich zerfetzt werden.
»Computer, wie lange, bis wir die Zielkoordinaten erreichen?«
»Fünfundzwanzig Sekunden«, antwortete der Computer teilnahmslos.
Das würden die längsten fünfundzwanzig Sekunden ihres Lebens werden.
»Warnung«, meldete der Computer erneut.
»Alle Warnungsdurchsagen stumm schalten«, befahl B’Elanna. An ihrer Kontrollstation konnte sie alles sehen, was sie wissen musste, ohne dass der Computer sie noch zusätzlich nervös machte.
Sie berechnete die Phasenvarianz des Korridors neu mithilfe eines selbst entwickelten Programms, das aus ein paar von Seven of Nine inspirierten Borg-Algorithmen bestand. Als sie damals diese Varianzen nicht hatte kompensieren können, war die Voyager gezwungen gewesen, die Slipstream-Technologie aufzugeben. Da ihr Shuttle kleiner und weitaus einfacher zu stabilisieren war, funktionierte ihr Programm darin bisher. Aber nun schien es seine Grenzen erreicht zu haben.
Noch zehn Sekunden, und der Slipstream-Antrieb würde sich automatisch abschalten.
Halte einfach durch, bat B’Elanna und sah zu, wie sich die Anzeige der Phasen-Integrität langsam der Siebenundachtzig-Prozent-Marke näherte.
Sie hielt den Atem an, während das hohe Winseln des Antriebs tiefer wurde – dann sprangen sämtliche Anzeigen auf ihrer Konsole in den roten Bereich, als der Slipstream-Korridor in sich zusammenfiel und das Shuttle an den richtigen Koordinaten ausspuckte. Um B’Elanna herum ertönte eine Reihe von erschütternden Explosionen, als einige wichtige Systeme gleichzeitig überlastet wurden. Aus dem Augenwinkel erkannte sie ein Protokoll zur Energieumleitung, das Kula aufgerufen hatte; ohne Zweifel, um ein Kraftfeld zu Mirals Schutz zu aktivieren.
B’Elanna saß inmitten von durchgeschmorten Konsolen, explodierten Plasmaleitungen, die noch immer protestierend Funken sprühten, und hatte einen bitteren metallischen Geruch in der Nase. Einiges von dem, was sie benötigte, hätte sie replizieren können, wenn nicht auch der Replikator durchgebrannt wäre. Sie sah sich in der Situation, die seit der Planung dieser Reise immer ihr schlimmster Albtraum gewesen war. Die Reparaturen würden Tage dauern, und sie waren nur in einem gut ausgestatteten Raumhafen möglich.
Bis zu Toms Ankunft würde die Home Free antriebslos im Raum treiben. Aber die Voyager könnte sich verspäten, und das Shuttle hatte nur noch wenige Nahrungs- und Wasservorräte an Bord.
Was ich brauche, ist ein Freund, dachte B’Elanna missmutig. Der Ernst ihrer Lage drohte sie zu überfordern, bis sie sich daran erinnerte, dass sie tatsächlich einen Freund hatte, der gar nicht so weit entfernt war.
Ich frage mich, ob er mich so sehr vermisst hat wie ich ihn, überlegte B’Elanna, während sie sich hastig daranmachte, die Kommunikationsanlage wieder betriebsbereit zu machen.
»Seven? Seven, wo bist du?«
Chakotays Herz pochte immer noch wie wild, nachdem er die Tür zu Sevens Wohnung in San Francisco aufgebrochen hatte, da sie nicht auf sein beharrliches Klopfen reagiert hatte. Er durchsuchte hektisch das Erdgeschoss, dann überlegte er, was in den sechs Stunden passiert sein könnte, seit er sie das letzte Mal gesehen hatte.
Den Großteil des vorherigen Abends hatten sie mit einem langen Besuch im Hospiz verbracht, in dem Sevens geliebte Tante Irene untergebracht worden war. Auch wenn sich Seven anfangs gegen diesen Schritt gewehrt hatte, war es Chakotay gelungen, sie davon zu überzeugen, dass es sowohl notwendig als auch das Beste für Irene war. In den letzten achtzehn Monaten hatte sich Seven selbst um Irene gekümmert, während das Irumodische Syndrom Irenes Verstand immer heftiger zusetzte. Jedoch war Seven nicht länger in der Lage, ihre Tante weiterhin zu pflegen. Darüber hinaus waren die Ärzte der Ansicht, dass Irenes Leiden in den nächsten Tagen ein Ende finden würde.
Als sich Seven und Chakotay nach dem Besuch getrennt hatten, hatte sie darauf bestanden, dass sie müde genug war, um schlafen zu können, und er hatte ihr geglaubt. Dennoch hielt er es für unwahrscheinlich, dass sie zu tief schlief, um sein Klopfen an der Haustür zu hören. Panik beschleunigte seine Atmung und seine Schritte, als er die Treppe in den ersten Stock hinaufeilte, um seine Suche dort fortzusetzen. Die ganze Zeit rief er weiter: »Seven? Seven, wo bist du?«
Er fand sie schließlich in einer dunklen Ecke ihres Schlafzimmers, die Knie mit beiden Händen umklammert, die tiefblauen Augen geöffnet, aber leer.
»Seven«, sagte er besorgt.
Sie regte sich kein bisschen, blinzelte aber träge, was, wie er hoffte, eine Reaktion darstellte.
Chakotay zog schnell den nächsten Vorhang auf, um sie besser sehen zu können. Ihre blasse Haut war noch eine Nuance fahler als sonst, und ihre Stirn, Wangen und Hände waren feuchtkalt. Ihr langes blondes Haar war lose auf dem Kopf aufgetürmt, und einige Strähnen klebten ihr unordentlich im Nacken. Sie trug eine schwarze Hose und ein eng anliegendes, rotes Tanktop. Die Jacke, die verknittert am Fußende ihres Bettes lag, hätte das lässige Outfit vervollständigt. Chakotay gestattete sich erst, sich zu entspannen, nachdem er ihre Atmung und ihren Puls überprüft und festgestellt hatte, dass sie langsam, aber kräftig und regelmäßig waren.
Er hatte befürchtet, dass so etwas passieren würde. Seven hatte in den letzten Monaten so viel durchgemacht. Die meisten wären schon viel früher daran zerbrochen. Vorsichtig hob er sie auf, legte sie sanft ins Bett und sah sich im Zimmer um, um herausfinden, was sie dazu veranlasst haben könnte, sich in sich selbst zurückzuziehen.
Seven war als Annika Hansen geboren worden, ein menschliches Mädchen, das im Alter von acht Jahren von den Borg assimiliert worden war. Jahre später hatte sie von den Borg den Auftrag erhalten, mit ihren neuen »Verbündeten« an Bord der Voyager zusammenzuarbeiten. Letztendlich hatte diese Zusammenarbeit ihren Zweck erfüllt, aber um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten, hatten Chakotay und Captain Kathryn Janeway beschlossen, Seven vom Rest des Kollektivs zu trennen. Zu Beginn hatte sich Seven nachdrücklich gegen diese Entscheidung aufgelehnt. Aber mit der Zeit hatte sie die wiedergewonnene Individualität zu schätzen gelernt, die ihr die Borg genommen hatten, und war zu einem wichtigen Mitglied der Besatzung der Voyager geworden.
Das Schiff hatte es geschafft, die Reise aus dem Delta- in den Alpha-Quadranten in erstaunlich kurzer Zeit zu bewerkstelligen. Bei ihrer Ankunft auf der Erde war Seven anfänglich von allen als Kuriosität betrachtet worden, mit Ausnahme von Tante Irene. Sie hatte ihre lange für tot gehaltene Nichte mit offenen Armen empfangen. Mit der Zeit hatte auch die Sternenflotte Sevens Brillanz zu schätzen gelernt, sie über die Jahre immer wieder um Rat gebeten und sie an der Akademie unterrichten lassen. Am wertvollsten war ihr Wissen vor ein paar Monaten gewesen, als die Borg eine Invasion des Alpha-Quadranten begonnen hatten mit dem Ziel, die Föderation zu vernichten. Seven hatte der Präsidentin beigestanden und sie während des gesamten Konflikts beraten. Die Caeliar, eine mächtige und xenophobe Spezies, die der Föderation bislang unbekannt gewesen war, hatten die Feindseligkeiten beendet, indem sie die Borg von Mitgliedern des Kollektivs zu Mitgliedern der Caeliar-Gestalt transformiert hatten.
Die Transformation hatte Milliarden von Borg befreit und Seven von dem gelöst, was sie noch zur Borg gemacht hatte – synthetische Implantate, die viele ihrer lebenswichtigen biologischen Systeme kontrolliert hatten. Körperlich war sie noch genauso stark wie zuvor. Geistig jedoch war sie nun zwischen ihren eigenen Gedanken und einer Stimme hin- und hergerissen, die permanent wiederholte: »Du bist Annika Hansen.«
Seven hatte sich monatelang wacker gegen diese Stimme zur Wehr gesetzt. Aber nach einigen traumatischen Erlebnissen in letzter Zeit war ihr diese Kontrolle entglitten: der immer schlimmer werdende Zustand ihrer Tante und der Tod ihrer früheren Besatzungskameradin und guten Freundin B’Elanna Torres und deren kleiner Tochter Miral Paris. Seven war überzeugt gewesen, die Stimme unter Kontrolle halten zu können, bis ihr bewusst geworden war, dass sie bald auf sich alleine gestellt sein würde. Alle ihre anderen Freunde begaben sich an Bord der Voyager auf eine neue gefährliche Mission in den Delta-Quadranten.
Als Chakotay erfahren hatte, welchen Problemen Seven alleine gegenüberstand, hatte er erkannt, dass er ihr zur Seite stehen musste. Sie hatten einen Plan ausgearbeitet, und ihre Abreise von der Erde sollte in ein paar Tagen stattfinden.
In den letzten Stunden musste irgendetwas Sevens unglaubliche Widerstandskraft gebrochen haben. Außer einem unberührten Glas mit Nahrungsergänzungsmitteln stand nichts auf ihrem Schreibtisch. Was, verdammt noch mal, ist passiert?, fragte sich Chakotay, den langsam Panik überkam. Als er zu Sevens Computer sah, fiel ihm auf, dass ihr Nachrichtensystem geöffnet war und die jüngste Nachricht vom Hospiz gekommen war. Mit zitternden Händen aktivierte er die Wiedergabe, und eine von Irenes Pflegerinnen erschien auf dem Bildschirm.
»Es tut mir sehr leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, Professor Hansen, aber Irene ist verstorben. Ich war mir sicher, dass Sie es so schnell wie möglich erfahren wollten. Wir behalten ihre Überreste in Stase. Wir wissen, wie wichtig es Ihnen ist, sich zu verabschieden.«
Verzweiflung und Wut überkamen Chakotay. Er hatte Irene gemocht und sich gefreut, wie bereitwillig sie Seven in ihr Leben aufgenommen hatte. Sie war eine intelligente und warmherzige Frau gewesen, und Seven hatte schnell eine Beziehung zu ihr aufbauen können. Irene war die erste wirkliche Familie gewesen, die Seven jemals gehabt hatte. Irenes Krankheit hatte einen großen Teil zu Sevens derzeitigem Zustand beigetragen, und die Pflegerin, die sie wegen der traurigen Nachricht kontaktiert hatte, hatte nicht wissen können, welchen Schaden sie damit anrichten würde. Dennoch verspürte Chakotay den irrationalen Drang, die Dame zu erwürgen.
Er setzte sich auf Sevens Bettkante, nahm ihre klammen Hände in seine.
»Seven, du musst mir zuhören. Ich weiß, dass es schwer ist, aber wir wussten beide, dass dieser Tag kommen würde. Irene würde dich nicht so sehen wollen. Sie hat dich geliebt und wollte immer nur dein Bestes. Als du zurückkamst, hast du viel Freude in ihr Leben gebracht, und wie du dich in ihren letzten Lebensjahren um sie gekümmert hast, war ihr größter Trost. Komm, wir gehen und verabschieden uns zusammen von ihr. Wir bleiben, solange du möchtest. Aber du musst dich jetzt zusammenreißen. Seven? Seven, kannst du mich hören?«
Ihr langes Schweigen nahm er als Zeichen, dass sie ihn nicht hören konnte. Rasch eilte er zum Computer und schickte zwei dringende Nachrichten ab.
Jetzt blieb ihm nur noch, abzuwarten.
Du bist Annika.
Seven stand auf einem offenen Platz in einer überwältigenden Stadt. Breite Gehwege teilten den Marmorboden auf verschiedenen Ebenen gleichmäßig. Der riesige Platz war von hohen, aus Stahl und Glas bestehenden Gebäuden umgeben, und der Himmel leuchtete sanft bernsteinfarben. Vor ihr lag ein flaches, lang gestrecktes Becken, gefüllt mit spiegelndem, dunklem Wasser. Um dieses Becken standen seltsame Statuen und gepflegte, zu absurden Formen geschnittene Bäume. Die Stadt wirkte völlig verlassen, und die unheimliche Stille vermittelte den Eindruck, dass sie nicht die geschäftige Metropole war, die die Gebäude andeuteten.
Sie näherte sich dem Becken und betrachtete ihr Spiegelbild.
Du bist Annika, wiederholte die Stimme.
Seven weigerte sich, eine erneute Diskussion mit dem Eindringling in ihrem Verstand zu beginnen. Er musste mittlerweile wissen, wie ihre Meinung zu dem Thema lautete.
Du bist Annika.
»Ich bin Seven of Nine«, murmelte sie automatisch.
Auf einmal erzitterte das Wasser. Seven trat vorsichtig zurück, als eine kleine Gestalt daraus auftauchte. Sie war sowohl vertraut als auch völlig fremd.
Auf dem Wasser stand ein junges Mädchen mit langem, blondem Haar. Das Gesicht war unverkennbar menschlich, aber die Arme reichten dem Mädchen fast bis an die Knie, und es hatte große, breite Füße, die nur zwei Zehen sowie einen klauenartigen Auswuchs aufwiesen. Es war in durchscheinenden, lavendelfarbenen Stoff gewickelt, der ihm bis zu den Knöcheln reichte.
»Warum wehrst du dich?«, fragte das Mädchen.
»Wer bist du?«, entgegnete Seven und befürchtete, dass sie die Antwort bereits kannte.
»Ich bin Annika/Du bist Annika«, antworteten das Mädchen und die Stimme synchron.
»Ich bin Seven of Nine«, schrie Seven trotzig.
Ein trauriges, aber auch bösartiges Lächeln breitete sich auf dem Gesicht des Mädchens aus. »Nicht mehr«, versicherte es.
Auf einmal konnte sich Seven nicht mehr bewegen. Ihre Haut begann zu jucken und schien enger zu werden und sich zu verfestigen. Mit einem Keuchen hinderte sie den Schrei, der seinen Ursprung in ihrem Innersten hatte, daran, aus ihrer Kehle zu dringen.
Annika kicherte.
Hilfe, bat Seven von Grauen ergriffen.
Aber selbst wenn ihr Flehen hörbar gewesen wäre, es war niemand mehr da, der es hätte hören können.
Auf ein leises Klopfen hin ließ Chakotay Seven allein und eilte die Treppe hinab. Er öffnete die Eingangstür, hinter der ein selbstsicherer junger Kadett stand.
»Icheb.« Chakotay lächelte erleichtert, bevor er ihn freundschaftlich umarmte. »Danke, dass du so schnell gekommen bist.«
Icheb erwiderte die Geste etwas zurückhaltender, bevor er sich von Chakotay löste, um zu fragen: »Wo ist Seven?«
»Oben.«
Besorgnis zuckte über das Gesicht des jungen Mannes. »Irgendetwas stimmt nicht, oder?«
Chakotay hob eine Hand, um weiteren Fragen zuvorzukommen. »Warum setzen wir uns nicht, und ich erkläre dir alles.«
Icheb hob das Kinn und legte den Kopf ein wenig schief, als fände er die Bitte beunruhigend. Es erinnerte Chakotay an die Tage, als Icheb, wie Seven, hauptsächlich Borg gewesen war.
Dann folgte ihm Icheb ins Wohnzimmer und setzte sich mit im Schoß gefalteten Händen auf die Sofakante.
»Bevor ich anfange, muss ich dich etwas fragen«, sagte Chakotay zögernd.
Icheb nickte leicht, und Chakotay sprach weiter.
»Wie ist es dir in den vergangenen Monaten ergangen?«
»Sehr gut, danke der Nachfrage«, antwortete Icheb automatisch.
»Bist du sicher?«
»Ziemlich.«
Da der junge Mann tatsächlich gesund wirkte, wollte Chakotay nicht noch weiter nachhaken, auch wenn es in Anbetracht von Sevens Zustand schwer nachzuvollziehen war.
Bevor er fortfuhr, schluckte Chakotay schwer. Ein tief verwurzeltes Pflichtgefühl machte es ihm schwer, das Vertrauen, das die Sternenflotte einst in ihn gesetzt hatte, aufs Spiel zu setzen, genauso wie Ichebs Zukunft innerhalb dieser Organisation, die ihm so wichtig geworden war. Unglücklicherweise hing vielleicht Sevens Leben davon ab.
»Wie du sicherlich weißt, sind die Borg vor einigen Monaten in den Föderationsraum eingedrungen und wurden nur durch das Eingreifen einer Spezies besiegt, die man Caeliar nennt.«
»Ich habe von ihnen gehört, Captain«, antwortete Icheb, »obwohl ich über keinerlei Informationen über ihre Handlungen während dieses Kampfes verfüge. Derzeit ist es Kadetten strikt untersagt, Nachforschungen über die Caeliar anzustellen. Wie Sie sich vorstellen können, sind viele von uns neugierig.«
»Selbstverständlich sind Sie das. Und momentan reicht ›Chakotay‹ völlig. Ich habe vor ein paar Tagen meinen Abschied eingereicht.«
»Warum?«, fragte Icheb abwehrend, als würde er Chakotays Entscheidung persönlich nehmen.
»Ich kann nicht der Sternenflotte dienen und gleichzeitig Seven helfen. Und im Moment braucht sie mich mehr als die Sternenflotte.«
Icheb holte Luft, um eine weitere Frage zu stellen, aber Chakotay ließ ihn nicht zu Wort kommen
»Was ich dir nun mitteile, sind vertrauliche Informationen und ich vertraue darauf, dass du sie entsprechend behandelst.«
Offensichtlich wurde Icheb die Tragweite dieser Worte bewusst, denn seine Wangen röteten sich und er nickte zustimmend. Von der Besatzung der Voyager, die ihn vor den Borg gerettet hatte, hatte er gelernt, die Sternenflotte zu lieben und zu bewundern. Es stand jedoch außer Frage, wem seine Loyalität stets vor allen anderen gehören würde.
»Wir wissen nicht viel über die Caeliar«, fuhr Chakotay fort. »Aber wir wissen, dass sie die Borg nicht besiegt, sondern assimiliert haben.«
Icheb erblasste. In Gegenwart ehemaliger Borg konnte man das Wort ›assimiliert‹ nicht einfach so dahinsagen.
Chakotay sprach weiter: »Soweit ich von Seven erfahren habe, erschufen die Caeliar die Borg vor Jahrtausenden unabsichtlich. Darum haben die Caeliar auf dem Höhepunkt der Invasion diese verlorenen Seelen in ihre Gestalt aufgenommen. Die Borg wurden zu Caeliar transformiert, und Sevens Beschreibung zufolge war diese Transformation angsteinflößend, aber letztendlich wunderbar.«
Aufgebracht erhob sich Icheb.
»Aber ich habe seitdem einige Male mit Seven gesprochen. Wurde sie …?«, begann er.
»Nein«, versicherte ihm Chakotay, ohne ihn die naheliegende Frage zu Ende stellen zu lassen. »Seven wurde transformiert. Ihre Borg-Implantate haben sich aufgelöst. Und obwohl sie für kurze Zeit Teil der Caeliar-Gestalt war, wurde sie letztendlich von der Verbindung getrennt. Soweit wir das beurteilen können, ist sie nun völlig menschlich.«
»Wie ist das möglich?«, wollte Icheb wissen. »Seven könnte ohne ihre Implantate oder den Regenerationsprozess nicht überleben. Sie können nicht einfach verschwinden. Etwas muss sie ersetzt haben.«
»Das glaube ich auch.« Chakotay nickte »Die Caeliar bestehen aus Catomen – künstlich erschaffenen Teilchen, die darauf programmiert werden können, jede Form anzunehmen. Ich glaube, dass ihre Implantate durch Catome ersetzt wurden.«
»Ist das etwas Gutes?«, fragte Icheb besorgt.
»Körperlich ist sie in Ordnung. Das Medizinische Korps der Sternenflotte und der Doktor haben das bestätigt. Aber seit der Transformation hört Seven eine Stimme in ihrem Kopf, die darauf besteht, dass sie Annika Hansen ist.«
»Aber sie ist Annika Hansen, auch wenn mir bewusst ist, dass sie diese Bezeichnung nicht mag.«
»Annika wurde mit acht assimiliert. Seven hat fast überhaupt keine Erinnerungen an ihre Kindheit, und die wenigen, die sie hat, sind auch noch schmerzhaft. Sie hat sich selbst immer als Seven of Nine betrachtet. Sie ist als Borg aufgewachsen und erwachsen geworden und weigert sich nun, dieser Stimme nachzugeben, die anscheinend darauf besteht, dass sie alles ablegen muss, was sie als Borg geworden ist. Schließlich hat sie versucht, sich anzupassen, in der Hoffnung, die Stimme damit loszuwerden. Aber in den letzten Wochen hat Seven eine Reihe traumatischer Ereignisse durchgemacht: die Einweisung ihrer Tante in ein Krankenhaus, den Verlust von B’Elanna und Miral und den Abflug des Großteils ihrer ehemaligen Kameraden an Bord der Voyager-Flotte. Seitdem fiel es Seven immer schwerer, mit der Stimme fertigzuwerden.«
»Seven verliert ihren Kampf, nicht wahr?«, fragte Icheb.
»Das befürchte ich auch. Aber ich glaube, dass wir ihr zusammen helfen können.«
»Wie?«
»Bevor wir über das Wie sprechen, muss ich etwas wissen«, kündigte Chakotay an. »Auch du warst einmal Borg. Hast du so etwas, wie Seven es beschreibt, selbst erlebt?«
»Nein«, antwortete Icheb, ohne zu zögern. »Aber wie Sie sich sicher erinnern, wurde ich kurz nach der Rückkehr der Voyager zur Erde zusammen mit Seven und dem Doktor inhaftiert und erhielt einige Tage lang keine Gelegenheit zur Regeneration. Meine Brunali-Physiologie hat sich in dieser Zeit völlig wiederhergestellt, und seitdem habe ich nicht nur die Fähigkeit verloren, meine verbliebenen Implantate zu nutzen, sondern auch meine Abhängigkeit von ihnen. Mittlerweile wurden sie entfernt.«
»Gut«, sagte Chakotay erleichtert.
»Aber wie …?«, begann Icheb, bevor ihn ein weiteres Klopfen an der Tür zum Schweigen brachte.
»Warte einen Moment.« Chakotay stand auf, um an die Tür zu gehen.
Wie erwartet stand dort eine alte Freundin, Sveta. Sie hatte kühle, scharf geschnittene Züge, und ihre Mähne dünnen, weißen Haares hing ihr in einem eng geflochtenen Zopf den Rücken hinab und reichte ihr bis fast an die Hüfte. Obwohl sie selbst Chakotay vor zehn Jahren für den Maquis rekrutiert hatte, sah sie keinen Tag älter aus.
»Danke, dass du gekommen bist«, begrüßte er sie aufrichtig.
»Du sagtest, es wäre dringend«, antwortete sie argwöhnisch.
»Das ist es auch. Bitte komm rein.«
Sveta sah ihm durchdringend in die Augen. Er konnte ihre Bedenken verstehen. Während ihrer letzten Begegnung hatte er seinen eigenen dunklen Kampf ausgefochten, und sie hatte ihn harsch zurechtgewiesen, weil er sich derart in seiner Verzweiflung gesuhlt hatte. Sie waren nicht als Freunde auseinandergegangen, aber jetzt war nicht der Zeitpunkt, zu versuchen, die Kluft zwischen ihnen zu überbrücken.
Glücklicherweise schien Sveta sofort zu bemerken, wie dringend es ihm war, und dass er Herr über sich selbst und die derzeitige Situation war. »Es ist schön zu sehen, dass du zurück bist.« Sie lächelte, als sie über die Schwelle trat.
»Es ist schön, zurück zu sein«, stimmte er zu.
2
Der Doktor würde niemals biologische Nachkommen zeugen können. Er war ein Hologramm, darum war Fortpflanzung unmöglich. Dennoch war er der Meinung, dass der tiefe Stolz, den er empfand, während er an Bord der U.S.S. Galen stand, dem Gefühl nahe kam, den frischgebackene Eltern empfanden. Sie war ein experimentelles medizinisches Schiff, das er zusammen mit seinem Schöpfer Doktor Lewis Zimmerman und mit beträchtlicher Hilfe ihres langjährigen Freundes, Lieutenant Reginald Barclay, entworfen hatte.
Die erste Krankenstation, auf der er jemals gearbeitet hatte – auf der Voyager – war auf Effizienz ausgelegt gewesen, aber auch ein wenig zu zweckmäßig. Selbst wenn jemand, der den Empfangsraum der Galen betrat, wohl kaum als Erstes die Inneneinrichtung bewundern würde, war sich der Doktor sicher, dass die weichen Brauntöne und das subtile Grün einladend wirkten. Wichtiger als diese oberflächlichen Veränderungen waren die gestalterischen Merkmale, auf die er bestanden hatte, damit sie den Raum angenehmer und nützlicher machten, sowohl für den Arzt als auch den Patienten.
Sein persönliches Büro befand sich nahe dem Eingang, damit er sehen konnte, wenn jemand eintrat, selbst wenn der Computer nicht darauf programmiert war, ihn über die Ankunft neuer Patienten zu unterrichten. Die Krankenstation bestand aus drei Notfall-Biobetten und einer Reihe von abgeschiedenen Untersuchungsräumen, die seine Patienten bestimmt zu würdigen wissen würden. Operationssäle, die Intensivstation und Aufwachräume lagen direkt neben der Hauptkrankenstation. Ein Deck tiefer gab es zwei größere Anlagen dieser Art, die im Fall einer flottenweiten Katastrophe aktiviert werden konnten. Der Doktor hoffte, dass dieser Notfall nie eintreten würde, auch wenn ihn seine Jahre in der Sternenflotte gelehrt hatten, dass solche Hoffnungen meist unrealistisch optimistisch waren.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!