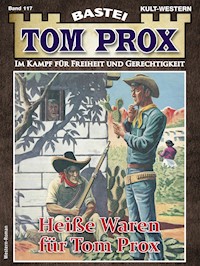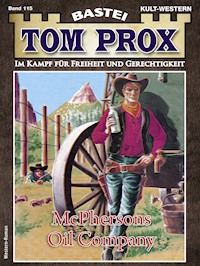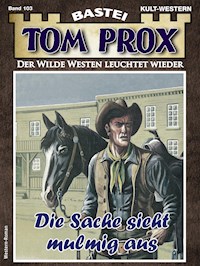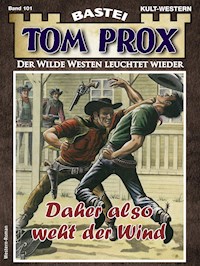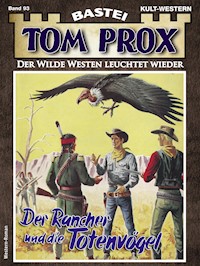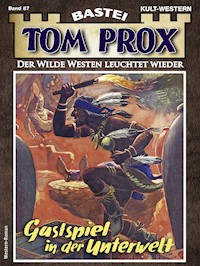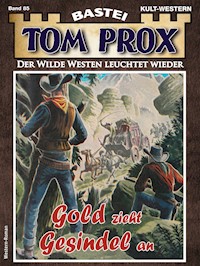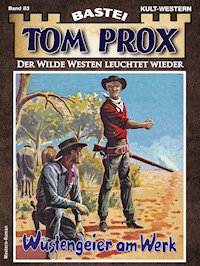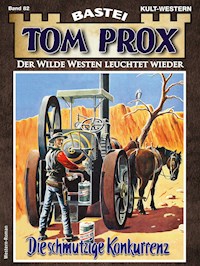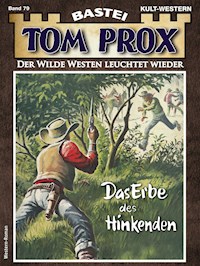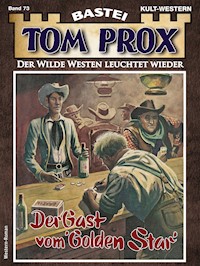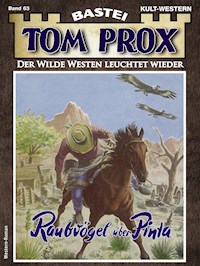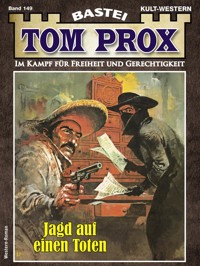
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Tom Prox
- Sprache: Deutsch
Mag Snuffy Patterson bisher auch geglaubt haben, alles längst erlebt zu haben, so lehrt die Suche nach einem vermeintlich Toten den Sergeanten der Ghost Squad nun, dass es immer noch schlimmer kommen kann.
Patterson ist auf dem Orinoco unterwegs, wo ihm der südamerikanische Tropenwald so zusetzt, wie es selbst die Fieberhölle der Florida-Sümpfe nicht vermochte. Aber auch für Captain Tom Prox und Sergeant Ben Closter läuft es alles andere als rund. Zwar ist ihnen der strapaziöse Ausflug nach Venezuela erspart geblieben, dafür aber werden in Santa Fe, gleichsam unter den Augen der beiden Ghosts, gleich zwei brutale Morde begangen. Ausgerechnet von den Opfern hatten sich die Specials wichtige Auskünfte erhofft über die Einbrüche in einige der renommiertesten Museen der Staaten. Besteht vielleicht ein Zusammenhang zum Raub des "Stern des Amazonas", einem wertvollen Smaragd, der dem Kunsthändler Stan Morris gestohlen wurde? Und was, zum Teufel, hat eigentlich der unauffindbare Tote im Urwald mit all diesen Vorkommnissen zu tun ...?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Jagd auf einen Toten
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Vorschau
Impressum
Jagd auf einen Toten
Von Frederic Art
Mag Snuffy Patterson bisher auch geglaubt haben, alles längst erlebt zu haben, so lehrt die Suche nach einem vermeintlich Toten den Sergeanten der Ghost Squad nun, dass es immer noch schlimmer kommen kann.
Patterson ist auf dem Orinoco unterwegs, wo ihm der südamerikanische Tropenwald so zusetzt, wie es selbst die Fieberhölle der Florida-Sümpfe nicht vermochte.
Aber auch für Captain Tom Prox und Sergeant Ben Closter läuft es alles andere als rund. Zwar ist ihnen der strapaziöse Ausflug nach Venezuela erspart geblieben, dafür aber werden in Santa Fe, gleichsam unter den Augen der beiden Ghosts, gleich zwei brutale Morde begangen. Ausgerechnet von den Opfern hatten sich die Specials wichtige Auskünfte erhofft über die Einbrüche in einige der renommiertesten Museen der Staaten.
Besteht vielleicht ein Zusammenhang zum Raub des »Stern des Amazonas«, einem wertvollen Smaragd, der dem Kunsthändler Stan Morris gestohlen wurde? Und was, zum Teufel, hat eigentlich der unauffindbare Tote im Urwald mit all diesen Vorkommnissen zu tun ...?
1. Kapitel
Stan Morris war als Kunsthändler weit über die Grenzen Neu-Mexikos hinaus bekannt. Er besaß ein hübsches Vermögen, das ihm erlaubte, nach seinen persönlichen Wünschen zu leben. Der 56-Jährige war von sehr aufgeschwemmter Gestalt, hatte eine spiegelblanke Glatze, graue, scharfe Augen und eine herrische, fast überhebliche Art, mit anderen Menschen umzugehen, deren Bankkonto kleiner war als sein eigenes. Morris war zwar überall bekannt, aber wenig beliebt, trotz seiner weitreichenden Verbindungen bis in die erste Gesellschaft Neu-Mexikos hinauf.
Ein Missgeschick hatte ihn in wilde Erregung versetzt, und so saß er nun vor dem mit Akten überladenen Schreibtisch Tom Prox gegenüber. Der Ghostchef musste seine ganze Liebenswürdigkeit aufbieten, seinen aufgeregten Besucher zu beruhigen.
»Das ist eine Katastrophe«, brüllte Morris aufgebracht. »Ich habe der örtlichen Polizei einen Wink gegeben, dass der ›Stern vom Amazonas‹ im Tresor meines Hauses ruht und eine Sonderwache verlangt. Aber glauben Sie etwa, man habe mir auch nur einen einzigen Beamten geschickt? Niemand hat sich um mich gekümmert. Ich möchte wirklich wissen, wofür unsereins seine Steuern bezahlt.«
»Ich denke, Sie sind versichert, Mr. Morris«, warf Tom beschwichtigend ein.
»Natürlich bin ich versichert, aber was nutzt mir das Geld?«, blaffte Morris. »Der ,Stern des Amazonas' hat sechshundertzweiunddreißig Karat. Er ist der zweitgrößte Smaragd, der je gefunden wurde. Dreißigtausend Dollar habe ich damals für ihn bezahlt, und hundertzwanzigtausend ist er heute wert!«
»Die Special Police wird sich um Ihren Fall kümmern, Mr. Morris. Wir werden alles unternehmen, um Ihnen den Smaragd zurückzubringen. Aber Sie dürfen auch nichts Unmögliches von uns verlangen. Wer wusste, dass Sie den Smaragd in Ihrem Tresor aufbewahrten?«
»Niemand! Vor sechs Tagen habe ich ihn aus der Bank geholt. Ich hatte einen ausländischen Gast in meinem Haus, dem ich den Stein zeigen wollte.«
»Haben Sie einen Verdacht, Mr. Morris?«
Morris schüttelte den massigen Schädel. »Nein, ich kann Ihnen keinerlei Hinweise geben. Sehen Sie sich meinen Safe selbst an! Einfach aufgeschlitzt wie eine Sardinenbüchse!«
»Und was fehlt noch?«
»Das ist es ja gerade, nichts! Nur der ,Stern des Amazonas'.«
»Sind Sie Sammler?«
»Ein wenig schon.« Der Kunsthändler grinste verlegen. »Man muss schließlich irgendwie sein Geld anlegen. Smaragde und Rubine behalten stets ihren Wert. Sie sind verdammt teuer und nehmen vor allem keinen Platz weg.«
»Gut, will mir den Tresor einmal ansehen, Mr. Morris, mehr kann ich im Augenblick nicht für Sie tun.«
»Was? Mehr nicht? Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, he? Ich gebe Ihnen vierundzwanzig Stunden Zeit; dann muss der Stein auf meinem Schreibtisch liegen! Wie Sie das anstellen, ist mir egal. Aber man kennt das ja schon. Da wird in der Öffentlichkeit mit der Special Police ein richtiger Kult getrieben, und wenn man die Männer braucht, versagen sie auf der ganzen Linie.« Morris redete sich nun in Rage.
»Haben Sie etwa Ellis Berrys Verschwinden schon aufgeklärt? Gar nichts haben Sie erreicht. Ich habe Sie auf den Fall aufmerksam gemacht, und ich teile Ihnen jetzt mit, was bei mir im Hause geschehen ist. Machen Sie, was Sie wollen! Ich werde mich auf jeden Fall beim Gouverneur beschweren.«
Tom Prox hatte Mühe, ernst zu bleiben. Der Mann gefiel ihm gar nicht. Die ganzen vergangenen Tage hatte Morris fortlaufend der Strippe gehangen und seine Beschwerden über sie ausgegossen, dass die Untersuchung wegen des Verschwindens von Ellis Berry nicht vom Fleck kam und dass er der Meinung sei, die ganze Special Police müsse aufgelöst werden.
»Wie lange sind Sie schon im Besitz dieses Smaragds?«, wollte Tom Prox noch wissen.
»Seit zehn Monaten, Captain.«
»Und wer hat ihn Ihnen verkauft?«
»Mr. Berry selbstverständlich. Er war mein Freund, nicht nur mein Agent.«
»Und wo hatte Mr. Berry den Stein her? Fand er ihn selbst?«
»Ich möchte wissen, warum Sie sich dafür so interessieren, Captain. Ich habe Berry niemals danach gefragt. Für mich war nur die Tatsache interessant, dass der Smaragd existierte und Berry dreißigtausend Dollar dafür zahlen musste. Das war ein Preis unter Freunden.«
»Einen solchen Wertgegenstand deponiert man nicht im eigenen Tresor, Mr. Morris«, stellte Tom Prox mit leidenschaftsloser Stimme fest. »Einen solchen Stein überlässt man der sicheren Obhut einer Bank. Sie hätten wissen müssen, dass Ihr Safe nicht gerade der geeignete Ort dafür war.« Dann wandte sich der Captain an seinen Sergeanten Ben Closter.
»Ben, du übernimmst hier die Wache am Telefon, ich werde zu Mr. Morris hinausfahren. Ruf Dr. Scipp an und frage ihn, was der Bericht über Wood macht! Ich will ihn bis spätestens heute Abend bei mir auf dem Schreibtisch sehen.«
»Okay, Chef, wird besorgt. Das Beste ist, ich gehe gleich mal selbst rüber zum Doc.«
»Dann kannst du auch bei Leutnant Taylor vorsprechen und versuchen, herauszubekommen, wo Gil Bacon wohnt. Jetzt müssen wir uns an den halten.«
»Wood? Bruce Wood? Was haben Sie denn mit dem zu schaffen, Captain?«, rief Stan Morris erschrocken. »Woher kennen Sie ihn?«
»Mr. Wood ist ein spezieller Freund von mir.«
»Seltsame Freundschaften pflegen Sie, Captain«, knurrte der Kunsthändler.
Tom hob leicht die linke Augenbraue. »So? Und wie meinen Sie das, wenn ich fragen darf?«
»Nun, das ist Ihre eigene Sache, geht mich nichts an. Aber wenn Sie Mr. Wood sehen, sagen Sie ihm, dass er sich zur Hölle scheren soll.«
»Das wird sich kaum machen lassen, Mr. Morris«, erklärte Captain Prox ruhig. »Bruce Wood ist tot. Er wurde in der vergangenen Nacht im Gängeviertel von Santa Fe ermordet. Direkt vor unseren Augen.«
»Das ist das Erste, was ich höre. Da kann man wieder sehen, was die Special Police wert ist. Unter ihren Augen! Und Sie wollen der berühmte und berüchtigte Captain Prox sein? Vielleicht machen Sie sich langsam mit dem Gedanken vertraut, ins Zivilleben überzuwechseln.«
Stan Morris wuchtete sich keuchend aus dem Stuhl, griff nach seinen Schweinslederhandschuhen, stülpte sich den hellgrauen Hut auf und schlurfte zornbebend aus dem Office. Die Tür fiel hinter ihm so heftig ins Schloss, dass die matte Milchglasscheibe noch eine ganze Weile zitterte.
»Ein angenehmer Zeitgenosse«, sagte Ben Closter. »Warum nur immer die falschen Menschen so viel Geld besitzen!«
Tom Prox nahm seinen Hut vom Haken, warf sich den leichten Mantel über den linken Unterarm. Er war die vergangenen Tage an den Schreibtisch gefesselt gewesen, um nach allen Seiten seine Fühler auszustrecken, aber so sorgfältig er auch jeden Schritt berechnete, sie waren nicht vorangekommen.
Die Mörder Bruce Woods waren wie von der Bildfläche verschwunden. Eine sofort angesetzte umfassende Razzia hatte keinen Erfolg gebracht. Die Unterwelt von Santa Fe hielt zusammen wie Pech und Schwefel. Das wenigstens schien darauf hinzudeuten, dass sie auf eine heiße Fährte geraten waren, an deren Ende einer der Großen der Unterwelt stehen musste.
Noch bevor er den Raum verlassen konnte, erklangen auf dem Gang eilige Schritte. Dann wurde die Glastür aufgerissen, und Leutnant Taylor stürmte herein.
»Wir haben ihn, Captain. Was sagen Sie nun?«
»Wen haben Sie?«
»Gil Bacon, den Polizeispitzel!«
»Donnerwetter, eine saubere Arbeit! Herein mit ihm!«
»Nun, soweit ist es noch nicht«, schränkte Taylor ein. »Jedenfalls haben wir seine Anschrift, die richtige Anschrift. Denn die, die er uns genannt hatte, stimmt nicht. Das Haus ist vor drei Jahren abgerissen worden, wegen Baufälligkeit ...«
»Ich bewundere die Umsicht der städtischen Polizei.« Der Ghostchef lächelte.
»Wenn ich einen Spitzel beschäftigen würde, wüsste ich todsicher, wo ich ihn jederzeit erreichen kann. Aber bei Ihnen scheint man sich nicht einmal die Mühe gemacht zu haben, nachzuprüfen, ob die Anschrift überhaupt stimmt.«
»Das war auch nicht notwendig, Captain«, erwiderte Leutnant Taylor. »Bacon tauchte regelmäßig bei uns auf, und so wichtig war er für uns auch nicht, dass wir einen besonderen Kurierdienst zu ihm unterhalten mussten.«
»Wie lautet die Anschrift?«
»Albemarle Road zwölf.«
»Wo ist das?«
»Nicht weit von hier. Vielleicht zwei Meilen. Soll ich Ihnen einen Wagen besorgen?«
»Nicht notwendig, Leutnant. Ich denke, Sergeant Closter wird froh sein, sich endlich mal die Füße vertreten zu können. Los, Ben, ich muss diesen Bacon sofort sprechen. Wenn er nicht in seiner Bude ist, dann warte dort, bis er auftaucht.«
»Die Albemarle Road ist keine sehr feine Gegend, Captain«, fiel Leutnant Taylor ein, »Vielleicht sollte Sergeant Closter einen zweiten Beamten mitnehmen. Nur so zum Schutz, meine ich.«
»Keine unnötigen Aufregungen, Leutnant. Ist zwar riesig nett von Ihnen, aber überflüssig. Erklären Sie Sergeant Closter, wo die Albemarle Road liegt. Ich werde mich inzwischen zu Mr. Morris begeben. Hat er übrigens den Einbruch der Ortspolizei gemeldet?«
»Drei unserer Beamten sind augenblicklich bei ihm«, erklärte Taylor. »Warum, war er vielleicht schon hier?«
»Vor drei Minuten hätten Sie ihn hier begrüßen können. Er war noch aufgeregter als sonst. Es ist wirklich höchst seltsam. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen vermögenden Mann getroffen, der gesunde Nerven besaß.«
Tom war inzwischen in den Gang getreten und verschwand um die Ecke.
Ben Closter zog sich seine Jacke an, ließ die Trommel seines kurzläufigen Polizeicolts aus der Lagerung schnellen und prüfte die Munition. Dann drückte er die Trommel in den Rahmen zurück, steckte die Waffe zurück und nickte Leutnant Taylor zu.
»Ich mache mich auf den Weg, Leutnant.«
»Und Sie wollen keinen Wagen, Sergeant?«
»Kommt nicht infrage. Ich habe seit Tagen schon keinen Gaul mehr zwischen den Schenkeln gehabt. Das einzige Mittel gegen Fettsucht ist Bewegung. Ich will nur hoffen, dass die Albemarle Road nicht weiter als eine Meile von hier entfernt ist.«
»Für zwanzig Gramm würde ich bei Ihnen gutsagen.« Taylor grinste. »Zu Fuß erreichen Sie sie in zwanzig Minuten.«
Ben Closter setzte seinen Hut auf und marschierte dicht an dem Leutnant vorbei. Als er das Gebäude verlassen hatte, fiel ihm ein, dass er vergessen hatte, sich nach der genauen Richtung zur Albemarle Road zu erkundigen. So hielt er, als er ein Stück die Straße hinabgegangen war, an dem Zeitungsstand eines Schwarzen an und fragte. Mit der benötigten Information und einem Exemplar der New York Times setzte er seinen Weg dann fort.
Wer ihn so die Straße herabkommen sah, wäre wohl niemals auf den Gedanken gekommen, es mit jemand anderem zu tun zu haben als mit einem kleinen, dicken und geschäftstüchtigen Kaufmann, der sich eines ansehnlichen Bankkontos erfreute, einer reichen Kinderschar und einer energischen Ehefrau.
Der Vorteil an seiner runden Erscheinung war die Tatsache, dass ihn kein Mensch für einen Geheimbeamten hielt. Seine unmögliche Figur war seine beste Maske, das konnten alle die Verbrecher bezeugen, die er in seiner beruflichen Tätigkeit bisher zur Strecke gebracht hatte.
Nun, die Albemarle Road war wirklich keine sehr vornehme Gegend. Sie war nicht ganz so schlecht wie die Slums von Santa Fe, in denen Bruce Wood erschossen worden war; aber auch sie war nur dürftig und von ärmlicher Eleganz.
Die Häuser standen eng beieinander. Sie waren hoch, dunkel und unfreundlich. In ihren Erdgeschossen waren kleine Läden eingerichtet, deren Erzeugnisse ziemlich wahllos hinter den verschmutzten Fensterscheiben aufgebaut waren.
Nummer zwölf war ein Mietshaus aus der Jahrhundertwende. Vier Stockwerke hoch, mit einem winkligen Hinterhof und einem Seitengebäude. Der Laden im Erdgeschoss, den ein Friseur gemietet hatte, war ebenso schäbig wie das ganze Haus. Im Allgemeinen waren die Friseure auf der ganzen Welt gleich. Wenn Ben es geschickt anstellte, würde es ihm wohl gelingen, schon jetzt etwas über Gil Bacon zu erfahren.
Jede Kleinigkeit konnte ihm unter Umständen von Nutzen sein. Wenn Bacon wirklich ein Polizeispitzel war, ein Mann, der in den Verbrecherkreisen ein und aus ging und den die Gier nach einigen leicht verdienten Dollars zum Spitzel gemacht hatte, so würde er ein zurückgezogenes Leben führen.
»Rasieren, Mann! Aber mit einem scharfen Messer!«, forderte der Sergeant.
»Sofort, wird gleich besorgt, Mister«, dienerte der Friseur heftig. In der Männerabteilung war Ben Closter der einzige Kunde.
Wohlig stöhnend ließ er sich in den bequemen, mit Leder bezogenen Sessel nieder, um gleich darauf nach hinten überzukippen, als der Friseur auf das Pedal am Sitz trat.
»War Gil schon hier?«, begann Ben harmlos das Gespräch in der Annahme, dass ein Mann wie Bacon sich nicht mit Selbstrasieren aufhielt, wo er es doch bequem haben konnte.
»Nein, Mister, ich habe ihn noch nicht gesehen, und ich bin seit acht Uhr im Laden. Es ist heute mächtig still. Die Hitze ist fürchterlich. Was sagen Sie zum Wetter?«
»Na, das ist kein Wetter mehr, das ist eine Zumutung«, stellte Ben fest.
»Na, wem sagen Sie das, Mister«, stöhnte der Friseur, als er Sergeant Closter ein heißes Handtuch auf die linke Backe klatschte.
»Ich habe gestern den ganzen Abend auf Gil gewartet, aber der krumme Hund hat uns hängen lassen.« Der Sergeant hatte sich schnell eine Geschichte einfallen lassen, um jedes Misstrauen im Keim zu ersticken.
»Wollten eine Runde Poker spielen. Ist kein Verlass mehr auf ihn. Früher, da konnte man seine Uhr nach ihm stellen. Möchte wissen, was mit dem los ist.«
»Scheint ihm nicht gerade rosig zu gehen«, gab der Friseur zu bedenken, als er nun das Messer am Lederriemen abzog.
»Davon habe ich noch nichts gemerkt.«
»Früher war immer Betrieb bei ihm auf der Bude. Gil war stets ein verflucht lockerer Vogel. Es verging kaum eine Nacht, in der er nicht ein halbes Dutzend Besucher hatte. Und vor fünf, sechs Uhr morgens machten sie nie Schluss. Nein, alles, was recht ist, Gil Bacon hat es schlimm getrieben. Ich will ja nichts gegen ihn sagen, zumal er ein Kunde von mir ist. Aber wohnen Sie mal unter einem, der ein halbes Nachtlokal aus seinem Quartier macht. Da geht auch Ihnen eines Tages der Hut hoch.«
»Ganz der Alte.« Ben Closter grinste. »Aber warum hat er nun mit diesem Leben Schluss gemacht?«
»Da fragen Sie mich zu viel. Wenn Sie ein Freund von ihm sind, sollten Sie es eigentlich besser wissen als ich. Aber so sind nun mal die Menschen. Kaum hat einer eine Pleite erlebt und hält sich ein wenig zurück, da kommen auch schon seine Kumpels von allen Seiten an, um zu jammern, dass die herrlichen Zeiten, wo sie noch umsonst saufen und Rabatz machen konnten, vorbei sind. Ist keine halbe Stunde her, da hat auch Jimmy nach ihm gefragt.«
»Jimmy? Kenne ich nicht.«
»Na, Jimmy Jeffra, wissen Sie nicht? Der ist doch auch ein alter Freund von ihm.«
Ben schloss die Augen und versuchte, das Gehörte zu überdenken. Der Name Jeffra sagte ihm nichts. Immerhin war es interessant zu erfahren, dass er nicht der Einzige war, der ein besonderes Interesse an Bacon bekundete. Vielleicht war das nur Zufall, doch Ben beschloss, nach diesem Jeffra ein wenig die Augen offenzuhalten.
Kurz darauf warf Sergeant Closter einen Vierteldollar auf die Ladentheke und verließ den Raum, worauf hinter ihm klingelnd die Tür ins Schloss fiel. Viel hatte er zwar nicht erfahren, aber doch eine kleine Neuigkeit.
Auf der Straße zündete er sich eine Zigarette an und blies den Rauch in die Luft. Dabei beobachtete er eine Weile die Menschen auf der Albemarle Road.
Schließlich drehte er um und marschierte pfeifend an der Hausfront entlang, um gleich darauf durch das breite Eingangstor das Gebäude zu betreten.
Der Hausflur war dunkel, und es roch nach billigem Essen. An der Wand hing eine große Tafel, auf der sämtliche Mieter verzeichnet waren. Der Name Gil Bacons war auch dabei. Der Mann wohnte im vierten Stockwerk des Vorderhauses.
Kein Namensschild hing an der Wohnungstür. Ben Closter legte das Ohr gegen den Türrahmen und versuchte zu lauschen. Vielleicht hatte Bacon ja Besuch? Aber es blieb alles still. Dann drückte Ben auf den Klingelknopf. Schrill schepperte die Glocke im Flur. Er bückte sich und versuchte durch das Schlüsselloch zu sehen, aber zu erkennen war nichts.
Ein paar Minuten wartete Ben Closter. Dann probierte er es ein zweites Mal. Wieder ohne Erfolg. Gil Bacon war ausgeflogen, und der Teufel mochte wissen, wann er zurückkehren würde. Wahrscheinlich saß er irgendwo im verräucherten Hinterzimmer einer Kneipe und soff.
Prüfend betrachtete Ben das Türschloss. Es konnte kein großes Kunststück sein, es mithilfe eines gebogenen Stück Drahts zu öffnen. Zwar ließ sich ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung nicht mit seinen Dienstvorschriften in Einklang bringen, aber es gab Situationen, in denen man eben darüber hinwegsehen musste. Schließlich ging es hier um einen Mord.
»Na, dann wollen wir mal«, murmelte er vor sich hin, während er den Türknopf in die Hand nahm und ihn mechanisch nach rechts drehte.
Er stieß einen leichten Pfiff aus. Lautlos öffnete sich die unverschlossene Wohnungstür.
Auf Zehenspitzen schlich Ben den kurzen Gang hinab, bis er an eine angelehnte Tür kam. Er hielt inne und wartete. Langsam griff er mit der rechten Hand unter die Jacke und zog den Colt hervor.
Plötzlich zuckte er leicht zusammen. Hinter der kaum handbreit geöffneten Zimmertür vernahm er ein Geräusch. Es klang, als sei eine gefaltete Zeitung zu Boden gefallen. Verflucht, sollte Bacon doch zu Hause sein?
Ben holte tief Luft und spannte seine Muskeln an. Dann streckte er vorsichtig die linke Hand aus und warf die Tür auf.
»Hallo, Mr. Bacon! Dachte, ich sehe mal herein, wo schon die Wohnungstür ...«
Bevor er jedoch ganz in den Raum getreten war, erhielt er von rückwärts plötzlich einen fürchterlichen Schlag, dass er mit einem kurzen Aufschrei vornüber der Länge nach auf den Teppich fiel. Er versuchte noch, die Faust hochzureißen, um abzudrücken, aber es ging so schnell, dass die Waffe polternd zu Boden fiel und ihn eine fürchterliche Dunkelheit umfing.
Wie lange er so dagelegen hatte, konnte er nicht feststellen. Es mochten Sekunden gewesen sein oder auch Minuten; als er die Augen aufschlug, merkte er, dass er allein war. Von einem Gegner war nichts zu sehen. Ruhig blieb er auf dem Teppich liegen. Nur seine Augen wanderten umher. Es musste das Wohnzimmer Bacons sein.
»Hölle«, fluchte Ben leise vor sich hin, »da hat sich doch einer hier zu schaffen gemacht. Das sieht mir sehr nach einem Einbruch aus. Alle Schränke und Schubladen wurden durchwühlt, der ganze Kram ist auf dem Fußboden verstreut.«
Leise stöhnend, richtete er sich auf. Es gehörte wirklich nicht viel Fantasie dazu, um festzustellen, dass Bacons Wohnung von einem Einbrecher heimgesucht worden war. Dabei war wohl kaum anzunehmen, dass Bacon besondere Vermögenswerte in seiner Wohnung versteckt hielt. Was also konnte ein Einbrecher hier gesucht haben?