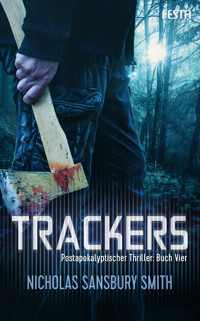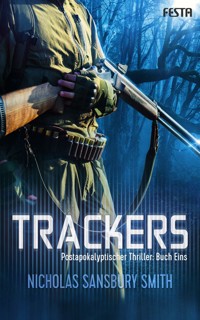4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die tödliche Jagd geht weiter... Die Vereinigten Staaten wurden durch mehrere Atombomben aus Nordkorea nahezu zerstört. Wie weit werden die Überlebenden gehen, um die zu retten, die sie lieben? In einer Zeit, in der die Bedrohung noch nie so real war, schildert die Trackers-Serie, welche Auswirkungen ein EMP-Angriff haben könnte. Explosive, harte Action, geradezu aus den Schlagzeilen gerissen. Steve Konkoly: »Nicholas Sansbury Smith zündet das postapokalyptische Genre mit Trackers neu.« Matthew Mather: »Eine actiongeladene Story über die EMP-Apokalypse, voller brutaler Kämpfe und großartigen Figuren.« Dr. Arthur Bradley: »Ein nuklearer EMP-Schlag ist nach wie vor eine der am wenigsten verstandenen, aber verheerendsten Bedrohungen für die industrialisierte Welt.« Tom Abrahams: »Man dachte schon, das postapokalyptische Genre hätte seine Unterhaltungskraft verloren, und da erscheint Trackers. Eine wunderbare Mischung aus militärischer SciFi, Polit-Verschwörung und Dystopie.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Aus dem Englischen von Christian Jentzsch
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The Hunted (Trackers #2)
erschien 2017 im Verlag CreateSpace Independent Publishing.
Copyright © 2017 by Nicholas Sansbury Smith
Copyright © dieser Ausgabe 2019 by Festa Verlag, Leipzig
Lektorat: Katrin Holle
Titelbild: Arndt Drechsler
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-744-8
www.Festa-Verlag.de
Für meinen Vater, unermüdlich in seinem Streben nach einer besseren Welt und seinem Kampf für sie.
Die Menschheit hat das Netz des Lebens nicht gesponnen. Wir sind nur ein Faden darin. Was wir dem Netz antun, das tun wir uns selbst an. Alle Dinge sind miteinander verbunden. Alles ist vernetzt.
Chief Seattle, 1854
PROLOG
Dr. Martha Kohler taumelte irgendwo südlich im Rocky-Mountain-Nationalpark in einem aus Müllsäcken selbst gebastelten Strahlenschutzanzug den Highway 7 entlang. Eine Skibrille und ein Halstuch schützten ihr Gesicht, doch ihr war nur allzu bewusst, dass dies nicht reichen würde, um sie vor der Strahlung zu schützen, die vom Himmel nieselte.
Vor drei Nächten hatte die atomare Explosion die umliegenden Wälder in Brand gesetzt und sie selbst beinahe erblinden lassen. Überall boten sich Bilder einer Apokalypse. Im Nordosten schwankten geschwärzte Nadelbäume im Wind und verbreiteten den Geruch von verbrannten Piniennadeln. Im Südwesten stand ein Wald in Flammen, die aufsteigende schwarze Rauchwolke verhüllte die Sonne.
Als ihr Wagen auf der Straße den Geist aufgegeben hatte, war sie aufgeschmissen. Die Soldaten der Nationalgarde hatten ihr geraten, an Ort und Stelle zu bleiben und auf Hilfe zu warten. Nach zwei Tagen hatte sie beschlossen, etwas zu unternehmen. Warten war gleichbedeutend damit zu sterben. Die Flucht gab ihr zumindest eine Chance, Hilfe zu erreichen, bevor es zu spät war.
Martha hatte Herzrhythmusstörungen, seit sie ihren Wagen verlassen hatte. Als Ärztin wusste sie, was radioaktive Strahlung mit dem menschlichen Körper anstellte. Sie hatte getan, was sie konnte, um das radioaktive Material von ihrer Haut fernzuhalten, aber es ließ sich nicht vermeiden, es einzuatmen. Ein fadenscheiniges Baumwollhalstuch war kein Ersatz für einen ABC-Schutzanzug.
Das tiefe Rasseln eines Hustens begann in ihrer Kehle. Das Geräusch schien durch die stille, nachmittägliche Landschaft zu hallen. Sie sehnte sich nach einem Schluck Wasser und leckte sich die aufgesprungenen Lippen. Ein Bach schlängelte sich auf der linken Seite die Straße entlang, doch das Wasser zu trinken käme einem Todesurteil gleich.
Sie schleppte sich dahin auf der Suche nach Nahrung oder Menschen, die ihr helfen konnten. Seit drei Stunden hatte sie niemanden mehr zu Gesicht bekommen. Zuvor war ein Mann vor ihr geflohen und hatte dabei irgendwelchen Unsinn über eine Invasion von Aliens gebrüllt. Delirium war ein weiteres Anzeichen für die Strahlenkrankheit. Bis jetzt schien Marthas Verstand noch in Ordnung zu sein – doch wenn er es nicht war, würde sie das überhaupt registrieren?
In den letzten Tagen hatte sie reichlich Tote auf der Straße gesehen. Einem weiteren Opfer näherte sie sich jetzt, einem älteren Mann, der auf dem Rücken lag und die Hände verdreht hatte wie eine Gottesanbeterin. Neben ihm lag ein zweiter Leichnam, bei dem die Leichenstarre bereits eingesetzt hatte. Die grauhaarige Frau war ihm zugewandt und hatte sich wie ein Embryo zusammengekrümmt. Sie hatten sich zum Sterben nebeneinandergelegt.
Wenigstens waren sie zusammen, dachte Martha. Ihr Mann war schon vor zehn Jahren an Herzversagen gestorben. Reue und Bedauern stiegen in ihr auf. Diese Gefühle brachen immer gern aus ihr heraus, wenn es einen Schicksalsschlag zu verkraften gab, und meistens ging es dabei um Dinge, die sie in ihrer Ehe gesagt oder nicht gesagt und getan oder nicht getan hatte.
Sie seufzte und setzte ihren Weg fort, obwohl sie buchstäblich Sterne sah. Die Anstrengung des Marsches forderte ihren Tribut und sie hatte erst den halben Weg nach Denver geschafft. Die Soldaten hatten zu dieser Richtung geraten, um der Strahlung aus dem Weg zu gehen, aber die Leichen verrieten ihr, dass sie sich immer noch mitten in der Todeszone befand.
Sie erreichte einen Minivan und stützte sich dagegen, um sich kurz auszuruhen. Neben dem Heulen des Windes hörte sie ein leises Kratzgeräusch, als versuchte sich jemand zu räuspern. In dem Van bewegte sich etwas. Martha warf einen Blick durch das Rückfenster. Zwei kleine Gestalten saßen eng beieinander auf dem Rücksitz, halb unter einer Plane verborgen. Auf dem Fahrersitz war jemand über dem Lenkrad zusammengebrochen und den blassen, mit Blasen übersäten nackten Armen nach zu urteilen, waren die beiden Kinder vermutlich Waisen.
Bisher hatte sie sehr darauf geachtet, anderen Leuten auf der Straße aus dem Weg zu gehen. Falls jemand herausfand, dass sie Jodtabletten besaß, die sie in ihrer Arzttasche aufbewahrte, würde man sie ihr gewiss abnehmen und ihr dabei vielleicht sogar etwas antun. Aber diese Kinder würden niemandem etwas antun und sie konnte sie nicht einfach hier zurück- und sterben lassen.
Sie sah sich den weiteren Verlauf der Straße genauer an. Ein Stück weiter, direkt unter einer Brücke, bewegte sich etwas. In ihrem Schutz saßen mehrere Menschengruppen, doch die Bewegung stammte von loser Kleidung, die im Wind flatterte. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass in dieser Richtung noch etwas oder jemand am Leben war. Zufrieden mit dem Ergebnis öffnete sie die Tür des Vans. Die beiden Kinder schreckten vor ihr zurück. Ihre braunen Locken waren ein zerzauster Urwald.
»Tun Sie uns nichts«, schniefte der Junge.
Martha zog ihr Halstuch herunter und schob die Brille hoch, sodass die Kinder ihr Gesicht sehen konnten. Sie konnte nur vermuten, wie beängstigend sie in den Müllsäcken aussah, die den größten Teil ihres Körpers bedeckten. In den Augen eines Kindes sah sie wahrscheinlich wie ein Alien aus.
Sie bemühte sich um den gleichen ruhigen Tonfall, den sie als Kinderärztin ihren Patienten gegenüber anschlug. »Ich will euch nichts tun. Ich bin hier, um zu helfen.«
»Können Sie unserem Papa helfen?«, fragte das Mädchen.
»Euer Vater schläft«, log Martha. Sie löste einen Streifen Klebeband von ihrer Taille, griff in den entstandenen Spalt und zog das Fläschchen mit Jodtabletten aus der Tasche.
»Ich bin Doktor Martha Kohler und werde euch helfen, dass ihr euch wieder besser fühlt, okay?« Sie starrten sie nur an.
»Wie heißt ihr zwei?«, fragte Martha.
Das Mädchen fing an zu schluchzen, die Tränen liefen ihm über die gerötete Haut. Der Junge kratzte sich an einer wunden Stelle auf der Wange.
Martha schraubte den Deckel ab und schüttelte zwei Tabletten auf die Innenseite ihres Handschuhs. Ihre trockenen, aufgesprungenen Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. »Ich möchte, dass ihr die nehmt. Okay? Danach fühlt ihr euch besser.«
»Papa hat gesagt, wir sollen keine Süßigkeiten von Fremden annehmen«, wandte der Junge ein. Er rieb sich die blutunterlaufenen Augen und blinzelte sie dann an, als würde er in die Sonne schauen.
»Ich bin Ärztin und das hier sind keine Süßigkeiten«, erwiderte Martha. »Haben euch eure Eltern denn nicht beigebracht, dass man darauf hören muss, was Ärzte sagen?«
Das Mädchen zog die Nase hoch und wischte mit dem Ärmel darüber, während der Junge zögernd nickte.
»Es ist okay, ich verspreche es«, fuhr Martha fort, indem sie ihnen die Tabletten hinhielt. »Die bewirken, dass ihr euch besser fühlt.«
»Haben Sie Wasser?«, fragte das Mädchen. »Ich hab solchen Durst.«
Martha schüttelte den Kopf. Es war offensichtlich, dass diese Kinder der Strahlung bereits eine gewisse Zeit ausgesetzt waren. Die Tabletten halfen, die Aufnahme von radioaktivem Jod über die Schilddrüse zu verhindern, aber sie konnten nicht rückgängig machen, was bereits geschehen – und aufgenommen worden – war. Sie brauchten Wasser und Schutz vor der Strahlung. Vielleicht konnte sie die Plane zerschneiden und sie darin einwickeln, auch wenn es keine ideale Lösung wäre.
Zuerst einmal musste sie die Kinder dazu bringen, ihr zu vertrauen. Sie lehnte sich in den Wagen und zauberte ein warmes Lächeln auf ihre Lippen.
»Wie wär’s mit einem Spiel?«, schlug sie vor. »Wollt ihr etwas spielen?«
Der Junge neigte den Kopf zur Seite und seine blauen Augen strahlten ein wenig heller.
»Würde ich gern«, gestand das Mädchen.
»Nein, Emma. Papa hat gesagt, wir sollen hierbleiben, bis Hilfe kommt.«
»Ich bin die Hilfe, die dein Vater gemeint hat. Also, ich weiß jetzt, dass du Emma heißt. Und wie heißt du?« Martha sah den Jungen fragend an.
»Micah«, antwortete er schüchtern. Sein Blick huschte zum Fahrersitz. »Papa schläft gar nicht, oder?«
»Ihr müsst diese Tabletten nehmen«, ging sie nicht darauf ein, »dann können wir etwas spielen.«
Junge und Mädchen streckten beide eine Hand aus und nahmen eine Tablette von ihrem Handschuh. Sie betrachteten die Tabletten skeptisch, steckten sie trotzdem in den Mund und schluckten sie unter Schwierigkeiten.
»Kann ich mal die Plane sehen?«, fragte Martha. »Ich muss euch beiden daraus einen Anzug so wie meinen machen, um eure Haut zu schützen.«
Micah zögerte, dann zog er die Plane weg. Ein widerlicher Gestank drang darunter hervor und bestätigte ihre Befürchtungen. Die Kinder waren bereits krank. Die ersten Symptome einer Strahlenvergiftung waren Erbrechen und Durchfall. Die zusätzliche Dehydrierung machte es nicht gerade besser. Sie musste diesen Kindern schleunigst sauberes Wasser und medizinische Hilfe beschaffen.
»Kommt her.« Sie streckte beide Hände nach ihnen aus.
Emma und Micah rutschten über die Rückbank und Martha half ihnen auf die Straße. Es dauerte ein paar Minuten, die Plane mit ihrem Multifunktionswerkzeug zurechtzuschneiden, aber als sie fertig war, hatte sie genügend Stücke, um die Kinder in provisorische Anzüge zu hüllen.
»Hebt die Arme«, befahl Martha.
Die Kinder gehorchten. Martha wickelte sie in die Plastikplane ein und klebte die losen Enden zusammen. Emma zitterte im Wind und bekam eine Gänsehaut auf den Armen.
»Seid ihr bereit?«, fragte Martha die Kinder.
Beide nickten. Sie nahm sie an die Hand und führte sie zu den nächsten abgestellten Autos.
»Wiedersehen, Papa«, verabschiedete sich Emma.
Micah blieb stumm, sah sich aber ein paarmal um, als sie sich von dem Minivan entfernten. Martha musste sanft an seiner Hand ziehen, damit er in Bewegung blieb.
»Das mit eurem Vater tut mir leid, aber er würde wollen, dass ihr euch in Sicherheit bringt.« Hinter ihr schniefte jemand. Sie wusste nicht, ob es Micah oder Emma war.
Wenn sie anfingen zu weinen, würden sie noch mehr dehydrieren. Wasser war jedoch nicht ihre einzige Sorge. Sie musste noch eine Möglichkeit finden, die Gesichter der Kinder zu bedecken. Ein Toyota Prius ein Stück weiter erregte ihre Aufmerksamkeit und sie ging mit den Kindern im Schlepptau zu ihm. Einige ihrer Freunde fuhren einen Prius und sie alle gehörten zu der Sorte, die allzeit bereit war.
»Bleibt hier«, sagte sie.
Micah und Emma blieben hinter dem Wagen stehen, während Martha ihn umrundete und sich davon überzeugte, dass niemand darin saß. Sie öffnete die Tür und durchsuchte den vorderen Teil und das Handschuhfach. Im Getränkehalter in der Tür steckte eine leere Flasche Brombeertee. Sie wechselte auf die Rückbank und zog eine Decke beiseite, unter der sich ein Paar Tennisschuhe und ein Sweatshirt verbargen. Auf dem Boden stand eine Sporttasche. Sie ging den Inhalt durch und fand eine beinahe volle Wasserflasche.
Einen Moment lang starrte sie die Wasserflasche nur an. Dann verzogen sich ihre Lippen seit Tagen zum ersten Mal wieder zu einem natürlichen Lächeln. Sie öffnete die hintere Seitentür, um ihren Fund den Kindern zu zeigen. Im Westen trieb Rauch über die Straße. Sie drückte die Flasche an die Brust. Der Waldbrand breitete sich aus, doch sie machte sich nicht der Flammen wegen Sorgen – es war der Rauch. Durch die schwarze Wolke, die sich ihnen langsam näherte, konnte sie nichts mehr sehen.
Emma und Micah griffen nach der Flasche.
»Trinkt nicht zu viel auf einmal«, mahnte Martha.
Emma stürzte das Wasser dennoch gierig herunter. Ein dünnes Rinnsal tropfte von ihrem Kinn.
»Nicht alles auf einmal«, wiederholte Martha.
»Tut mir leid«, entschuldigte sich Emma. Sie gab die Flasche an ihren Bruder weiter, der ein paar Schlucke trank und sie dann Martha gab. Sie setzte die Flasche an, trank langsam, leckte sich die Lippen und schraubte die Flasche zu. Dann verstaute sie sie unter ihrem Anzug und schob sie sich in den Hosenbund.
Martha nahm Emma und Micah wieder an die Hand und führte sie weiter durch die wechselnden Winde. Auf der anderen Seite der Brücke, der sie sich näherten, lagen noch mehr zusammengekrümmte Leichen. Es gab keine Möglichkeit, den Kindern ihren Anblick zu ersparen, doch nichts konnte schlimmer sein als mit anzusehen, wie der eigene Vater an Strahlenvergiftung starb.
Ein leises Pfeifen war unter dem Rauschen des Windes zu hören, das an- und abzuschwellen schien. Sie lauschte bewusst auf das Geräusch und hörte es einen Moment später wieder. Martha sah sich nach der Ursache um, doch alles war in Rauch gehüllt. Sie konzentrierte sich wieder auf die Fahrzeuge vor ihr. Vor der Brücke standen sogar noch zwei mitten auf der Straße – ein schwarzer Sportwagen und ein Kleinbus.
Auf halbem Weg dorthin hörte sie plötzlich das rostige Klappern eines Fahrzeugs und blieb wie angewurzelt stehen. Das Geräusch wurde lauter, ein Scheppern und Rattern, dann gesellte sich das Tuckern eines Motors hinzu. Sie drehte sich wieder zu der Rauchwolke um. Im Nordosten ragte eine Armee von Baumskeletten aus der hügeligen Landschaft wie Kerzen auf einer Geburtstagstorte. Die sich durch das Gelände schlängelnde, nicht asphaltierte Nebenstraße war frei und auf ihr war keine Spur von Bewegung auszumachen.
Hatte sie akustische Halluzinationen? War das der Anfang des Deliriums? Sie wandte sich an die Kinder und fragte: »Hört ihr auch dieses Geräusch?« Beide nickten. »Hört sich wie ein Auto an«, bestätigte Micah.
Martha drehte sich gerade in dem Augenblick um, als ein Pick-up die Rauchwand durchbrach. Mehrere Männer in grünen ABC-Schutzanzügen standen auf der Ladefläche des Wagens. Die Anzüge waren von der Sorte, die auch die Männer der Nationalgarde trugen.
Ihr Instinkt verriet ihr, dass etwas nicht stimmte. Die Männer fuhren nicht in einem Humvee wie die anderen Soldaten.
Martha zog die Kinder zu dem schwarzen Sportwagen und duckte sich dahinter. Der Pick-up fuhr mit quietschenden Reifen Slalom um die abgestellten Wagen. Wer diese Männer auch waren, sie hatten es eilig.
»Werden die uns helfen?«, fragte Micah. Er erhob sich und lugte hinter dem Wagen hervor.
Martha zog sanft an seinem Arm. »Sei still«, flüsterte sie.
Der Pick-up wurde langsamer und Martha lauschte angestrengt, um über den Motorenlärm hinweg etwas von der Unterhaltung der Männer mitzubekommen.
»Wo hattest du diese Leute gesehen?«, fragte einer von ihnen. Durch die Maske klang seine Stimme verzerrt.
»Ungefähr hier.«
Martha lugte um die Stoßstange. Der Pick-up fuhr jetzt Schritttempo. Sie zog den Kopf ein und wies die Kinder leise an: »Kriecht unter den Wagen und kommt erst raus, wenn ich es euch sage. Okay?«
Die Kinder starrten sie an.
»Na los«, flüsterte Martha. »Ärztliche Anordnung.«
Sie half ihnen dabei, unter den Wagen zu kriechen, und als sie gut darunter versteckt waren, rannte sie vom Sportwagen zum Kleinbus.
»Da!«, rief eine Stimme.
Martha blieb stehen und drehte sich zu dem Pick-up um, während sie ein Stoßgebet zum Himmel sandte, ihr Instinkt möge sich in Bezug auf diese Männer irren. Sie hob die Hände, als der Pick-up vor ihr anhielt. Die Beifahrertür öffnete sich und ein Soldat sprang heraus. Die Männer auf der Ladefläche richteten ihre Sturmgewehre auf Martha, wodurch ihr das Herz plötzlich bis zum Hals schlug. Sie versuchte, ihre Gesichter zu erkennen, doch die Helme verbargen zu viel.
»Bleiben Sie, wo Sie sind«, befahl ihr einer der Bewaffneten.
Der Beifahrer sah sich gründlich in der Umgebung um, während er sich ihr mit einer Hand am Griff einer gehalfterten Pistole näherte. Sie konnte seine Augen hinter dem Visier erkennen. Sie waren kristallblau und auf sie gerichtet.
»Sie sind die erste Person, die wir seit einer ganzen Weile auf der Straße sehen«, erklärte er ruhig. »Das bedeutet, Sie sind entweder wirklich dumm oder wirklich gescheit, weil Sie hier draußen überlebt haben.«
Martha hielt die Hände oben und antwortete nicht.
»Sie sind wohl nicht sehr redselig, was?« Er kam ein paar Schritte näher – so nah, dass sie eine S-förmige Narbe auf seiner Stirn erkennen konnte. Es sah aus, als wäre das Muster absichtlich eingeritzt worden.
Er wandte den Kopf zu seinen Männern und bedeutete ihnen, die Gewehre herunterzunehmen. Auf der Ladefläche des Pick-ups hustete jemand und mehrere kleine, mit Gasmasken bedeckte Gesichter lugten über den Rand der Ladefläche. Die Kinder trugen aschebedeckte Schutzanzüge.
Martha entspannte sich ein wenig, aber sie behielt die Hände oben. Der alte Pick-up war kein Militärfahrzeug. Vielleicht hatten diese Männer ja gar keine bösen Absichten, wenn sie versuchten, diesen Kindern zu helfen.
»Sie haben sich ja einen richtig schicken Anzug gebastelt«, fuhr der Mann mit einem leisen Lachen fort, nachdem er sie und ihre Müllsack-Schutzkleidung von oben bis unten betrachtet hatte. »Ich vermute mal, dass Sie das eine oder andere über radioaktiven Fallout wissen. Habe ich recht?«
Martha beschloss, das Risiko einzugehen und ihm zu antworten. »Ich bin Ärztin und wir haben es an und für sich gar nicht mit Fallout zu tun. Die Strahlung durch eine Atombombenexplosion in der Höhe ist kurzfristig gefährlicher als der Fallout.«
Der Mann drehte sich zu den anderen Soldaten um. »Sie kann also doch reden – und klug ist sie auch noch!«
»Zu welcher Einheit gehören Sie?«, fragte sie.
Der Mann hob eine buschige graue Augenbraue. »Einheit?«
»Ich habe angenommen, Sie sind ein Soldat. Der ABC-Schutzanzug stammt aus Militärbeständen, oder nicht?«
»Sie sind sogar eine sehr kluge Frau.« Er drehte sich zum Pick-up um und rief: »Jungens, zu welcher Einheit gehören wir?«
Die Männer auf der Ladefläche brüllten im Chor: »Sons of Liberty!«
Martha hatte noch nie von so einer Einheit gehört, aber sie wusste auch nicht viel über das Militär. Vermutlich war es ein gemeinsames Rufzeichen oder so etwas.
»Sind Sie ganz allein hier draußen unterwegs?«, fragte der Mann.
»Ja«, erwiderte sie etwas zu hastig.
»Carson, hast du nicht gesagt, du hättest drei Personen vor der Brücke gesehen?« Einer der Männer hinten auf dem Pick-up nickte. »Sie und zwei andere, die wie Kinder aussahen.«
Der Mann vor Martha kam noch näher. Und da bemerkte sie die mit Klebeband abgedichteten Löcher in der Brust seines Anzugs. Der Bereich um die Löcher war dunkel verfärbt mit etwas – das stark nach Blut aussah. Ein kalter Schauder überlief ihren verschwitzten Körper.
»Warum würden Sie mich anlügen wollen? Sehe ich für Sie wie jemand aus, der einem Kind etwas antun würde?«, fragte er sie. Martha blieb stumm und wich einen Schritt zurück. Waren das Einschusslöcher auf der Vorderseite seines Anzugs?
Sein ganzes Verhalten änderte sich schlagartig. »Jetzt machen Sie mich wütend«, grollte er. Er machte zwei, drei schnelle Schritte und blieb direkt vor ihr stehen. Heißer Atem beschlug die Innenseite seines Visiers.
»Ich wollte Sie eigentlich mitnehmen und von hier wegbringen, aber Sie stellen meine Geduld auf eine harte Probe und wir haben bereits einen Arzt in unserer Basis.«
»Es tut mir leid.« Marthas Gedanken überschlugen sich. »Ich bin unterwegs schon ein paar ganz üblen Leuten begegnet. Man weiß nie, wem man trauen kann, richtig?«
Der Mann grinste wieder. »Verdammt richtig.«
»Sie bringen uns also irgendwohin, wo es sicher ist?«, fragte sie.
»Sicher. Sie und die Kinder. Sagen Sie mir nur, wo sie sind.«
Martha bewegte sich ein wenig zur Seite, um einen besseren Blick auf die Kinder und die Männer mit den Gewehren hinten auf der Ladefläche des Pick-ups werfen zu können. Wegen der Masken und Visiere konnte sie die Gesichter nicht deutlich sehen, aber aus diesem Winkel fielen ihr andere Details an dem Wagen auf: eine auf die Beifahrertür gestempelte 88, der Doppelblitz des SS-Symbols aus Klebestreifen, eine Armbinde mit einem gezeichneten Adler und einem Hakenkreuz in seinen Klauen. Diese Männer waren keine Soldaten – sie waren irgendeine Bande von rassistischen Rechtsextremen.
»Was denn nun? Holen Sie jetzt die Kinder oder nicht?«, fragte sie der Mann vor ihr.
»Okay«, gab sie scheinbar nach. »Ich hole sie und bin gleich wieder zurück.«
»Auf keinen Fall. Einer meiner Männer wird Sie begleiten.« Er drehte sich um und winkte. »Carson, schaff deinen Arsch hierher.«
Kaum hatte sich der Mann von ihr abgewandt, rannte Martha los.
Wenn diese Männer für diese Anzüge Soldaten getötet hatten, ließ sich unmöglich sagen, was sie mit den Kindern machen würden. Den Kindern, die bereits in dem Pick-up waren, konnte Martha nicht mehr helfen, aber vielleicht konnte sie die Männer von Micah und Emma weglocken.
»Halt!«, rief der Anführer mit zorniger Stimme.
Sie sprang in den Straßengraben und rannte zu der Ansammlung geschwärzter Bäume am Fuße eines Hügels in der Nähe. Ein Schuss zerschmetterte die Stille des Nachmittags. Kindliche Schreie folgten. Martha warf einen Blick zurück und sah einen Jungen im Rollstuhl auf der Ladefläche des Pick-ups. Er rief den sogenannten Sons of Liberty zu, sie sollten aufhören, doch die Männer achteten nicht auf ihn.
Mündungsfeuer blitzte und Kugeln bohrten sich neben ihr in den Boden. Die Bäume waren immer noch 30 Meter entfernt. Sie würde es nicht schaffen.
Martha wollte die Hände heben, um sich zu ergeben, als sie von einer Kugel in die Schulter getroffen und so heftig zu Boden geschleudert wurde, dass ihr der Aufprall den Atem raubte.
Sie schnappte nach Luft und wälzte sich langsam auf die linke Seite. Die aus ihrer Brust zischende Luft bedeutete, dass sie wahrscheinlich einen Lungendurchschuss hatte.
Da wusste sie, dass sie die Wunde nicht überleben würde.
Falls die Kugel eine Arterie getroffen hatte, würde sie in wenigen Minuten tot sein. Und selbst wenn nicht, würde sie längst tot sein, bevor irgendwelche Hilfe eintraf.
»Warum mussten Sie das unbedingt tun?«
Martha blinzelte die Tränen weg, die ihr in die Augen stiegen, und funkelte den Anführer an, der nun vor ihr zum Stehen kam.
»Ich habe ihnen befohlen, dass sie Sie nicht erschießen sollen, aber einer von ihnen hat wohl falsch gezielt. Im Vertrauen gesagt glaube ich langsam, dass meinen Männern diese ganze Ende-der-Welt-Sache Spaß macht.«
Der kühle Wind trug ihre dünnen, hohen Stimmen zu ihr, als Micah und Emma zu schreien anfingen.
»Was …«, keuchte Martha. »Was werden Sie mit ihnen machen?«
»Keine Sorge, ich tue ihnen nichts. Sie sind viel zu wertvoll. Die Regierung zahlt ein hübsches Sümmchen für diese Kinder. Ein paar von ihnen sind Krüppel, aber selbst die Beschädigten sind wahrscheinlich noch etwas wert.«
Er schnalzte mit der Zunge, als belehrte er ein Kind. »Wir verschwinden von hier, bevor uns das Feuer einholt. Wollen Sie eine Kugel in den Kopf? Mehr kann ich jetzt nicht für Sie tun.«
»Nein«, ächzte sie, indem sie den Kopf einmal hin und her bewegte. »Bitte nicht.« Er zuckte die Achseln. »Ihre Entscheidung.«
Sie sah dem Mann hinterher, wie er ohne Eile zur Straßenböschung ging und sie allein zum Sterben zurückließ, während die Flammen im Westen langsam auf sie zukrochen.
1
Zwei Tage später
Marcus Colton, der Polizeichef von Estes Park, stand im kühlen Morgenwind an der Barrikade vom Highway 7. Mehrere Freiwillige flankierten ihn und betrachteten schweigend die gesperrte Straße. Sie wussten jetzt, warum keine Flüchtlinge und gestrandeten Touristen darauf unterwegs waren.
Sie waren alle tot.
Die verstrahlte Zone begann etwa 50 Kilometer weiter südlich und niemand konnte sagen, wie schlimm es dort draußen aussah. Fünf Tage waren seit dem nordkoreanischen Angriff vergangen. In dieser kurzen Zeitspanne waren mehrere Einwohner von Estes Park den Tankala-Brüdern zum Opfer gefallen. Die Polizei von Estes Park hatte sich mithilfe von Major Nathan Sardetti und Sam »Raven« Spears um die beiden Serienmörder gekümmert, aber die Ortschaft Estes Park in Colorado hatte für die Gerechtigkeit einen hohen Preis gezahlt.
Colton hatte mit Captain Jake Englewood seinen besten Freund verloren und Officer Rick Nelson lag im Krankenhaus von Estes Park auf der Intensivstation. Er hatte versucht, drei Junkies daran zu hindern, eine Apotheke auszurauben, und für seine Bemühungen einen Ziegelstein auf den Schädel bekommen. Detective Lindsey Plymouth und Raven Spears waren den Straftätern auf der Spur, während Colton an der Straßensperre auf Neuigkeiten von Patrol Sergeant Don Aragon wartete.
Eine Stunde zuvor hatte Colton Don in Ravens Jeep mit einem ABC-Schutzanzug auf dem Highway 7 nach Süden geschickt, um die Gegend auszukundschaften. Bisher hatte er sich noch nicht gemeldet und Colton wurde langsam ungeduldig.
Er hob das Funkgerät an die Lippen und sprach hinein. »Don, hören Sie mich? Over.«
Eine längere, von statischem Rauschen erfüllte Pause trat ein, bis Don sich schließlich mit seiner gedehnten Sprechweise des Westens meldete.
»Reichlich Interferenzen, aber ich kann Sie hören, Chief.«
»Haben Sie einen Lagebericht für mich?«, fragte Colton. »Irgendwelche Überlebende?«
»Negativ, Chief. Hier draußen sind alle tot.«
Colton zog an seiner Zigarette, um den kostbaren Tabak nicht einfach verbrennen zu lassen. Seine Hand zitterte, als er sie sinken ließ – eine Kombination aus posttraumatischer Belastungsstörung, Nerven und Arthritis im Anfangsstadium. Colton fluchte in sich hinein. Er hatte sich darauf gefreut, sich in ein paar Jahren zur Ruhe zu setzen und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Stattdessen versuchte er, die Stadt zusammenzuhalten, während der Rest des Landes auseinanderfiel.
»In Ordnung, fahren Sie noch ein Stück weiter und melden Sie sich dann.« Colton klemmte das Walkie-Talkie wieder an seinen Gürtel und nickte Rex Stone zu. Melissa, die vermisste Tochter der Stones, war vor dem EMP-Angriff ermordet worden und Colton hatte die Leiche gefunden. Jetzt stand Rex auf der Ladefläche eines Pick-ups und hielt ein Springfield-Repetiergewehr auf die Straße gerichtet.
»Hat er niemanden gefunden?«, fragte Rex mit schroffer Stimme, den Blick starr nach vorn gerichtet. Vor fünf Tagen war er noch ein unbekümmerter Mann der leisen Töne gewesen. Der anfängliche Schock des Verlustes seiner Tochter schien sich in Wut umzuwandeln – eine Wut ohne bestimmtes Ziel. Das war eine gefährliche Kombination und Colton war nicht sicher, ob es eine gute Idee war, Rex einzusetzen, doch sein alter Freund hatte darauf bestanden.
Colton schüttelte den Kopf und ging zum Randstreifen der Straße, um auf Don zu warten. Das Ausbleiben von Flüchtlingen beendete zumindest den wachsenden Disput zwischen Colton und seinem neuen Stellvertreter hinsichtlich der Frage, ob sie mehr Leute in der Stadt aufnehmen sollten oder nicht.
24 Stunden zuvor, nicht lange nachdem Colton mit Jakes Leichnam vom Prospect Mountain zurückgekehrt war, hatte er seine Polizisten und bewaffneten Freiwilligen angewiesen, Flüchtlinge auch weiterhin abzuweisen, wenn sie nicht über Fähigkeiten verfügten, die der Stadt nützen würden. Ärzte, Ingenieure, Mechaniker und Polizisten wurden dringend gebraucht.
Doch seitdem sich die Gewitterstrahlung über das nördliche und zentrale Colorado gelegt hatte, gab es niemanden mehr, den sie abweisen konnten, und Colton fragte sich langsam, ob da draußen überhaupt noch jemand lebte.
Während sie warteten, betrachtete er die mit Schnee bedeckten Berge. Der Winter stand vor der Tür und er wusste nicht, ob er Estes Park ohne Jake durch die Kälte bringen konnte. Trotz Ravens unerwarteter Hilfe verfügte Colton nicht über das nötige Personal, um alle Herausforderungen zu meistern, mit denen sich Estes Park in den nächsten Monaten konfrontiert sehen würde.
Ganz oben auf Coltons Liste stand die Ergreifung der Schweine, die einen seiner Polizisten ins Koma geschlagen hatten. Raven und Lindsey arbeiteten bereits daran, aber selbst wenn sie die Verantwortlichen schnappten, wäre in dem kleinen Gefängnis von Estes Park nicht genügend Platz, um sie darin unterzubringen. Theo, der Strolch, der in Ravens Haus eine Schießerei begonnen hatte, saß ebenso bereits ein wie mehrere Stadtbewohner, die beim Plündern erwischt worden waren.
»Ein Fahrzeug nähert sich!«, meldete Rex.
Colton blickte von seiner Zigarette auf und suchte auf dem Highway nach Ravens Jeep. Stattdessen wurde das Tuckern eines alten Dieselmotors von den Klippen zurückgeworfen. Er griff nach seinem Single Action Army Revolver, ließ ihn aber im Halfter, als er sah, dass es Lindsey war, die Jakes roten 52er Chevy Pick-up fuhr. Raven saß auf dem Beifahrersitz, Nathan mit übergestreiftem Rucksack auf der Ladefläche.
Colton nahm einen letzten Zug und trat den Stummel unter dem Absatz aus, bevor er dem Wagen entgegenging. Lindsey fuhr auf den Seitenstreifen und winkte.
»Morgen, Chief«, begrüßte sie ihn.
Raven stieg aus und ging zur Heckklappe, um seinen Hund herauszulassen und Nathan nach unten zu helfen. Die neue Hundestaffel und der ramponierte Pilot kamen zu Colton, der neben den Männern trottende Creek wedelte mit dem Schwanz. Nathans gebrochener Arm war eingegipst und die sichtbaren Bereiche seiner Haut mit Schnitten und Prellungen bedeckt. Raven und er hatten einiges abbekommen in dem Kampf auf dem Prospect Mountain, bei dem Brown Feather und Turtle Tankala ebenso wie Jake den Tod gefunden hatten.
»Major, Sie sehen aus, als wären Sie von einem Auto überfahren worden und dann von einem Bus und dann noch von einem Zug«, empfing ihn Colton. »Wann kommen diese Marines, die Ministerin Montgomery schicken wollte, um Sie abzuholen?«
Nathan zuckte die Achseln. Selbst das schien zu schmerzen. Er zuckte zusammen und betrachtete die Straße. »Ich habe noch nichts von ihr gehört, aber die Marines suchen wohl noch meinen Neffen. Ich dachte, das Signal wäre außerhalb des Tals etwas besser für den Fall, dass meine Schwester mich zu erreichen versucht.«
Colton konnte immer noch nicht glauben, dass der Pilot der Bruder der Verteidigungsministerin war. Er hatte außerdem das unangenehme Gefühl, dass die Marines, die Nathans Neffen suchten, im Lager der Easterseals in Empire, Colorado, keinen mehr lebendig vorfinden würden.
Lindsey setzte ihre Fliegersonnenbrille ab und begegnete Coltons Blick. Die letzten fünf Tage hatten neue Falten rings um ihre Augen hinterlassen.
»Glück gehabt?«, fragte er.
»Wir haben uns ein paar Leute auf dem Black Canyon Drive vorgenommen, darunter auch die Arnettes«, erwiderte sie. »Sie glauben, die Verdächtigen gestern auf der Devils Gulch Road gesehen zu haben.«
»Sie meinen, sie könnten sich da in einem Haus verstecken?«, hakte Colton nach.
»Das vermute ich.«
Raven gesellte sich zu ihnen. Ein Verband verdeckte die Schramme auf seiner Wange. Unter seinen dunklen Augen hingen dicke Tränensäcke. Trotz seiner Verletzungen schien er bester Laune zu sein. Colton schnaubte. Man brauchte Raven nur etwas zu jagen zu geben, dann würde er sogar in der Hölle glücklich sein.
»Da oben wohnen eine Menge Leute, Chief«, wandte Raven ein. »Sie könnten überall sein. Ich würde vorschlagen, den Leuten da oben Bescheid zu geben, damit sie die Augen offen halten und sich melden, wenn sie irgendwas bemerken.«
»Das kann ich nicht riskieren«, erwiderte Colton. »Vergessen Sie nicht, unsere Verdächtigen sind Süchtige, und wenn ihnen die Pillen ausgehen, werden sie sich nach einer neuen Quelle umsehen. Sie könnten alles Mögliche anstellen, um sich mehr zu beschaffen.«
»Der Chief hat recht«, fügte Nathan hinzu. »Sie müssen gefunden werden, bevor sie noch mehr Leuten Schaden zufügen.«
»Was sollen wir also tun, Chief?«, fragte Lindsey. Ihre schulterlangen roten Haare flatterten im Wind. Sie war Mitte 20 – zu jung, so kam es Colton vor, um das Grauen der letzten Tage erlebt zu haben. In Afghanistan hatte er neben Männern und Frauen ihres Alters und sogar noch jüngeren gekämpft. Es hatte sie verändert. Verdammt, es hatte ihn auch verändert.
»Nehmen Sie Creek mit und sehen Sie, ob er eine Witterung aufnehmen kann. Vielleicht können wir ihren Aufenthaltsort einengen. Wenn Sie unsere Verdächtigen ausfindig gemacht haben, will ich unterrichtet werden, bevor Sie zugreifen«, ordnete Colton an.
Lindsey nickte und Raven tippte sich an den Schirm seiner Baseballkappe.
»Viel Glück«, wünschte Colton. Er wollte Creek tätscheln, doch der Hund flitzte bereits hinter Raven her. Der Hund mochte formal zu einer Hundestaffel gehören, aber treu ergeben war er einem und nur einem Mann.
Colton wollte sich gerade eine neue Zigarette anzünden, als es in seinem Funkgerät knisterte.
»Chief, hören Sie mich?«
Colton nahm das Walkie-Talkie von seinem Gürtel und hielt es sich an die Lippen. »Ich höre.«
»Ich habe eine Überlebende gefunden«, seufzte Don. »Eine Frau. Sie ist in schlechter Verfassung, Sir. Sieht ganz so aus …« Statisches Knistern übertönte seine Worte.
»Wiederholen Sie bitte«, verlangte Colton. »Sie werden undeutlich.«
»Sie …« Knistern. »Angeschossen.«
Bei dem Wort überlief es Colton kalt. Er ließ das Funkgerät sinken und drehte sich zu dem Chevy um.
»Warten Sie, Lindsey!«, rief er. »Öffnen Sie die Straßensperre. Ich rücke ebenfalls aus.« Rex und die anderen Männer des Wachtrupps starrten ihn an, ohne sich zu rühren.
»Na los«, befahl Colton.
Einige der Männer machten sich daran, die Betonklötze aus dem Weg zu räumen.
»Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist?«, fragte Raven.
»Don hat eine Überlebende auf der Straße gefunden. Offenbar ist sie angeschossen worden. Wir holen sie ab.« Lindsey lehnte sich aus dem Fenster des Pick-ups. »Ohne Anzüge?«
Colton fluchte. Er hatte die Strahlung vergessen. Er hob das Funkgerät wieder an die Lippen.
»Don, können Sie die Frau allein in die Stadt zurückbringen?«
Knistern und Rauschen drangen aus dem Gerät und die Antwort ließ lange auf sich warten. Don redete leise, als ob er nicht wollte, dass jemand mithörte.
»Sir, ich glaube nicht, dass sie durchkommt. Und selbst wenn ich sie ins Krankenhaus schaffe, sind wir schon knapp an medizinischen Hilfsmitteln. Wir müssen an unsere Leute denken.«
Colton hätte beinahe ein weiteres Mal geflucht. Er hatte einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen, als er seinen Leuten befohlen hatte, Leute abzuweisen. Doch kein einziges Mal hatte er einem von ihnen aufgetragen, jemanden im Stich zu lassen, der medizinische Hilfe benötigte.
Was würde Jake tun?
Die Antwort darauf war leicht. Colton wusste, sein bester Freund hätte die verwundete Fremde falls nötig auch auf dem Rücken getragen. Colton drückte auf die Sendetaste. »Es ist nicht unsere Art, Leute da draußen zum Sterben liegen zu lassen. Bringen Sie die Frau in die Stadt.«
»Aber, Sir, ich dachte, wir wären uns einig …«
»Das ist ein Befehl.«
»Bei allem Respekt, aber das ist Verschwendung von Zeit und Ressourcen«, widersprach Don.
Jeder auf der Straße starrte Colton jetzt an und die allgemeine Spannung war spürbar angestiegen. Einige der Freiwilligen stimmten wahrscheinlich mit Don überein, doch dies war keine Demokratie. Colton hatte das Sagen und er musste allen zeigen, dass er in Estes Park immer noch das Kommando hatte.
Er drückte wieder auf den Sendeknopf. »Tun Sie Ihre Arbeit, Sergeant!« Es kam keine Antwort, nur statisches Knistern.
»Gute Entscheidung, Chief«, sagte Nathan. »Der Kerl ist ein schlimmer Finger. Sie sollten sich in seiner Nähe gut vorsehen.«
»Kommen Sie in die Gänge«, erwiderte Colton. »Ich regle das. Finden Sie diese Junkies. Ich will sie bei Einbruch der Dunkelheit hinter Schloss und Riegel haben.«
»Geht klar, Chief«, bestätigte Lindsey.
Colton verschränkte die Arme vor der Brust und als sein Blick auf die Berge fiel, wurde er wieder an die Nacht des Angriffs erinnert, als Raven und er Melissa Stones Leiche gefunden hatten. Als die Düsenjäger abgestürzt und die Lichter ausgegangen waren, hatte er sofort gewusst, dass es der Anfang von etwas Größerem war, aber er hatte keine Ahnung gehabt, dass er fünf kurze Tage später darüber entscheiden würde, wer lebte und wer starb. Mit einem schweren Seufzer klemmte er sich die nächste Zigarette zwischen die Lippen und machte sich wieder an die Arbeit.
Ty Montgomery hustete in die um seinen Kopf geschnallte Gasmaske. Die Welt roch nach verbranntem Zedernholz und Plastik. Seine Arme waren mit Kabelbindern an die Armlehnen seines Rollstuhls gefesselt. Es hatte keinen Sinn, sich gegen sie zu wehren. Und selbst wenn er sich seiner Fesseln hätte entledigen können, konnte er nirgendwohin. Er war mit den anderen Kindern hinten auf der Ladefläche des Pick-ups gefangen. Sie waren zu sechst, vier aus dem Lager, alle ungefähr in seinem Alter, dazu die beiden neuen Kinder, Micah und Emma.
Es war das zweite Mal, dass sie in den letzten beiden Tagen den Standort gewechselt hatten. Die vergangene Nacht hatten sie in einem Lagerhaus verbracht. Ein paar der Kinder aus dem Lager waren autistisch und das beständige Chaos machte ihnen schwer zu schaffen, doch den Männern war das egal. Sie brüllten nur und stießen die Kinder herum.
Tys bester Freund im Lager, Alex, hatte gut daran getan, sich zu verstecken, als die Soldaten gekommen waren. Wenn Ty gekonnt hätte, hätte er das Gleiche getan, aber er war zusammen mit diesen anderen Kindern gefangen genommen worden und die Männer behandelten sie wie Tiere.
Manchmal kam ihm alles wie ein böser Traum vor. Nur dass es zu schlecht roch und zu sehr wehtat, um ein Traum zu sein. Er war immer noch mit der Verarbeitung der Ereignisse der letzten fünf Tage beschäftigt. Zuerst die gewaltige Explosion, die wie ein Vulkanausbruch geklungen hatte. Dann die Brände. Seine Freunde waren an verschiedene Orte im Lager gebracht worden, wo sie Schutz vor etwas namens Strahlung gesucht hatten. Nach dem Ende des Regens waren die Soldaten der Sons of Liberty mit Gewehren aufgetaucht und hatten Mr. Barton und Mr. Gonzalez erschossen. Da hatte sich Alex davongestohlen und versteckt.
Ty schauderte angesichts der Erinnerung. Mr. Barton und Mr. Gonzalez waren seine Freunde gewesen. Er hoffte nur, dass es Alex gut ging, aber tief drinnen hatte er das mulmige Gefühl, dass es nicht so war. Alex hatte eine milde Form der Kinderlähmung und Ty machte sich Sorgen, dass er nicht in der Lage sein würde, allein zurechtzukommen. Er wünschte, er hätte sich noch von ihm verabschieden können.
»Da vorne!«, rief jemand mit gedämpfter Stimme.
Der Wagen wurde langsamer und alle Soldaten auf der Ladefläche erhoben sich. Die meisten von ihnen redeten nicht in Gegenwart der Kinder. Einer von ihnen war halbwegs nett, ein junger Mann mit einem pickligen Gesicht, namens Tommy. Wie bei den anderen auch waren Arme und Hals ausgiebig tätowiert, aber er brüllte nie.
Ty lauschte immer, wenn sich die Männer unterhielten und er sie hören konnte. Sie nannten sich die Sons of Liberty und ihr Anführer war der General. Er hatte eine sanfte, geschmeidige Stimme und eine S-förmige Narbe auf der Stirn wie Harry Potter. Der General sagte immer wieder, die Zeit sei gekommen, sich das Land von der korrupten Regierung zurückzuholen und wieder der Bestimmung zuzuführen, für die es bei seiner Gründung vorgesehen war. Die anderen Männer jubelten dann immer.
Ty verstand das nicht. Seine Mutter war in der Regierung und sie war tapfer und lieb. Warum wollten sie es Leuten wie ihr wegnehmen? Diese Soldaten waren anders als alle, die Ty kannte. Sie waren ganz gewiss nicht so wie sein Onkel Nathan und seine Mutter. Diese Männer trugen lustig aussehende Raumanzüge und anstatt den Leuten zu helfen, entführten sie Kinder und schossen Frauen in den Rücken.
Sie war nicht die erste Person, die sie unterwegs getötet hatten. Ein Ruck durchfuhr den Wagen und Ty umklammerte die Armlehnen seines Rollstuhls. Seine Augenbinde rutschte so weit herunter, dass er Tommy und einen anderen Mann namens Carson links von sich sehen konnte.
»Anhalten«, befahl Carson. Er schlug mit der flachen Hand auf das Dach der Fahrerkabine. Der Pick-up rollte aus und Carson sprang auf die Straße. Tommy blieb auf der Ladefläche.
»Alles gut«, beruhigte er die Kinder. »Wir halten nur für ein paar Minuten an.«
Die gedämpften Stimmen der anderen Soldaten kamen aus allen Richtungen, vor allem von den vordersten Fahrzeugen der Kolonne. Ty senkte den Kopf, um über den Rand seiner Augenbinde sehen zu können.
Auf dem Seitenstreifen der Straße standen ein Mann und eine Frau im Schutz einiger Nadelbäume. Sie trugen beide einen mit Campingausrüstung vollgestopften Rucksack. Der Mann winkte den Sons of Liberty zu, ein strahlendes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus.
»Ihr Jungens seid ja mal ein richtig erfreulicher Anblick. Meine Freundin und ich dachten schon, wir wären die letzten Menschen auf der Welt!«
»Wir haben schon seit über einem Tag keine Menschenseele mehr gesehen«, erklärte die Frau. Sie schlang schaudernd die Arme um die Brust.
Ty wollte ihnen zurufen, dass sie fliehen sollten, aber das würde nichts nützen. Sie würden nicht weit kommen.
Joshua und Bernie, zwei von den anderen Soldaten, gingen zu dem Pärchen. Sie waren beide von kräftiger, untersetzter Statur und hatten einen buschigen Bart, einen kahl rasierten Kopf und reichlich Tätowierungen. Ihre Gewehre waren auf den Boden gerichtet. Einen Moment später schloss sich ihnen der General an.
»Wohin wollt ihr zwei?«, fragte er. Trotz des Atemgeräts vor seinem Mund konnte Ty seine geschmeidige Stimme ganz deutlich hören. Er klang damit wie der Erzähler einer Serie im Discovery Channel.
Der junge Mann deutete mit einem Kopfnicken nach Westen. »Wir wollen vor dem Waldbrand fliehen.«
»Seid ihr krank?«, fragte Joshua.
Die Frau nickte.
»Können wir nicht gebrauchen«, verkündete der General beiläufig. Er ging zum Wagen zurück und ließ Joshua und Bernie auf der Straße zurück.
»Was? Was soll das heißen?«, fragte der junge Mann verblüfft.
»Das soll heißen, dass ihr am Arsch seid«, erläuterte Joshua mit einem kurzen Lachen. Er und Bernie wandten sich ab und folgten dem General.
»Ihr könnt uns doch nicht einfach hier zurücklassen!«, flehte der Mann. »Bitte …«
Seine Freundin rannte an ihnen vorbei und hielt den General am Ärmel fest, bevor sie jemand daran hindern konnte. Bernie und Joshua hoben ihr Gewehr.
»Zurück mit dir!«, rief Bernie.
Die Frau hob die Hände. Ihr Freund folgte ihrem Beispiel und schob sich langsam vor sie, sodass er sie abschirmte.
»Schon gut, schon gut, wir wollen keinen Ärger«, versuchte er, sie zu besänftigen.
Der General blieb, wo er war. »Gebt mir eure Rucksäcke«, forderte er sie gelassen auf.
Die Frau sah ihren Freund an, der ihr zunickte. Sie nahm ihren Rucksack ab und reichte ihn dem General, der ihn Bernie zuwarf.
»Deinen auch«, verlangte der General.
»Aber das ist alles, was wir haben. Wie sollen wir …«, wurde der junge Mann unterbrochen, als der General ihm einen rechten Haken verpasste. Etwas funkelte metallisch im Sonnenlicht, als seine Faust den Kiefer des Mannes traf. Ein lautes Knacken ertönte, Metall auf Knochen.
Die Frau stieß einen Schrei aus und kauerte sich neben ihren verletzten Freund.
Die Männer lachten, als der General den Messingschlagring in die Höhe hielt, den er gern über dem Handschuh an der rechten Faust trug. Er hockte sich vor das Pärchen und neigte den Kopf.
»Die Leute hören einfach nicht zu«, erklärte er. »Jetzt fordere ich euch noch einmal auf, mir eure Rucksäcke zu geben.«
Die Frau half ihrem verwundeten Freund, den Rucksack abzusetzen. Er stöhnte laut, als sie ihm die Träger über die Arme streifte. Der General nahm den Rucksack, wandte den Kopf zum Wagen und begegnete kurz Tys Blick.
»Merkt euch das, Kinder. So überleben wir in der neuen Welt.«
Er erhob sich und ging zum Wagen zurück, doch Joshua blieb bei dem Paar. »Hey, General, ich habe eine Idee. Wie wär’s, wenn wir die Frau hier mitnehmen?«
»Sie ist krank«, erwiderte der General. »Aber was soll’s, wenn du sie haben willst, nimm sie dir.«
Der verletzte Mann raffte sich auf und stellte sich vor seine Freundin. Mit einer Hand hielt er sich den Kiefer.
»Lauf, Sarah«, knirschte er.
»Bleib, wo du bist«, befahl Joshua.
Der verletzte Mann zog ein kleines Messer aus einer Scheide an seinem Gürtel und hob mit zittriger Hand die Klinge. »Erst musst du an mir vorbei.«
»Tu’s nicht«, flüsterte Tommy hinter Ty. »Komm schon, Mann. Lass sie einfach gehen.«
Joshua lachte schallend. Anstatt den Mann zu erschießen, nahm er sein Gewehr herunter. Ty stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Tommy sah ihn für einen Moment an. Ty bemerkte, wie Joshua sein eigenes Messer zückte, bevor ihm Tommy die Augenbinde wieder herunterzog.
Die Frau schrie. Johlen und Gelächter der Soldaten folgten. Dann Grunzen und Schmerzensschreie des jungen Mannes und schließlich ein gequältes Kreischen seiner Freundin. Es dauerte keine Minute, aber Ty kam es wie eine Ewigkeit vor. Tränen standen ihm in den Augen. Eine lief seine schmutzige Wange hinunter, er konnte nicht einmal die Hände heben, um sie wegzuwischen.
Nein. Nicht weinen. So schwach bist du nicht, dachte er.
Wäre seine Mutter jetzt hier, würde sie ihm vermutlich sagen, dass es in Ordnung war zu weinen, doch sie war, wie immer, in Washington D. C. und arbeitete. Er liebte seine Mutter mehr als sonst jemanden auf der ganzen Welt, trotzdem war er auch böse auf sie. Warum war sie nicht gekommen und hatte ihn gerettet?
Das Schluchzen der anderen Kinder steigerte sich zu einer Kakofonie des Jammerns. Einer der Soldaten sagte zu ihnen, sie sollten verdammt noch mal still sein. Tommy versuchte sie mit seiner ruhigen, näselnden Stimme zu beruhigen.
»Ist ja schon gut«, wiederholte er beständig.
Ein Schuss ertönte, dem zwei weitere folgten. Die Frau hörte auf zu kreischen.
»Ich hab dir doch gesagt, du sollst keine Kugeln verschwenden, Bernie. Die beiden waren doch schon so gut wie tot«, wies ihn der General zurecht. »Warst du im Irak auch so dämlich? Wenn ja, überrascht es mich, dass du mit heiler Haut nach Hause gekommen bist.«
Einige der Männer lachten. Ty versuchte, die Hände zu bewegen, aber selbst wenn es ihm gelang, die Fesseln zu lösen, würde er nicht einfach davonlaufen können. Frustriert zerrte er noch fester an den Kabelbindern.
»Das solltest du lieber lassen, mein Junge«, riet ihm Tommy. »Es ist besser für dich, wenn du einfach stillhältst.«
Ty erstarrte. Tommy hatte recht: Er musste sich benehmen, bis seine Mutter kam, um ihn zu holen.
»Es geht weiter!«, rief der General. »Bis zur Burg ist es nicht mehr weit.«
Die Türen der anderen Fahrzeuge öffneten sich und wurden zugeschlagen und dann setzte sich die Kolonne in Bewegung. Sein Rollstuhl erhielt einen Stoß. Obwohl er unterhalb der Hüften kein Gefühl mehr hatte, schoss ihm der Schmerz des Aufpralls die Wirbelsäule hoch. Er stieß einen gedämpften Schrei aus und klammerte sich an den Armlehnen fest.
Tommy versuchte, den Rollstuhl mit festem Griff an Ort und Stelle zu halten. Nach ein paar Minuten Fahrt hörte Ty eine leise Stimme dicht an seinem Ohr.
»Ist schon gut, mein Junge. Halt einfach durch«, flüsterte er.
»Halt die Klappe, Tommy. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht mit den Kindern reden«, fauchte Carson. »Wahrscheinlich kann dich die Hälfte von ihnen sowieso nicht verstehen.«
Ty blieb still und dachte an seine Mutter. Sie würde bald kommen und ihn finden. Und wenn sie das tat, würden die Sons of Liberty für alles büßen.
Lieutenant Jeff Dupree saß im Bauch eines Sikorsky UH-60 Black Hawk und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Es war bereits der dritte Hubschrauber, in dem er an diesem Tag saß. Nachdem er von einem Sikorsky SH-60 Seahawk zu einem Sikorsky HH-60 Pave Hawk gewechselt war, transportierte dieser Black Hawk nun sein Team. Seit dem Angriff der Nordkoreaner war die Logistik ein Albtraum und funktionierende Flugmaschinen und Ausrüstung zu finden, war ein Riesenproblem.
Tausend Dinge gingen ihm durch den Kopf, aber heute musste er sich darauf konzentrieren, den Sohn der neuen Verteidigungsministerin zu retten. Das Wissen um die Sicherheit seiner eigenen Kinder in Key West in der Obhut seiner Ex-Frau milderte den Stress des Einsatzes ein wenig, obwohl es schmerzte, dass sie mit ihr besser dran waren als mit ihm. Er war nicht der beste Vater – das wusste und akzeptierte er und er sagte sich ständig, dass er es irgendwann wiedergutmachen würde.
Er hatte bereits viel zu viele Geburtstage verpasst. Sobald dieser Einsatz vorbei und Ty Montgomery wieder in den Armen seiner Mutter wäre, würde Dupree nach Hause fahren. Es mochte zu spät sein, die Beziehung mit seiner Ex wieder zu kitten, aber vielleicht blieb noch genug Zeit, seinen Jungs ein Vater zu sein.
Während seiner letzten Dienstzeit im Irak hatte er einem Dutzend Männern das Leben gerettet. Er selbst wäre bei einem Luftangriff fast draufgegangen. Seine linke Seite, der linke Arm und ein Teil seines Kinns hatten Narben von der Explosion davongetragen. Für seine Männer war er ein Held, doch seine Frau hatte ihn nur einen lausigen Versager von Vater genannt.
Der Ohrhörer in seinem Helm übermittelte eine Nachricht.
»LT, wir nähern uns Cedar Rapids. Sieht ziemlich schlimm aus da unten. Der Wolkenkratzer im Osten sieht aus, als hätte er ein Passagierflugzeug verschluckt.«
Dupree tat es den anderen Männern nach, die sich in ihren engen ABC-Schutzanzügen um bessere Sicht auf die Stadt bemühten. Überall stiegen Rauchfahnen in den Himmel. Er erkannte sehr schnell, was der Pilot gemeint hatte. Die Tragfläche eines Flugzeugs ragte aus der verkohlten Seite eines hohen Gebäudes wie eine Haifischflosse aus dem Wasser.
»Diese Stadt brät wie Speck in einer Pfanne«, erklärte Staff Sergeant Erik Emerson. »Lieber Gott, diese Scheiße ist total verrückt.«
»Halten Sie Abstand«, befahl Dupree. »Ich will nicht von Überlebenden beschossen werden. Nicht jeder wird glücklich darüber sein, einen Militärhubschrauber zu sehen.«
»Falls es Überlebende gibt«, wandte Sergeant Dusty McCabe ein.
Dupree hatte es nicht laut ausgesprochen, aber bei ihrem Überflug war ihm der gleiche Gedanke gekommen. Der Anblick unter ihnen war eine ständige Erinnerung daran, dass das Leben in den Vereinigten Staaten nicht so bald wieder zum Normalzustand zurückkehren würde.
Seit dem nordkoreanischen Angriff waren erst fünf Tage vergangen und die Zivilisation zerfiel bereits. Durch Krawalle, Plünderungen, Gewalttaten und durch die Strahlung fanden in jeder Stunde Hunderte von Amerikanern den Tod. Es ließ sich nicht vorhersagen, wann diese Gegend je wieder bewohnbar sein würde. Duprees Blick folgte dem Band des Highways, der sich durch die Stadt zog. Auf dem Asphalt wimmelte es von Autos und Leichen.
Corporal Nick Sharps pfiff leise durch die Zähne, als ihr Vogel nach Westen schwenkte. »Mann, ohne einen von diesen würde ich draußen nicht überrascht werden wollen.« Er wischte sich über die Schulter seines ABC-Schutzanzugs.
»Diese Anzüge schützen uns, stimmt’s, LT?«, fragte Emerson.
»Solange der Scheiß schön eng sitzt«, erwiderte Sharps, bevor Dupree antworten konnte. »Am Ende willst du ja nicht im Dunkeln leuchten. Dann müssten wir dich in der Latrine als Nachtlicht aufstellen, Bruder.«
»Schluss mit dem Blödsinn«, befahl Dupree. »Wisst ihr eigentlich, was die Strahlung mit einem anstellt? Habt ihr Schwachköpfe eine Vorstellung davon, was diese Leute gerade durchmachen?«
»Bitte um Entschuldigung, Sir.« Das kam von Emerson.
Dupree richtete den Blick auf Sharps. Der Mann hatte ein Basketball-Stipendium am Duke sausen lassen, um sich den Marines anzuschließen, nachdem sein Bruder im Irak gefallen war. Dupree mochte ihn, aber Sharps war ein Scherzkeks.
»Nein, Sir«, antwortete Sharps einen Augenblick später.
»Das dachte ich mir. Hatten Sie mal ganz schlimmen Durchfall? Stellen Sie sich dazu noch innere Blutungen und brandige Geschwüre vor«, erklärte Dupree. »Sie fangen an, sich die Eingeweide aus dem Leib zu kotzen – buchstäblich. Und dann bleibt nur noch die Frage, was zuerst eintritt: Verbluten oder tödliches Koma – vorausgesetzt, Sie drehen im Delirium nicht völlig durch und schießen sich vorher den Kopf weg.«
Sharps senkte den Blick und alle anderen in der Kabine verstummten. Das dröhnende Schrapp-Schrapp der Rotoren war zunächst das einzige Geräusch, als sie sich von der Stadt entfernten, doch die Ruhe hielt nicht lange an.
»Also sind diese Leute am Arsch?«, fragte Sharps. Er zeigte auf die Interstate, die sich unter ihnen durch Maisfelder zog. Es dauerte einen Moment, bis Dupree einen antik anmutenden Cadillac entdeckte, der durch ein Minenfeld von kreuz und quer auf der Straße abgestellten Fahrzeugen fuhr.
»Woher sie wohl einen funktionierenden, fahrbaren Untersatz haben?«, fragte McCabe.
»Wie wär’s denn mit etwas Ruhe und Frieden?«, entgegnete Dupree. »Wir müssen uns auf einen Einsatz konzentrieren. Aller Wahrscheinlichkeit nach finden wir einen Haufen von …« Er brach ab, bevor ihm herausrutschen konnte, was er vorzufinden erwartete.
»Haufen wovon?«, hakte Sharps nach.
»Es ist ein Lager für behinderte Kinder und es hieß, wir sollten uns auf das Schlimmste gefasst machen«, erwiderte Dupree.
Alle Helme nickten zur Bestätigung. Sie waren jetzt vollkommen bei der Sache und bereit, das zu tun, was Marines am besten konnten – Leben retten.
Wenn es noch welche zu retten gab, dachte Dupree.
»Wie sieht’s mit dem Treibstoff aus?«, fragte er über Bordfunk.