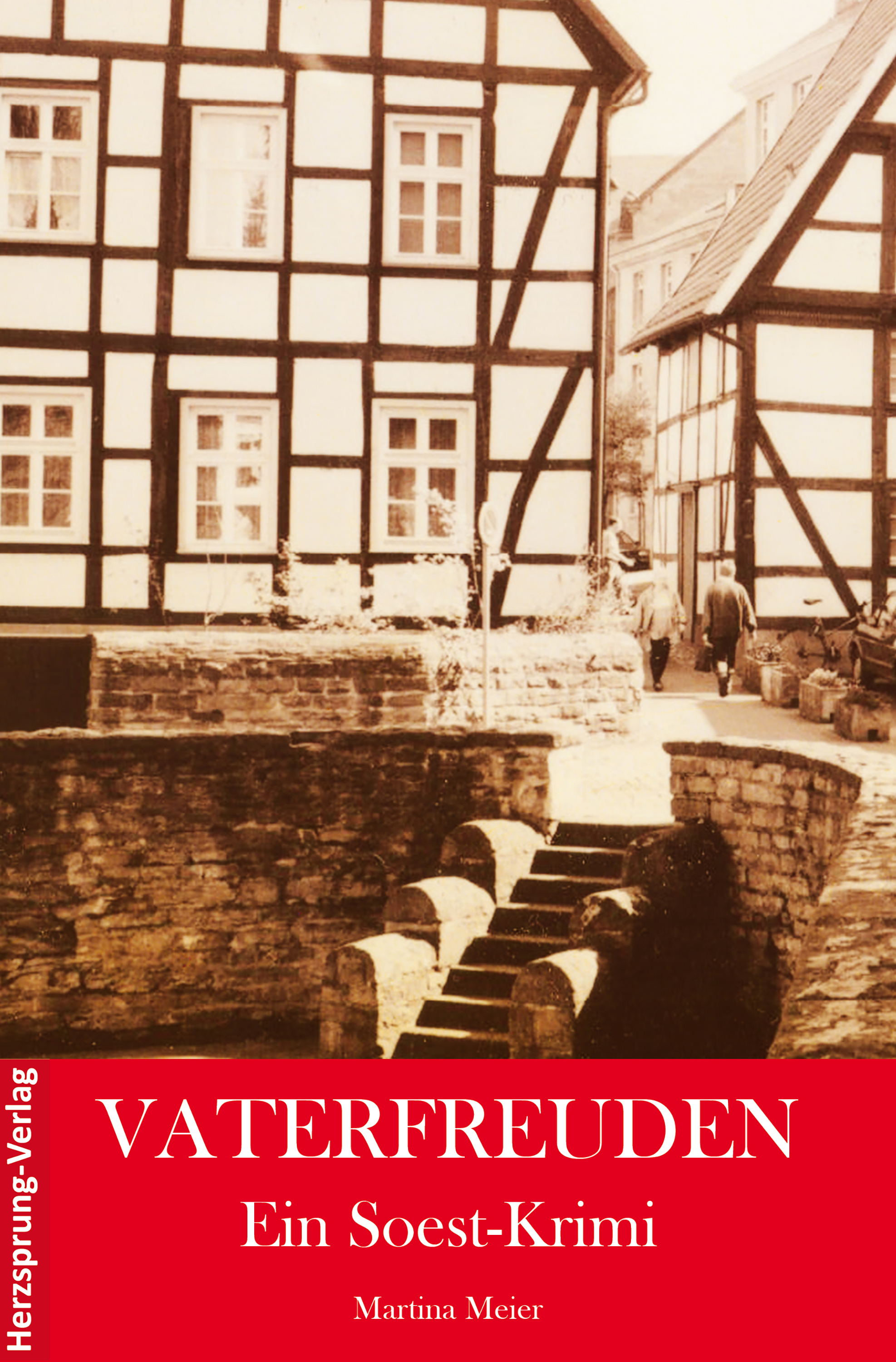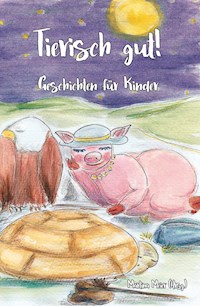9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Papierfresserchens MTM-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wenn ein Mensch geht, ganz egal ob er stirbt oder sich eine Beziehung löst, bleiben Dinge oft ungesagt. Und die doch so wichtig sind, damit derjenigen, der etwas zu sagen hat, einen Abschluss finden kann. Manchmal hat man später noch einmal die Gelegenheit, Unausgesprochenes zu sagen und mit sich ins Reine zu kommen. Aber eben nicht immer. Weil der Mensch, dem man etwas sagen möchte, längst gestorben ist. Oder weil ein Kontakt für immer abgebrochen ist. Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Raum lassen uns im vorliegenden Buch teilhaben an ihren bewegendsten Gedanken und Gefühlen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
o
Und was ich dir noch sagen wollte ...
Band 2
Martina Meier (Hrsg.)
o
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet - www.papierfresserchen.de
© 2023 – Papierfresserchens MTM-Verlag GbR
Mühlstr. 10, 88085 Langenargen
Alle Rechte vorbehalten. Taschenbuchauflage erschienen 2023.
Bearbeitung: CAT Creativ – www.cat-creativ.at
Titelbild: © Elena Schweitzer - Adobe Stock lizenziert
ISBN: 978-3-99051-133-6 - Taschenbuch
ISBN: 978-3-99051-134-3 - E-Book
*
Inhalt
Für Barisa
Ist das kreativ oder kann das weg?
Brief an Oma
Flügel
Gedanken in der Nacht
Mutter, du hast dich sterben gelegt
In Liebe John
Die Traueranzeige
Mein geliebter Herzensmensch
Niemand
Stummer Besuch
Wieder Jahrestag
Die Hand meines Vaters
Zwei Herzen, eine Seele
Verlorenes Leben
Liebste Oma mein ... und Opa, du
Traumfreundin
Wer bist oder warst du?
Späte Geständnisse
Letzte Worte
Bewusst
Flaschenpost zum Himmel
Jenseits der Stille
Zum Abschied für meine geliebte Oma
Warum ich dir schreibe
Schweigen bis in alle Ewigkeit
Wie das kleine Mädchen seine Mutter wiederfand
Und was ich dir noch sagen wollte
An mein Handfegerlein
Unvergessliche Erinnerungen
Grenzenlosigkeit
Was ich dir schon immer sagen wollte, aber nie wirklich konnte
Lieber Simon ...
Wenn die Wiesen glänzen
Einfach mitgenommen
Mein liebes Kind
Offene Fragen
In Memorandum an Omi Mariechen
Unüberbrückbare Klüfte
Unser Frühling
Abschied einer Mutter
Vergiss uns nicht
Happy Birthday, Bruderherz
Ein letzter Brief
Dunkle Tage
Kein Abschied
Auf Opas Spuren
In Dankbarkeit
Eines Tages werden wir uns wiedersehen
Was ich dir noch sagen wollte, Anna ...
Mein liebster Bruder
Die letzten Worte
Abschied in Ehren
Liebestraum
Sterne der Erinnerung
Unerreichbar
Wenn
An Michi
Abschied
Das Innere meines Herzens
Danke, Opa
Und so schwimmt in jeder Träne auch ein bisschen Glück ...
Bis zum Mond
Erinnerungen
Auszeit für immer
Ein Vater
Paragleiten
Unausgesprochenes
Liebe Oma
Die Blüte trägt den Samen ...
*
Für Barisa
Auf meinem Schreibtisch liegt ein Bogen. Weiß und leer. Worten, die ich in Gedanken formuliere, mangelt es an Tiefe. Meine Finger tasten in der Luft, sie versuchen, aus dem Nichts einen Brief zu kreieren. Sie wollen Sätze aufgreifen, die widerspiegeln, was ich für dich empfinde. Unsere nie zu ihrem körperlichen Ausdruck findende Beziehung verdient nach all den inzwischen vergangenen Jahren ein paar Zeilen, die verdeutlichen, Barisa, so fremd wie es dein Name laut Übersetzung besagt, sind wir uns nicht geblieben, doch so nahe wie ich wollte, sind wir uns niemals gekommen. Von Anfang an bedingten die Gelübde unserer beiden, wohlgemerkt unglücklichen Ehen, dass wir nicht zueinanderfinden durften.
Sind wir durch die Fesseln der Bis-dass-der-Tod-uns-scheidet-Litanei wahrlich bis ans Ende unserer Tage an unsere Partner gekettet? Diese trotzige, der Gesellschaft vorgegaukelte Zufriedenheit mit meiner Beziehung, die ich auf Nachfrage zum Besten gebe, kann dauerhaft nicht die Antwort sein auf die Trennung von dir, auf unser stets verbanntes Bedürfnis nach Intimität.
„Man lebt.“
„In jeder Ehe gibt es Zwist. Bei euch wird es ja nicht anders sein.“
„Man schlägt sich und verträgt sich.“
Auszüge aus dem Repertoire von Beschwichtigungen, die grundlegend brüchige Ehen über ihr Verfallsdatum hinaus aufrechterhalten.
Eine Lungenembolie, mein Leben war zeitweise ein Tanz auf des Messers Schneide, hat mir verholfen, im Diesseits bewusstere Entscheidungen zu treffen. Du bist mir wieder eingefallen. Deine Abwesenheit. Ach, Barisa, du fehlst mir so. An jedem Tag.
Seit du die Arbeitsstelle gewechselt hast, sind unsere Zusammenkünfte verebbt. Jene durch verstandesgemäße Zurückhaltung und gebremste Leidenschaft charakterisierten Mittagspausen haben sich endgültig ausgeschlichen.
Wem, außer vielleicht unseren Partnern, soll ich hierzu gratulieren? Was können wir uns von unserem lückenlos reinen Gewissen letztlich kaufen?
Womöglich brauchte ich die mir sämtliche Sinne raubende Erkenntnis, wir würden uns wohl nie wiedersehen, deine jähe Unerreichbarkeit, damit mir einleuchtete, sporadische Grenzüberschreitungen meinerseits hätten unsere freundschaftliche Zuneigung belebt und unseren Partnern nicht wehgetan. Meine ich. Rede ich mir ein. Falls wir uns nochmals begegnen sollten, werden dich meine Arme umschlingen und mit keiner Faser meines Körpers werde ich mich in Beherrschung üben. Versprochen. Barisa.
Ich eifere. Aufgrund meiner verstrichenen Chance, die möglicherweise stellvertretend ein anderer ergriffen hat. Meine zufälligen Berührungen waren zu zaghaft, um in dir etwas zu entflammen, dass dir unausweichlich dargelegt hätte, wir seien füreinander bestimmt.
Wir haben telefoniert, Aufträge bearbeitet, Notizen gemacht, all die routinierten Tätigkeiten, die unser Job forderte, sie gegen Bezahlung zu verrichten. Wie konnten wir übersehen, wer wir irgendwo in den Winkeln unseres Unterbewusstseins von jeher füreinander gewesen sein mussten? Plötzlich unser Erkennungsblick, der eine Blitz, die Explosion. So intensiv haben wir uns in die Augen gesehen, dass unsere Glieder anfingen zu zittern, dann war es geschehen. Um dich. Um mich. Um uns. Ein Band hat uns zusammengeschnürt. Hatten wir nichts Besseres zu tun, als uns aus dieser himmelsverwandten Enge herauszuschälen?
Deine letzten Stunden in meiner Firma? Eine Tragödie. Deine Nichtverfügbarkeit schwärt wie ein Wunde. Sobald ich mir die oft stummen Momente unserer Zweisamkeit hervorrufe, entzündet sie sich vor Sehnsucht. Ich schwitze. Ich kreische. Deine Schultern sind Landeplätze, die meine Hände bereisen müssen, und solange das Herz in meiner Brust nicht gegen deinen Rücken pochen durfte, werde ich nicht sterben können. Meine Erregung will strömen. In deinen Nacken hinein möchte ich hauchen. Meine Lippen wollen deine erkunden, nachahmen, was sie vormachen.
Geschriebene Zeilen, versendete ich sie an dich, könnten missverstanden werden. Es liegt in der Natur eines Briefes, dass er die Intensität meiner Gefühle für dich heruntertemperiert und abschwächt.
Ich befinde mich im Dachgeschoss, springe auf von meinem Sessel, zerknülle das Blatt, sehe aus dem Fenster auf die umliegenden Äcker. Das Korn ist gemäht. Es ist früher September. Einen nächsten Winter ohne dich kann ich voraussichtlich nicht überstehen. Den Stoppeln auf den Feldern werfe ich vor, sie wollten mir demonstrieren, wie wenig übrig geblieben ist von meinen Hoffnungen. Unsere Zusammenarbeit hätte Vorbereitung sein sollen. Für uns. Auf uns. Auf unsere Scheidungen. Wie rasch die Monate durch unsere Finger flossen, uns entglitten. Muss ich mich strecken wie ein Bettler seinen Hut nach ein paar Münzen, um von dir ein Lebenszeichen zu erhalten?
Die Aussicht, zeitlebens von dir abgeschieden zu sein, drängt mich, jedem einzelnen unserer verheißungsvollen Blicke Süße herauszusaugen. Ich bin eine Drohne auf der Jagd nach Reminiszenzen, ein Sammler von Erinnerungsvorrat für mein Depot im Alter. Ich bewege mich zu auf eine Dämmerung. Auf das „Ohne dich“. Auf jenen finsteren Ort jenseits von Fleischeslust. Sommer für Sommer strebe ich nach dir. Und bin doch einsam in meiner Partnerschaft.
Weit in die Stirn gezogen ist mein Strohhut bei den Wanderungen mit meiner Frau. Unter ihm verberge ich das Verlangen nach dir. Nichts aber kann meine Zuneigung zu dir aus meinem Gesicht tilgen. Ihre Arglosigkeit, so denke ich, ist gespielt. Ich bin der miserable Protagonist eines Ich-führe-eine-intakte-Ehe-Films. In wenigen Jahren lasse ich sie zurück. Meine Frau Sonja.
Meine Unrast werde ich nicht ablegen können, bis meine Fahndung erfolgreich verlaufen ist, ich dich gefunden haben werde. Falls irgendetwas am Ende meiner Tage Sinn ergeben sollte, dann nur mit dir, dann ausschließlich wegen deiner Anteilnahme, liebste Barisa.
Noch trabt Sonja neben mir her, immerzu rennt sie, als wüsste sie um den Vorsprung, den sie herausholen müsse. Eine augenfälligere Einstimmung auf unser unweigerliches Auseinandergehen als ihren Vorsprung, den sie bei jedem Spaziergang mit mir zelebriert, kann es nicht geben. In meinem ungestillten Verlangen nach dir erkenne ich ein Scheitern. Keine Woche vergeht ohne die Frage: Warum ist Sonja bei mir und nicht du, Barisa? Die Zeit wird kommen, in der mir die Zimmer meines Hauses zu klein geworden sind. Als mutmaßlich vernunftbegabtes Wesen sollte ich dann der Begierde nach dir ausweichen können. Sag mir wie!
Das Salz getrockneter, niemals anders als hinter deinem Rücken geweinter Tränen, liegt auf meinen Wangen. Barisa, auf das Risiko, du hältst mich für naiv, sobald du winkst, werde ich hier ausziehen und dich hereinbitten in ein neues, eigens für uns beide angeschafftes Heim.
Die kahlen Flächen der abgemähten Felder liegen gleich goldener Teppiche vor meinem Fenster. Meine Drüsen produzieren Barisa-Hormone, sie durchfluten mich mit Starkstrom. Was bringt mich fort von Sonja, was hin zu dir? Mit welcher Methode kann ich ihr meine Abnabelung beibringen. Behutsam, doch unmissverständlich. Weiß Sonja, was für einen seligen Mann sie aus mir machen würde, gäbe sie mich offiziell frei? Frei für eine andere Frau, die sie als Barisa nicht benennen kann, da deren Name in ihrem Wortschatz nicht vorkommt.
„Such dir …“
„Geh doch …“
Derartige von ihr gesprochene Sätze könnten mich ungemein entlasten von einer Schuld, wenn ich sie in unserem riesigen Haus zurücklasse.
Unsere gemeinsamen Spaziergänge sind Fluchtbewegungen Sonjas, sie umreißen für meine Begriffe allzu klar: Nicht länger als nötig soll ich bleiben. Nichts wünsche ich mir inständiger. Ich blühe in Vorfreude bei der Erwägung einer baldigen Loslösung. Die zermürbenden Passagen unserer holprigen Partnerschaft mit bunten Worthülsen zu umgarnen bedarf einer Selbstverstellung, die mittlerweile meine Kräfte übersteigt.
Eine Ehe unter dem Diktat einer Leistungssportdoktrin widerstrebt mir. Mein restliches Leben darf sich nicht damit befassen, eine Strapaze durchzustehen. Gibt mir die Knechtschaft Struktur? Ist unsere Verbundenheit zum Zwang geworden und zur Sucht? Bin ich abhängig von der Gewohnheitsdroge Sonja? Halten wir uns blindlings an unser Eheversprechen, da wir Gefahr wittern, es könnte schlimmer kommen, wenn wir uns Neuem hingeben? „Was wird später sein?“, frage ich mich. Ja, das natürlich.
Falls ich mal nicht dran bin an Briefen, die ich dir schreiben möchte, meine Hemmungen zu überwinden, und schließlich das Papier zerknülle, weil bereits die ersten drei Worte hierzu veranlassen, schleppe ich mich Sonja hinterher. Ihren Ansprüchen. Ihren Auffassungen. Oder mich leibhaftig, während wir gehen.
Hole ich sie ein, umfange ich sie, bin jederzeit bereit, sie in der Umarmung zu ersticken. Sie hält mich ab von dir, Barisa. Das möchte ich ihr heimzahlen. Von Sonnenmilch auf meiner Haut habe ich die gesamte Saison abgesehen. Sonnenbrände übertünchen den Schmerz, der mich befällt, sofern ich grüble, wie wir unsere Arbeitspausen verbracht haben, stets präventiv unsere Hände in den Hosentaschen vergraben, damit nur ja nichts passieren konnte. Nachträglich will ich behaupten, jene Vermeidungsstrategien hätten wir unterlassen sollen.
Bloß in meiner Fantasie kann ich auf Pfaden wandeln, die mich näher an dich heranbringen. Ich trauere um die auf Jahrzehnte hin ausgedehnten Monate, die wir durch unser striktes Enthaltsamkeitsgebaren versäumt haben, weswegen wir jetzt an der Seite anderer Partner verbringen müssen.
An den obersten Zipfel des Ackers, umringt von der Kulisse aus Trauerweiden, Sumpfwiesen und Matschfeldern, reichen meine Blicke heran. Hinaus ins Land muss ich, will ich dich jemals finden. Wegzugehen macht mir Angst. Immerhin habe ich mit Sonja drei Mädchen.
Der Postwagen hält vor unserer Einfahrt. In die Briefkastenklappe geworfen wird eine Sendung. Ich laufe hinunter, entnehme den Umschlag. Außen deine Adresse. Innen deine Telefonnummer. Liebste Barisa, meine bekritzelten Papierbögen verräume ich. Vom Schreibtisch in den Mülleimer.
Ich wähle dich an, es piept, du nimmst ab. Kannst du mein Lächeln hören? Unbestritten. Denn du lächelst ebenfalls.
„Heute Abend?“, frage ich dich.
„Heute Abend“, antwortest du.
Oliver Fahnwurde 1980 in Pfaffenhofen an der Ilm im Herzen Oberbayerns geboren. Der Heilerziehungspfleger lebt bis heute zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in der Kreisstadt. Fahn veröffentlicht regelmäßig Beiträge in Kulturmagazinen und verfasst Texte für Anthologien.
*
Ist das kreativ oder kann das weg?
Es gibt Menschen, die wollen wir gerne vergessen, und doch gehen sie uns einfach nicht aus dem Kopf. Aus irgendwelchen Gründen kommen uns ihre Aussagen, ihre Kommentare immer wieder in den Sinn. Bringen uns zum Nachdenken. Zum Zweifeln. Und nicht immer geht es dabei um die große verflossene Liebe, um eine unschöne oder frische Trennung, es gibt Menschen, die begleiten uns nur ein sehr kurzes Stück unseres Weges und dennoch bleiben ihre Kommentare. Und leider haften nicht nur die Guten.
So geht es auch mir. Kunst ist wichtig. Kunst muss gefördert werden. Immer kürzen sie die Mittel am falschen Ende. Aber Künstler wird man nicht, um Millionen zu machen, Künstler wird man aus Überzeugung. Kunst soll etwas bewirken. Künstler leben für den Moment. Künstler müssen sich auflehnen gegen die Obrigkeit. Den Nachbargarten besetzen. Fenster mit Steinen im Nachbarhaus bewerfen. Einfach nur dagegen sein. Das Künstlermetier ist schon sehr eigen. Vor einiger Zeit hielt ich es für eine gute Idee, in diese Welt einzutauchen und mir ein Bild zu machen von diesen Menschen, von ihren Sorgen. Doch vor allem wollte ich etwas bewegen. Aufmerksam machen. Begeistern. Zeigen, dass Kunst und Kultur mehr ist. Nicht nur verstaubt. Sondern modern.
Doch dann fing es an. Meine Kleidung war zu vornehm, zu modern, zu elegant. Das hatte bisher zu Jeans, T-Shirt und Stiefeln noch nie jemand zu mir gesagt. Doch ich verstand schon am zweiten Tag, was damit gemeint war.
Als ich an dem Morgen zur Arbeit radelte, lachte die Sonne vom Himmel, 30 Grad sollten es werden. Ein wunderschöner Sommertag im Frühjahr. Als ich die Einrichtung betrat, kamen mir kühle 13 Grad entgegen. Wärmer als 17 Grad wurde es auch nicht. Gut, jetzt müssen wir Heizkosten sparen. Aber es war vor dem Russlandüberfall. Heizen kostet Geld und Mitarbeiter können frieren, lautete das Motto der Einrichtung, als ich fragte, ob man die Heizung aufdrehen könnte. Da dies nicht ging, wollte ich lüften, warme Luft in den Raum lassen. Wieder falsch. Die Fenster bleiben zu! Lüften ist insgesamt unerwünscht, auch die Haustür, die für angenehm frische Luft im Treppenhaus sorgen würde, musste verschlossen sein. Die verschlossenen Türen und Fenster heißen neue Besucher nicht gerade willkommen. Licht aus, es ist hell genug! Bildschirmarbeiten in einem dunklen Raum. Das perfekte Disco-Ambiente.
Jeder Arbeitsrechtler hätte den Aufstand geprobt, von wegen Arbeitssicherheit und Gesundheit des Arbeitnehmers. Aber die kümmerte in dieser Einrichtung die Chefetage wenig. Respekt gegenüber Mitarbeitenden Fehlanzeige. Verständnis. Ein Wort, das sie nicht kannten. Und an diesem Ort sollten kreative Ideen entstehen! Neue Bündnisse geschlossen werden und Firmen sich bei ihren Großveranstaltungen wohlfühlen. Wohlfühlen in einem Raum, in dem Pilze an den Wänden wachsen. Kalt und feucht. Ohne Service. Wohlfühlen taten sich hier sicherlich nur die Schimmelsporen, die sich fröhlich an der Wand vermehrten.
Wohlgefühlt habe ich mich nicht. Nicht eine Sekunde. Ob es nur an der unfreundlichen Art der Kollegen lag, an den kalten und uneinladenden Räumlichkeiten? Ich kann es nicht sagen. Aber eines möchte ich noch sagen: Liebe Susan, einen solchen Ort braucht wirklich niemand! Niemand! Du kämpfst für ein Relikt aus vergangenen Zeiten, das die Moderne verschlafen hat. Ein Relikt, so wie auch du es bist. Mit deinen Ansichten. Veraltet. Vermodert. Auch wenn Vintage und Retro in ist, Respektlosigkeit und die Ausgrenzung von Minderheiten wird sich hoffentlich nie wieder durchsetzen. Vielleicht lädst du die LQGTB+ Gesellschaft in dein Haus ein. Aber alle anderen lädst du aus. Ausgrenzung funktioniert immer in zwei Richtungen. Kreativität und kreative Köpfe braucht das Land. Aber du und deine Einstellungen können definitiv weg! Danke für nix. Außer für eine dicke Erkältung im Sommer.
Christina Reinemannwurde 1982 in Nordhessen geboren. Zwischen 2011 und 2014 veröffentlichte sie Bücher im Selbstverlag. Zuletzt erschienen ihre Kurzgeschichten „Qualitätsmanagement“ und „Lebe, Liebe, Lache“ in einer Anthropologie.
*
Brief an Oma
Liebe Oma,
schon vor langer Zeit bist du von uns gegangen und doch muss ich oft an dich denken, wenn ich zurück in meiner alten Heimat bin.
Wie oft hast du am Fenster gestanden und mir hinterhergewunken, wenn ich weggefahren bin? Wie oft kamst du die Treppe hinauf, wenn ich wieder ankam? Du hast dich immer so gefreut und warst so glücklich, wenn ich da war! Du hast mich mein ganzes Leben lang begleitet. Immer warst du für mich da, hast mich getröstet, wenn ich hingefallen war, hast mit mir gelacht und hast mich zugedeckt, wenn mir kalt war. Im Winter hast du mir oft eine Wärmflasche gemacht und dann war es gleich ganz kuschelig warm.
Wir haben lange Spaziergänge unternommen und Brombeeren gepflückt. Du hast mir immer von früher erzählt und dann alle Geschichten für mich aufgeschrieben. Das Buch ist ein großer Schatz, in dem ich gerne lese.
Für dich war die Familie das Wichtigste im Leben und du hast immer gerne alle um dich gehabt.
In meinem Regal steht ein altes Bild, auf dem du mit deiner Familie Weihnachten feierst. Deine Eltern und Geschwister sind bei dir und du lächelst glücklich in die Kamera.
Noch heute blühen deine gelben Blumen im Garten, beim letzten Besuch habe ich mir einige ausgegraben und in meinem Garten eingepflanzt. So habe ich einen Teil von dir mitgenommen und bin ganz sicher, dass du bei mir bist, wenn sich die gelben Blüten im Wind hin und her beugen, als würden sie tanzen.
Liebe Oma, ich wollte dir noch sagen, dass ich dich sehr vermisse.
Deine Enkelin
Dörte Müller, geboren 1967, geboren und aufgewachsen im Harz, schreibt und illustriert Kinderbücher. Sie lebt mit ihrer Familie in Bonn und freut sich schon, wenn die gelben Blumen wieder blühen.
*
Flügel
Und was ich dir noch sagen wollte: Es gibt sie, die Elfen.
Ich sitze etwas verträumt und gedankenverloren auf meiner Lieblingsparkbank. Hinter und über mir raschelt es und die Bäume werfen nach und nach ihre bunten Blätter ab. Es duftet nach Herbst – etwas rauchig und leicht vermodert. Die Natur zieht sich langsam, aber merklich zurück. „Ach, schade“, denke ich. „Nun ist der Sommer vorbei.“ Ein leises Gefühl von der Sehnsucht nach Sonne und Wärme umhüllt mich. Ich spüre ein leichtes Poltern neben mir, schaue nach links und gucke in zwei lächelnde Augen, etwas spitzbübisch. Dann schaue ich genauer hin. Huch, eine Elfe.
Sie zeigt nach oben und ruft: „Wer ist zuerst in der Baumkrone?“ Und zack, ist sie auch schon weg. „Wo bleibst du denn?“, ruft sie einen Moment später. Und sie ist schon wieder auf dem Weg zurück zu mir. „Ich war schon fast oben!“
Ich drehe mich etwas zur Seite und zeige ihr meinen Rücken. „Oh“, meint sie nur.
Ich blicke etwas traurig und sage: „Ich habe meine Flügel gestutzt.“
Nun schaut sie sich meinen Rücken etwas genauer an. „Da klebt etwas!“, ruft sie mit ihrer hellen, lauten Stimme. „Dein linker Flügel ist festgeklebt. Irgendwie fixiert. Mit einem schwarzen Aufkleber. Ich knibbel den mal ab. Okay?“
„Klar“, sage ich. Aber innerlich sträube ich mich etwas dagegen. Der Aufkleber hat mich ja schließlich mein Leben lang begleitet. Irgendwie habe ich den lieb gewonnen. Das sage ich ihr aber natürlich nicht.
Sie zeigt mir den Aufkleber. Ich lese laut vor: „Ich muss.“ Oh! Na, der kann aber wirklich mal langsam weg. Und sofort spüre ich meinen linken Flügel. Wie schöööön. Und ich erinnere mich daran, wie ich ihn als Kind bewundert habe. So feingliedrig. In der Sonne hat er kunterbunt geschimmert.
„Hm“, meint die Elfe. „Auf deinem rechten Flügel steht auch noch etwas.“
„Was denn?“, seufze ich.
„Ich darf nicht“, antwortet sie. „Das ist schon etwas schwieriger“, entgegnet die kleine Elfe. Sie verharrt einen Moment und überlegt angestrengt. „Der Satz ist irgendwie eintätowiert. Komm, wir verbinden uns und denken gemeinsam gaaaanz fest an die Liebe und an Freiheit und alles ist ganz hell und voller Licht.“ Sie nimmt meine Hand und kaum haben wir damit begonnen, an all das Schöne und Positive zu denken, erscheint ein Lichtstrahl und überschreibt meine alte Aussage.
Ein neuer Schriftzug entsteht: Ich darf! Ich spüre, wie das Blut langsam und ganz sanft in meine Flügel einströmt. Ein leichtes Ziehen und Kribbeln. Dann recke und strecke ich mich und ein warmes Lächeln überzieht mein Gesicht.
Die Elfe hilft mir auf, schiebt mich von hinten etwas an und stützt mich. Der erste Flug! Noch etwas unsicher und wackelig. Aber ich spüre sie schon, diese neue Freiheit. Tun und lassen zu dürfen, was ich möchte. Sein zu dürfen, wer ich bin, und mir alles, wirklich alles zu erlauben.
Die kleine Elfe ist so schnell weg, wie sie gekommen ist. „Bis morgen“, ruft sie mir noch winkend aus der Ferne zu. „Dann treffen wir uns wieder hier und fliegen hoch in den Baum. Und wir springen und hüpfen von Blatt zu Blatt.“
Ich lächle und winke wie verrückt und vor lauter Freude und Vorfreude hebe ich mit einem festen Flügelschlag noch mal kurz vom Boden ab.
Fantastisch. Und ich denke immer und immer wieder: „Flügel. Flügel. FLÜGEL.“
Stefanie Bräunig schreibt seit einigen Jahren Kurzgeschichten und Gedichte. Manche davon fallen dabei geradezu vom Himmel. Andere entfalten sich auf ihrem Sofa sitzend zur Musik. Auf ihrer eigenen Website herzensgut-do.de teilt sie ihre Gedanken und Erlebnisse in Form von Texten, selbst gemalten Bildern und Fotografien. Sie begegnet Flora und Fauna mit einem offenen Herzen, welches weitere Texte tief aus ihr herauszaubert. Über einen wundervollen Sonnenaufgang freut sie sich genauso wie über ein Gespräch über Gott und die Welt bei einem gemeinsamen Spaziergang oder einer Tasse Kaffee.
*
Gedanken in der Nacht
Warum denke ich gerade jetzt an dich? Obwohl ich dich doch gar nicht kenne. Liegt es am Thema dieser Ausschreibung? Fünfzig Jahre habe ich kaum einen Gedanken an dich verloren.
Wozu auch?
Mir ist flau im Magen, doch die Gedanken sind da, ich kann mich nicht dagegen wehren.
Ich hätte dich gebraucht, als Vater und als Freund. Einen, der mit mir spielt oder ein Fahrrad repariert. Einen, zu dem ich aufsehen kann. Was ich von dir weiß, das hat mir Mutter erzählt, aber das ist nicht viel. Sie hatte es nicht leicht im Leben, doch all ihre Liebe schenkte sie mir. Es fehlte mir an nichts, außer einem Papa.
Ich glaube, sie hat dich nie vergessen. Mutter trug bis zu ihrem Tod dein Bild bei sich. Dies war in einem kleinen roten Mäppchen. Neben deinem war auch mein Bild. Wir sahen uns verdammt ähnlich. Auch ich hatte ein kaputtes Auge, wie seltsam.
Warum war ich dir egal? Ich sehnte mich nach einer Familie. Nicht, dass ich keine hätte. Aber sie war nicht komplett. Als uneheliches Kind wurde ich in der Schule gehänselt – und keiner war da, der mir half.
Ich kann mich gut erinnern. Mit sechzehn wollte ich dich kennenlernen. Mutter warnte mich davor. Und sie behielt recht. Du hast dich verleugnen lassen. Und später wurde mir gesagt, da kamen mir die Tränen, du wolltest mich nicht sehen.
Ich war so enttäuscht und voller Wut.
Das war der Tag, an dem ich dich vergessen habe.
Ich weiß nicht, ob ich Geschwister habe. Aber eines weiß ich, du hast zwei wundervolle Enkel, die nach ihrem zweiten Opa fragten, als sie noch klein waren. Ihnen schenkte ich meine Liebe, damit sie mein Leid nie erleben sollten.
Vielleicht hätte ich dich später doch noch suchen sollen. Aber ich wollte es nicht.
Und nun frage ich mich, ob dies richtig oder falsch war.
Gedanken eines Siebzigjährigen in der Nacht. Keiner kennt meinen Kummer.
Aber das Leben ist, wie es ist.
Dieter Geißler, geboren 1954 in Weimar, Ausbildung zum Koch, danach Studium an der Fachschule für Gaststätten- und Hotelwesen Leipzig. Heute lebt der Rentner in Frankenheim, in der „Hohen Rhön“. Durch eine Krankheit kam er mit 57 Jahren zum Schreiben. Er verfasst Gedichte und Kindergeschichten. In verschiedenen Verlagen wurden von ihm Gedichte und Kindergeschichten veröffentlicht.
*
Mutter, du hast dich sterben gelegt
Mutter, du hast dich sterben gelegt –
du fühlst, dass dein Räderwerk stockt.
Wir haben dich so gut, wie wir konnten, gepflegt
und dir noch so manches Lächeln entlockt.
Ein ganzes Jahrhundert beinahe durchschritten,
so wenig bekommen, so vieles erlitten;
hast Krieg und Verfolgung, Kummer und Leid,
auch bittere Armut erlebt
und trotzdem der Jugend glückliche Zeit
in deine Erinnerung gewebt.
Für dich kommt ein anderes Kind grad zur Welt,
versucht, alles besser zu machen;
wird vieles erträumen, was das Leben nicht hält
und wird wie du weinen und lachen.
Es wird ihm nicht alles auf Silber gereicht,
kein Lorbeer umsonst ihm gebracht –
doch mit deinem Leben hast du’s ihm vielleicht
ein klein wenig leichter gemacht.
Dr. Franz Mach,geboren 1954 in Wien, nach der Matura Medizinstudium, Facharztausbildung zum Chirurgen, 25 Jahre eigene Praxis in Klosterneuburg. Seit der Jugend Verfassen von Gedichten, Liedern und Songs. Mehrere öffentliche Aufführungen im Rahmen von Liederabenden.
*
In Liebe John
Meine liebe Motte,
du wunderst dich sicher, weshalb du plötzlich einen Brief in deinen Händen hältst, der meinen Namen als Absender trägt. Wir hatten die letzten drei Jahre keinen Kontakt, was ich mir ankreide. Motte, ich war nicht immer eine große Stütze für dich. Besonders nicht in den Momenten, in denen du mich so gebraucht hättest. Das tut mir unendlich leid. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber ich möchte dir etwas mit auf den Weg geben. Etwas, was ich schon längst hätte sagen sollen, mich aber nie getraut habe.
Ich bin so stolz.
Ich frage mich, wie du dich all die Jahre gesehen hast. Warst du auch stolz? Ich frage mich das, weil ich dich nie gefragt habe. Du schienst immer so beschäftigt zu sein. Beschäftigt mit dir selbst. Voll eingebunden in deinen Alltag.
Ich habe mich gefreut für dich. Ich weiß, dass der Weg dorthin schwer war, und ich weiß, dass du es nicht immer leicht hattest.
Manche gehen leichtfüßig durchs Leben. Man könnte meinen, sie schweben oder tanzen im Takt des Glückes.
Manche aber treten auf der Stelle. Sie sinken immer wieder ein. Du warst so jemand. Es hat mich jedes Mal geschmerzt zu sehen, wie du scheiterst.
Aber ich habe dich auch bewundert. Oh, wie ich das tat. Die Stärke, die du an den Tag legst, faszinierte mich schon immer.
Du kämpfst.
Für dich.
Ich bin so dankbar.
Wo dein eigenes Leid ist, dort ist die Liebe nicht weit fort. Anstatt dich zurückzuziehen, bist du zu mir gekommen. Du hast aus meinem Gewitter einen Regenbogen gezaubert. Obwohl du es nicht geschafft hast, für dich selbst die Sonne scheinen zu lassen. Ich bin dankbar, dass ich deine Fürsorge und deine Liebe spüren durfte, wann immer ich sie brauchte. Obwohl ich nie danach gefragt habe. Danke, dass du mein Leben begleitet hast. Du hast mir gezeigt, was bedingungslos bedeutet.
Es gibt kaum jemanden, der heller leuchtet, obwohl er nicht vor Freude strahlt. Doch weiß ich nicht, ob du dies je gesehen hast, wenn du in den Spiegel blicktest. Ich wünschte, ich hätte dich gefragt …
Motte, wann immer du einsam, traurig oder frustriert bist, so nimm dir diesen Brief zur Hand. Bewahre in bei dir für die Zeit, in der ich nicht mehr sein werde.
In Liebe
John
Valerie Wernitz,26 Jahre, aus Hamburg. Die Autorin hat Pädagogik studiert und arbeitet gerne mit Kindern. In ihrer Freizeit entdeckt sie neue Orte und macht entspannte Aktivitäten wie Yoga. Sie schreibt besonders gerne Gedichte und lyrische Werke. Neben dem Schreiben macht ihr auch das Nähen und Stricken sehr viel Spaß.
*
Die Traueranzeige
Er sitzt allein auf einer Bank im Park nahe dem Bestattungsunternehmen. In der Hand hält er einen Zettel, auf dem ihm die freundliche Mitarbeiterin verschiedene Formulierungen für die Traueranzeigen aufgeschrieben hatte. Eine nach der anderen liest er sie erst stumm und dann leise sprechend durch. Er ist sich bei der Wortwahl im Zweifel, die den Tod seiner geliebten Ehefrau nennt. Jedes einzelne Wort prüft er darauf ab, ob es zu dem traurigen Ereignis passt.
Obwohl er seine Frau sehr geliebt hat und seine Ehe weit über die Silberhochzeit hinaus bestand, hält er die Formulierung meine innig geliebte Frau für unangebracht. Eine derartige Formulierung, meint er, sei etwas für Jungverheiratete oder für Paare, die viel, viel länger verheiratet gewesen waren als er. Für ihn drückt gerade dieses Wort innig etwas Einengendes aus, so als wenn er seine Ehefrau mit seiner Liebe (und den sogenannten Liebesbezeugungen) bedrängt oder gar eingeengt hätte. Dem war aber nicht so. Er liebte sie stark, aber nicht bedrängend und einengend.
Nachdem er sich für meine liebe Frau entschieden hat, liest er nun die zahlreichen Worte, die das Sterben bezeichnen. Auf seinem Zettel stehen die Begriffe: gestorben, verstorben, erloschen, tot, verschieden, hingeschieden, verblichen, erlöst, ausgelitten, entschlafen, heimgegangen, geendet, krepiert, von hinnen gegangen, das Zeitliche gesegnet.
Einige Begriffe scheiden sofort aus. Er nimmt einen Stift und streicht die Worte durch, die auf gar keinen Fall infrage kommen. Dann überdenkt er die restlichen Worte und stellt fest, dass aufgrund des – Gott sei Dank – sanften, nächtlichen Todes, keine Begriffe zu wählen sind, die mit einer quälenden Erkrankung in Verbindung stehen. Es bleiben nur wenige Worte übrig.
Er besinnt sich auf das Glaubensbekenntnis seiner Kirche. Dort heißt es: gekreuzigt, gestorben und begraben … Ja, entscheidet er sich, dort steht dieses gestorben, das passt zu ihrem Tod. Alles andere, meint er, sind Bezeichnungen, die das doch zwar hart klingende Wort sterben etwas weicher erscheinen lassen sollen. Wenn die Worte verblichen, entschlafen oder von hinnen gegangen gewählt werden, dann hat der oder die Hinterbliebene bestimmt sogenannte Zukunftsangst und will sich durch diese genannten Worte selbst beruhigen, ist er überzeugt.
Nachdem er sich für das gestorben entschieden hat, muss er noch darüber nachdenken, ob er die Beerdigung, das Begräbnis, die Bestattung oder die Beisetzung anzeigt. Er will sich morgen, wenn er die Mitarbeiterin im Bestattungsinstitut erneut aufsucht, mit ihr unterhalten und sich die eventuell vorhandenen Unterschiede des Ablaufs erklären lassen. Sollte sich herausstellen, dass alle Begriffe problemlos austauschbar seien, will er Beerdigung wählen.
Dass dieses Ereignis an der Grabstelle in aller Stille ablaufen soll, darüber besteht bei ihm kein Zweifel.
Seine Ehefrau war eher in sich gekehrt, als dass sie eine Person war, die an allen Festen teilnehmen und ständig der Mittelpunkt sein musste. Sie hätte es bestimmt gewollt, wenn im Anschluss an die Beisetzung kein Treffen im nahe gelegenen Restaurant stattfinden würde.
„Weshalb“, so meinte sie einmal, „weshalb soll man denn Menschen, mit denen man nicht viel zu tun hatte, im Anschluss an eine Beerdigung auch noch verpflegen? Eine Trauerfeierlichkeit ist keine Party, auf der der Tod eines lieben Menschen gefeiert, bejubelt und vielleicht sogar im Alkohol ertränkt werden soll.“
Einerseits, denkt er jetzt, hatte sie recht. Andererseits, fällt ihm dazu aber auch ein, könnten dabei gute Erinnerungen an die Verstorbene ausgetauscht werden. Jeder erinnert sich vielleicht an eine andere Situation oder Begebenheit, die das Bild der Verstorbenen in den Köpfen der Trauernden komplettiert. Die Traurigkeit weicht dann vielleicht bei den Trauernden und es macht sich Dankbarkeit breit. Dankbarkeit, dass man dieser jetzt beerdigten Frau eine kurze oder lange Zeit ihres Lebens nahe sein, sie begleiten und sie – im wahrsten Sinne des Wortes – erleben durfte.
Und als ein kleines Dankeschön für die Mühen, die sich einige während der letzten Tage mit ihr und ihm in Form von Gesprächen und Handreichungen gemacht hatten, sollte dieses Beisammensein auch gesehen werden.
Nach jedem Gedanken daran fragt er sich leise: „Was hätte meine Frau dazu gesagt? Wie hätte sie entschieden?“ Und er bedauert, nie direkt und abschließend mit ihr darüber gesprochen zu haben.
Jetzt kann er es nicht mehr tun.
Bis morgen muss er sich entscheiden.
Traurig faltet er den Zettel und denkt noch lange über seine liebe Ehefrau und seine jahrzehntelange Beziehung zu ihr nach. Tieftraurig macht er sich schließlich auf den Weg nach Hause.
Charlie Hagistwurde 1947 in Berlin-Steglitz geboren. Nach Grund- und Oberschule absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Während seiner Tätigkeit in der Personalabteilung des Hauses bildete er sich zusätzlich zum Personalfachkaufmann (IHK) weiter. Ehrenamtlich war er als Richter am Amtsgericht Berlin-Tiergarten, am Sozialgericht Berlin und danach am Landessozialgericht Berlin tätig. Charlie Hagist ist verheiratet, hat einen Sohn.
*
Mein geliebter Herzensmensch
Mein geliebter Seelenmensch!
Am Sonntagmorgen um 04.25 Uhr hat sich deine Seele endgültig von der irdischen Hülle gelöst und durfte ins göttliche Licht eintauchen. Es war der Moment des definitiven Loslassens und danach hatte ich nur noch einen Gedanken: „Jetzt bin ich nur noch ein halber Mensch ohne dich.“
Trotz des großen Schmerzes weiß ich mit Sicherheit, dass es dir auf der andern Seite des Regenbogens gut geht und diese Gewissheit tröstet mich unendlich.
Nun sitze ich in der ersten Reihe der Kirche, alle unsere Verwandten, Bekannten und Freundinnen sehen mich traurig an, denn sie können erahnen, was gerade in mir vorgeht. Eigentlich wollte ich den Abschiedsbrief an dich persönlich vorlesen, aber ich schaffe es nicht und so übernimmt unsere Freundin Regula diesen Liebesdienst.
Ich möchte dir noch so viel sagen und ich denke, all die anwesenden Trauernden haben ein Anrecht darauf, deine Lebensgeschichte kennenzulernen, denn sie ist etwas ganz Besonderes. Ebenso wie du es warst. Wie schlimm das klingt: So wie du es warst. In Zukunft werde ich immer in der Vergangenheit von dir sprechen müssen, aber für mich lebst du in meinem Herzen immer weiter.
Nun hören wir in den Abschiedsbrief und dein Leben hinein.
Deine Mutter war zur Zeit deiner Schwangerschaft schwer gezeichnet von einem Kriegstrauma. Die Ärzte hatten ihr prophezeit, dass sie das Kind nie zur Welt bringen würde. Da hatten sie die Rechnung ohne deinen Willen gemacht, denn mitten in einer Oktobernacht ertönte dein erster Schrei. Offenbar glauben die Ärzte immer noch, du würdest nicht überleben und du wurdest mit der Nottaufe verstehen. Als du mit deinen Eltern nach Hause durftest, verschlimmerte sich der psychische Zustand deiner Mutter so sehr, dass sie in eine Klinik eingeliefert wurde und du im zarten Alter von sechs Monaten in ein von Nonnen geführtes Heim kamst. Die waren aber mit der Pflege eines Säuglings dermaßen überfordert, dass du dank einer Sonderbewilligung der Gemeinde in ein normales Kinderheim übersiedeln durftest. Dort bist du bis zur Wiederverheiratung deines Vaters geblieben und als zehnjähriges Mädchen kamst du in ein echtes Zuhause. Oft hast du danach an die Zeit im Heim zurückgedacht, denn es war nicht immer einfach mit der Stiefmutter. Du warst stets eine fleißige Schülerin und nach Abschluss der offiziellen Schulzeit wurdest du im Schirmgeschäft deiner Cousine als Lehrtochter eingestellt und später konntest du als Geschäftsführerin sogar den Laden übernehmen und hast selber viele Lehrtöchter ausgebildet.
Dann, eines Tages im Spätherbst, als du in das Haus umgezogen bist, in dem ich schon einige Jahre gewohnt hatte, haben sich unsere Wege zum ersten Mal gekreuzt und schon bald haben wir gespürt, dass unsere Gefühle füreinander mehr als Freundschaft waren ... es war ganz einfach Liebe. Es gab natürlich Leute, die fanden unsere tiefe Verbundenheit nicht normal, denn sie konnten ja nicht ahnen, dass sich da zwei Seelen gefunden hatten, die zufällig äußerlich in der gleichen Karosserie steckten. Im Laufe der Zeit jedoch, nachdem bei dir die ersten Anzeichen der lebensbedrohenden Krankheit sichtbar wurden, merkten auch Zweifler und Verurteiler, dass uns offenbar das Schicksal zusammengeführt hatte.
Nach dem Tode deines Vaters verschlimmerte sich dein Gesundheitszustand, und als du nach einer Operation aus der Narkose aufgewacht bist, hatten deine Nieren ernsthafte Probleme. Seit deinem 30. Lebensjahr hattest du immer zu hohen Blutdruck, der leider nur mit Tabletten behandelt, aber dessen Ursache nie gesucht worden war.
Die Ferien im Piemont wurden zur Katastrophe, denn du konntest nachts nicht mehr richtig atmen und wir mussten notfallmäßig nach Hause zurückkehren. Natürlich wurdest du sofort von Kopf bis Fuß untersucht und dabei hat sich herausgestellt, dass du bereits ein chronisches Nierenversagen hattest. Dadurch hatte sich Wasser auf der Lunge angesammelt. Du musstest sofort ins Spital und dort dreimal wöchentlich an die Dialyse. Nach zwei Jahren hast du dich für die Bauchdialyse entschieden, die du viermal täglich zu Hause selber durchführen konntest. Drei Bauchfellentzündungen warfen dich gesundheitlich in ein tiefes Loch und du musstest deinen geliebten Beruf aufgeben.
Dann, acht Jahre später, wurde dir mit einer neuen Niere auch ein neues Leben geschenkt, denn die Lebensqualität wurde durch die Transplantation merklich verbessert.
Allerdings hielt die Freude darüber gerade mal zwei Jahre, denn innerhalb von wenigen Monaten hast du zweimal einen Hirnschlag erlitten und nach dem zweiten gestaltete sich die Rehabilitation sehr schwierig und dauerte drei Monate. Danach durftest du wieder nach Hause und mit einer externen Spitalhilfe, die fünfmal wöchentlich morgens zwei Stunden das Nötigste erledigte, durften wir wieder gemeinsam die Tage genießen. Es gab solche und solche Tage, aber wir waren für jeden schönen Moment dankbar. Ich habe deine positive Einstellung und den einzigartigen Humor immer bewundert. Trotzdem waren wir uns bewusst, dass wir auf einem Vulkan lebten, der jederzeit wieder ausbrechen konnte. Zur Erhaltung der transplantierten Niere musstest du täglich Unmengen von Tabletten schlucken, was nach den Hirnschlägen immer schwieriger wurde, da du nur noch mit großer Anstrengung die Kapseln hinunterschlucken konntest. Ich schluckte jeweils mit und zählte immer wieder: „Eins, zwei, drei, schlucken.“ Du gabst dir solche Mühe und warst für alles sehr, sehr dankbar. Wenn ich in dieser Zeit etwas gelernt habe, dann sind das Geduld und Dankbarkeit. Du warst mein leuchtendes Vorbild und wirst es immer bleiben.
Trotz aller Bemühungen wurde die Leistung der Niere immer schwächer und die Ärzte sprachen wieder von Dialyse, aber davon wolltest du nichts mehr wissen, denn du warst viel zu geschwächt.
Ja, ich konnte deine Entscheidung verstehen, auch wenn mir bewusst war, was dies bedeutete. In absehbarer Zeit würde deine Lebenskerze erlöschen. Als der Zeitpunkt kam, durftest du bei uns zu Hause im Dabeisein einer lieben Freundin, einer Ärztin, deine Seele auf die Reise schicken.
Mit einem dankbaren Lächeln im Gesicht hast du diese Welt verlassen. Ein paar Tage zuvor durfte ich in deinen Augen lesen:
Nun trage ich einen Teil von dir
hinaus in die göttliche Ewigkeit.
Nun trägst du einen Teil von mir
für den Rest der irdischen Vergänglichkeit.
Mein geliebter Herzensmensch, ich danke dir für alles, was ich mit dir erleben durfte, für deine Liebe und deinen Glauben an das ewige Leben. Du bist jetzt in guten Händen und unsere Liebe ist unsterblich, denn,
die Liebe hat sich nun gewandelt:
sie ist unendlich zart,
still
und dennoch voller Lebendigkeit,
fern,
aber in jedem Augenblick gegenwärtig.
Sie ist geheimnisvoll
und doch ganz klar, rein und frei
von allen Dingen dieser Welt.
Nun ist sie daheim
in der Geborgenheit des Herzens,
im Schutze der Erinnerungen:
unantastbar,
unbesiegbar, unverlierbar.
Ewig dein bis zu unserem Wiedersehen.
Jeannine Di Marcoist eine 73-jährige, jung gebliebene vierfache Oma, die seit der Pensionierung ihre Leidenschaft zum Schreiben auslebt. Als ehemalige Deutschlehrerin und soziokulturelle Animatorin, die gerne in der freien Natur und mit Tieren lebt, bevorzugt sie Kurzgeschichten, sei es für Erwachsene oder für Kinder. Ihr bisheriges Leben ist geprägt von Höhen und Tiefen, aber sie lebt nach der Überzeugung, dass wir für jeden Tag dankbar sein und die schönen Momente genießen sollten. Das Leben ist ein Geschenk.
*
Niemand
Niemand hat mich je gefragt, wolltest du so leben,
denn dann hätt’ ich Nein gesagt, hab so viel gegeben.
Vieles, was mir wichtig war, habe ich verloren.
Doch für meine Tochter kämpf ich, ich hab’s mir geschworen.
Irgendwann, da wird sie fragen: „Wie hast du’s geschafft?“
Unter Tränen werd ich sagen: „Nicht aus eigner Kraft.“
Eines gebe ich ihr mit, vertrau auf Gott allein,
glaub an dich und bleib dir treu,
denn er wird bei dir sein.
Michaela Goßmann, Jahrgang 1984, ist Lehrerin in Mainz.
*
Stummer Besuch
Als ich vor der Tür stehe, nehme ich noch einen tiefen Zug von der Zigarette, die fast schon bis zum Filter abgebrannt ist. Einen Moment überlege ich, ob ich nicht einfach wieder gehen soll, anstatt zu klingeln. Doch während ich noch zögere, wird schon die Tür aufgerissen. Man erwartet mich. Ich zucke zusammen und schnippe den glühenden Stummel hinaus auf die Straße. Eine Dame im weißen Kittel bittet mich einzutreten und ich folge ihr über das knarrende Parkett durch den Flur. In der Luft liegt ein muffiger, stickiger Geruch. Er wird stärker, als wir durch einen zerschlissenen Fadenvorhang in die Stube gelangen. Ich blicke mich um, bis meine Augen an der Gestalt vor dem Fenster hängen bleiben.
Es ist erschreckend, sie so zu sehen. Dass sie im Rollstuhl sitzt, habe ich gewusst. Aber keiner hatte mich davor gewarnt, was mich sonst hier erwarten würde. Ich mustere ihren aufgedunsenen Körper, der bei jeder zuckenden Bewegung ihrer Hände erbebt. Ihr Gesicht ist fahl und irgendwie verzogen, als hätte man eine Wachsfigur in der Sommerhitze stehen lassen. Ihre eingefallen Augen blicken stier umher und scheinen doch nichts richtig wahrzunehmen. Ich versuche mich daran zu erinnern, wie sie früher ausgesehen hat, als ich ihr Schlüsselkind gewesen bin. Doch da ist kein Bild in meinem Kopf. Nur eine vage Erinnerung an warme Umarmungen, heiß geliebten Kartoffelauflauf zum Mittagessen und Schulaufgaben am Küchentisch. Sonst nichts. Es ist zu viel Zeit vergangen.
„Besuch ist da“, schnarrt die Pflegerin mit polnischem Akzent und schiebt den Rollstuhl Richtung Tisch.
Der freie Stuhl nebenan wird mir angeboten. Ich atme tief ein und nehme Platz. Versuche irgendwie, den Blick der umherstreifenden Augen einzufangen. Weiß sie, dass ich da bin? Und wer ich bin?
Hilfe suchend schaue ich zu der Pflegerin, doch sie lächelt nur und geht hinaus. Um Kaffee zu kochen und nicht zu stören, wie sie sagt. Ich klammere mich an den mitgebrachten Blumenstrauß. Mir fallen keine Worte ein. Was sagt man einer sterbenden Frau? Ihr rasselnder Atem in der Stille ist unerträglich. Unerwartet stoppt ihr Blick und es ist, als studiert sie mein Gesicht. Auf der Suche nach etwas Vertrautem.
„Ich freue mich, dass du mich einmal besuchst.“ Für einen kurzen Moment scheinen ihre glasigen Augen plötzlich zu strahlen. „Was ist das her, dass ich dich im Arm hatte. So ein kleines Bündel bist du gewesen. Wir haben den Strampler umknicken müssen, weil deine Beine so kurz waren.“ Ganz hinten aus ihrer Kehle bahnt sich etwas wie ein Lachen gemischt mit krächzendem Husten den Weg. Dann triftet ihr Blick wieder ab.
Nervös rutsche ich auf meinem Stuhl hin und her. Ich muss mich zusammenreißen, nicht die bunten Punkte auf der Tischdecke zu zählen. Es schreit förmlich danach. Als Kind habe ich das immer getan.
„Du musst etwas sagen“, denke ich. „Irgendetwas.“
Die Gedanken in meinem Kopf rasen und überschlagen sich. Doch ich schaffe es nicht, einen von ihnen zu greifen und festzuhalten. Draußen höre ich das Parkett knarren. Ich bin regelrecht erleichtert, dass die Pflegerin zurückkommt. Sie stellt die Blumen ins Wasser und ich habe nichts mehr, woran ich mich festhalten kann. Ich presse meine schwitzigen Hände auf meine Oberschenkel.
„Ein besonderer Tag“, sagt die Pflegerin, als sie den Kaffee serviert. „Sie bekommt nicht viel Besuch.“
Ich starre betreten auf das Porzellan mit Blümchen.
So oft hatte ich mir das vorgenommen. Wenigstens ein Anstandsbesuch. Das war ich ihr schuldig. An der Entfernung hatte es nicht gelegen. Aber die Angst vor diesem Moment war zu groß gewesen. Tausend Mal habe ich ihn schon in meinem Kopf ablaufen lassen. Und jetzt, wo er da ist, fühlt er sich noch unangenehmer an, als ich ihn mir ausgemalt hatte.
Ich hebe den Kopf, um nach der Zuckerdose zu greifen. Da bemerke ich die Schnabeltasse mir gegenüber. Die Pflegerin legt sie in die zuckenden Hände und hilft, sie zum Mund zu führen. Hilflosigkeit breitet sich in mir aus. Schluckende Laute sind zu hören, gefolgt von einem Aufstoßen.
„Wenn du magst, kannst du es auch mal versuchen.“
Ich sitze wie erstarrt und merke, wie es in meinem Hals drückt und kratzt. „Ich hätte nicht kommen sollen“, denke ich, während ich mich zu einem Lächeln zwinge.
Der Rollstuhl wird näher geschoben. Ihre zuckende Hand versucht, nach meiner zu greifen. Irgendwie ekel ich mich davor, sie anzufassen. Die Haut ist rau und vergilbt wie eine alte Tapete. Aber unerwartet angenehm warm liegt sie dann in meiner. Der Kloß in meinem Hals wird immer größer.
„Ich kann das nicht“, platzt es plötzlich aus mir heraus. Ich springe auf und renne Richtung Flur. Die Fransen des Vorhangs legen sich um mich, als wollten sie mich zurückhalten. Ich versuche, sie abzustreifen, aber mit jeder Handbewegung verheddere ich mich mehr in ihnen. Ich schlage um mich und schüttle meinen Körper. Schließlich kann ich mich aus dem Geflecht befreien und stürze den Flur entlang. Draußen krame ich in meinen Taschen nach den Zigaretten und stecke mir eine in den Mund. Meine Hände krampfen sich um das Feuerzeug. Sie sind zu zittrig, um es zu betätigen.
Ich vermeide jeden Blick zurück und steige in mein Auto. Dort sitze ich mit laufendem Motor, ohne loszufahren. Das Lenkrad fest umklammert. Manchmal ist es verdammt schwer, einfach Danke zu sagen.
Christoph Ringleb,Jahrgang 1984, lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Leidenschaftlicher Schrebergärtner, der gerne im Grünen Momente und Gefühle auf Papier festhält. Stipendiat des Literatur Labor Wolfenbüttel 2003. Veröffentlichung einiger Gedichte und Kurzgeschichten in Anthologien.
*
Wieder Jahrestag
Erinnerungen
unzerstörbar –
wieder Jahrestag
Jahrestage. Ich mag sie nicht. Schon vorher beginnen vernarbte Erinnerungen zu schmerzen und danach braucht es eine ganze Weile, bis das Leben wieder im Lot ist. Jedes Jahr von Neuem. Gestern war wieder einer. Nach so vielen Jahren verblassen Erinnerungen, manche bleiben lebendig, als wäre es gestern gewesen .