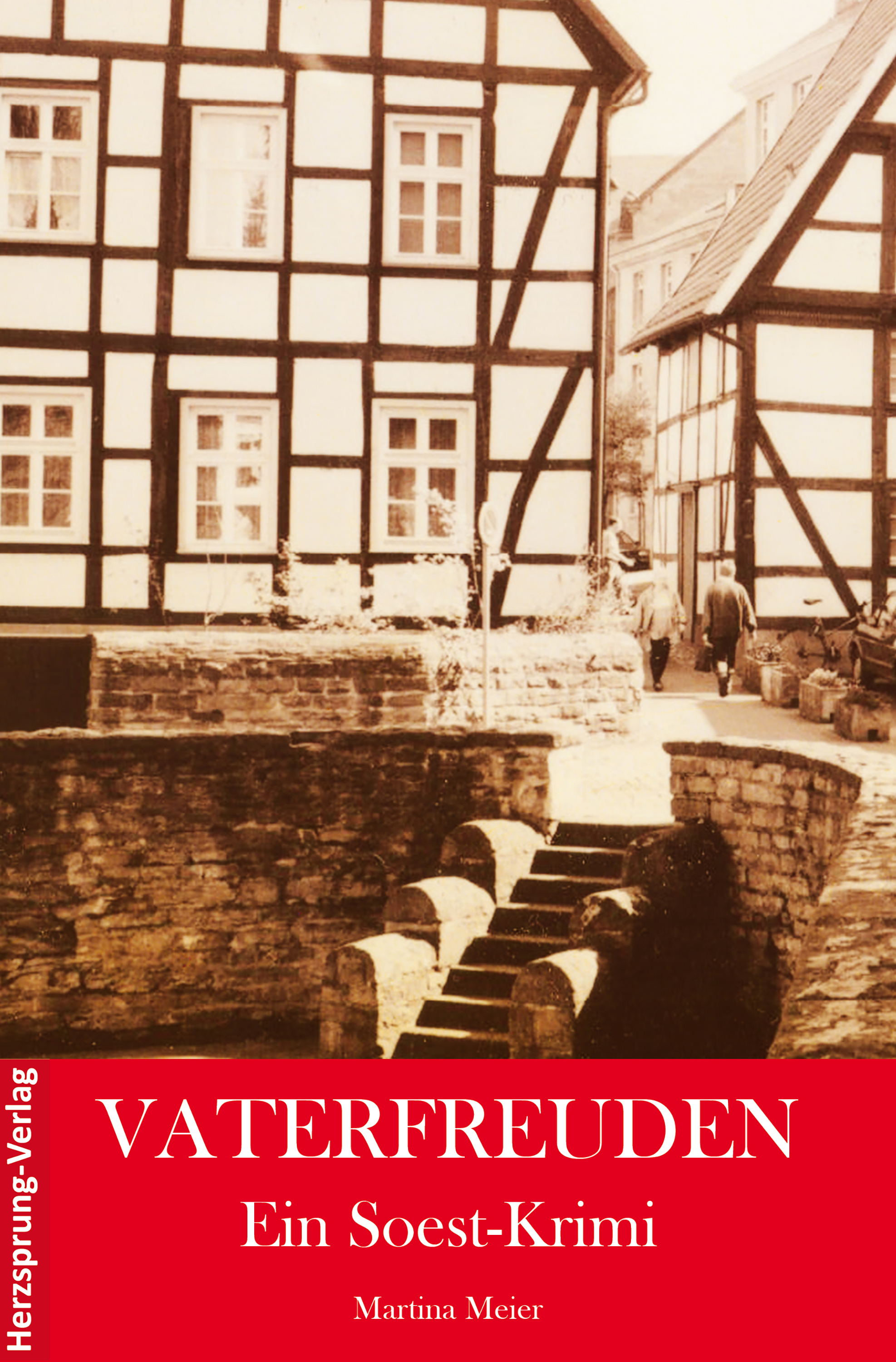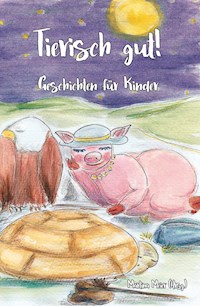7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herzsprung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 geht eine lang vergessene, reale Angst um, denn noch nie seit Ende des Kalten Kriegs war die gefühlte Bedrohung auf eine militärische Auseinandersetzung bei uns so groß wie aktuell. Alte, längst tot geglaubte Ängste tauchen auf, immer wieder geschürt durch die Medien. Was passiert, wenn ... Doch wir möchten diese Gedanken nicht unser Leben bestimmen lassen, setzten Hoffnungen dagegen. Hoffnung auf ein friedvolles Miteinander der Menschen, der Völker. Alles nur Utopie? Wir spüren in diesem Buch unseren eigenen Kriegsängsten nach, schreiben über die Hoffnung, die wir jeder kriegerischen Handlung entgegensetzen. Und vielleicht erinnern wir uns auch daran, was Krieg für uns alle bedeuten kann, bedeutet hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
o
Unsere Hoffnung Unsere Angst
Eine Auseinandersetzung mit Krieg und Frieden
Martina Meier (Hrsg.)
o
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet - www.herzsprung-verlag.de
© 2023 – Herzsprung-Verlag GbR
Mühlstr. 10, 88085 Langenargen
Bearbeitung: CAT creativ - www.cat-creativ.at
Alle Rechte vorbehalten. Taschenbuchauflage erschienen 2023.
Cover gestaltet mit einem Bild von © Ju_see
ISBN: 978-3-99051-139-8 - Taschenbuch
ISBN: 978-3-99051-140-4 - E-Book
*
Inhalt
*
Licht über Kiew
Seltsamer Lichtschweif in tiefblauer Nacht.
Einsamer Stern einer finsteren Macht?
Zieht seine Bahnen am himmlischen Zelt,
nähert sich brennend der schlafenden Welt.
Bringt er uns Freundschaft, das Feuer der Liebe
oder doch Schläge und Kämpfe und Hiebe?
Wärmt er mit Glück uns’re wartenden Herzen,
bringt er nur Kummer voll elender Schmerzen?
Sprüh’n hier die Funken der Leidenschaft munter,
blitzt da nicht eher die Feindlichkeit runter?
Strahlet bald uns’re Verbundenheit klar
oder lieget in Asche die Menschlichkeit gar?
Lodert die Flamme der hochstolzen Freiheit,
bevor sie verglüht in erzwungener Einheit?
Steht stark der Wall uns’res feurigen Willens
oder sengt schon die Glut an dem heißen Mut stillens?
Erfüll’n sich die Wünsche der Kinder so rein
oder schlägt gelb die todbringende Bombe jetzt ein?
Schimmert die Hoffnung den Weg durch die Nacht
oder eher das höllische Irrlicht einer grausamen Macht?
Caroline Seegerwurde 1979 in Zürich geboren und lebt mit ihrer Familie in der Nordwestschweiz. Sie studierte in Zürich, Neuenburg und Basel, arbeitet als Sprachlehrerin in der Erwachsenenbildung und reist gerne. Schreiben war von früh auf eine Leidenschaft, der sie mit dem Älterwerden der Kinder wieder mehr Zeit widmen kann.
*
Frieden ist der Kuss des Herzens, der Zusammenhalt spendet.
Katja Heimberg
*
Abschied vom Frühling
Ich will meinem Vater die Hand reichen, doch er schlägt sie mit einer abwehrenden Bewegung aus und stützt sich gegen den alten Weidenbaum, der mitten im Innenhof steht. Hierhin wollte er also unbedingt noch einmal zurückkehren, ich konnte es den wenigen Worten entnehmen, die er am Morgen mühevoll hervorgestoßen hat. Er hat sein Ziel erreicht. Doch ich bin mir nicht sicher, ob er zwischen dem neuen Kinderspielplatz und den blank polierten Gehwegplatten seinen verwilderten Hof von damals überhaupt noch wiedererkennt. Nur die große Weide ist geblieben. Nachdenklich betrachtet er die jungen, grünen Zweige, die erste Knospen tragen und den Blick auf die modernen Luxusapartments ringsum schon bald mit ihrem dichten Blütenmeer verstellen werden.
Mein Vater greift in die Brusttasche seines Hemdes, gedankenverloren befühlt er den schmalen Gegenstand darin und ich sehe in seinem Blick, dass er gerade ganz woanders ist, nicht an einem anderen Ort, aber in einer anderen Zeit. Auf der Suche nach den verlorenen Erinnerungen, die ihn mit diesem Innenhof verbinden, bekommen seine Augen plötzlich einen kindlichen Glanz.
Damals glich der Hinterhof der Brunnengasse einem Schrottplatz. Wer durch das stets offene Tor des Eckhauses trat, auf dessen Balkonen seit Jahren pflichtgemäß die Nationalflaggen gehisst wurden, der empfand den Anblick des hier versammelten Gerümpels als beinahe anstößig: Bergeweise waren morsche Holzreste aufgeschichtet, in die sich Heerscharen von Holzwürmern und emsige Wanzen hineinbohrten. Die Brunnengässler sahen in den rostigen Metallbehältern und brüchigen Backsteinen, die sich hier mannshoch türmten, eine Ordnung verletzt, die sie eigentlich hätten bewahren sollen. Doch schien es, als hätten sie ihr beschämtes Missfallen darüber, zusammen mit all dem Ramsch im Innenhof abgeladen und in duldsames Schweigen gehüllt, wie fast überall geschwiegen wurde.
Für Ulrich und seine Kameraden war der vermüllte Hof jedoch weniger ein Ort spießbürgerlicher Schande als vielmehr eine Quelle für Mysterien, Geheimnisse und Abenteuer, die danach schrien, entdeckt, freigelegt und erlebt zu werden: Ein kaputter Rechen wurde zu einem verschollen geglaubten Artefakt mit magischen Kräften erhoben, in einem angekokelten Buch sahen sie eine Schatzkarte und eine rostige Gießkanne diente Ulrich als Waldhorn, mit dem er seinen Ritterorden vor Angreifern warnte, die Schloss Schrottstein erobern und die wunderschöne Prinzessin Marie befreien wollten.
An diesem schulfreien Märztag spielten Ulrich und seine Freunde hier Verstecken. Der Hof hielt unzählige Fluchtmöglichkeiten, Orte des Rückzugs oder des Hinterhalts bereit. Schon vor Tagen hatte er einen perfekten Schlupfwinkel entdeckt. Unweit der großen Weide stand, von Drähten und einem ausgeschlachteten Damenfahrrad halb begraben, ein großer, alter Kessel, den man mal zum Zementmischen verwendet hatte. Die Öffnung des Kessels ragte senkrecht nach oben, sodass man von der Seite nicht erkennen konnte, ob sich jemand darin befand.
Während Werner noch fest die Augen geschlossen hielt und dabei laut zählte, zerstreuten sich die übrigen Kinder aufgeregt in sämtliche Richtungen. Am Kessel angekommen, schob Ulrich schnell die umrankenden Drähte zur Seite und schlüpfte durch das runde Loch ins Innere.
Etwas zog an seinem Arm, und als er erkannte, dass sich ein Drahtende in seinem Hemdsärmel verfangen hatte, riss dieser schon längs der Seitennaht auf. Ulrich verfluchte sich, als er den Schaden begutachtete. Dreckig und zerrissen war sein Hemd jetzt.
„Wie ein Lump von der Hafenstraße siehst du aus“, hörte er in Gedanken schon die schimpfende Stimme seines Vaters. Und nichts war schlimmer, als ein Lump von der Hafenstraße zu sein, so viel wusste Ulrich schon. Aß er zu viel, konnte er auf der Hafenstraße enden. Strengte er sich nicht genug in Mathematik an, konnte er auf der Hafenstraße enden. Wer nicht aufpasste oder sich nicht anständig benahm, endete er ganz sicher auf der Hafenstraße.
Vor allem dachte Ulrich aber daran, dass sein Vater ihn später beim Anblick des zerrissenen Hemdes am Kragen packen, kräftig durchschütteln und ihm sagen würde, dass er zu nichts zu gebrauchen sei.
Seine Großmutter würde das Hemd flicken müssen, wenn da noch was zu flicken war. Vor ihrer Reaktion hatte er sogar noch größere Angst, denn seitdem seine Mutter verschwunden war und Ulrich mit Vater und Oma allein in der kleinen Wohnung lebte, war sie besonders streng. Meist gab ihm die Großmutter zehn oder zwanzig Streiche mit der Weidengerte, je nach Schwere des Vergehens und ihrer aktuellen Tagesform. Das zerrissene Hemd schätzte Ulrich auf durchaus zwanzig Hiebe.
Er schaute durch das Kesselloch auf die grünen Zweige der Weide, die über ihm hingen. Der Winter war vorbei, der Baum trug zarte Knospen, die Zweige waren besonders dünn und biegsam. Das veränderte den Prügelstil seiner Großmutter. Im Frühling wurde Ulrich anders geschlagen: Statt des dumpfen Schmerzes der Winterzüchtigung waren es nun frische, saftige Rutenhiebe, bei denen die Haut erst lange danach zu brennen aufhörte. Oh, wie er den Frühlingsbeginn hasste.
Bald hörte Ulrich Geräusche im Gras. Er erkannte Werner am schlurfenden Gang, wie er den rechten Fuß nur halb anhob und die Sohle seines Schnürschuhs leicht durch das feuchte Gras zog. Die schleifenden Schritte kamen näher, verstummten dann und entfernten sich wieder. Eine diebische Freude überkam Ulrich, die ihn den Ärger über das zerrissene Hemd vergessen ließ. Mit einer Gelassenheit, die sich nur der Triumphierende leisten kann, lehnte er sich langsam gegen die rostige Kesselwand und blinzelte der Frühlingssonne entgegen, deren Strahlen ins Innere des Kessels fielen.
Dann nahten abermals Schritte, doch dieses Mal klangen sie nach schweren Stiefeln, energischer und fordernder waren sie, hatten in ihrem Auftreten überhaupt nichts Spielerisches mehr. Es konnte weder Werner sein, der da vor seinem Versteck herummarschierte, noch eines der anderen Kinder. Ulrich rutschte unwillkürlich ein Stück tiefer auf den Boden seines Verstecks. Einer der metallenen Hemdknöpfe, der nur noch lose an der Naht seines aufgerissenen Ärmels gehangen hatte, löste sich dabei und sprang quer durch den Kesselbauch, dessen ovale Form das Rasseln noch zu verstärken schien wie eine übergroße Klangschale.
Die Schritte waren verstummt, alles war ganz still. Vielleicht, weil sich der große Stiefelträger entfernt hatte. Oder hatte er sich verraten? Nur das leichte Rascheln der Weidenzweige im Frühlingswind war zu hören. Ulrich hielt den Atem an, beugte sich dann behutsam vor und tastete nach dem flüchtigen Messingknopf. Er hatte ihn gerade zwischen seinen Fingern, als plötzlich ein Schatten das Innere des Kessels verdunkelte. Noch bevor Ulrich aufschreien konnte, erschien ein haariger Arm in der Öffnung, hatte ihn von hinten am Kragen seines Hemdes gepackt und zog ihn kraftvoll, wie einen Eimer aus dem Brunnen, durch die Öffnung heraus.
Das Erste, was der Junge sah, war ein dunkles Augenpaar, das ernst auf ihn gerichtet war. Es waren zweifellos die Augen seines Vaters, doch wirkten sie so sorgenvoll, dass er ihn zuerst gar nicht wiedererkannte, als hätte man ihm die Augäpfel eines Fremden ins Gesicht geschraubt. Nicht nur der Blick, nein, die ganze Erscheinung war merkwürdig unvertraut. Der Mann setzte Ulrich auf den Zehenspitzen ab und besah sich seinen Jungen.
Für einen Moment wischte unendliche Erleichterung über das Gesicht des Vaters, alle Liebe lag nun in seinem Blick, mit dem er seinen Sohn voller Stolz von oben bis unten musterte. Ulrich, wie er so in seinem zerrissenen Hemd dastand, fühlte sich unbehaglich, hatte er diesen väterlichen Ausdruck der Fürsorge doch schon lange nicht mehr gespürt. Und wie ein feiner Windhauch, der sofort wieder verschwindet, verfinsterte sich die Miene des Mannes plötzlich. Ein kräftiger Schlag mit der flachen Hand traf Ulrich im Gesicht, sodass sein Kopf zur Seite geworfen wurde und ihm das Blut in die Wange schoss.
„Vielleicht ist doch alles wie immer“, dachte Ulrich verwirrt und fast erleichtert.
„Was hast du schon wieder mit deinen Klamotten angestellt, du Lump? Willst du etwa auf der Hafenstraße enden?“, rief sein Vater zornig und packte ihn am Kragen. Doch noch bevor Ulrich entschuldigende Worte stammeln konnte, hatte ihn der Vater wieder losgelassen, betrachtete ihn aus kurzer Distanz mit dieser neuen, unheimlichen Milde und drückte ihn dann fest an sich. Ulrich hatte fast das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, so unbarmherzig eng hatte sein Vater die Arme um den Jungen geschlungen und drückte dessen Gesicht entschlossen an seine Brust. Ulrich spürte, wie etwas Feuchtes auf seine Schulter tropfte und den Hemdstoff tränkte.
Es kam ihm vor wie eine Ewigkeit, dass sein Vater ihn so hielt. Als er seine Umarmung lockerte, lag in den Augen des Mannes dieselbe Ernsthaftigkeit wie in dem Moment, als er Ulrich aus dem Kessel gezogen hatte. Erst jetzt fiel ihm auf, was an der Erscheinung seines Vaters so anders war: Er trug heute nicht seinen grauen Arbeitskittel mit dem Aufnäher von Elektro Mertens, sondern jene braune Uniform, in der seit Monaten junge Männer prahlerisch durch die Brunnengasse marschierten. Auch die schwarzen, fest geschnürten Lederstiefel, mit denen sie dabei so einen unerträglichen Lärm auf dem Kopfsteinpflaster veranstalteten, glichen exakt denen, die Vater jetzt trug. Lediglich die rote Binde haftete nicht hochmütig an seinem Arm, sondern schielte schamvoll aus der linken Hosentasche heraus. In der Uniform sah sein Vater ganz klein aus, fast bucklig, als habe er sich in eine zu enge Haut gezwängt.
„Ich werde für einige Zeit fortmüssen“, sagte er und wich dabei Ulrichs fragendem Blick aus. „Du wirst dich um Oma kümmern und ihr keine Sorgen bereiten, hast du gehört?“
Ulrich nickte stumm. Dann gab er Ulrich einen Kuss auf die Stirn, der noch immer nicht verstand, was das alles zu bedeuten hatte.
„Nimm die hier“, sagte der Vater und zog eine silberne Taschenuhr hervor, auf die feine Blumenornamente ins Metall ziseliert waren. „Verwahre sie für mich.“
Der Mann erhob sich, tätschelte seinem Sohn kurz den Kopf und wandte sich rasch ab. In der knitterigen Uniform ging er ganz krumm, fast sah es so aus, als trüge er ein schweres, unsichtbares Joch auf den Schultern. Ulrich blickte ihm nach, bis er zwischen aufgequollenen Holzplatten und verdreckten Metallkanistern kaum noch zu sehen war. Seine Wange brannte noch immer vor Schmerz.
Hart und kalt lag die kleine Taschenuhr in Ulrichs Hand. Er klappte den Deckel auf. Ein kleines Foto, das den Vater bei der Hochzeit mit seiner Mutter zeigte, klebte auf der Innenseite. Der Bräutigam steckte in einem dunklen Nadelstreifenanzug und hatte seinen Arm um die selig lächelnde Braut geschlungen, unter deren Schleier lange, schwarze Locken hervorschauten. Als er wieder aufsah, hatte sein Vater den Innenhof schon verlassen und langsam begriff Ulrich, dass nun die Zeit des endgültigen Abschieds begonnen hatte.
Mein Vater klappt den Deckel der Uhr zu und schiebt sie zurück in die Brusttasche seines Hemdes. Dann fährt er sich langsam mit den Fingern über die linke Wange, wie jemand, der sein Fahrzeug auf Lackschäden prüft. Als erwache er aus einer tiefen Trance, blickt er suchend um sich, findet mich und greift nun doch nach meiner Hand, die ich ihm noch immer helfend entgegenstrecke.
„Komm, Papa, wir fahren wieder zurück“, sage ich sanft.
Zögerlich wendet er sich vom Weidenbaum ab und wir gehen Hand in Hand auf das neue, glänzende Stahltor der Brunnengasse zu. Er hält meine Hand so verkrampft fest, als wolle er sie nie wieder loslassen. Die Kindlichkeit, die eben für einen Moment in seinen Augen funkelte, ist Hilflosigkeit gewichen. Er ist jetzt wieder der alte, gebrechliche Mann ohne Erinnerungen, den ich stützen muss.
„Der Frühling kommt“, sagt mein Vater matt, wobei er die Worte weder an mich noch an sich selbst richtet, sondern mehr so vor sich hin spricht. „Die Weide trägt schon erste Knospen.“
René Gröger ist 1988 in Hamburg geboren. Seit einigen Jahren lebt er in München, wo er an der Hochschule für Musik und Theater den Masterstudiengang „Musikjournalismus im öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk“ absolviert hat. Zurzeit arbeitet er als freier Journalist, unter anderem für den Bayerischen Rundfunk. 2019 wurde seine erste Kurzgeschichte im Rahmen des „Literaturwettbewerb Hamburg“ veröffentlicht. Es folgten weitere Veröffentlichungen und erste Auszeichnungen. So wurde er 2020 beim Literareon-Kurzgeschichten-Wettbewerb für seinen Text „Treasure Island“ mit dem 2. Preis prämiert. Außerdem gewann er den PERGamenta Literaturpreis für seine Kurzgeschichte „Heimatwärts“.
*
Mein Herz brennt
Tobende Sorgen,
es gibt wieder Krieg,
was wird aus Morgen?
Angst begleitet mich nun,
soll ich einfach wegschauen,
was kann ich selbst noch tun?
Ich höre Kinder schrei’n,
sehe Zerstörung und auch Mord,
Hoffnungslosigkeit, kein Sonnenschein.
Wo ist Gott in dieser Zeit?
Warum gibt es Kriege? Wie kann das sein?
Keine Barmherzigkeit.
Jeder Krieg ist letztendlich
auch ein Krieg in mir,
der Mensch wird dann zum Tier.
Gier und Hass begleiten,
törichte Gedanken,
Grenzen zu überschreiten.
Wir bleiben dabei außen vor,
Kanonenfutter für die Schlachten,
im Leichensack durchs Friedhofstor.
Solang’ mein Herz mit diesen Sorgen brennt,
geb’ ich die Hoffnung auf Frieden niemals auf,
damit Gott den Friedensengel zukünftig ernennt.
Mein Urvertrauen liegt dabei in Leuten,
die für den Frieden kämpfen
und von unser aller Freiheit träumten.
Ich bin bereit, mein Herz hierfür zu opfern,
die Friedenflagge jetzt zu hissen
und an die Pforte der Geschichte anzuklopfen.
Mein Mitgefühl gehört all jenen,
die fliehen und heimatlos geworden,
nach Schutz und Geborgenheit sich sehnen.
Ich will Zeichen für den Frieden setzen,
mit all meinen Gedanken und Gedichten,
hört auf, Euch gegenseitig zu vernichten!
Thomas Krieg,geboren 1971 in Mainz, lebt in Erkelenz. Abitur in Krefeld, Studium der Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Exp. Psychologie) in Heidelberg und Düsseldorf. Tätigkeit als Berufsberater. Beschäftigung mit Lyrik seit 2000.
*
Ihr Weg
Wir hatten mit ihr gehofft. Nach vielen Jahren der niederdrückenden Sorgen, der öden Tage, die gefüllt waren mit Krankheit und Unsicherheit, waren Farben unser Lebensthema. Farben und immer wieder Farben – in der Natur, in unseren Gesprächen und unserer Zukunft. Farben gemalt, gedichtet, gelebt.
Ganz sanft wagten wir zu träumen.
Nach einem plötzlichen Krankheitsschub mit neuen Ängsten, einer vagen Zukunft gab es Entwarnung. Dann leuchtete wieder eine neue, hoffnungsvolle Prognose. Das Leben schien freundlich weiterzurollen und mit ihm die Farben. Wir saßen zusammen, wir feierten das Leben, wir nahmen Anteil aneinander im Café, bei Festen und in Projekten.
Dann kam so plötzlich das Haltlose über sie. Keine Zukunft mehr, keine Buntheit. Ein Stolpergang durch das Uferlose. Kleine Stopps ohne Perspektive. Farben, die sich angstvoll auflösten und verschwanden.
Wie gerne hätte sie mit uns das bunte Leben getanzt mit festen Schritten und der sehnsuchtsvollen Musik im Blut.
Sie lehrte uns, mit großen Augen und vollem Herzen wahrzunehmen, und freute sich an den Blumen und am Vogelgesang. Ihre wärmende Hand und ihr Lächeln lagen neben der unseren. Kostbare Zeit schenkte sie uns.
Nun ist sie entschwunden an einem Frühlingstag, als die Natur nur so sprießte und die Sonne neuen Mut sandte. Sie wollte gehen, ein buntes Leben konnte sie nicht mehr wahrnehmen.
Sie versprach uns Farben zu senden. Farben, die jetzt bleiben, als Geschenk und als Erinnerung.
Und das spüren wir immer, wenn wir an sie denken.
Luitgard Renate Kasper-Merbach, geboren 1958 in Bad Schussenried, verheiratet, drei Kinder, schreibt seit ihrer Kindheit Gedichte und Prosa, zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien, Einzelveröffentlichungen: sieben Bücher, zuletzt Farbentage, einige Literaturpreise.
*
Trage Sorge für den Frieden
Hör’ auf Dein Herz! Es wird Dir sagen,
was Du beitragen kannst in dieser Zeit,
wo wir uns nach dem Frieden sehnen,
damit der Weltfrieden wird Wirklichkeit.
Frieden fängt an in unserer Gesinnung,
am Herzensgrund, wo die Liebe wohnt.
Trotz Verletzungen weiß Deine Seele,
dass sich Einsatz für den Frieden lohnt.
Der Frieden beginnt mit einem Lächeln,
das uns möglich ist zu jeder Tageszeit.
Lächeln steckt an und setzt sich oft fort,
wenn wir alle für den Frieden sind bereit.
Gib Deinen Frieden weiter an die Kinder,
dass sie spüren können, was Frieden ist,
und sie einstehen für die Unterdrückten,
sodass kein Mensch das jemals vergißt.
Liebe hat die Kraft. Der Mut ist imstande,
den Frieden hinauszutragen in die Welt.
Er braucht Toleranz, Hoffnung, Einsatz
und Beständigkeit, die ihm die Treue hält.
Nimm Rücksicht auf Deinen Nächsten.
Trage immer zum guten Miteinander bei,
damit der Weltfrieden nicht mehr länger
nur Wunschdenken der Menschheit sei.
Wir sehnen uns nach Liebe und Frieden,
wollen mit dem Leben in Einklang sein,
kennen aber Zeiten, wo wir uns viel lieber
bequem in der Wohlfühlecke richten ein.
Deshalb trage stets Sorge für den Frieden.
Fange bei Dir in Deiner Herzensmitte an.
Lass’ ihn wachsen. Trage ihn nach außen,
dass Dein Gegenüber ihn spüren kann.
Ein Psalmspruch ermahnt den Menschen:
Suche Frieden und jage ihm nach!
Der Friedensgedanke braucht langen Atem,
fordert unsere Ausdauer, die oft liegt brach.
Die Kirchturmglocke sollte daran erinnern,
den Friedensklang zu tragen in die Welt.
Sie soll ein Sinnbild sein für die Botschaft,
die für uns lebbar ist: Der Frieden zählt!
Sieglinde Seilerwurde 1950 in Wolframs-Eschenbach geboren. Sie ist Dipl. Verwaltungswirt (FH) und lebt mit ihrem Ehemann in Crailsheim. Seit ihrer Jugend schreibt sie Gedichte. Später kamen Aphorismen, Märchen und Prosatexte hinzu. Ferner fotografiert sie gerne. Bislang hat sie bereits über 200 Gedichte im Internet und diversen Anthologien veröffentlicht.
*
Fürchte dich nicht vor dem Untergang
So gut es geht, verdränge ich meine Kriegsangst. Die Furcht vor einem Aufstand in unserer Heimat. Ich flüchte in meine Gedanken, denn würde ich mich der Angst stellen, so hätte ich dennoch keinen Einfluss auf den Fortgang des Krieges in der Ukraine. Unweigerlich wird kommen, was kommen soll, was kommen muss. Natürlich ist ein Ausbleiben jeglichen Kriegsgeschehens hierzulande wünschenswert. Jedoch muss ich anerkennen, wie wenig es zählt, wenn ich gegen den Krieg votiere. Effektiv die Stirn bieten kann ich ihnen ja nicht, den Tyrannen dieser Erde, den Untergangsbeschwörern unseres Planeten.
Der Rückzug in meinen Kopf ist die einzige Flucht, die mir gelingen mag. Sobald ich in meinem Gehirnkästchen Ideen spinne, aus denen Geschichten entstehen, mein Geist also etwas hervorbringt, das ich als kreativen Prozess bezeichnen darf, fühle ich darin meine eigentliche Wahrheit, meine tatsächliche Wirklichkeit. Was ich dem Wahnsinn in der Ukraine entgegenzusetzen habe, ist meine schöpferische Kraft. Was meinen Seelenfrieden mit schweren Geschützen bombardiert, will ich konsequent ausblenden. Nach Möglichkeit halte ich mich deshalb fern von Informationsdiensten, die mich mit grausamen Nachrichten konfrontieren. Meinem Verständnis nach bin ich nicht geboren, um zu leiden.
Engagement darf sich niemals in Entrüstung erschöpfen, denn damit ist den Opfern des Krieges mitnichten geholfen. Ist das, was auf Entrüstung folgen muss, damit sie Betroffenen nützt, nicht Spende in Sache oder Geld? Ich bin bereit, all das Materielle zu geben, nie aber werde ich bei noch klarem Verstand meinen inneren Frieden veräußern. Er wird mir für die kurze Dauer meines Lebens eigen bleiben, dafür werde ich sorgen. Würde ich meinen Frieden verlieren, so hätte ich alles verloren. Durch die Berichte der Medien innerlich Schaden nehmend, wäre ich im wahrsten Sinne aus mir ausquartiert, nicht nur redensartlich obdachlos. Um dem entgegenzuwirken, vollziehe ich meine gedanklichen Reisen, erbaue Luftschlösser, durchschwimme Meere, überspringe Häuser meines Wohnbezirks im Handstand. Meine Schatzkammer an Größenfantasien ist reichlich gefüllt. Sie trägt mich seit Monaten über die allgemeine Düsterkeit hinweg. Ein mir seit Geburt innewohnender Fanatismus treibt mich an, viele Interessen, die ich in Angriff nehme, bis ins Extremste zu entwickeln. Ich bin genetisch so aufgestellt, dass alles, womit ich beginne, dazu veranlagt ist, mich vollends zu vereinnahmen. Derzeit jongliere ich mit Wörtern, die in ihrem Fortgang zu Erzählungen werden. Die teils komplexen Handlungen selbiger liefern mir das Alibi für eine strukturierte Vorbereitung, denn ohne Planung entstünden keine nachvollziehbaren Geschichten. Womöglich wäre mir mit mathematischen Gleichungen ebenso gedient. Man nehme das als nüchternes Eingeständnis, alles, worin ich einen Algorithmus erkenne, beruhige mein Gemüt. Ein rechnender Kopf läuft selten auf Nebenschauplätzen heiß, ein schreibender Mensch ist fokussiert auf sein Schriftstück, von dem er die Illusion hat, es sei seiner eigenen Kontrolle unterworfen. Ich liebe jene von äußeren Umständen scheinbar nicht aus den Angeln zu hebende Eigeninitiative. Alles, was mir von Unberechenbarkeit unbehelligt scheint, entspricht meinem Verständnis von freiem Denken.
Das Kind in mir, so erwachsen es auch auftritt, will getätschelt werden. Früher wollte ich in den Armen meiner Mutter geschaukelt werden, heutzutage brauche ich ersatzweise verbindliche Zusagen, das unverhandelbar Bestehende, das unweigerlich Festgelegte. Das Kind in mir muss wissen, selbst wenn draußen Krieg tobt, Panzer grollen, Schüsse fallen, die Erde umfassend aus ihren Fugen gerät, es behält seine Heimat. In den kontinuierlichen Bewegungen von vertrauten Tätigkeiten liegt sein Zuhause. Die einstmalige Geborgenheit im Schoß der Mutter hat sich gewandelt, ich finde sie mittlerweile im gesprochenen Wort und in geschriebener Sprache. Was ich schreibe, muss grooven, denn sobald ein melodischer Rhythmus meinen Zeilen mitschwingt, vergesse ich die Zeit und ich löse mich aus dem Raum, der mich eindämmt. Ich bin dann versunken im Jetzt, gegenwärtig in meinem Tun, abseitig von allem Trübsinn, schwerelos in mir.
Mitunter kommt es vor, dass ich bei meiner zwischenzeitlichen Internetrecherche auf normalerweise von mir ignorierte Neuigkeiten stoße. Binnen kürzester Frist kann ich die Botschaften wieder abschütteln, nachdem sie mich augenblicklich aus meiner Mitte gerissen haben. Für die gefühlt dreißigste Drohung eines Medwedew, er wolle den Westen dem Untergang weihen, sofern nicht haarklein seinen Forderungen nachgegeben werden würde, möchte ich nichts empfinden. Zu militärischen Operationen habe ich keinerlei Bezug, für die Taktiken von Maschinerien, die vorgeben, nur über einen Krieg wäre nachhaltiger Frieden zu erlangen, habe ich nichts übrig. Warnungen vor radikaler Vernichtung bestimmter Menschengruppen als zentrales Instrument einer Interessensvertretung sind mir abgrundtief zuwider. Mit nie weiter als halb geöffneten Augen durchforste ich den Dschungel an News, falls sie aufpoppen. Meine EDV-Kenntnisse lassen die dauerhafte Ausblendung von Pop-ups nicht zu, deswegen muss ich gegen sie mit anderen Methoden fechten.
Mein Element ist das weiße Blatt. Ist die Word-Datei am Ende einer Schreibsitzung dann voll mit sinngebenden Sätzen, so entspricht das meinem fundamentalen Bedürfnis, mich als gestaltendes Individuum wahrzunehmen. Mit sämtlichen Fasern meines Geistes bin ich bei mir, solange ich tippe. Eine Story niederzuschreiben, von der ich meine Vision nicht leugnen will, ein verborgenes Publikum würde sie bejubeln, stimmt den Einzelgänger in mir zufrieden. Obgleich ich weitgehend abgekapselt bin von der Zivilisation, teile ich mein Gedankengut mir ihr. Über meine fertigen Geschichten bin ich indirekt mit den Menschen verbunden, sofern sie mich lesen. Durch meine exzessiv ausgelebte Leidenschaft in der Abgeschiedenheit meines Speicherzimmers fällt es mir naturgemäß leichter, mich von Kriegsberichten zu distanzieren. Ich werde nicht so ungefiltert penetriert von der negativ geprägten Kollektivansicht, der Krieg würde uns unausweichlich niederschmettern, uns allesamt zerstören.
Möglicherweise dient mein Ehrgeiz, zu schreiben, in diesen Tagen der Demonstration, man könne seine Kräfte auf andere Dinge lenken als auf das Ping-Pong-Spiel von Waffengewalt und Gegenreaktion. Ich will Handlungen schmieden, den Figuren ein Leben mit Eigendynamik einhauchen, plausible Erklärungen finden dafür, warum sie agieren, wie sie agieren. Abgesehen von Sprache bin ich flächendeckend unmusikalisch. Ich kann weder singen noch malen und doch ergeben Silben, entsprechend angeordnet, Klang und Farbe. Die Anonymität der Leser, an die ich adressiere, ist mir erbaulich wie sonst nichts. Allein der Gedanke, sie würden in heimischen Sesseln in meinen Büchern schmökern, zustimmend nicken oder skeptisch die Stirn runzeln, er beflügelt mich. Aufgehoben bin ich in ihrem stummen Applaus. Ein Abstand, der in Kriegszeiten Vorteile bringt. Diese Distanz verringert jetzt meine Anspannung. Vom aufgewühlten Volk, in dem es vor Erregung wimmelt, das sich in ungehemmter Sensationslust ergeht, bleibe ich weitgehend verschont. Von der Negativität pandemischen Ausmaßes kommen in meiner Speicherkammer lediglich Partikel an. Mittels meiner Tastatur biete ich der Tyrannei die Stirn, dem Martyrium Paroli. Selbst wenn unbeteiligten Dritten meine Schreiborgien wie das Sandkastengeplänkel von Kleinkindern anmuten mag, ich fühle mich aufgehoben in der Architektur meiner letztendlich geschichtsbildenden Sätze. Ist denn nicht jeder künstlerische Aktionismus ein Zugewinn für den Weltfrieden? Sind nicht kontemplativ betriebene Tätigkeiten Grundvoraussetzung eines beständigen Friedens? Würde die Erde noch beben, wenn alle Menschen an ihren Rechnern säßen, deren Fingerkuppen auf den Tasten glühten statt am Abzug eines Gewehrs?
Zeitweilig grüble ich, ob meine Haltung unverfroren sei. Überall sterben Zivilisten und ich bewahre meinen Seelenfrieden. Vertrete ich nicht nur folgerichtig die Ansichten moderner Psychologie, ihre allseits gepredigte Resilienz, wenn meine Gelassenheit selbst im Sturm umliegender Kriegsschauplätze unangetastet bleibt? Wäre meine Widerstandsfähigkeit im Hinblick auf den Ukrainekrieg plötzlich anfechtbar, so müsste ich die Wissenschaft der Seelenklempner für eine heuchlerische Religion halten. Wenn schon, muss sie ganzheitlich gelten, nicht bloß wie sie Einzelnen in den Kram passt. Wer will mir vorschreiben, ich müsste Mönch sein, ein buddhistisches Kloster meine Heimat nennen, damit ich noch in den heftigsten Wirren meditieren darf? Äußere Umstände können mir niemals verheerend genug sein, dass ich mich von ihnen länger als nur kurzfristig in Aufruhr versetzen lasse. Vorgedrungen bin ich ins Labyrinth aus Buchstaben, verstrickt mit Wortstellungen, auf seltsamen Pfaden werde ich von diesem Konstrukt behütet. Was mich aus der Bahn schmeißen könnte, wird von ihm abgefedert. Mein Bestreben, Konstellationen grammatikalisch zu verfeinern, der Versuch, jeden Satz bis an die Grenze der Machbarkeit zu vollenden, lässt in mir keinen Platz für etwas anderes als eine beinahe totale Weltabkehr.
Unter dem Eindruck mir schleierhafter Zeichen und unverständlicher Symbole, die unsere Erde hervorbringt, muss ich meinen eigenen Weg finden. Am Ende meiner Tage geht es darum, zu entdecken, was mir wesentlich erscheint: mich selbst. Wäre es nicht ohnehin fatal, Jahre in Furcht vor einem möglichen Kriegsausbruch bei uns zu vergeuden? Jahre vergehen und egal, was man im Nachhinein unternimmt, sie kommen nicht zurück. Vielmehr will ich die Zeit nutzen, an meinem sprachlichen Ausdruck zu feilen, an Geschichten zu tüfteln, sie nach dem Vorbild der Bildhauer von allem Überbestand befreien und somit in ihrer Ästhetik vollenden. Soweit es mein Talent zulässt, möchte ich mich aus der Reserve locken, noch die letzten Tropfen Schweiß investieren und mein Herzblut anzapfen.
Ist meine Blindheit für die Umwelt eine Errungenschaft oder bin ich bloß noch abgestumpft und taub, dazu verdammt, für einen elektronischen Mülleimer zu texten, weil ich von Verlagen häufiger abgelehnt werde, als ich mir eingestehen möchte? Produziere ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, Wegwerfware am laufenden Band? Stets durchleuchte ich meine Geschichten in puncto Schlüssigkeit, bin besessen vom Verlangen, sie anschaulicher zu gestalten, sie lesenswerter zu machen obendrein. Reicht mein Wollen oder bräuchte ich mehr Können? Derartige Zweifel sind Momentaufnahmen.
Wenn ich nämlich Stunden vor dem Bildschirm verbringe, fließen meine Gedanken zumeist stromlinienförmig. Mein produktives Empfinden lindert sämtliche Vorbehalte, die mich jenseits des Speicherzimmers zerfressen. Hier bin ich im Fluss mit meiner Bestimmung, alles strömt, ich fühle mich pudelwohl. Unterdessen bade ich in der Überzeugung, ich könnte die Welt eigenhändig nicht retten, also hätte es seine Richtigkeit, dass ich mich ihr entziehe. Sind meine Geschichten Perlen, die den Ozean aus Gewalt in homöopathischen Dosen beträufeln? Spekuliere ich insgeheim auf ihre bescheidene Einflussnahme? Mildern ihre Weisheiten Leid? Immerhin geringfügig? Vielleicht sind meine Erzählungen ja auch Funken, die in ihrer Vielzahl einen universalen Frieden entzünden. Womöglich laden meine mikroskopischen Friedensakte Nachahmer ein, sich ebenso aggressionsfeindlich zu positionieren. Ist es utopisch zu denken, mein Modell, vielfach kopiert, würde die Motivation zur Kriegsbeteiligung allmählich erlahmen lassen?
Keine meiner Nächte vergeht, ohne dass ich vom Schwung einer Weltwelle träume, die über den Machthabern zusammenschlägt, ihnen ihre Diktatur um die Ohren haut. Keine Nacht ohne meinen Glauben an das Zusammenwirken von an vielerlei Orten veranstalteten Freitagsdemonstrationen, an die vielleicht nur literarisch verwirklichte Liebesbeziehung zwischen einem ukrainischen Ingenieur und einer russischen Intellektuellen, an die Bereitschaft, sich mit einer eingewanderten Familie zu treffen und mit ihr auf Englisch und mit Händen und mit Füßen zu unterhalten. Ich ersehne einen Dominoeffekt, bei dem ich die ersten Steine zu Fall bringe, eine von mir in Gang gesetzte Kaskade, die in letzter Konsequenz die Peiniger unter sich begräbt.
Die voranschreitende Finanzkrise ist in aller Munde, wo der emotionale Bankrott fast allerorts längst vollzogen ist. An jener Verarmung stört sich wohl niemand. Solche Missverhältnisse registriere ich und transportiere sie schreibend. Wenn die Erde in Schutt und Asche versinkt, werde ich derweil, im Beisein meiner spätesten Atemzüge, in die Tasten hacken. Mit einem lächelnden Gesicht, das bald versteinert, werde ich mir einbilden, was ich bespiele, wäre ein edles Piano, keine simple Tastatur. Bis es so weit sein könnte, werde ich es mit Pippi Langstrumpf halten, mir die Welt formen, wie sie mir gefällt, ihre Unebenheiten schreibend geradebiegen.
Meine literarische Entrückung ist ein Schlupfloch, dem Klammergriff der Despoten zu entkommen. Beileibe bin ich keine Kokosnuss, die man in den Schraubstock einspannen darf, um ihr die Schädelplatte aufzusäbeln. Den Inhalt meines Kopfes lasse ich von keinen Sekten löffeln, damit sie mir im Austausch ihre Dogmen einpflanzen. Erstarren und meinungslos werden will ich frühestens, wenn ich gestorben bin. Auf einer Erde, die am Abgrund steht, lässt sich zocken.