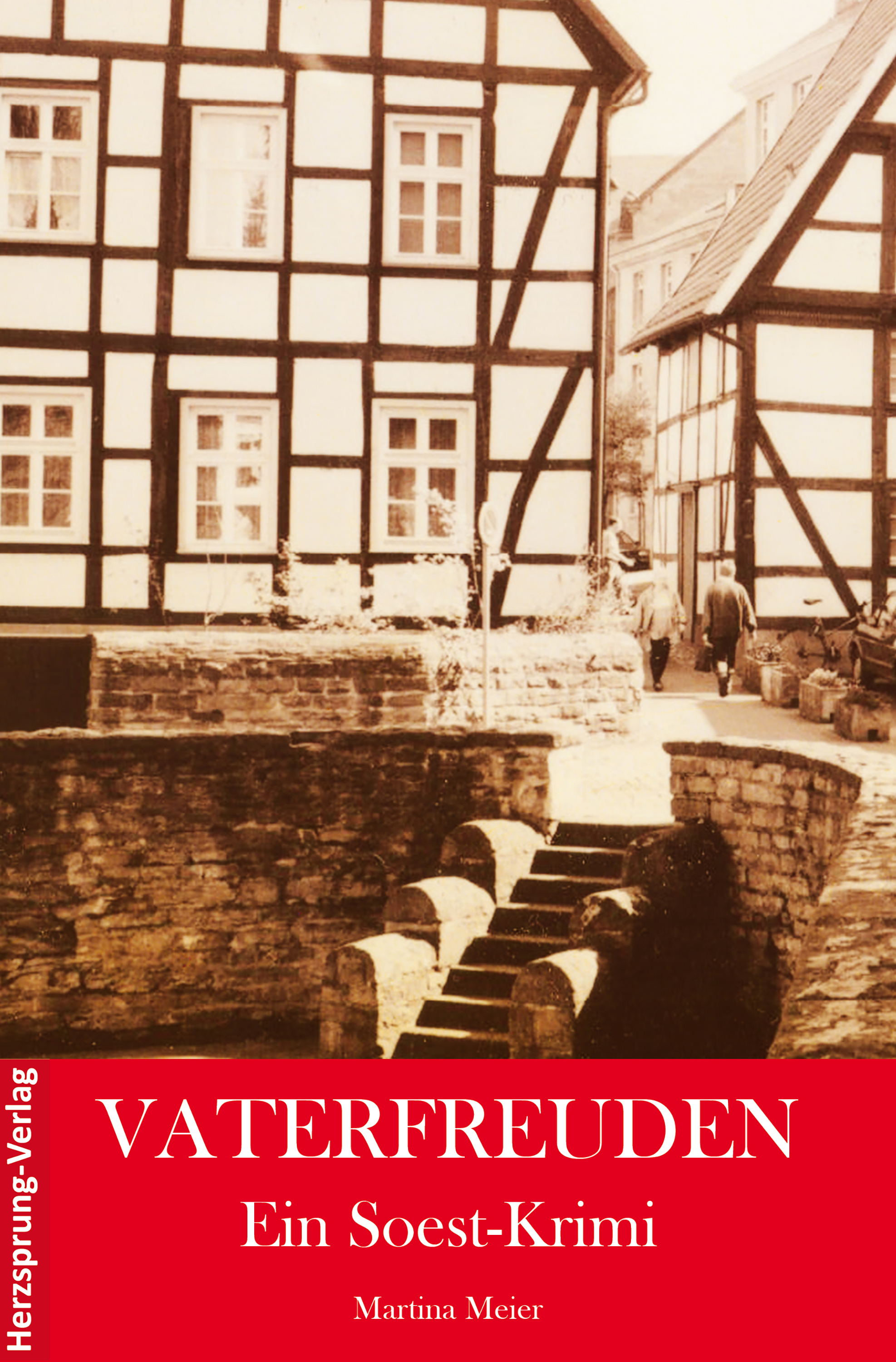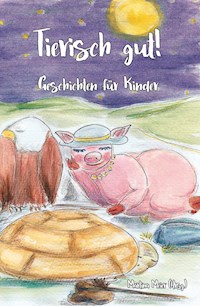9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herzsprung-Verlag + CAT creativ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Können Worte etwas ändern? Etwas ändern an der Zerstörung unserer Umwelt, unserer Natur, unseres Lebensraums? Wir sagen mit dem vorliegenden Buch: „Ja!“ Denn die Geschichten, Erzählungen, Berichten, die lyrischen Auseinandersetzungen legen den Finger in die Umweltwunde. Die Texte rütteln auf und machen allesamt deutlich, dass wir Menschen das Problem der massiven Umweltzerstörung nur – und das sei betont – nur zusammen lösen können. Jetzt. Hier. Heute. Denn jeder Einzelne kann in seinem Umfeld etwas tun kann, um unserer Natur zu helfen. Und wenn alle zusammen laut aufschreien, quasi stellvertretend für unsere Umwelt, unseren Lebensraum, dann muss dieser Aufschrei gehört werden. Klimaerwärmung mit sommerlichen Temperaturen um die 40 Grad in Mitteleuropa, fehlende Niederschläge … oder wie unlängst die Flutkatastrophe im Ahrtal, das alles darf nicht unsere und die Zukunft unserer Kinder und Enkel sein!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
o
Wenn der letzte Baum gerodet ...
Umweltgeschichten
Martina Meier (Hrsg.)
o
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.herzsprung-verlag.de
Herausgegeben von CAT creativ - www.cat-creativ.at
Lektorat und Gestaltung
im Auftrag von
© 2023 – Herzsprung-Verlag
Mühlstraße 10 – 88085 Langenargen
Alle Rechte vorbehalten. Erstauflage 2023
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Cover gestaltet von Papierfresserchens MTM-Verlag
mit einem Bild von © Leo Lintang- Adobe Stock lizenziert.
ISBN: 978-3-99051-110-7 - Taschenbuch
ISBN: 978-3-99051-111-4 - E-Book
*
Inhalt
Die böse Fliege
Ohnmacht
Das Habitat
In einer grauen Welt
Leif
Ein Märchen in weniger als 80 Tagen – kein Gedicht
Schuld
Höre, Mensch
In einer Welt vor eurer Zeit
5 vor 12
Die Geißel
Bis ich den Wald nicht mehr sah
Waldleben
Das Haus im Wald
Dass es nie geschehen werde
Lisa will sie selbst sein
Wood – Der letzte Baum der Erde
Der Wald in Kinderfarben
Der rote Drache
Ich wünsche den Menschen mehr Augenlicht
Verpackungen
Mutter Erde
Ein Fisch ruft um Hilfe
Waldleben
Klimakatastrophe – Eine Stellungnahme
Gedenken wir der Gänseblume
Erinnerungen des Mondes
Terror
Sweeny und die Revolution
Regenspaziergang
Auf ein Wort
Seid gewarnt
Vom Klettern in Bäumen
Stadtgrün
Bäume sind nur Bäume
Wenn der letzte Baum gerodet ist ...
Segelflieger
Ein wahres Wunderwerk
Ein Auto im Wald
Hüterin der Erinnerung
Hölzerner Methusalem
Pechschwarze Lunge
Endzeit
Die Sprache der Bäume
Zum Hinschied von Abies Tanner – Eine Abschiedsrede
Selbstmord als Lösung der Umweltprobleme?
Frage an einen alten Baum
Im Dialog mit Mutter Erde
Das Moor schützen
Die grüne Zukunft
Der zweibeinige Baum
(K)ein gutes Geschäft
Ein Sternlein mahnt
Glückslos
Ich hab’ da so ein Ziepen ...
Ein alter Baum
Schutzfehlfunktion
Segel setzen
Riesenmammutbaum
Eine eigene Geschichte
Freiflug zum Ballermann
Tabula rasa
Im Moor
Lügen
Wenn der letzte Wald gerodet ...
Das kleine Wäldchen
Eisbär Schmuck macht Druck
Nachtschatten
Plädoyer für das Leben
Der letzte Schnee
Zu spät
Stumme Stimmen
*
Die böse Fliege
Es ist September. Die Tage verkürzen sich, der Wind bläst kühl von den Bergen her. Auch die Abendsonne scheint ihre Farbpalette geändert zu haben. Mit sanftem Pinselstrich taucht sie den Himmel in fast schon herbstlich warme Töne.
In weitem Strahl regnet das Pestizid auf die Äste und Zweige der Olivenbäume. Gérard sprüht und versucht gleichzeitig, den herabregnenden, giftigen Wolken auszuweichen. Eine Schutzkleidung trägt er nicht, er muss sie erst noch suchen. Ich stehe in einiger Entfernung und regele den Druck und die Weite des Strahls. Wir kommunizieren mit Handzeichen, denn der Generator knattert ohrenbetäubend. Schade, dass ein biologisches traitement nicht möglich zu sein scheint aufgrund der Größe der Bäume. Böse blaue Fliege! Es wurmt mich, dass selbst hier in meinem korsischen Olivenparadies die Idylle nun von Giftschwaden vernebelt wird. Und ich betätige auch noch den Hebel, ich vergifte die böse blaue Fliege. „So muss es sein“, hat Gérard gesagt, „sonst gibt es keine Oliven.“
Plötzlich scheinen die knorrigen, alten Baumriesen sich im Sprühnebel zu winden und drohend, mit den Ästen zu wogen. Beginne ich zu halluzinieren? Bekommt mir das Gift nicht? Bin ich die böse blaue Fliege?
– Liegestuhl im Halbschatten unter dem Olivenbaum, Blick auf hellblauen Himmel mit vom Wind zerrissenen Wattewolken –
Nach wie vor empfinde ich es als Privileg, hier zu sein, auf Korsika, umgeben von Natur, Wind, Meer, Sonne, Regen, Gewitter und Geschichten aus vergangenen und gegenwärtigen Zeiten. Das Leben in den zu Kommunen gebündelten Dörfern dieser alten Insel erscheint mir manchmal wie ein Mikrokosmos. Durch Gérard eröffnet sich mir ein einmaliger Blick durch sein von ihm eingestelltes Mikroskop auf seinen persönlichen Objektträger und die darauf befindlichen Personen und Orte. Auch ich schwelge vor meinem inneren Auge in der Nostalgie vergangener Tage, als die Steinterrassen des Golfes vom Summen der Bienen und dem Duft unzähliger Obstbäume erfüllt waren. Als Landwirtschaft Leidenschaft war. Heute scheinen im Zuge des Wachstumswahns und der Globalisierung, des überhandnehmenden Tourismus und der Landflucht der Einheimischen auch die Grenzen der Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit zu verschwimmen. Überall wird zum eigenen Vorteil gebogen, gedeichselt und geflunkert, um die eigenen Taschen zu füllen und die der Verwandten.
„Man muss die Zähne zeigen, wenn man sich dem entgegensetzen will“, sagt Gérard. La pratique de la combine – Vetternwirtschaft – scheint allgegenwärtig und die Olivenfarm wie eine gesunde Insel – umgeben von Ignoranz und Selbstsucht. Eine Trutzburg im Kampf gegen die blauen Fliegen des Massenkonsums und doch beginnt sie, zu bröckeln. Eine Ladung Pestizid einmal im Sommer wird wohl nicht die Baumriesen in die Knie zwingen, nicht sofort, nicht in unserem Leben. Doch es wird Teil unseres Kreislaufs, wir binden es fest ein und dann gibt es kein Zurück. Wir vergiften uns selbst, vergiften die Olivenbäume, aber was solls, in ein paar Jahrzehnten, wenn Gérard nicht mehr ist, werden sie gefällt. Keine Bäume, keine Fliege. Keine Fliege, keine Probleme. Aber auch keine Oliven, schade. Doch trotzdem kämpfen wir weiter gegen Hürden mit Problemen an.
Doch ach, wie bin ich froh und dankbar, auf diesem Eiland angelandet zu haben. Der Abschied wird schwer werden, doch wie beim Baden im Meer wird die Zeit kommen, zu der ich mich abstoßen und mit zwei, drei kräftigen Zügen der Arme und Beine zurück in die Weite begebe. Hinaus aus dem Mikrokosmos, der mich wie eine schützende Glocke umgibt, hinein in die brausenden Wellen des Großstadtlebens. Immerhin gibt es dort keine bösen, blauen Fliegen, also brauche ich kein Pestizid zu spritzen. Nein, in der Großstadt ist es umgekehrt. Ich bin die Olive, eine von Millionen. Gegen den bösen Stillstand wird CO² gespritzt. Doch ich bin verloren, kein Baum weit und breit, keine weisen, grünen Riesen, die schützen und speichern und Sauerstoff erzeugen. Alles grau, wir haben sie einbetoniert.
Mich schaudert, während ich mich wie ein kleines Kind am Fuße der imposanten Wurzeln meines Lieblingsolivenbaums zusammenrolle. Ich möchte hierbleiben, möchte nicht zurück in den Hochhauskomplex. Aber ich muss doch etwas erreichen, mich beweisen, jemand sein und etwas aus mir machen. Es reicht nicht, irgendwo seine Wurzeln in die Erde zu graben und die Nase in den Wind zu strecken. Deshalb werden wir alle abgeholzt, schon als Kinder, auf Leistung getrimmt, ohne Wurzeln. Ich möchte sie wieder wachsen lassen. Hier in aller Einfachheit und Ruhe.
Frühstück mit Feigen-, Cédrat- und Esskastanienmarmelade, Hühner und Schafe füttern, Äpfel ernten, Gartenarbeit, Gestrüpp ausreißen, Disteln schneiden, Steine sammeln, Mauern bauen, Mittagessen mit Tomatensalat, Sardinen und Grenadinensirup, Mittagspause am Strand, beim Bäcker Brot kaufen, ein bisschen lesen, weiterarbeiten, Gemüse pflanzen, Karotten, Auberginen, Tomaten, Zucchini, Kräuter, Bohnen und Zwiebeln gießen, Hühnerstall zusperren, den Schafen gute Nacht sagen, Abendessen mit Schinken und Oliven als Aperitif und Forelle überm Holzfeuer, dazu ein kleiner Pastis mit Mandelsirup, nette Gespräche bei Tisch, Schlafenszeit.
So lebe ich hier das Leben, das ich mir wünsche. Lasst uns wieder Wurzeln haben, lasst uns gemeinsam wachsen und der bösen, blauen Fliege trotzen! Lasst euch nicht roden, grabt euch ein und wachst hoch hinaus, als Wald sind wir stark.
In Frankfurt am Main 1992 geboren, träumte Svenja Ohlsenschon als Kind davon, als Seefahrerin die Welt zu bereisen und Bücher über ihre Abenteuer zu schreiben. Aus Neugier für Kulturen und Sprachen studierte sie Übersetzen und Dolmetschen in Heidelberg und Köln und brach, wenn auch nicht mit dem Schiff, zu zahlreichen Abenteuern in Europa auf. Frankreich und die französische Kultur ist ihre zweite Heimat, auch Barcelona nannte sie einen Sommer lang ihr Zuhause, bevor sie sich in die schroffe Schönheit der schwedischen Insel Gotland verliebte und nun zwischen Deutschland und Schweden als Übersetzerin und freie Autorin arbeitet und zeitweise auf einem Bauernhof lebt, wo sie den Kühen ihre neuesten Abenteuergeschichten erzählen kann.
*
Ohnmacht
Ein Gefühl der Schwäche, dass mir den Atem raubt.
Zwei wunderschöne, alte Pappeln liegen am Wegesrand.
Enthauptet, zerteilt und mit menschlichem Liebeshohn verziert.
Mein Herz blutet, meine Seele schreit.
Gestern noch haben sie mich wohlwollend empfangen,
mich mit ihrer Schönheit verzaubert.
Heute hat man sie bereits zu Grabe getragen.
Ohne Mitleid, ohne Anstand, ohne Respekt.
Schöpferkraft über Jahrhunderte gewachsen wird von
Menschenhand zerstört.
Ausreden statt Einsicht, zulassen statt aufhalten.
Eigennutz steht vor Nachhaltigkeit und Artenschutz.
Der Mensch wird zum gefräßigen Raubtier, ohne jegliche
Vernunft. Wert ist ein Wort, dass vom Nutzer missbraucht wird.
Was zurückbleibt, ist die Erinnerung an den Ursprung der
Schöpfung. Unwiederbringlich, geopfert aus menschlicher Gier.
Die lautlosen Schreie aller Naturgeister werden überhört.
Und so stirbt der Leib von Mutter Erde einen leisen Tod.
Der Himmel wird dunkler, die Natur farbloser und das Leben
der Menschen verliert seinen Glanz.
Mein Geist sehnt sich nach einer anderen Welt, die ich hier
nicht mehr finde.
Und so lasse ich die Ohnmacht zu im Hier und Jetzt in der Hoffnung
auf das Leben in einer anderen Welt.
Birgit Härter,Dörth.
*
Das Habitat
Theobald Greiner blickte auf seine Pflanzen. Alle waren mit einem seltsamen Mehltau überzogen. Nicht nur Blätter und Früchte waren betroffen, auch Stamm und Wurzeln. Die Schicht ließ sich auch nicht durch irgendein Schädlingsbekämpfungsmittel oder durch Düngung wegbekommen. Das Schlimmste aber war, dass, wenn man den toxikologischen Untersuchungen Glauben schenken konnte, die Krankheit dafür sorgte, dass die Pflanzen tödliche Gifte bildeten. Das war eine Katastrophe. Alles, was sein Habitat besaß, war nicht mehr essbar, bis auf die eingelegten Nahrungsmittel. Doch die würden nicht ewig reichen.
Habitat D79539 war eines von vielen, die die Menschen vor der Auswirkung der Erdzerstörung schützten. Jahrzehntelang hatten Wissenschaftler die Verantwortlichen gewarnt, dass Klimawandel und Artensterben Bedrohungen waren, keiner wollte auf sie hören. Nun war es so weit. Kein Mensch konnte außerhalb der Habitatkuppeln überleben, die erschaffen worden waren, nachdem vernichtende Stürme mit unvorstellbarem Ausmaß und Sturzfluten, die sich mit sengenden Dürren abwechselten, zur Normalität gehörten.
Die Umweltkatastrophen überall hatten zwei Milliarden Menschen das Leben gekostet. Die Regierungen hatten nur einen Ausweg gesehen: die Städte abzureißen und stattdessen Kuppelhabitate aus unzerstörbarem Diamantinium zu errichten und die Menschheit darin einzuschließen. Die Industrienationen waren sich endlich ihrer Verantwortung bewusst geworden und hatten den ärmeren Ländern geholfen, die Habitate auch hier zu errichten. So hatten auch die Bevölkerungen der sogenannten Entwicklungsländer mehr oder weniger überlebt.
Die Habitate hatten das Ende der Nationalstaaten und der Globalisierung bedeutet. Jedes Habitat war vollständig autark und von den anderen abgeschlossen. Nur über Erdkabel im Boden konnte man kommunizieren. Weil man so autark war, gab es kaum Gründe, miteinander zu reden. Kaum jemand tauschte sich noch aus. Die Vereinten Nationen hatten sich zu Beginn der Krise darauf geeinigt, dass alle Habitate die Länderkennung und die Postleitzahl als Kennziffer trugen. Mittlerweile gab es die Vereinten Nationen nur noch auf dem Papier. Zu abgeschottet waren die einzelnen Sphären voneinander. Freiheit war ebenfalls Geschichte. Die Population der Habitate wurde streng kontrolliert. Austausch zwischen den Bevölkerungen der Kuppeln gab es nur, um Inzucht zu verhindern. Doch die Familienplanung war gesetzlich geregelt.
Greiner schüttelte den Kopf. Er musste aufhören, über solche Sachen nachzudenken. Es gab größere Probleme. Er war der leitende Agrarökologe, in dessen Verantwortungsbereich es lag, dass die Siedlung genug zu essen hatte. Diese elende Krankheit hatte das fast unmöglich gemacht. Er wusste, woran das lag, man brauchte neues Genmaterial, denn unter den Pflanzen kam es zur Inzucht. Es gab nur einen Weg: Er musste nach draußen, neue Pflanzen besorgen. Er war noch nie draußen gewesen. Doch was sollte er tun? Schweren Herzens ging er zum Ausrüstungszentrum.
„Hallo Theobald!“, grüßte ihn der Zentrumsleiter.
„Hallo Yaak, ich muss raus. Wir brauchen neues Saatgut“, erwiderte er den Gruß.
Yaak Küng, Nachbar Theobalds, Leiter der Materialbeschaffung und sein bester Freund, sah ihn beinahe mitfühlend an. „Nach draußen? Bist du lebensmüde? Das wirst du nicht schaffen!“, protestierte Küng entsetzt.
Doch Theobald ließ sich nicht abbringen. „Wir haben keine andere Wahl. Wenn wir keine neuen Pflanzen finden, dann werden alle verhungern. Wir brauchen genetisch besser angepasste Sorten, nur so können wir die Krankheit, die unsere Kulturen bedroht, besiegen“, erwiderte er ungewollt scharf.
Yaak schüttelte nur missbilligend den Kopf. „Mag ja sein, dass das alles stimmt, du bist hier der Agrarökologe. Aber was hilft das, wenn du dabei draufgehst?“, entgegnete er. Schließlich hob er resigniert die Schultern. „Also gut. Aber ich komme mit!“, erwiderte er entschieden.
Theobald wollte protestieren, aber ihm war klar, dass Yaak genauso wenig abzubringen war wie er. Er kannte seinen Freund dafür zu gut.
Gesine Sagapolutele, eine der Ausrüsterinnen für die seltenen, gefährlichen Expeditionen ins Umland von Habitat D79539 und Angestellte von Yaak, blickte die beiden Abenteurer ungläubig an. „Das kann doch nicht euer Ernst sein!“, rief sie aus.
„Fang du jetzt nicht auch noch an. Willst du jetzt was zu essen oder sollen wir warten, bis unsere Pflanzen alle an dieser Genkrankheit gestorben sind? Dann können wir das Habitat auch sprengen, denn dann spielt es keine Rolle mehr“, entgegnete Theobald scharf.
„Schön, schön. Hier habt ihr die Schutzanzüge. Ich übernehme keine Verantwortung für euer Tun“, hielt sie Theobald entgegen und gab ihm widerstrebend die Anzüge.
Der Anzug schirmte ihn von den Umwelteinflüssen ab. Die Hitze brannte ihm auf den Kopf. Theobald musste sich beeilen. Das Thermometer an seinem Anzug verriet ihm, dass es über fünfzig Grad hatte. Da vernahm er Donner in der Ferne. Yaak, der neben ihm herging, blickte besorgt zum Horizont. „Wir müssen schnell machen, sonst sind wir erledigt“, stellte er beinahe nüchtern fest.
Da hatte sein Freund natürlich recht. Gegen ein Gewitter half der Schutzanzug nichts, das wusste der Agrarökologe auch. Er blickte über das trockene Land. Etwas fände er bestimmt. Er brauchte nur einige Saatkörner. Zügig lief er auf den Hain unweit des Habitats in den Hängen des Tüllingers, eines Berges, an dessen Fuß das Habitat lag, zu. Warum die Bäume hier überlebt hatten, verstand Theobald nicht. Jemand schien vor der Klimakatastrophe damit begonnen zu haben, hitzeresistentere Pflanzen wie Orangen, Ananas und andere tropische Früchte anzupflanzen, sodass sich jetzt ein ansehnlicher Hain gebildet hatte.
Sie begannen, Früchte mit Samen und Ableger der Pflanzen einzusammeln. Der Donner kam näher. Unruhig blickte Theobald zum Himmel. Wenn sie nicht bald zurückkehrten, riskierten sie ihr Leben. Kaum hatte er das auch nur gedacht, als ein heftiger Windstoß über ihn hinwegfegte und ihn fast hinwarf. Entsetzt packte er die Ernte ein und wandte sich zum Gehen. Im selben Augenblick wurde er von etwas am Kopf getroffen. Voller Schrecken blickte er auf den Eisklumpen in der Größe eines Hühnereis. Nein!
„Schnell, sonst schaffen wir es nicht mehr!“, rief er Yaak verzweifelt zu. Sie begannen, zu rennen, so gut es in dem Schutzmantel ging, doch mit einem Male ging ein sintflutartiger Regen mit großen Hagelkörnern gemischt über ihnen nieder. Furchtsam kämpfte sich Theobald vorwärts. Sie mussten das Habitat erreichen! Die waren angewiesen auf die Pflanzen. Der Sturm zog und zerrte an ihm. Man sah die Hand nicht mehr vor Augen. Da stieß er gegen eine Wand. Die Tür des Habitats! Er hatte es geschafft. Schnell gab er den Code ein und die Tür öffnete sich. Mit letzter Kraft zwängte er sich hindurch, bevor er erschöpft im Durchgang zum Habitat zusammenbrach.
Da hörte er einen Schrei! Yaak! Eine gewaltige Windhose kam auf die Siedlung zu. Entsetzt sah er, wie sein Freund von dem Wirbel mitgerissen wurde „Yaak, nein!“, schrie er verzweifelt. Im selben Moment schloss sich die Tür. Da hörte er ein schabendes Geräusch. Die innere Pforte öffnete sich.
„Um Himmels willen, Theobald! Was ist passiert?“, rief Gesine entsetzt aus.
„Ich habe es geschafft. Wir brauchten doch was zu essen“, flüsterte Theobald und gab ihr die Samen. „Yaak hat es nicht geschafft“, murmelte er noch, bevor er bewusstlos wurde.
Florian Geiger, wohnhaft in Lörrach, geboren 1982 in Heidelberg, schreibt schon seit seiner Kindheit gerne Geschichten, besonders in den Bereichen Science-Fiction und Fantasy. Bisher konnte er Kurzgeschichten in verschiedenen Verlagen veröffentlichen. Seine Hobbys sind das Schreiben von Kurzgeschichten und das Lesen. Website: https://floriantobiasgeiger.jimdofree.com/, Fediversum: https://opensocial.at/profile/anarcheron.
*
In einer grauen Welt
Es war trist und grau
Und die Wochen lasteten schwer auf seinen Schultern.
Die Tage waren kurz wie das sehnsuchtsreiche Schweifen
Nach einem Halt – in der Dunkelheit.
Begegnungen voller Herzensregung waren rar –
Und diese leisen, zuversichtlichen Momente
Als er in ihre warmen Augen sah –
Die eine Verheißung auf ein neues, wildes Leben darstellten –
Schienen nicht wirklich real – und greifbar zu sein.
Unerreichbare Träume in der Gegenwart –
Und der einst so leichte, jugendliche Pfad –
Wie soll man das miteinander vereinbaren?
Nostalgie in allen neuen Wegen –
Arbeiten ohne Pause, machen, streben –
So verging die Zeit im Nebelflug der Welt –
Allein die Hoffnung auf Ruhe, ein grüner Gedanke.
Grün kann doch die Lösung sein!
Stille, Klarheit, Reflexion.
Neue Energien – neue Impulse – ein neuer Anfang
In dem wir zu uns zurückkehren.
Zu uns selbst zurückkehren. In die Natur.
In ein natürliches Leben, wo exotische Pflanzen strahlen
Und schillernde Vögel harmonisch singen –
Wo kraftvolle Bäume um die größte Schönheit ringen.
Hier, in solch einem Friedensort kann sich Liebe entfalten
Mit unendlich weitem Flügelschlag!
Dieser eine, ungreifbare Moment …
Er möchte endlich wieder wach sein.
Fährt raus aus der Stadt, zu seiner einstigen Oase –
Er war so versunken, dass er alles vergaß.
Der letzte Baum dieser Erde war bereits gerodet worden.
Stille Besinnung – Blicke schweifen – ins Nichts.
Der Planet war trist und grau – und wurde dunkler und dunkler.
Philip Bartetzko
*
Leif
Im Wald krachte und knackte es. Mit brachialem Getöse stürmte ein Tyrannosaurus Rex aus dem Unterholz, dicht gefolgt von einem wutschnaubenden Velociraptor. Der Velo war viel kleiner als der Rex, aber dafür schneller und wendiger. Der Rex hatte ihm einen fetten Pterandon weggeschnappt. Auf einer Lichtung kämpften die beiden Tiere erbittert um ihre Beute. Sie brüllten, umkreisten sich, warfen mit ihren Körpern achtlos Bäume um und bissen sich, nach einem heftigen Gerangel, mit ihren langen, messerscharfen Zähnen ineinander fest. Jetzt nützte dem Velo keine Schnelligkeit mehr, denn der Rex hatte einen seiner gefiederten Arme im Maul. Er wehrte sich verzweifelt, klemmte die Kehle des Rex zwischen seine Kiefer und drückte zu. So rollten sie fauchend, schnaubend und um sich schlagend über die Lichtung. Der Kampf war jetzt auf beiden Seiten aussichtslos. Aber sie gaben nicht auf.
Es dauerte nicht lange, bis sie beide inmitten der umgestürzten Bäume liegen blieben. Der Rex versuchte, noch einmal auf die Beine zu kommen, aber er hatte keine Kraft mehr. Er brach neben seinem toten Feind zusammen und tat seinen letzten Schnaufer.
Die entwurzelten Bäume lagen mit ihren grünen Kronen kreuz und quer auf der Lichtung. Im Hintergrund ragten zwei dicke hölzerne Pfosten auf, von denen das Furnier abgeplatzt war. Auf der Sitzfläche des alten Stuhls hatte sich soeben ein urzeitlicher Kampf um Leben und Tod abgespielt. Die Plastikbäume und Saurier lagen in wildem Durcheinander. Einige Bäume waren über den Rand auf den sandigen Boden abgestürzt.
Leif kniete verschwitzt und von dem wilden Kampf erfüllt vor dem Stuhl, die kleinen Hände noch an den Körpern der Spielfiguren.
Der Stuhl stand draußen vor dem Haus auf der freien Fläche aus Sand und Staub. An manchen Stellen ragten borstige Büschel vertrockneter Pflanzen aus dem letzten Jahr empor.
Das Haus mit der hölzernen Veranda war farblos. Wind und Sand hatten seinen Anstrich längst abgeschliffen. Dahinter stand ein verfallener Stall vor einer weiten Ebene voller grauer Stümpfe, silberner Stämme und nackter Äste. Mama nannte die Ebene Wald. Sie sagte, früher wäre der Wald grün gewesen und hätte genauso ausgesehen wie seine Plastikbäume. Wenn Leif Holz für den Herd sammelte, dann versuchte er manchmal, sich vorzustellen, wie grüne Baumkronen hoch über seinem Kopf in den Himmel ragten.
Vor dem Haus, ein Stück hinter dem Stuhl, zeichnete ein schmaler Graben ein großes Karree in den sandigen Boden. Mama nannte dieses Viereck das Feld. Wenn der Frühling regenreich war, wuchsen dort Kichererbsen und kleine, harte Radieschen. Im Moment wuchs gar nichts, denn es war Winter. Erst in einem oder zwei Monaten würde es wieder regnen. Leif mochte den Frühling nicht. Der Regen verwandelte den Sand in knöcheltiefen Schlamm. Außerdem kamen dann die Stürme. Nach den Stürmen wurde es heiß. Und erst im Herbst, wenn der Boden von der Trockenheit aufgerissen war, konnte er endlich wieder draußen spielen.
„Leif, komm herein, es wird bald dunkel!“
Mama war vor die Tür getreten. Sie achtete immer darauf, dass er im Dunkeln zu Hause war. Dabei hätte er so gerne den Mond und die Sterne beobachtet.
Er stopfte seine Dinos und Bäume in eine zerschlissene Plastiktüte und rannte ins Haus. Dabei spielte er mit ausgebreiteten Armen, er wäre ein fliegender Pterandon.
„Spiel noch ein bisschen am Tisch“, sagte Mama und strich ihm über den Kopf. „Ich mach dir gleich Essen.“
Leif legte seine Tüte auf den Küchentisch. Er hatte jetzt keine Lust mehr auf die Saurier. Lieber hätte er die Kühe, Schweine und Pferde aufgestellt, aber die hatte Mama ganz hinten im Schrank versteckt. Es gefiel ihr nicht, wenn er damit spielte.
Manchmal, wenn Papa da war, dann erzählte er von früher, als er selbst ein Junge war. Im alten Stall hatten Rinder gestanden. Hühner waren pickend und gackernd um das Haus gelaufen. Das hätte Leif zu gerne gesehen. Papa hatte sogar einen zahmen Hund gehabt.
Hunde gab es immer noch. Aber sie streiften wild umher und waren einer der Gründe, warum Leif im Dunkeln im Haus sein musste.
Dinosaurier hatte es wohl nicht gegeben, als Mama klein war, jedenfalls machten ihr diese Spielfiguren nichts aus.
„Mama, wann wurde deine Mama geboren?“
„Die Oma? Aber die kennst du doch gar nicht. Lass mal überlegen ... Das war neunzehnhundertirgendwas. In den Neunzigern muss das gewesen sein.“
„Gab es da noch Dinosaurier?“
Mama lachte. „Nein, Leif, die Saurier waren da schon längst ausgestorben.“ Das Ende des Wortes sprach sie so leise, dass es fast unhörbar war. Sie löffelte sein Kinderpulver in eine Schale. Dann öffnete sie eine Gallone Befeuchter, goss davon ein wenig über das Pulver und rührte beides zu einem Brei. Sie legte ihm einen Kaustreifen dazu. „Iss mein Junge, damit du groß und stark wirst.“ Das sagte sie immer. Außerdem sagte sie: „Du musst kauen, sonst fallen dir die Zähne aus!“
Leif aß nicht gerne, aber er hatte inzwischen begriffen, dass es zwecklos war, den Brei und die ewigen Kaustreifen zu verweigern. So kurz vor der Regenzeit gab es nichts anderes.
Früher hatte es Früchte gegeben. Papa sagte, die Früchte wären rot, grün und gelb gewesen Leif glaubte nicht, dass das Essen wirklich so leuchtende Farben gehabt hatte. Alle Dinge schienen früher grellbunt gewesen zu sein.
Papa hatte ihm erzählt, dass sie früher sogar Tiere gegessen hatten. Leif war bei dem Gedanken übel geworden. Einmal hatte er zwischen den grauen Baumstümpfen ein totes Tier gefunden. Das Fell hatte an dem steifen Körper geklebt und es hatte entsetzlich gestunken.
„Leif! Ab nach unten!“
Mamas Stimme klang scharf. Sie war mit zwei Schritten am Schrank, drehte den Schlüssel um und nahm das Gewehr heraus. Leif ließ seinen Löffel auf den Tisch fallen und sprang auf. Während er blitzschnell den dünnen Teppich zur Seite klappte und die Falltür im Boden öffnete, lud Mama das Gewehr schon durch und trat ganz nah an die Haustür.
Leif sah, wie sie durch die kleine Scheibe in der Tür nach draußen spähte. Dann klappt er die Falltür über seinem Kopf zu. Er hörte das Scharren, als Mama den Teppich oben wieder zurückschob.
Es war stockdunkel auf den grob gezimmerten Holzstufen. Der Raum unter dem Fußboden des Hauses war nicht hoch genug, um darin zu stehen. Leif hockte sich dicht an die untere Stufe und stütze sein Kinn auf die Knie. Er lauschte.
Gedämpft hörte er Mamas Stimme. „Gehen Sie weiter. Ich habe ein Gewehr. Verschwinden Sie oder ich schieße.“
Leifs Herz begann wild zu klopfen.
„Ich meine es ernst!“ Mamas Stimme klang schrill. Sie hatte Angst.
Leif zog die Schultern zusammen. Er konnte kaum noch hören, was oben geschah, weil sein Atem so laut ging. Die Stimme seiner Mutter, zersplitterndes Glas und dann ein lauter Schuss. Leif hielt sich die Ohren zu und duckte seinen Kopf näher an die Knie. Dumpf hörte er einen zweiten Schuss.
Dann passierte nichts mehr. Er nahm die Finger aus den Ohren, hob den Kopf ein wenig und lauschte. Nichts. Schritte. Das Schaben des Teppichs. Die Luke über ihm öffnete sich. „Leif? Alles okay?“
„Mama!“ Als sie ihn in die Arme nahm, presste er sich an sie.
„Ist schon gut, Kleiner, schon gut!“ Mamas Hand, die seinen Kopf streichelte, zitterte. Sie blieben eng umschlungen auf dem Boden sitzen und wiegten sich leise.
„Sind sie weg?“, fragte Leif, den Kopf in Mamas Halsbeuge geschmiegt.
„Könnte man so sagen“, antwortete Mama. Das hatte sie jetzt gesagt, als würde sie zu einem Erwachsenen sprechen. Er hob den Kopf und schaute sie fragend an. „Du bist ein großer Junge, nicht wahr?“, fragte Mama.
Er nickte.
„Ich muss jetzt da draußen etwas tun und so lange musst du alleine hier im Haus bleiben. Schaffst du das?“
Wieder nickte er. Und er fühlte sich sehr tapfer.
„Und du schaust nicht aus dem Fenster, okay?“
Er schüttelte den Kopf.
„Setz dich einfach aufs Sofa. Es wird ein bisschen dauern, aber es ist alles in Ordnung und wir sind sicher. Hast du das verstanden?“
„Ja.“
„Du bist ein toller Junge!“ Mama küsste ihn auf die Stirn, bevor sie vom Boden aufstanden. Leif setzte sich in die Sofaecke. Mama nahm das Gewehr und ging hinaus.
Die kleine Scheibe in der Tür war zersplittert. Ein leichter Wind wehte durch das Loch herein. Draußen wurde es langsam dunkel.
Leif wippte mit den Füßen, die über der Sofakante hingen. Mit einem Finger pulte er in einem kleinen Loch im Gewebe des dicken Polsters, auf dem er saß. Ihm war langweilig. Er wollte wissen, was Mama draußen machte. Aber er hatte versprochen, ein großer, tapferer Junge zu sein, deshalb blieb er sitzen. Er zog die Beine ganz auf das Sofa und schmiegte sich an die Armlehne. Das war gemütlich. Gedankenverloren knibbelte er an einer Kruste an seinem Knie.
Als Mama ihn weckte, war es draußen hell. Er hatte gerade etwas von einem T-Rex geträumt, dessen grüner Kopf durch die Haustür hereingespäht hatte. Mama sah müde aus und schien gar nicht im Bett gewesen zu sein. „Komm mit, ich habe etwas Tolles gefunden!“, sagte sie. Leif sprang vom Sofa und trat mit Mama vor die Tür.
Der Stuhl, auf dem er gestern noch gespielt hatte, war umgefallen und zerbrochen. Direkt daneben lag ein großes, rundliches Bündel. Sie traten näher und er erkannte, dass es ein zerschlissener Rucksack war. Er stand oben offen und einige große Gegenstände waren zu sehen.
„Nimm etwas heraus“, forderte Mama ihn auf.
Leif holte mit beiden Händen etwas Großes, Rundes ans Licht. Es war schwer und darinnen schwappte es.
„Weiter“, ermunterte Mama ihn.
Es kamen noch weitere von den runden Dingern zum Vorschein. Sie waren verschieden groß und schimmerten silbern mit Resten von Papier daran.
„Was ist das?“
„Das sind Konservendosen. Darin ist ganz tolles Essen!“
Leif wurde aufmerksam. Bilder von leuchtenden Farben tauchten vor seinem inneren Auge auf. Gemeinsam trugen sie die Dosen ins Haus und bauten sie auf dem Küchentisch auf.
„Du darfst dir eine aussuchen, die wir sofort öffnen. Die anderen bewahren wir auf, bis Papa wieder da ist. Das ist dann unsere Überraschung für ihn.“
Leif zeigte aufgeregt auf eine von den großen Dosen und Mama holte ein seltsames Werkzeug aus der Kramschublade. Damit schnitt sie das Metall am oberen Rand auf. Sie schnupperte und strahlte ihn dann an. „Es ist Obst!“
Leif beugte sich über die geöffnete Dose und schaute hinein. Große, runde, Dinger schwammen in einem durchsichtigen Saft. Sie waren orange! Er konnte es kaum fassen. Es stimmte wirklich, was Papa über die Farben erzählt hatte.
„Und das kann man essen?“, fragte er skeptisch.
Mama war schon aufgestanden und holte eine saubere Schale aus dem Küchenschrank. Mit einer Gabel stach sie in die Dose und beförderte eins von den orangen Dingern heraus. Es flitschte ein bisschen in der Schale hin und her und sah aus wie ein halb durchgeschnittener Ball. Mama zerteilte es in kleinere Stücke, spießte dann eins davon auf und hielt es ihm hin.
Sehr zögerlich nahm Leif die Gabel. Er starrte das orange Stück an. Schnupperte. „Es riecht gut.“
„Es schmeckt auch gut. Probiere es!“
Leif streckte seine Zunge heraus und leckte erst einmal probeweise an dem seltsamen Ding. Es war süß und irgendwie – hell, bunt? Er kannte kein passendes Wort für das, was er schmeckte.
Vorsichtig schob er sich das ganze Stück in den Mund. Erst war es glibberig und etwas fest. Nicht wie Brei. Aber auch nicht wie Kaustange. Es war ein sehr merkwürdiges Gefühl, als seine Zähne hindurchbissen. Und dann breitete sich in seinem Mund etwas Unglaubliches aus. Leif riss die Augen auf und Mama lachte. Sie nahm sich mit spitzen Fingern auch ein Stückchen aus der Schüssel und als sie es sich in den Mund schob, schloss sie genüsslich ihre Augen. „Hmmmmmmmm“, machte sie.
Leif tat es ihr nach. Mit geschlossenen Augen konnte er diese Süße und das Unbeschreibliche noch besser schmecken. „Hmmmmmmm“, ahmte er Mama nach und fand, dass dies ein genau passendes Geräusch war. Er kaute, lutschte, sog und drückte mit seiner Zunge an dem Stück herum, bis es nur noch dünner Brei war, dann schluckt er es hinunter und dieses Schlucken machte weit hinten im Hals noch einmal ein neues, herrlich prickelndes Gefühl. Er öffnete die Augen und schaute strahlend in Mamas lächelndes Gesicht. „Was ist das? Kann ich noch mehr?“
„Iss, so viel du kannst, wir können es nicht mehr aufbewahren, wenn die Dose einmal geöffnet ist. Es sind Pfirsiche.“
„Was? Pfische?“ Leif begann zu kichern, während er das nächste Stück in den Mund schob.
„Nein, P-f-i-r-s-i-ch-e.“ Mama kicherte jetzt auch.
Lachend aßen sie die Dose leer.
Nach dem Essen gingen sie hinaus und brachten den leeren Rucksack zur Feuertonne. Später würden sie ihn verbrennen. Er war kaputt und würde sich nicht mehr reparieren lassen.
Leider war auch sein Spielstuhl kaputt und so morsch, dass er nur noch als Brennholz taugte. Von dort, wo er gestanden hatte, führte eine breite Schleifspur bis zu den Stümpfen im Wald.
„Leif, ich möchte, dass du nicht mehr zum Wald gehst, bis wir es dir wieder erlauben. Verstanden?“
Leif nickte.
Am nächsten Tag kam Papa nach Hause und Leif rannte ihm entgegen. Papa hob ihn hoch und wirbelte ihn durch die Luft.
„Wir haben Dosen gefunden mit Pfirsich drin!“, rief Leif aufgeregt.
Papa stutze, setzte Leif auf den Boden und wechselte einen stirnrunzelnden Blick mit Mama.
Als sie ihm die Dosen zeigten, nahm er eine von den Flachen heraus. Am Nachmittag ging er mit Leif nach draußen vor das Haus. Sie hockten sich auf die Verandastufen und Papa öffnete die Dose.
Leif stieg ein fremder Duft in die Nase.
„Ah, es ist das, was ich vermutet hatte“, sagte Papa, nahm eine Gabel und hob damit etwas von dem Inhalt heraus.
„Probiere“, sagte er. „Es ist ganz anders als Pfirsich. Nicht süß. Lass dir Zeit.“
Leif sperrte erwartungsvoll den Mund auf. Er schmeckte zuerst Salz, spürte etwas Weiches, Faseriges auf der Zunge und dann kam ein großes – Warmes? Dunkles? Schweres? Er kaute, seine Zähne zerteilten weiche Stücke und der Geschmack breitete sich in ihm aus wie eine Woge. Leifs ganzer Körper schien augenblicklich nach mehr zu verlangen, nach viel mehr! Seine Hände griffen nach der Dose, nach der Gabel.
Papa überließ ihm beides und beobachtete seinen Sohn, wie er noch im Kauen immer die nächste Gabel aus dem Blech pulte. Gierig schaufelte der Junge die ganze Dose leer. Er kleckerte, leckte sich die Lippen. Saft lief ihm übers Kinn und tropfte auf sein T-Shirt.
„Was ist das?“, nuschelte Leif mit vollem Mund. Seine Augen glänzten.
„Es ist Fleisch“, antwortete sein Vater leise und schaute auf den Staub zwischen seinen zerrissenen Stiefeln.
Claudia Grothus, geboren 1965 in Essen. Hat in Duisburg Soziologie studiert und anschließend freiberuflich im Eventmanagement für Industriekultur im Ruhrgebiet gearbeitet. Sie lebt heute im Münsterland und ist Texterin und Content-Managerin in der eigenen TYPO3-Agentur und betreibt mit ihrem Mann ein privates Artenschutzprojekt. Ihre Themen sind menschliche Abgründe und wie sie auf das Miteinander von vielen Menschen bei wenig Ressourcen und die brandgefährliche Situation unseres Planeten Einfluss nehmen. www.claudia-grothus.de
*
Ein Märchen in weniger als 80 Tagen – kein Gedicht
Einst wollte ich die ganze Welt einmal sehen.
Ich dachte, in 80 Tagen könnte ich es schaffen.
Am ersten Tag flog ich nach Afrika.
Als das Flugzeug landete, strömten die Menschen herbei.
Ihre Flüsse waren ausgetrocknet.
Ihr Land war unfruchtbar und ihr Vieh verdurstet.
Um die staubigen Reste tobten Streit und Krieg.
Davor wollten alle fliehen.
Bevor sie mich herunterziehen konnten, hob meine Maschine ab.
In Überschall flüchtete ich zum Horizont.
Wir erreichten Amerika.
Dort klebte das Öl im Gefieder und Fell der Tiere.
Menschen bekämpften sich.
Ein Hurricane verhinderte unsere Landung.
Zur Sicherheit flogen wir weiter.
Wir landeten in Australien.
Was nicht von Feuern verbrannt war, hatten Fluten weggerissen.
Diese unerträgliche Hitze! Überall ...
Wir machten uns so schnell auf und davon, wie wir Gas geben konnten.
Asien ist riesig, dachten wir, und landeten.
Viele verdursteten bereits in nie dagewesener Hitze.
Viele hatten keine Arbeit und waren auf der Flucht.
Andere beschossen sich, weshalb alle übrigen auf der Flucht waren.
Eilends verließen wir das Getümmel und kehrten heim nach Europa.
Hier diskutierten die Menschen, ob sie den anderen helfen sollten.
Sie wurden aber gar nicht gefragt, sondern überrannt.
Die übrigen diskutierten, ob es Klimawandel gibt und was zu tun sei.
Niemand hörte zu.
Meine Reise hatte keine 80 Tage gedauert,
und doch war ich hier schon fremd.
Jetzt warte ich auf den Countdown meines Spaceships.
Vielleicht ergeht es mir auf dem Mars besser.
Ellen Westphalschreibt seit den 80ern Gedichte und Geschichten, die sie unter anderem in Anthologien, Zeitschriften und im Internet veröffentlicht. Zu ihren wichtigsten Themen gehören unser Verhältnis zur Erde und allen ihren pflanzlichen und tierischen Geschöpfen.
*
Schuld
Der Tod wird uns alle holen. Er weiß nicht, wie man Ausnahmen macht oder Mitleid zeigt.
Aber heute schaut der Tod auf die Menschen runter und fragt sich, warum sie sich den Tod der Erde wünschen. Warum sie ihr Heim zerstören und das Leben ihrer Nachfahren mit dem Dampf der Maschinen in dreckigen Rauch werfen, als wäre es nicht so wichtig wie ihres.
Menschen mit weißen Haaren, die das Leben der Jungen diktieren, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Weisheit war nur ein Mythos, der von denen erfunden wurde, die eine Form der Macht spüren wollten. Weisheit war nie Teil des Alters, so wie es alle immer erzählen. Es ist nur eine Lüge mit grauen Zähnen.
Wir leben in einer Gesellschaft, die von fliegenden Autos und mechanischen Menschen träumt, die Intelligenz besitzen. Wir leben in einem Zeitalter, in dem hart daran gearbeitet wird, eine Lösung zu finden, wie der Mensch auf dem Mars überleben könnte. Hätte es auf dem Mond auch Sauerstoff gegeben, so wäre er schon längst zu Staub zerfallen.
Weil Menschen nun mal Menschen sind und alles zerstören, was zerstört werden kann. Weil Menschen furchtbar sind und an niemand anderen denken als an sich. Weil Menschen die Waffen erfunden haben, die uns schlussendlich in den Untergang ziehen werden.
Wir werden sterben und es wird unsere Schuld sein. Wir werden leiden und uns über die Konsequenzen unserer Taten wundern. Wir werden alle mit in den Untergang ziehen, alle Tiere, deren Namen mit Unschuld versehen ist, mitnehmen und allem, außer uns, die Schuld dafür geben.
Der Tod wird jeden holen. Aber er schaut heute runter auf die Menschen und wundert sich, weshalb sie einen Planeten mit in den Tod ziehen, der ihnen nichts außer Leben schenkte.
Einen Dank an die alte Politik, die seit Anfang der Zeit versucht, die Menschheit zu Formen zu zwingen, die nicht existieren.
Einen Gruß an die Menschheit, die es endlich geschafft hat, die Erde zu industrialisieren.
Ein Hoch auf den Tod der Welt, weil Menschen einfach nur Menschen sind. Individuen, deren Spezialität die Zerstörung selbst ist.
Achoaq Cherif, geboren 2001 in Tunesien, wuchs im Kanton Basel in der Schweiz auf. Obwohl sie bis in ihren Jugendjahren den Fokus auf Naturwissenschaften und Kampfkunst legte, entdeckte sie später das Schreiben für sich und entschied sich nach der Matura, Germanistik und Anglistik an der Universität Basel zu studieren. Im Laufe des Studiums wagte sie sich immer mehr, ihre kreativen Texte zu präsentieren, und entschied sich, auch welche zu veröffentlichen. Somit machte sie den ersten Schritt in die Literaturwelt mit ihrem Debütwerk „Sprechende Texte“ im September 2022. Im selben Jahr wurde ebenfalls ihr erstes Gedicht „Lass uns gegen die Welt tanzen“ veröffentlicht.
*
Höre, Mensch
Höre, Mensch, was ich zu sagen habe,
bin Albert, ein sehr intelligenter Rabe,
schlauer noch als mein Namensvetter,
mein Interesse gilt Klima und Wetter.
Bin mit einer großen Gabe gesegnet,
sehe, was dir in der Zukunft begegnet,
höre, Mensch, die sieht düster aus,
Ungemach steht dir ins Haus.
Im Jahr 2050, noch verschwommen,
habe ich Schlimmes wahrgenommen,
hab mich bei meinem Neste umgeseh’n,
höre, Mensch, es war nicht schön.
Die Stelle mit der Buche am Waldesrand,
höre, Mensch, ich habe sie kaum erkannt,
mein Baum, mein Nest total zerstört,
der Zustand der Wiese hat mich empört.
Bunte Blumen oder Gräser gab es keine,
dafür verdorrte Halme, Staub und Steine,
keine einzige Biene weit und breit,
höre, Mensch, es kommt eine düstere Zeit.
Und darum, Mensch, höre gut zu,
die Schuld daran trägst allein du,
durch dich entsteht der Treibhauseffekt,
doch mancher hat das noch nicht gecheckt.
Globaler Handel, zu viel Verkehr,
Energieverbrauch und Fleischverzehr,
Kreuzfahrtschiffe,Co²-Ausstoß, Methan,
Mensch, diese Ursachen führt man an.
Habe ständig meine Wiese im Sinn,
2050 – schaue immer wieder hin,
kein Insekt, das eine Blüte umkreist,
weißt du, Mensch, was das heißt?
Du, Mensch, hast die Erde geschunden,
danach sind alle Bienen verschwunden,
bald darauf geht’s dir an den Kragen,
so ähnlich hörte man es Albert E. sagen.
Noch kannst du das Schlimmste verhindern,
denk an die Zukunft von deinen Kindern,
höre, Mensch, ändere sofort dein Verhalten,
lass Vernunft und Scharfsinn walten,
Ideen dazu gibt es wirklich viele,
informieren, handeln, das führt zum Ziele,
nicht nur reden, sondern was tun
höre, Mensch, du darfst nicht ruh’n.
Margret Küllmar,geboren 1950, aufgewachsen auf einem Bauernhof in Nordhessen, nach der Schule Ausbildung in der Hauswirtschaft, dann Lehrerin an einer Berufsschule, jetzt im Ruhestand, schreibt Kurzgeschichten und Gedichte. Veröffentlichungen in zahlreichen Anthologien und von drei eigenen Lyrikbänden.
*
In einer Welt vor eurer Zeit
Als ich jung war, taten mir immer die alten Menschen leid. Jetzt, wo ich alt bin, habe ich Mitleid mit den Jungen. Sie wurden gesattelt mit der Schuld der Vorahnen. Zurückgelassen in einer Welt, die einst von Schönheit und Reichtum nicht zu übertreffen war und jetzt karg und leer ist. Mit einem letzten lauten Ausruf ihrer gezerrten Seele versuchte sich die Erde zu retten. Sich und uns. Doch wir waren wie Würmer, die unaufhörlich tiefere Löcher in sie gruben auf der Suche nach ihren Bodenschätzen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Die Augen zusammengepresst, um ja nicht vorauszusehen. Getrieben von dem ständigen Drang nach mehr hörten wir nicht hin.
Dann geschah, was passieren musste. Die widerrechtlich gebohrten Schlupflöcher stürzten ein. Begruben Mensch, Tier und Pflanzen. Leben. Doch auch dies reichte nicht zum Umdenken aus. Wir rodeten ohne Unterlass weiter grenzenlos die Wurzeln des Lebens. Wandelten Holz zu Papier um, um darauf unser eigenes Todesurteil zu drucken. Das Netz des Lebens, gesponnen von der Natur, wurde von uns Menschen durchtrennt. Immer weiter, immer schneller.
Als ich jung war, da war die Luft noch klar. Jeder Atemzug stärkte den wohligen Körper. Wir rannten durch dichte, grüne Wälder. Die Waldluft geschwängert mit Erinnerungen. Pilze, die aus dem saftigen Boden sprossen. Rehe, die erschrocken durch das Gehölz irrten. Das war eine Welt. Unsere Welt. Der Planet leuchtete in einem strahlenden Blau. Pflanzen aller Arten ebenso wie Tiere waren hier zu Hause.
Es gab Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jede Jahreszeit brachte etwas mit sich und nahm sich dafür etwas mit. Ein dauerndes Gleichgewicht. Jahr für Jahr. Jahrzehnte für Jahrzehnte. Jahrtausende für Jahrtausende. Doch wir Menschen fingen an, den Takt des Lebens zu beeinflussen. Wir nahmen und nahmen und gaben nichts. Wir dachten, wir könnten die Natur austricksen. Immer mehr, weiter, schneller.
Wir lagen so falsch. Es gab so viele Warnungen der Erde, doch wir ignorierten und manipulierten sie.
Der einst satte Regen blieb immer länger aus. Das Eis der Polare schmolz rasant. Stürme fegten erbarmungslos auf uns nieder. Die belebende Luft veränderte sich. Jeder Atemzug war gestreckt – genau wie der Boden ausgezehrt. Wir kastrierten brutal die Erde. Nichts wuchs mehr. Die einst wärmende Sonnenmutter brannte tadelnd auf uns hinab. Alles wurde wenig und plötzlich wieder kostbar. Das Horten brachte uns nichts mehr, wir mussten zusammenhalten. Für das Überleben unserer Spezies. Wir konnten nicht mehr nur nehmen ohne Unterlass, sondern mussten geben ohne Erwartungen. Denn alles musste sich irgendwann dem Kreislauf des Lebens beugen.
Dann schließt sich wieder der Kreis. Gutes zum Gutem und Schlechtes zu Schlechtem. Es liegt an jedem einzelnen Gast, auf diesem Planeten das Gleichgewicht des Lebens in Balance zu halten. Denn jede Ungleichheit wird hart spürbar sein. Denn dann schwingt das Rad des Lebens nicht mehr gleichmäßig, sondern holprig und kann zerbrechen. Wir müssen der Natur wieder die Bänder unserer Verbindung reichen. Voller Demut und Reue und hoffen, dass ihre Liebe zu uns noch ausreicht. Das einstige Bündnis zwischen uns zu erneuern. Gegenseitigen Respekt und Toleranz. Sonst ist diese Geschichte der Menschheit auf diesem gütigen Planeten bald zu Ende erzählt.
Julia Elflein, geboren 1990, lebt in Friedrichshafen.
*
5 vor 12
Erderwärmung, Klimakatastrophen und Baumsterben –
und wir Menschen mit der Verantwortung mittendrin!
Täglich erreicht uns eine andere Meldung in Medien,
die uns Angst macht und fortan geht durch den Sinn.
Wie Fotos zeigen, sieht man selbst von der ISS aus
das gravierende Ausmaß unserer notleidenden Natur.
Den Nadelbäumen unserer Heimat fehlt das Wasser
und das Baumsterben zieht immer mehr seine Spur.
Umweltschützer mahnen längst, dass es 5 vor 12 ist.
Das Umdenken jedes einzelnen Menschen ist gefragt.
Machen wir ernst damit – es ist noch Luft nach oben,
bevor die Abgasentwicklung weiter an der Natur nagt.
Ausgetrocknete Bachläufe, Niedrigwasser der Flüsse!
Vogelarten und Schmetterlinge sind am Verschwinden,
wenn wir nicht das Verhalten überdenken und ändern,
Verzicht üben, fortan die Schnürsenkel enger binden.
Das Wort einschränken möchte keiner mehr hören,
denn es erinnert uns stark an die Corona-Pandemie.
Handeln wir verantwortlich zum Wohl unserer Kinder!
Beginnen wir bei uns nach dem Motto: Jetzt oder nie!
Egal, in welcher Großstadt man bei uns unterwegs ist:
Menschen sind unterwegs zum Shoppen und Kaufen.
Wir werden künftig überlegter unterwegs sein müssen,
nicht der Mode nachgeben dürfen und Neues kaufen.
Aus der Sorge für den Erhalt der Ressourcen heraus,
sollte man das eigene Verhalten stärker hinterfragen.
Infolge eines überlegten veränderten Kaufverhaltens
müssten Firmen der Nachhaltigkeit Rechnung tragen.
Warum nicht in einem Secondhandladen einkaufen?
Setzen wir uns zukünftig für mehr Nachhaltigkeit ein!
Das klimaorientierte Gemeinwohl sollte das erste Ziel
aller produzierenden Unternehmen unserer Welt sein.
Es fängt beim Umgang mit unseren Lebensmitteln an.
Vermitteln wir den Kindern: Sie sind Mittel zum Leben.
Doch werden vielfach Nahrungsmittel achtlos entsorgt,
statt Essbares sinnvoll an die Tafelläden weiterzugeben.
Denke ich an das hohe Gut Wasser das wir haben:
Es rückte seit der Hitzeperiode mehr ins Bewusstsein.
Beim Duschen und Baden oft Wasserverschwendung!
Auch mit weniger langem Duschen wird die Haut rein.
Ein sparsamer Umgang mit Wasser, Strom und Gütern,
ist für das Gemeinwohl eines jeden Einzelnen Pflicht.
Güter der Erde stehen nicht unendlich zur Verfügung,
auch Wälder und unterschiedliche Bodenschätze nicht!
Oder aber die immer weniger werdenden Ressourcen,
wenn man auf die zunehmende Städtebebauung blickt!
Einfamilienhäuser werden zum Auslaufmodell werden.
Der Flächenbedarf den raren Grund und Boden erstickt.
Wegen der Luftverschmutzung durch störende Abgase
gehört meines Erachtens der Rennsport verboten.
Ob man Fernsehübertragungen konsumiert/boykottiert,
muss jeder Mensch für sich eigenverantwortlich ausloten.
Auch die Traumschiffe pusten viele Abgase in die Luft.
Muss es immer ein Urlaubsflug in ein fernes Land sein?
Wie wäre es, hier seine Gewohnheiten zu hinterfragen?
Mir fallen auch hierzulande viele schöne Fleckchen ein.
Zwar haben wir uns alle in der Komfortzone eingerichtet.
Es fällt uns sicherlich nicht leicht, sie wieder aufzugeben.
Doch besteht wirklich die dringliche Notwendigkeit hierfür.
Auch künftige Generationen haben ein Recht auf Leben.
Sieht man diversen Änderungsmöglichkeiten in das Auge,
wirkt der Umweltschutz fast wie ein unbezwingbarer Berg.
Die Frage kommt auf: Was kann ein Einzelner bewirken?
Angesichts dessen, was zu tun ist, ist er doch ein Zwerg.
Dennoch kann jeder von uns seinen Beitrag dazu leisten,
sogar mit Erfolg, wie man an einer Greta Thunberg sieht,
wenn man sich dennoch anzugehenden Problemen stellt
und nicht aus Bequemlichkeit vor der Verantwortung flieht.
Schon Kinder sollte man an dieses Thema heranführen,
damit sie früh lernen, achtsam mit der Natur umzugehen
und die ganze Schöpfung in ihrer unberührten Schönheit
als das größte Geschenk für unser aller Leben zu sehen.
Sieglinde Seiler wurde 1950 in Wolframs-Eschenbach geboren. Sie ist Dipl. Verwaltungswirt (FH) und lebt mit ihrem Ehemann in Crailsheim. Seit ihrer Jugend schreibt sie Gedichte. Später kamen Aphorismen, Märchen und Prosatexte hinzu. Ferner fotografiert sie gerne. Bislang hat sie bereits über 200 Gedichte im Internet und diversen Anthologien veröffentlicht.
*
Die Geißel
Mein Leben schwindet. Und mit ihm meine Erinnerungen. Was bleibt, sind diese Zeilen.
Ich erinnere mich an eine Zeit des Umbruchs.
An Chaos.
An verwüstetes Land.
Anfang des 21. Jahrhunderts hatten wir unseren Zenit erreicht. Wir drangen in die Tiefen der Ozeane vor, schickten Raumsonden Milliarden Kilometer in die Weiten des Sonnensystems und spähten noch die kleinsten Elementarteilchen aus.
Unsere Rechnungen zu begleichen, aber vergaßen wir.
Wir hatten das Schwarze Gold nutzbar gemacht, errichteten riesige Raffinerien, die sich tief in das Land bohrten. Aus dem gewonnenen Öl erschufen wir Plastik und mit Plastik ermöglichten wir alles.
Wir wurden schneller, höher, weiter. Produzierten Hunderte Millionen Tonnen Wunderbaustoff jedes Jahr. Konsumierten, warfen weg, vergaßen.
Plastikmüll aber häufte sich an. Denn in unserer Arroganz übersahen wir, es wieder loszuwerden. Oder scherten wir uns nicht?
Bald schwammen Teppiche aus Müll so groß wie Kontinente in den Ozeanen der Welt. Plastikkrusten im Strandgestein säumten Ufer wie früher Sand am Meer. Mikroplastik gelangte selbst in unsere Nahrungskette.
Wissenschaftler ermahnten.
Umweltschützer strampelten.
Aber wir schauten weg.
Denn Ignoranz war komfortabel und die Lösung doch so einfach.
Wir erlaubten es Wissenschaftlern, in die Ökosysteme der Welt einzugreifen und bakterielle Helferlein zu erschaffen, die an unser statt Herr des Problems werden sollten. Ideonella sakaiensis erschien als Retter der Welt. Seine einzigartige Enzymausstattung erlaubte den Mikroben etwas ganz Besonderes: Sie konnten Kunststoffe verstoffwechseln – und wir ließen sie.
Die Bakterien begannen zu fressen. Sie schlemmten sich durch die Müllteppiche der Ozeane und Abfallberge der Städte und wir lehnten uns erleichtert zurück. Bis eine Laune der Natur uns frech angrinste. Eine winzige Mutation warf den Mikrobenstoffwechsel durcheinander. Die Bakterien entsorgten weiterhin Plastik, schieden aber von nun an Kohlendioxid aus. Binnen Monaten entschied sich das Schicksal der Welt.
Das Treibhausgas der Bakterien fachte den Klimawandel an. Wie sollten wir Kleinstlebewesen stoppen, die ihre Nahrung in allen Ökosystemen, auf allen Kontinenten, in allen Meeren fanden? Die unnachgiebig fraßen und sich vermehrten, immer mehr und mehr Kohlendioxid ausschieden, während die Sonne unbarmherzig brannte? Die Welt erglühte, während wir nur hilflos zusehen konnten.
Binnen Jahren erwuchs simples Wasser, die Voraussetzung allen Lebens, zur Währung der entzündeten Flamme der Welt. Reichtum wurde nicht länger in Euro, Dollar oder Yen gemessen oder in Silber oder Gold gewogen, sondern in Volumina dosiert. Volaqua wurde zur einzigen Währung, zur wahren Währung, die verdunstete, entwich, sich verknappte.
Die Führer der Welt trafen harte Entscheidungen. Rationierten. Sanktionierten. Investierten die Nutzlosigkeit ihrer angehäuften Münzen und Papierscheine in die Errichtung von Wasserfallen. Verzweifelt versuchten sie, selbst die Feuchtigkeit der Luft zu ernten.
Doch sie konnten nicht verhindern, dass die Welt, wie wir sie kannten, zerfiel. Nachbarn verdursteten. Städte explodierten. In unserer dunkelsten Stunde geißelten wir uns für unsere Ignoranz. Wir jammerten. Wir flehten. Wir hätten unsere Töchter und Söhne gegeben, den Klimawandel zu stoppen. Doch die Geister, die wir gerufen hatten, wurden wir nicht los.
Ideonella sakaiensis blieb hungrig. Es gedieh und vermehrte sich. Es spuckte immer mehr Kohlendioxid aus und befeuerte die Welt. Nach nur ein paar Jahrzehnten waren selbst die Ozeane verdurstet. Alles Wasser war verdampft und entwichen.
Zurück blieben nur Stein, Salz und Knochen.
Das Recht des Stärkeren galt einmal mehr. Schwindende Völker stritten nur noch um den nächsten Tropfen Volaqua, um erst morgen qualvoll verdursten zu müssen.
Selbst aus Lebewesen ließ sich Volaqua gewinnen, um den Wasserkreislauf für einen Moment zu überlisten. Erst nur aus Pflanzen, später aus Tieren.
Und noch später?
Was taten wir, wenn unsere Kehlen brannten wie Glut? Unsere Schleimhäute verdorrten und aufrissen? Unsere Zungen wie reife Pflaumen in unseren Rachen schwollen und krampften?
Waren die saftigen Körper unserer Nachbarn nicht zu schwach, die Dürre zu überstehen? Waren nicht nur wenige imstande, das Notwendige zu tun? Ihre Gaumen mit Glückseligkeit zu spülen?
Egal welcher Farbe.
Welchen Geschmacks.
Welcher Herkunft.
Heute ist alles Plastik verdaut und der Planet atmet auf.
Einmal mehr ist er sauber. Sauber und heiß. Die Welt glänzt in den Strahlen der Sonne. Glüht. Bezaubernd schön. Und tot. Die klaren Wellen, die einst gegen Uferböschungen schwappten, sind in weißer Kruste erstarrt.
Und ich?
Ich bin der Wächter des Salzes und der Knochen. Auf meiner Insel aus Stein ernte ich das letzte Nass, destilliere das letzte Leben und schreibe auf. Erinnere.
Leben, wie wir es kannten, gibt es bald nicht mehr. Bedauern kann ich das nicht. Bedauern kann ich nur etwas anderes. Dass ich nicht werde sehen können, welche Geschöpfe sich aus den Ozeanen aus Salz erheben. Denn Leben findet einen Weg.
Henrik Winterbergist Wissenschaftsjournalist für Bio- und Medizinmagazine. Er wurde 1978 geboren, promovierte in Düsseldorf, forschte in Oxford, Großbritannien, und kann seine Neugier noch immer nicht zügeln. Auf einer 15-monatigen Reise über sechs Kontinente der Welt zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Jungs fand er nicht nur die Inspiration für seine Kurzgeschichten, sondern weiß, wovon er spricht – er hat vor Ort recherchiert. Gegenwärtig lebt er mit seiner Familie am Fuß der Schwäbischen Alb.
*
Bis ich den Wald nicht mehr sah
Darf ich sehen?
Die Sonne mit schlafenden Augen.
Darf ich berühren?
Das Moos mit nackten Fersen.
Darf ich spüren?
Bäume, schlank wie Riesen.
Anhalten, unter der Sonne?
Bleich, flüssig, frei.
Die Berge, sie rufen, sehnen nach mir,
Hänge singen meinen Namen.
Der Boden, er weint, flüstert nach mir,
Gras greift nach meiner Haut.
Darf ich ihn hängen?
Meinen Kopf ganz oben hin.
Ich will bloß erblicken,
was hinter den Wolken ist.
Sie nahmen mir die Knochen und schlugen mein Blut zu Schaum,
Sie schabten die Schuppen von meiner Haut.
Sie pressten mich durch Einschusslöcher, stopften mich aus mit Eiter,
bis ich den Wald nicht mehr sah.
Darf ich nun laufen?
Auf warmem Grund.
Darf ich nun klettern?
Auf einen bloßen Stumpf.
Darf ich nun sehen?
Die Sonne untergehen.
Darf ich jemals wieder sein?
Fort und frei.
Maria Orlovskaya, 1994 in Moskau geboren, studierte Psychologie und Drehbuch & Dramaturgie in Babelsberg. Danach arbeitete sie in einem Arthouse Kino, als Assistenz in der Reittherapie und betrieb eine Siebdruckerei. Ein halbes Jahr war sie auf Reisen, unterwegs von einem Heavy Metal Konzert zum nächsten. Momentan lebt und arbeitet sie im größten Yogazentrum Europas, während sie jedes Jahr zahlreiche Gedichte und Kurzgeschichten veröffentlicht.
*
Waldleben
Er ist meine Zuflucht.
Von meinem Haus aus brauche ich sechs Minuten, bis ich dort bin. In weiteren drei Minuten bin ich komplett von ihm umgeben. Ich atme tief ein und Ruhe durchflutet mich. Der Stress fällt ab und macht tiefer Zufriedenheit Platz.
Der Wald ist meine Zuflucht.
Seine Schönheit beeindruckt mich und jeden Tag entdecke ich etwas Neues. Riesige, dunkle Kiefern, freundlich anmutende Birken, stattliche, teils jahrhundertealte Stiel- und Traubeneichen und dazwischen ein Wust an Büschen, Gräsern und Moosen. Hin und wieder kreuzt ein Reh meinen Weg, ein Eichhörnchen oder sogar einmal eine ganze Wildschweinrotte.
Aber auch wenn ich die Zeit vergesse, wenn ich meinen Wald durchstreife, macht die Zeit nicht halt und Veränderung tritt ein. Und diese Veränderung ist nicht gut.
Wenn ich nun meine Zuflucht betrete, fallen meine Sorgen nicht schlagartig ab, sondern begleiten mich. Angst krabbelt meinen Nacken entlang.
Mein Wald ist krank.
Die Dürre der letzten Jahre hat den Bäumen stark zugesetzt, sie sind am Verdursten. Auch der Frühling war dieses Jahr sehr trocken, so trocken, dass es zu verheerenden Waldbränden gekommen ist. Tagelang flogen die Hubschrauber mit riesigen Wasserkanistern hin und her, nachts konnte ich von meinem Fenster aus das Glühen der Flammen in der Ferne sehen.
200 Hektar Wald wurden vernichtet.
Das sind 281 Fußballfelder.
Dürre und Brände sind aber noch nicht alles, es gibt noch einen anderen Feind, einen kleineren, aber dafür sehr hartnäckigen – den Borkenkäfer.
Ich schäume vor Wut, wenn ich die Bagger anrücken sehe, die meinen Wald dezimieren, ihn abholzen und vernichten. Ich weiß, dass sterbende Bäume eine Gefahr darstellen, niemand will, dass einem Spaziergänger eine Baumkrone auf den Kopf fällt. Dennoch macht es mich wütend.
Wir alle brauchen die Bäume.
Sie versorgen uns mit Sauerstoff, binden Kohlenstoffe, filtern die Luft für uns. Der Wald bietet Lebensräume für so viele Tierarten und schenkt uns ein Raum zur Erholung.
Der Wald ist UNSERE Zuflucht.
Und er braucht unsere Hilfe.
Claudia Gers,ehemals Poschgan, wurde1982 in Stuttgart geboren. Nach dem Studium der Biologie und einem ereignisreichen Jahr als Vulkantourguide in Nicaragua, nahm die Hobbyautorin einen Job als Key Account Managerin in der Pharmaindustrie an. Sie lebt nun mit ihren zwei Töchtern, Ehemann, zwei Hunden, Katze und zwei Schildkröten in Wassenberg, NRW. In ihrer (sehr geringen) Freizeit widmet sie sich ganz ihrer Fantasie und schreibt Kurzgeschichten und Kinderbücher.
*
Das Haus im Wald
Wenn Arne den Zenit des sanft ansteigenden, jedoch kontinuierlich aufwärts führenden Hohlwegs erreicht, dann ist er, inzwischen knapp 50, auf seinem persönlichen Dach der Welt angekommen. Am Gipfelkreuz des Stadtwaldes. So außer Puste ist er befreit vom Ballast des Alltags. Die Nöte seiner Entlassung sind augenblicklich vergessen. Für einen Grafikdesigner angeblich überaltert, war der Rauswurf nach einer Flut von Abmahnungen wegen verschiedener geringfügiger Delikte vorhersehbar.
Oben am Ausguck, da, wo ein steiniger Bach fast blaues Wasser mitführt, in Tausenden Schwingungen mäandert und ins Tal hinabplätschert, dort bilden Fichten, in ihrer Menge unzählbar, den Hauptbestand der grüngrünen Kulisse.
Die Natur steht seinem beruflichen Werdegang, eine Gasse, die nichts als eine Sackgasse beschreibt, gleichgültig gegenüber. Auf ihm nie zuvor bekannte Weise ahnt Arne eine Verbundenheit mit dem Kosmos. Diese unbeeinträchtigte Ursprünglichkeit lädt ihn ein, zu verweilen. Wassertropfen vom vorangegangenen Regen glitzern auf den Nadelspitzen, verströmen eine Palette an Düften, die Arne mittlerweile unverzichtbar geworden sind. Sein Lebenselixier, wie er sagt, ist der Wald, die luftige Höhe, jenes Nichts-als-Grün ringsherum.
Umzingelt von etlichen Quadratkilometern Waldung verkörpert die Landschaft einen ungeschliffenen Edelstein. Es sind nicht nur die Entdeckungen von Eicheln, Tannenzapfen, leuchtenden Tollkirschen und deftigem Bärlauch, die seine Sinne berühren, es ist die befreiende Erkenntnis, die Einsamkeit hält er aus, in ihr kann er aufleben. Einsamkeit ist ihm keine Vereinsamung, Einsamkeit ist für ihn die Befreiung schlechthin, Freiheit in Reinform.
Während Arne sich wieder und wieder um seine eigene Achse dreht, mit dem Panorama verschmilzt, geht ihm auf: Hiesige Vegetation durch Rodung zu bändigen, würde bedeuten, einen ungeschliffenen Diamanten in eine Schablone zu zwängen. Die Vokabel Beschneidung erscheint ihm hierbei zutreffend.
Arne ist überwältigt, neuerdings rührt ihn die Erkenntnis: „Dort will ich wohnen, da will ich bauen!“
Im Forst, unweit vor den Toren unserer aus allen Nähten platzenden Stadt, Kontrast erleben zu Krach und Gestank. Sicherlich ist das Wasserschutzgebiet ein fragwürdiger Ort, um zuerst an Baugrund zu denken, an eine Baugenehmigung. Dafür bedarf es politischer Kontakte. Seine Beziehung zu Bürgermeister Franz hält Arne für tragfähig. Ist sie ausreichend belastbar für solch außergewöhnliche Anfragen? Widersprechen Arnes Wünsche seinen Prinzipien? Gibt es eine Lösung für das Dilemma aus Vorhaben und Gewissen?
Im Anschluss seines heutigen Spaziergangs, die Bronchien mit Sauerstoff gesättigt, sein Organismus von Mut betankt, will er Franz aufsuchen und ihm glaubhaft versichern, sein Druck in der Brust ließe nirgends so dramatisch nach wie in jener beredten Stille. Die Quelle des Waldbachs sei sein Jungbrunnen, er liebe es, wenn weder Motorengegröle seine Sehnsucht nach Erholung erschüttert noch Rauchschwaden von benachbarter Raffinerie seine Nase quälen. Nahezu jeder Schritt durchs Spalier beidseitig verdichteten Unterholzes hält noch bessere Argumente bereit, um Bürgermeister Franz von der Wichtigkeit seines Anliegens zu überzeugen.
Arne bleibt abrupt stehen. Genau an dem Fleck muss er innehalten. An diesem Standort, Bauern stapeln dort ihr Holz, Stamm auf Stamm, möchte er sein Bedürfnis nach Abgeschiedenheit realisieren.
Auf dem hoch über der Stadt thronenden Plateau will er ein Haus hinstellen, inmitten von Jägerständen und Futtertränken könnte seine Oase Wahrheit werden. Oder einige hundert Meter weiter östlich, bei den dürren Bäumen, die allesamt windschief in die gleiche Richtung neigen.
Sobald er hier vorbeikommt, oft stundenlang in der naturgemachten Architektur meditiert und dabei nicht selten den Kastanienbaum hinter der verwitterten Steinbank umarmt, muss er beim Anblick der schlanken Riesen, die ihn umstehen, an satt gegessene Mikados denken, recht viel dicker sind sie tatsächlich nicht. Und doch beständig. Stabiler als er, Arne, in den vergangenen Monaten.
Ist sein Entschluss, jenseits der Zivilisation möchte er heimisch werden, bereits unumstößlich?
Arne schlurft, ein paar Schritte bloß, wendet dann erneut, schnuppert an den stachligen, in ihrem Reservoir schier unerschöpflichen Brombeersträuchern, sieht am Horizont einen Adler kreisen, fasst, nachdem er abermals weitergetippelt ist, harzige Rinde auf einem Stoß gefällter Bäume, leckt an seinen klebrigen Fingern und genießt, was er sieht, hört, riecht und schmeckt.
Mit Bürgermeister Franz würde es keine Schwierigkeiten geben. Eine exklusive Genehmigung für Arnes Baugrund wäre ein Klacks oder wieso sollte der mit einem verschwindend geringen Anteil des Stadtwaldes geizen? Vorab, ehe er dem Bürgermeister begegnet, ist seine Meinung unbestechlich, er unterschreibe jede noch so vertrackte Verschwiegenheitsklausel, die Franz ihm vorlegt. Ungesehen signiere Arne, falls drei Kreuze nicht ausreichen – augenzwinkernd, mit derartigen Floskeln im Gepäck würde er vor Ort die Stimmung auflockern. Sollte Franz der Verdacht unlauterer Vergünstigungen kommen, würde Arne ihm diese moralischen Vorbehalte ausreden, selbstverständlich auch das.
Im Verborgenen kann er es ja zugeben, etwas mulmig ist ihm schon. Im Dunstkreis von Korruption auftreten, Bittsteller sein, das ist seine Sache eigentlich nicht. Möglicherweise wird Franz ihn konfrontieren, indes er seinem Antrag stattgebe, stemple er Arne zum Pionier und das lade Nachahmer ein. Bürger, die der Natur versöhnlich gegenübergestanden hätten, würden sie fortan zu ihren Gunsten ausbeuten wollen, man riefe sie mit einer Einzelfallentscheidung auf den Plan.
Darin ist die wachsende Stadt nun doch wieder ein Dorf. Auf heimlichen Pfaden von Flüsterpost und Mundpropaganda könnte Arnes Baugenehmigung ein inoffizielles Gesetz statuieren: die Abholzung als Kollektivrecht.
Woran würde man den Wald noch erkennen, wenn sämtliche Bewohner, von Arne angestiftet, das Baurecht zu ihrem Vorteil missbrauchten?
Bevor Arne bergab am Bach entlang rennt, als ginge es darum, das fließende Wasser zu überholen, saugt er gierig die ätherischen Ausdünstungen des immerzu dampfenden Waldbodens ein. Den Extrakt von Moos und Efeu zu inhalieren, ist allemal bekömmlicher als die tägliche Schachtel Marlboro.
Wenig später steht er vor dem Rathaus. Er ist gleichermaßen enttäuscht und schockiert, dass er fähig war, hier aufzuschlagen. Arne macht seinen Beinen Vorwürfe, dass sie ihn hergetragen haben.
Gegen seinen Willen?
Das nicht unbedingt.
Sobald ihm aber die Worte Ausbeutung und Abholzung auf der Zunge zergehen, muss er achten, dass sie ihm nicht über seine Lippen flutschen. Nie wollte er im Hinblick auf seinen hochgeschätzten Wald verrohen. Daher muss es ihm für den restlichen Tag gelingen, jede Brutalität aus seinem Sprachgebrauch zu verbannen. Er muss sich einbläuen, seine Absicht, im Wald zu bauen, sei ein gewöhnliches Verlangen von Naturromantikern. Die Gegenwart von Skrupel würde Arnes Bestimmtheit schwächen, seiner Standhaftigkeit schaden. Verwässert Arne seine Forderung, wird sie von Franz überhört.
Innen drinnen ist Arne aufwühlt. Sein Herz pocht. Es sprintet. Arne zögert. Minuten verbringt er auf der untersten Stufe der Vortreppe am Aufgang zur gläsernen Tür des Bürgerhauses. Der angeschriebene, ihm bereits auswendig geläufige Willkommensgruß Bitte treten Sie ein ist ihm suspekt. Gerade eben. In diesem Moment.