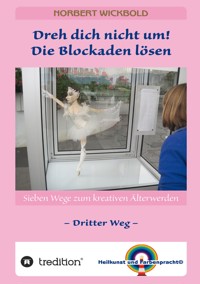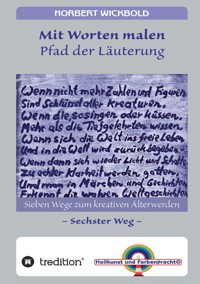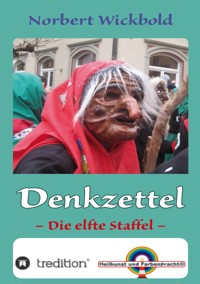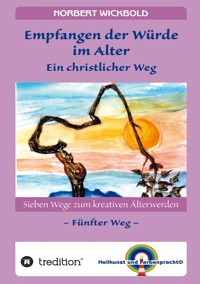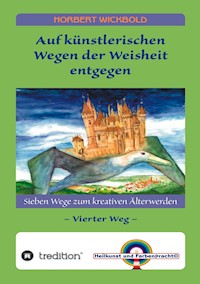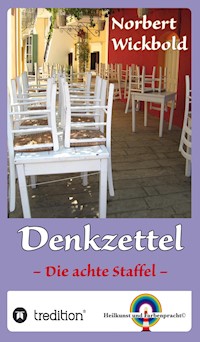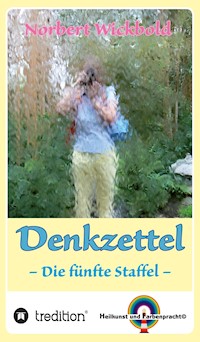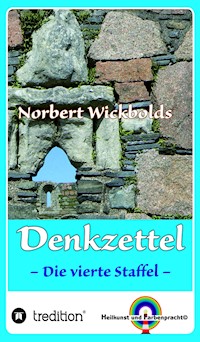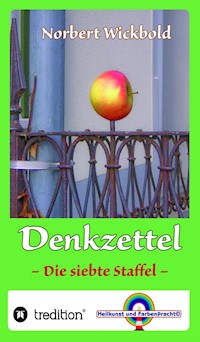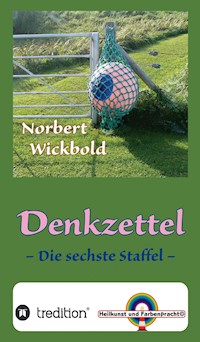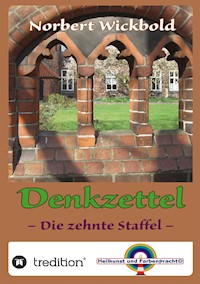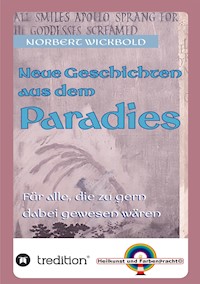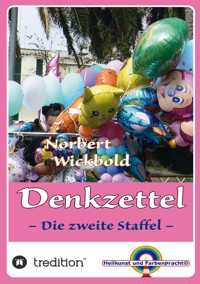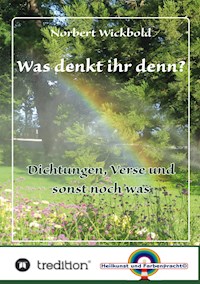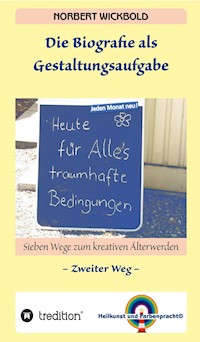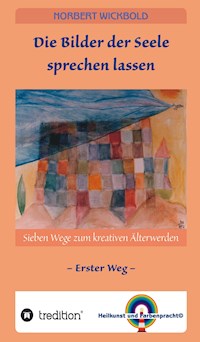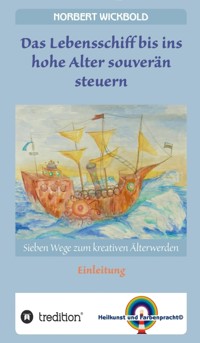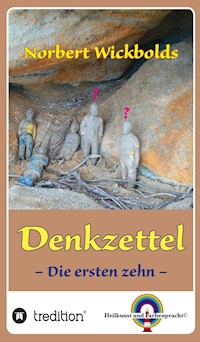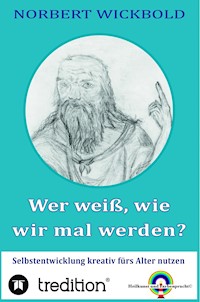
2,99 €
Mehr erfahren.
Im Alter würdevoll Leben, möglichst ohne Leiden zu müssen, dass wünschen sich viele Menschen. Ist das möglich? Nach 20 Jahren Arbeit in der Altenpflege, behaupte ich: Ja! Es ist möglich, wenn wir bereit sind, unser Leid anzunehmen. Dann können wir es wandeln. Wir können unser Leben, und somit auch unser Älterwerden und die Art, wie wir im Alter leben werden, in die Hand nehmen und es dadurch selbst gestalten. Was wir im Alter erleben steht in direktem Zusammenhang mit dem, was, bzw. wie wir bisher gelebt, gedacht haben und welche Erfahrungen wir dadurch gemacht haben. Deshalb halte ich den Ausspruch: »Wer weiß, wie wir mal werden?« für gefährlich. Gefährlich, weil er uns vortäuscht, wir könnten nicht jetzt schon an unserem Werden im Alter arbeiten, denn dadurch könnten wir es versäumen, die eigene Entwicklungsaufgabe frühzeitig in Angriff zu nehmen. Dieses Buch ist geschrieben worden, um Ihnen aufzuzeigen, wieviele Einflussmöglichkeiten Sie tatächlich haben, Ihr Älterwerden zu gestalten. Es liegt an Ihnen, etwas daraus zu machen! Wenn wir durch das Annehmen, des eigenen Schicksals und der damit verbundenen Aufgabe die Dinge unseres Lebens bewusst zum Abschluss bringen, bedeutet Alter nicht nur Verlust und Sterben, sondern Wandel und Neubeginn. Wir können mit Hilfe unserer Lebenserfahrung, einer gestalterischen Haltung und verschiedener therapeutischer Ansätze einen inneren Wandel vollziehen und den Abbau- und Sterbeprozess kreativ wandeln in einen Aufbau- und Intergationsprozess. Die Wege des Sterbens, des Absteigens vereinigen sich mit den Wegen der Erneuerung, der Wiedergeburt und des Aufsteigens zur großen Lebensspirale unserer Individualität. Das Buch vereint viele Beispiele aus der Praxis, der Kunst, der Dichtung und der Forschung. NORBERT WICKBOLD
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Norbert Wickbold
Wer weiß, wie wir mal werden?
Abb. 1: »Vom Schreiben zum Malen« Paula Hinze*, 89 J, 1994 Beispiel aus einer Malstunde
* Der Name wurde verändert. Dies gilt selbstverständlich für alle Namen der in diesem Buch beschriebenen Personen. Deshalb wird darauf nicht mehr extra hingewiesen.
Norbert Wickbold
Wer weiß, wie wir mal werden?
Selbstentwicklung kreativ fürs Alter nutzen
Wieviel Schönheit ist auf Erden
unscheinbar verstreut;
möcht ich immer mehr des inne werden.
Wieviel Schönheit, die den Taglärm scheut,
in bescheiden alt und jungen Herzen!
Ist es auch ein Duft von Blumen nur,
macht es holder doch der Erde Flur,
wie ein Lächeln unter vielen Schmerzen.
Christian Morgenstern
1. Auflage Copyright © 2014 by Norbert Wickbold Umschlaggestaltung und Illustration: Norbert Wickbold Korrektorat: Irene Wickbold Verlag: tredition GmbH, Hamburg ISBN: 978-3-8495-9811-2 (Paperback) ISBN: 978-3-8495-9812-9 (Hardcover ISBN: 978-3-8495-9813-6 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhalt
Vorwort
1.
Wie uns das Leben hilft
1.1
Wer weiß, wie wir mal werden?
1.2
Lebensziel Alter?
>
An wen sich dieses Buch wendet
1.3
Vom Sinn des Lebens, des Sterbens und der Aufgabe des Alters
1.4
Wie wir wurden was wir sind
1.5
Die Schule des Lebens und die Weisheit des Alters
1.6
Der Tod als Grenzerfahrung
1.7
Die eigene Biografie als Gestaltungsaufgabe
1.8
Zwischen Selbstvergessenheit und Neuerfindung
1.9
Und was wird aus mir? – Wenn der Partner Pflege braucht
1.10
Jetzt werde ich wirklich alt! oder – Wie das Alter gelingen kann
2.
Wie uns die Kunst hilft
2.1
Mit den Bildern der Seele sprechen – Alte Bilder verwandeln sich zu neuen
2.2
Was sind innere Bilder?
2.3
Arbeiten mit eidetischen Bildern
2.4
Arbeiten mit Visualisierungen
2.5
Illusion und Projektion – Täuschung und Ent-Täuschung
2.6
Innere Bilder wahrnehmen und zum Ausdruck bringen
2.7
Die Kunst als Orientierungsrahmen
2.8
Die Farbe als ganzheitliches Phänomen
2.9
Kunsttherapie und Heilung – Wie Kunst wirkt
2.10
Auf künstlerischen Wegen dem Alter entgegen
3.
Welche Therapie uns unterstützen kann
3.1
Welche Therapie hat welche Ziele?
3.2
Die Macht der Bilder – gestern und heute
3.3
Mit Worten Bilder malen – Biografisches Schreiben
3.4
Das Ich, die Erinnerung und die Demenz –Eine meditative Annäherung
3.5
Alles nur Einbildung?
3.6
Realität und Scheinrealität – Betrachtungen über die Welt der äußeren Bilder
3.7
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß! – Oder doch?
3.8
Du machst mich noch ganz verrückt! – Partnerschaften bis ins Alter
3.9
Trauma und Demenz
3.10
Wie alles sich zum Ganzen webt
4.
Spezielle Themen
4.1
Von Hexen, Giftzwergen und Vampiren – und wie man mit ihnen umgeht
4.2
Vom Leitbild zum Leidbild? – Prägung und Krankheit am Beispiel der parkinsonschen Krankheit
4.3
Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen
4.4
Ach wie gut, dass ich jetzt weiß
5.
Zusammenfassung und Ausblick
A
Danksagung
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis der Abbildungen
Stichwortverzeichnis
Über den Autor
Vorwort
Durchaus Verständnis und zuweilen überschäumende Begeisterung ruft es hervor, wenn Erwachsene das Kind im Manne bzw. in der Frau zu seinem Recht verhelfen wollen. Wenn sich jedoch jemand über die Ausgelassenheit von Kindern beschwert, so entgegnet man ihm mit den Worten: „Sie waren doch selbst mal ein Kind!“
In einem lockeren Gespräch erzähle ich, dass ich Altenpfleger bin. Darauf begegnet mein Gesprächspartner spontan mit dem Satz: »Ach, das könnt‘ ich nicht!« Sogleich klärt er mich darüber auf, wie sehr solche Menschen zu bewundern sind und wie schwer und anstrengend deren Arbeit doch sei. Viele Menschen reagieren so. Doch kommt es ihnen auch in den Sinn, dass es für einen angemessenen Umgang mit alten Menschen einer echten Würdigung bedarf? Denkt mein Gegenüber vielleicht: »Arme(r) Irre(r)!« und versucht sich aus seinem Unverständnis heraus als besonders mitleidvoll zu erweisen? Ich kann ihm nicht entgegnen: »Sie waren ja auch schon mal alt.« Im weiteren Gespräch mit ihm erfahre ich schnell: Mit dem eigenen Älterwerden und der damit verbundenen Lebensperspektive möchte er sich „noch“ nicht auseinandersetzen. Die Antwort: »Das kommt schon früh genug!« klingt wie eine Warnung. Dann wird das Thema gewechselt.
So bleibt bei vielen Menschen die Altersvorsorge beschränkt auf die Absicherung der finanziellen Folgen des Alters. Natürlich kann ich all diesen Menschen entgegnen: »Auch Sie werden einmal alt!«, doch hat das keine überzeugende Wirkung. Zu groß ist die Angst vor dem eigenen Alter und – in letzter Konsequenz – dem eigenen Tod. Wir wissen um unsere Vergänglichkeit, aber wir wollen möglichst nicht daran erinnert werden. Die Überzeugung vom »Verrückt-werden im Alter« ist offenbar in allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen tief verwurzelt.
…denn im Alter scheint alles, was im »normalen Leben« Sinn macht, (und jetzt weiß ich auch, warum man heute vom Sinn machen und nicht mehr vom sinnvollen Sein spricht) seinen Wert und seine Bedeutung zu verlieren. Mir scheint, im Alter liegt der Sinn nicht mehr in dem, was wir haben oder machen, sondern in dem, was wir sind – und zwar gegenwärtig.
Zwar sind Menschen, die selbst einen älteren Menschen pflegen oder gepflegt haben, eher dazu bereit, sich mit den Schwierigkeiten im Umgang mit älteren Menschen oder mit den in die Jahre gekommenen Eltern auseinander zu setzen, aber dem eigenen Älterwerden und der damit einhergehenden persönlichen Entwicklung, sehen auch sie oft skeptisch entgegen. »Dann lieber gar nicht erst alt werden!«, ist eine Äußerung, die ich viele Male von jung und alt gehört habe. Viele Menschen wünschen sich, dass sie plötzlich umfallen und dann sofort tot sind, um so der Auseinandersetzung mit Alter und Tod mühelos zu entgehen.
Gerade den Menschen, denen das Alter in erster Linie als eine Bedrohung erscheint, möchte ich mit diesem Buch Mut machen genauer hinzuschauen und sie dazu ermuntern, dem Alter und somit auch dem eigenem Älterwerden, also dem eigenen Werden im Alter, zuversichtlich entgegen zu gehen.
Wie sehr Altenpflegerinnen und Altenpfleger auch gelobt werden, wer etwas über »das Alter« erfahren will, befragt lieber Professoren, Chefärzte von Großkliniken, Politiker oder Leiter von Altenpflegeheimketten. Als Experten gelten ebenfalls Chefökonomen und – sollten sie es in ihrem Leben zu Ruhm und Ehre gebracht haben, sodass sie zu den prominenten Persönlichkeit zählen – auch ein paar ausgewählte Alte, wie Schauspieler, Schriftsteller oder Adlige. Doch wem kommt es in den Sinn, dass die vielen Tausend Pflegekräfte, AltenpflegerInnen und Krankenschwestern irgendetwas beachtenswertes zum Thema Alter zu sagen haben? Und wenn sich tatsächlich mal jemand aus diesem Personenkreis zu Wort meldet, dann wirkt das so – wie es einmal in einem Hörspiel beschrieben wurde – als würde einem beim Waldspaziergang von ihrem Ameisenhaufen aus eine Ameise eine weiße Fahne entgegenschwenken und ausrufen: „Hier bin ich!“ Selbst wenn so etwas tatsächlich geschähe, würde man es einfach nicht glauben, weil man schließlich weiß, dass Intelligenz, Wissen und Erfahrung einer Ameise dazu überhaupt nicht ausreichen. Somit ginge man kopfschüttelnd vorbei und würde niemanden davon erzählen, um nicht noch selbst als verrückt oder eben »alt« zu gelten. Im tiefsten Grunde gibt es nur einen Expeten für ihr Leben und Altwerden: Sie selbst! Zwar werden gerne Schauspieler, Musiker und Künstler als »Vorbildliche« Alte präsentiert, dennoch ist es den Entscheidern nicht möglich, zu erkennen, was sie in der Altenpflege mit jemanden anfangen sollen, der Klavier spielen kann. Auch künstlerisch Begabte oder Schauspieler sucht man bei den in der Pflege Tätigen vergebens. Und ist es nicht seltsam, dass die künstlerisch Tätigen, also diejenigen, die gerade nicht im »richtigen« Leben stehen, soviel vom Leben verstehen, dass ihnen viel eher, als den »Normalen« ihr Alt-Werden gelingt? Johannes Heesters setzte sich mit 104 Jahren schauspielerisch mit dem Tod auseinander.
Wer etwas wissen will über »Das Alter« der sieht sich unweigerlich auch konfrontiert mit »dem Alten«, also mit alten Gewohnheiten, Vorurteilen und Meinungen. Und das ist nicht nur ein persönliches, sondern gerade auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Lange wurde die Pflege alter Menschen als reine Frauensache angesehen, sodass es für Männer eine Zumutung wäre, so etwas tun zu müssen. Doch wenn es eine Zumutung ist, warum kann man das Frauen ohne weiteres zumuten? Und wenn die Alten als Zumutung gesehen werden, wie sollen sie dann würdevoll leben? Sollte man den Jungen wie den Alten nicht endlich durch eine würdigende Wertschätzung ihre Würde zurückgeben? Wie soll es uns gelingen, im Alter ein Leben in Würde zu führen, wenn wir das Alter selbst, also die letzte Phase des Lebens nicht wirklich wertschätzen und würden? Das Alter als Lebensabschnitt würdigen können wir, indem wir ihm die Bedeutung geben, die es für unsere gesamte Entwicklung hat. Mir scheint, dass es dazu erforderlich ist, all das Verdrängte, Befürchtete und Misslungene in unserem Leben frühzeitig anzunehmen und aus seiner Verbannung zu erlösen.
Aus den persönlichen Erfahrungen und Gedanken aus 19 Jahren Arbeit in der Altenpflege und der Auseinandersetzung mit den Fragen nach dem Sinn des Lebens, des Alters und des Sterbens ist dieses Buch gewachsen. Ich möchte nicht stehenbleiben bei weitverbreiteten und verzerrenden Vorstellungen und Vorurteilen über »die Alten«, sondern nach den inneren Motivationen dieser Menschen fragen. Dazu bedarf es vielleicht auch einiger ungewöhnlicher Betrachtungsweisen. Zur Klärung erscheint es mir wichtig, die individuelle Entwicklungsaufgabe zu betrachten. In der Bewältigung der persönlichen Entwicklungsaufgabe und der Auflösung der damit verbundenen Verwicklungen sehe ich einen wesentlichen Beitrag, den jeder selbst leisten kann, um zur Verhütung von Verwirrtheit und Demenz beizutragen. Ich halte den Ausspruch, den selbst die in der Pflege Arbeitenden machen: »Wer weiß, wie wir mal werden?« für gefährlich. Gefährlich, weil er uns vortäuscht, wir könnten nicht jetzt schon an unserem Werden im Alter arbeiten, denn dadurch könnten wir es versäumen – wie viele der derzeit alten Menschen es möglicherweise versäumt haben – die eigene Entwicklungsaufgabe frühzeitig in Angriff zu nehmen. Dann freilich, wenn wir die Chancen, die sich für uns durch die Auseinandersetzung mit den in uns wirkenden Gedanken, Gefühlen und Bildern nicht nutzen, gehen auch wir möglicherweise einem Schicksal entgegen, das auch uns in Verwirrung oder Verzweiflung führen kann. Ich glaube nicht, dass es als ein Segen anzusehen ist, wenn wir mit einem Schlag und unvorbereitet aus dem Leben scheiden ohne zuvor in unserem Leben zu dem gereift zu sein, zu dem wir von unserem Wesen her angelegt sind, denn das braucht gewöhnlich ein ganzes Leben, um sich zu entfalten. Kann es sein, dass gerades das Nicht-Ergreifen unserer Entwicklungsaufgabe uns zu dem macht, was wir – im Alter – befürchten? Jean Gebser sagt: „Alles, was uns zustößt, geht von uns aus.“(GEBSER, 1986, S. 279) Wenn das so ist, dann liegt darin für uns auch die große Chance, unser Alter selbst zu gestalten! Das Leben selbst, die gemachten Erfahrungen, die Kunst und viele therapeutische Formen können uns auf unserem Weg zu uns selbst unterstützen. Ein Weg, der trotz aller Schwierigkeiten doch spannend und lohnenswert bleibt – bis zur letzten Stunde!
Die im Buch verwendeten Wörter Phantasie und Phantasien habe ich aufgrund vieler Zitate in der alten Schreibweise belassen.
Dezember 2013 Norbert Wickbold
1. Wie uns das Leben hilft
Abb. 2: »Lebensschiff«. Norbert Plötz, 1994
„Was auch geschah, was auch geschieht,
Was immer auch geschehen wird –
Was immer kam
Und was dich mied,
Was kommen,
Was dich meiden wird:
Nimm auch das Nichtgeschehene
als das Erfüllte an,
denn erst das Ungeschehene macht das Geschehen dann…“
Jean Gebser
1.1
Wer weiß, wie wir mal werden?
Sehnsucht nach der Kindheit
Oh Kinder wie die Zeit vergeht! Dabei ist es doch noch gar nicht so lange her, dass wir Kinder waren. Ob wir jetzt vierzig, sechzig oder achtzig sind: Unsere Jugendzeit liegt längst hinter uns. Was immer wir in unserer Kindheit erlebt haben, ein Teil in uns sehnt sich zurück in diese Zeit, die uns heute fast wie das verlorene Paradies erscheint.
„Wenn ihr nicht umkehrt, und werdet, wie die Kinder,
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“
(1985, Mt,18,3)
Als Erwachsene sehnen wir uns manchmal zurück in unsere Kindheit und Jugend, besonders wenn das Leben, das wir gerade führen, geprägt ist von Mühen, Verlusten und Einschränkungen. Doch als wir Kinder waren, konnten wir nicht schnell genug erwachsen werden. Groß wollten wir sein – nicht klein! Älter wollten wir sein, endlich erwachsen. In der Kindheit bedeutete älter werden ein Zuwachs an Selbstständigkeit, Freiheit und Beweglichkeit.
Wir werden älter, aber wir wollen nicht alt werden!
Können wir wirklich wissen, wie wir im Alter sein werden?
Inzwischen sind wir um ein vielfaches länger erwachsen, als unsere – ach so kurze – Kindheit war. Was haben wir in diesen Jahren nicht alles erlebt! Vieles davon war schön, vieles, das uns heute noch mit Freude oder Stolz erfüllt. Einiges war nicht schön, manches hätten wir am liebsten ganz aus unserem Leben gestrichen. Und darüber sind wir älter geworden. Erst nur langsam, fast unmerklich und dann immer schneller. Wir werden älter, aber wir wollen nicht alt werden! Und das, obwohl wir uns gegenseitig zu jedem Geburtstag Gesundheit und ein langes Leben wünschen! Und wer weiß, wie alt wir tatsächlich noch werden? Und wer weiß, wie wir dann sein werden? Denn oft bedeutet Alter in unseren Vorstellungen einen immer schneller fortschreitenden Verlust an Beweglichkeit, Freiheit und Selbständigkeit. Was bleibt sind wohl nur unsere Verschrobenheiten, eine zunehmende Vergesslichkeit und womöglich noch eine Verblödung? Werden wir dann wie Kinder, die nicht mehr selbst Essen können, die in die Hose machen und nicht einmal mehr richtig sprechen können? Nein, dann wollen wir lieber gar nicht alt werden. Denn so wollen wir nicht werden. Aber können wir uns das aussuchen? Können wir wirklich wissen, wie wir im Alter sein werden? Bleibt uns nichts anderes übrig als achselzuckend die Frage zu stellen: „Wer weiß, wie wir mal werden?“ Oder können wir selbst Einfluss darauf nehmen wie wir alt werden? Dieses Buch ist geschrieben worden, um Ihnen aufzuzeigen, wieviele Einflussmöglichkeiten Sie tatächlich haben, Ihr Älterwerden zu gestalten. Es liegt an Ihnen, etwas daraus zu machen!
Kinder des Lichts
Haben wir uns als Kinder und Jugendliche alles genommen, was uns das Leben bot, so scheint im Alter das Leben alles wieder von uns zurück zu fordern. Doch darin kann auch eine höhere Weisheit liegen. Die Phase des Wachsens und des Gedeihens ist vorwiegend eine Zeit des Nehmens, des Aufnehmens und des aktiven Tuns und Bewirkens. Hingegen ist die Phase des Alters eine Zeit des Abgebens, des Loslassens, der Kontemplation und des Bewahrens. Nichts ist daran als absolut aufzufassen. Selbstverständlich hat auch die Zeit der Kindheit und Jugend ihre Einschränkungen und Entbehrungen. So mussten wir erst die Mühen der Schülerschaft und des Lehrlingsstandes durchstehen und uns in unserem Fach bewähren, um schließlich zur Meisterschaft zu gelangen.
Können wir wirklich all unser Leid vergessen und verdrängen?
„Die Kinder sind wahre Kinder des Lichts, sie tragen das Licht noch unverfälscht in sich. Zuerst einmal kommen sie mit einer grenzenlosen Zuversicht und einem tiefen Vertrauen in die Welt, dass sie alles was sie von ihren Eltern wahrnehmen als gut betrachten, weshalb sie es dann genauso wie sie machen. Sie sind anfangs völlig kritiklos, kindlich naiv, wie man sagt. Doch später merken sie, dass nicht alles wirklich gut war, was sie von den Eltern gelernt haben. Sie machen ihre Erfahrungen und erleben Enttäuschungen, bekommen Ängste, werden misstrauisch. Dann ist der anfängliche Zauber gebrochen, sie haben ihre kindliche Unschuld verloren. Das geht leider oft viel zu schnell. Wie schön wäre es, wenn man diesen Zauber länger aufrecht erhalten könnte. Ist das vielleicht gemeint mit dem Satz: »Das ihr werdet, wie die Kinder«? Hieße das, alle Sorgen und Zweifel, alles Misstrauen und alles, was uns in Leben und Leiden gezeichnet hat, einfach zu vergessen? Ist alles was unser Leben bisher ausmachte wertlos geworden? Können wir das alles wiedervergessen und einfach nochmal von vorne anfangen, alles neu erlernen? In der Tat scheinen manche alten Menschen diesen Weg zu beschreiten. Doch der Weg der Verwirrtheit ist eine Sackgasse, in die sich die Menschen manövriert haben, aus der sie nicht mehr herauskommen. Zumindest können wir aufhören, uns an unsere Enttäuschungen zu klammern und uns mit den Wunden, die sie in uns gerissen haben, zu identifizieren. Solange wir sagen: Ich bin der, der diese Wunden trägt, der dieses Leid erfahren hat, der diese Schmerzen und Ängste hat, ist unser Herz damit gefüllt und wir können den ursprünglichen Zauber, den wir seit unsere Kindheit in uns tragen, nicht mehr wahrnehmen. Doch können wir wirklich all unser Leid vergessen und verdrängen? Nein, wir können es nicht vergessen, und verdrängen sollten wir es auch nicht. Aber wir können aufhören, es als Grundlage unseres Lebens zu behandeln und unser weiteres Leben daran anzuknüpfen. Das Gestern hat uns zweifellos geformt. Und gerade dadurch sind wir heute nicht mehr der, der wir gestern waren. Also beginnt heute unser neues Leben. Auch der heutige Tag kann uns formen, und wir selbst können diesen Tag – und damit ein Stück unseres Lebens – formen.
Entscheidend für uns ist der unerschütterliche Glaube an das innere Licht, dass uns gegeben ist.
Wir stehen jeden Morgen als Neugeborene auf und abends stirbt das, was nur für diesen Tag wichtig war. All die Freuden, all das Leid, es ist da. Auch ohne uns. Jeder Mensch erfasst an jedem Tag etwas davon. Dennoch ist niemand die Freude oder das Leid selbst. Kein Mensch besteht nur aus Leid, Trauer oder Verzweiflung. Am Ende des Tages können wir all das zurück lassen. Dann kann an jedem Morgen ein neues Leben beginnen, weil das, was uns gestern geformt hat, heute nicht mehr zählt, denn für heute wartet Neues auf uns. Und wir können die Sorgen von gestern hinter uns lassen und dem neuen Tag vollkommen zuversichtlich entgegensehnen. Das könnte Jesus gemeint haben als er sagte: »Werdet wie die Kinder.« Für die Kinder ist jeder Tag eine neue Überraschung. Für uns ist dabei die Gelassenheit entscheidend, mit der wir unser altes Leben loslassen und das grenzenlose Vertrauen, der unerschütterliche Glaube an das innere Licht, das uns gegeben ist.“
(WICKBOLD, S. 75)
Wenn uns das tatsächlich ein Stück weit gelingt, dann müssen wir vielleicht nicht in der Weise alt werden, wie wir es befürchten, sondern können auch in den späteren Jahren ein erfülltes Leben führen.
Auch in der Altenpflege gibt es so etwas, wie Sternstunden.
Plötzlich sprudelte eine Quelle, die es zuvor in meinem Bewusstsein nicht gab.
In nunmehr 20 Jahren Arbeit in der Altenpflege und sechs Jahren Leitung von Gedächtnistrainingsstunden mit Älteren habe ich viele hundert – wahrscheinlich über tausend – alte und sehr alte Menschen kennen gelernt, von denen die meisten inzwischen verstorben sind. Mit einigen von ihnen hatte ich nur wenig zu tun, andere habe ich über viele Monate oder Jahre begleitet. Doch nicht nur ich habe diesen Menschen geholfen. Viele von ihnen haben mir geholfen ihre Situation, ihre Wünsche, Ängste, ihre Beweggründe und ihre Handlungslogik besser zu verstehen. Auch in der Altenpflege gibt es so etwas wie Sternstunden. Das sind Momente, in denen etwas Entscheidendes passiert, in denen z. B. plötzlich eine Brücke entsteht zu einem Menschen, der zuvor nur sehr schwer zugänglich war. So gab es etwa Herrn Siebeck, einen eigensinnigen Mann, der aufgrund seines fast zwanghaften Festhaltens an, von ihm exakt festgelegten Handlungsabläufen, die in Verbindung mit der bei ihm stark ausgeprägten parkinsonschen Krankheit, zu einer enormen Verlangsamung und somit zu einer großen Geduldsprobe für die Menschen wurde, die mit ihm zu tun hatten. Es war kurz vor Weihnachten, als ich durch eine Frage oder eine beiläufige Bemerkung, für mich überraschend und völlig unerwartet seine Aufmerksamkeit und sein Interesse geweckt hatte. Plötzlich sprudelte eine Quelle, die es zuvor in meinem Bewusstsein nicht gab. Der zu dieser Zeit hagere, knöcherne Mann mit dem stark vorgebeugten Gang auf seinen wackeligen Beinen erwachte zu neuem Leben. Die Spur des Gesprächs hatte ihn zurückgeführt in das Berlin der 20er Jahre, in dem er als Obst- und Gemüsehändler mit seinem Karren durch die Straßen Berlins gefahren war, dieser Großstadt mit ihrer quirligen Lebendigkeit, wie sie Alfred Döblin in »Berlin Alexanderplatz« meisterhaft beschrieben hatte und die bei den Schilderungen dieses alten Mannes nun vor meinem inneren Auge zu neuem Leben erwachte. Er hatte gelebt in dieser längst untergegangenen Zeit, die für ihn nun eine goldene Zeit war. Und ich hatte ihn quasi gesehen, mitten im legendären Berlin. Er hatte mich teilhaben lassen an seinem Leben und hatte mich zum Zeugen gemacht. Und er hatte mir gezeigt, dass dieser Mann viel mehr war, als nur der gebrechliche Alte, den ich bis dahin glaubte vor mir zu haben.
1.2
Lebensziel Alter?
Ich begang aufmerksamer auf die Äußerungen der alten Menschen zu achten und ihre Verhaltensweisen zu hinterfragen.
Solche Erlebnisse waren es, die mich zu der Erkenntnis führten, dass Alter mehr sein muss, als nur in einem brüchigen Körper gefangen zu sein, wehmütig auf die Vergangenheit zu schauen und des Lebens überdrüssig auf den Tod zu warten. Ich begann aufmerksamer auf die Äußerungen der alten Menschen zu achten und ihre Verhaltensweisen zu hinterfragen.
Ich sehe jeden Einzelnen in der Verantwortung für die eigene Entwicklung bis ins hohe Alter, die nicht an irgendjemanden abgegeben werden kann.
Vielleicht bemerken Sie bei der Lektüre dieses Buches, dass ich ein engagierter Zeitgenosse bin. Ich möchte – wie Sie auch – das Beste für die Menschen, die Unterstützung benötigen. Ich möchte, dass das Leben auch im Alter Freude bereitet und die Lebensqualität nicht nur auf die körperlichen Notwendigkeiten reduziert wird und vom Wohlwollen der Mitmenschen abhängt. Das gilt für die Menschen, für die ich Verantwortung trage und auch für mich selbst. Ich reflektiere meine Arbeit mit den alten Menschen und möchte, dass sie Anschluss finden an ihren ureigenen Lebenssinn. Ich versuche die Mitleidsmentalität, die sich manchmal im Umgang mit alten Menschen breitmacht, zu vermeiden und sehe jeden Einzelnen in der Verantwortung für die eigene Entwicklung bis ins hohe Alter, die nicht an irgendjemanden abgegeben werden kann. Und ich glaube daran, dass es einen individuellen inneren Sinn für den Zustand und die Lebenssituation in jedem Alter gibt, auch wenn es manchmal zugegebenermaßen schwierig ist, diesen zu erkennen oder auch nur zu erahnen und demgemäß zu handeln.
Es gibt viele wissenschaftliche Untersuchungen darüber, wie alte Menschen am besten gepflegt werden sollten, wie sie denken oder warum sie dement werden. Anstatt Sie mit unzähligen Forschungs- und Untersuchungsergebnissen zu langweilen, habe ich mich entschlossen die Untersuchungen einiger Gelehrter, die Äußerungen verschiedener Dichter und Künstler, sowie Erfahrungen alter Menschen, die meine Beobachtungen verständlich machen, zusammen zu tragen, ohne dabei einem Anspruch auf wissenschaftliche Exaktheit oder Vollständigkeit gerecht werden zu wollen.
Was wir im Alter erleben steht in direktem Zusammenhang mit dem, was wir bisher gelebt, gedacht und erfahren haben.
Märchen: Der Froschkönig
Unser Alter ist kein vom restlichen Leben völlig isolierter Anhang oder eine Krankheit, die uns unvorbereitet trifft. Was wir im Alter erleben steht in direktem Zusammenhang mit dem, was wir bisher gelebt, gedacht und erfahren haben. Das Erlebte haben wir in unseren Muskeln, Knochen, Organen und in jeder Zelle gespeichert. Der Körper weiß all das noch. Die Seele hat in uns Stimmungen und Bilder abgelegt, die sich beizeiten in den Vordergrund drängen. Unser Unterbewusstes spricht sich in Träumen und Bildern aus. Und auch unser Bewusstsein weiß mehr, als wir annehmen. Ist es nicht erstaunlich, wieviele Details aus längst vergangenen Tagen unser Gedächtnis abrufen kann? Lange vergessen Geglaubtes ist plötzlich wieder da. Es geht nichts verloren. Dies macht sich besonders bei schwerwiegenden Ereignissen bemerkbar. Handlungen und Körperreaktionen, Stimmungen und Gefühle, Erinnerungen und Situationen können plötzlich so präsent und stark sein, dass sie unser aktuelles Leben blockieren und uns überwältigen. Diese Dinge müssen zu allererst geklärt oder besser gesagt, erlöst werden. Es ist erstaunlich wie prägnant und treffend elementare Zusammenhänge und tiefe Wahrheiten im Märchen ausgesprochen werden. In dem Märchen »Der Froschkönig« heißt es:
„Heinrich der Wagen bricht!“
„Nein Herr, der Wagen nicht,
es ist ein Band von meinem Herzen,
das da lag in großen Schmerzen!“(GEBRÜDER GRIMM, S.5)
Diese Dinge müssen zu allererst geklärt oder besser gesagt, erlöst werden.
In diesem Märchen haben Klärung und Erlösung stattgefunden. Unsere schöne Seite muss unsere hässliche Seite annehmen und sich mit ihr vermählen, dann erweisen sich unsere ungeliebten Persönlichkeitsanteile als wahre Reichtümer. Der Prinz musste ein Dasein als Frosch fristen und seinem Diener, der um dessen wahre Größe und Bestimmung wusste, wurden drei eiserne Bänder über das Herz gelegt, damit es von der Trauer nicht zersprengt werden konnte. Märchen sind wunderbare Bilder für unsere Seele. Sie enthalten tiefe Wahrheiten, von denen wir vielleicht nur einen Teil begreifen. Und gerade dieser Teil ist für uns von Bedeutung. Später komme ich noch zu einer etwas anderen Deutung des Märchens.
Meine These lautet:
Wir können unser Leben, und somit auch unser Alterwerden und die Art, wie wir im Alter leben werden, selbst in die Hand nehmen und es selbst gestalten.
Vergesslichkeit, Verschrobenheit, Verwirrtheit und Demenz treten vielfach weder zwangsläufig noch unvorhersehbar auf.
Diese Schönheit tragen wir, trägt jeder Einzelne in seiner Seele, als eine Fülle von inneren Bildern.
Märchen und Träume oder auch die Bilder, die wir aus uns hervorbringen, sind oft wahre Schatzkästchen. Wie im Froschkönig die schöne Prinzessin den hässlichen Frosch erlöst, so kann, wie Dostojewski sagte, die Schönheit die Welt erlösen. Diese Schönheit tragen wir, trägt jeder Einzelne in seiner Seele, als eine Fülle von inneren Bildern. Je länger das Leben andauert, je mehr wir erlebt haben, um so reicher ist unsere innere Bilderwelt. Leider wissen wir all zu oft viel zu wenig mit diesen Bildern anzufangen. Viele Menschen wissen nicht einmal um den verborgenen Schatz in ihrer Seele. Sie trauen nur den äußeren Dingen, die sie zählen und messen, sehen und begreifen können. All dies verliert im Alter jedoch immer mehr an Bedeutung. Je stiller das äußere Leben wird, um so mehr können die inneren Bilder und Stimmen reden, denn nun ist es Zeit, das ihnen die eisernen Bänder abgenommen werden. Nun ist es an der Zeit, dass auch sie erlöst werden.
„Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen,
Wenn die, so singen oder küssen,
Mehr als die Tiefgelehrten wissen,
Wenn sich die Welt ins freie Leben,
Und in die Welt wird zurück begeben,
Wenn dann sich wieder Licht und Schatten
Zu echter Klarheit werden gatten,
Und man in Märchen und Gedichten
Erkennt die ewgen Weltgeschichten,
Dann fliegt vor einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.“(NOVALIS, S. 295)
Was können wir jetzt schon tun?
Um die als typisch angesehenen Alterserscheinungen zu vermeiden, bedarf es anderer Methoden, als sich davor zu fürchten oder erschrocken weg zu schauen mit dem Ausspruch: »Nur nicht so werden, wie die da. Dann lieber gar nicht erst alt werden!« Doch, was können wir jetzt schon tun? Wie können wir uns angemessen vorbereiten? Was treibt einen alten Menschen in die Demenz? Oder wollen sie etwa so werden? Können wir uns wirklich in das Seelenleben desorientierter Alter versetzen und ihre innere Motivation nachvollziehen?
Können wir uns wirklich in das Seelenleben desorientierter Alter versetzen und ihre innere Motivation nachvollziehen?
Wie viele Dinge um uns herum geschehen, ohne dass wir sie wirklich verstehen? Wir könnten durchaus so manches Mal ausrufen: »Ich versteh´ die Welt nicht mehr!« Meist kümmern wir uns einfach nicht mehr um diese Dinge. Problematisch wird es erst dann, wenn wir uns von zu vielen Dingen zurückziehen oder wenn wir ständig weiterhin damit konfrontiert werden. Dann müssen wir unsere eigenen Lösungen finden. Was machen wir, wenn die Ereignisse so erdrückend oder so ungeheuerlich sind, dass es uns die Sprache verschlägt? Dann müssen wir unsere eigene Sprache finden. Wer spricht mit uns, wenn uns unser Körper nicht mehr gehorcht und die Menschen uns nicht mehr verstehen? Was tun wir, wenn unser Tun keinen Sinn mehr hat? Wir suchen uns neue Ziele. Der Validationstrainer Jörg Ignatius beschreibt die folgenden
„Ziele desorientierter alter Menschen:
• Sich aus der schmerzhaften Gegenwart des Nichtgebrauchtwerdens zurückziehen
• Angenehmes aus der Vergangenheit wiederbeleben
• Langeweile durch Stimulierung sensorischer Erinnerungen lindern
• Unbewältigte Konflikte durch Ausdrücken der Gefühle lösen
• Das Gefühl von persönlicher Würde spüren, Identität und inneren Frieden wiederfinden.“(IGNATIUS, 2002, S. 2)
Es mag überraschend wirken, von den Zielen desorientierter alter Menschen zu sprechen, dennoch macht es deutlich, dass auch das scheinbar ziel,- und orientierungslose Verhalten für den Betroffenen durchaus sinnvoll sein kann.
Ziele der Arbeit am eigenen Alter formulieren.
Wenn auch das Leben nicht immer gradlinig auf ein Ziel zuläuft, die Kunst frei von einengenden Vorgaben sein sollte und die Therapie die Einmaligkeit jeder Individualität berücksichtigen will, so ist es doch sinnvoll, Ziele für die Arbeit am eigenen Alter zu formulieren. Die speziellen Ziele seines Lebens legt natürlich jeder für sich selbst fest. Für eine allgemeine Zielsetzung habe ich mich in diesem Buch an den folgenden zehn Punkten orientiert:
Tabelle 1: Zehn Ziele lebenspraktischer, künstlerischer und therapeutischer Eigenarbeit für das Alter
1. Sinnvolle Beschäftigung finden, auch bei Sinneseinschränkungen z. B. des Sehens oder des Hörens (siehe Kap.2.1 und 3.1)
2. Erschließung und Erweiterung nonverbalen und kreativer Ausdrucksmöglichkeiten (Kap.1.2, 2.2 und 3.2)
3. Bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie (Kap. 1.3, 1,7, 2.3 und 3.3)
4. Prävention von Desorientierung und Demenz (Kap.1.4, 2.4, 2.7 und 3.4)
5. Aufrechterhaltung, Wiedererlangung bzw. Erweiterung der sozialen Kompetenz (Kap. 1.5, 2.5 und 3.5)
6. Sinnfindung auch in schwierigen Lebenslagen und Grenzsituationen (Kap. 1.6, 2.6 und 3.6)
7. Selbstakzeptanz durch Selbsterkenntnis (Kap 1.8, 2.6 und 3.7)
8. Lösungsfindung für alte und neue Beziehungskonflikte (Kap. 1.9, 2.4 und 3.8)
9. Befreien und Erlösen gebundener Lebensenergie*
10. Integration der individuellen Persönlichkeitsanteile (Kap. 1.10, 2.10 und 3.10)*(Kap. 1.4, 2.9, 3.9)
Die in Klammern stehenden Zahlen geben die Kapitel an, die sich mit dem Thema befassen
> An wen sich dieses Buch wendet
An all jene Menschen, die sich mit ihrem eigenen Älterwerden oder dem Alter ihrer Angehörigen auseinandersetzen wollen.
Dieses Buch wendet sich an Menschen, die sich mit ihrem eigenen Älterwerden oder dem Alter ihrer Angehörigen auseinandersetzen wollen. Dabei sollen die seelischen Beweggründe erfahrbar, kreative Möglichkeiten des täglichen Lebens entdeckt und die Hilfen von Kunst und Therapie für ein selbstbestimmtes, sinnerfülltes und würdevolles Leben im Alter beleuchtet werden…
Können wir uns wirklich in das Seelenleben desorientierter Alter versetzen und ihre innere Motivation nachvollziehen?
Abb. 3: »Das Pferd, die Schlange und die Taube« Norbert Plötz, 1986
1.3
Vom Sinn des Lebens, des Sterbens und der Aufgabe des Alters
Ich kann doch nicht mehr neu anfangen. So kurz vor dem Ende meines Lebens.
Ein Buch über die Situation in den Städten Deutschlands im Mai 1945 trug den Titel: »So viel Zukunft war noch nie.« Bilder aller Städte glichen einander. Es lag alles in Schutt und Asche. Die Zerstörungen hatten ihr Ende gefunden. Nun ging es daran, neu zu beginnen. Wir, die wir nach dem Krieg geborene sind, kennen das aus der Geschichte. Für die älteren Menschen ist es Teil ihrer Geschichte, ihrer ganz individuellen Lebensgeschichte – deren Ende sie sich nähern. Heute, nach so vielen Lebensjahren können sie sagen: »Soviel Vergangenheit war noch nie.« Ihr Vorrat an Zukunft scheint ziemlich erschöpft. Damals, in der schlimmen Zeit, gab es die Perspektive einer besseren Zukunft, aber heute? »Ich kann doch nicht mehr neu anfangen. So kurz vor dem Ende meines Lebens«, mag da mancher alte Mensch denken.
Die Zeiten, da die Kinder und Enkel die Werke ihrer Eltern und Großeltern fortführen sind längst vorbei.
„Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden…
Wohlan denn Herz nimm Abschied und gesunde!“
(HESSE, 1976, S. 499)
So lautet die letzte Zeile aus dem Gedicht „Stufen“ dass H.H. Josef Knecht im „Glasperlenspiel” verfassen lässt, bevor er das höchste Amt, das Amt des Magister Ludi aufgab, um sich noch im Alter einer ganz neuen Aufgabe zuzuwenden. Beflügelt hatte ihn die Wahrheit, die sich ausdrückt in der zweiten Zeile dieses Gedichtes:
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt, und der uns hilft zu leben.“
(HESSE, ebenda)
Gibt es ein Jenseits, in dem wir weiterleben?
Die Zeiten, da die Kinder und Enkel die Werke ihrer Eltern und Großeltern fortführen, sind längst vorbei. In ihnen können die Alten nicht weiterleben, denn die Nachfahren haben ihre eigenen Ziele. Den Jungen gehört die Welt, und die Alten müssen sie ihnen übergeben – um sie dann selbst zu verlassen! Und wohin dann? Gibt es ein »Danach«? Oder wird unser Leib von den Würmern zerfressen und wir von den Menschen vergessen? – Aber warum habe ich dann überhaupt gelebt? Wofür habe ich das alles erlitten, wenn das dann alles Nichts gewesen ist? Gibt es für uns im Jenseits, ein Weiterleben? Wer kann das wissen? Wieviel Energie wird darauf verwendet, die jungen Menschen für ihr Leben auf Erden vorzubereiten, auf ihre Zukunft im Diesseits? Doch wenn es wirklich eine Zukunft für uns im Jenseits gibt, wer bereitet uns darauf vor?
In biblischen Zeiten wandelten noch Engel als göttliche Boten unter den Menschen.
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, sagt JESUS (1985, JOH. 18, 36) und verweist dabei auf das himmlisch-göttliche Königreich in das wir als Kinder Gottes eingehen werden. In biblischen Zeiten wandelten noch Engel als göttliche Boten unter den Menschen. Man konnte sie als Lichtwesen sehen. Aber die Fähigkeit, die Engelwesen wahrzunehmen ließ immer mehr nach. Später konnte man die Heiligen nur noch an ihrem hellen Schein um den Kopf erkennen. Deshalb sah man sie als die wahren Könige an. Als auch diese Fähigkeit versiegte, waren die Menschen immer mehr auf sich selbst gestellt. Die göttlichen Boten und die eigene göttliche Heimat der Menschen gerieten in Vergessenheit.
Abb. 4: Prähistorische Felszeichnung aus Australien (verkleinert)Jean Gebser
„In dem Alter, wo wir leben findet der unmittelbare Verkehr mit dem Himmel nicht mehr statt. Die alten Geschichten und Schriften sind jetzt die einzigen Quellen, durch die uns eine Kenntnis von der überirdischen Welt, soweit wir sie nötig haben, zuteil wird, und statt jener ausdrücklichen Offenbarungen redet jetzt der heilige Geist mittelbar durch den Verstand kluger und wohlgesinnter Männer und durch die Lebensweise und Schicksale frommer Menschen zu uns.“
(NOVALIS, 2001, S. 114)
Religio steht für die Rückbindung des Einzelnen an seine geistiggöttliche Vergangenheit – und Zukunft.
Seither ist es die ureigene Aufgabe der Religion das Bewusstsein von dieser göttlichen Heimat der Menschen wach zu halten. Religio steht für die Rückbindung des Einzelnen an seine geistiggöttliche Vergangenheit – und Zukunft. In den „Apokryphen“ findet sich der Satz: „Diese Welt ist eine Brücke, gehe darüber, doch baue darauf nicht deine Wohnstatt.“ Das älteste erhaltene (Toten-) Buch der Menschheit, „das ägyptische Totenbuch“ ist eine Sammlung von Sprüchen, die den Verstorbenen helfen sollten sich im Totenreich zurecht zu finden und die Götter positiv zu stimmen. Der zweite Spruch aus diesem Buch heißt:
Spruch, am Tag herauszugehen und zu leben nach dem Sterben
„O Einzigartiger, der als Mond aufleuchtet,
O Einzigartiger, der als Mond erglänzt –
Möge NN herausgehen über jener deiner Menge nach draußen!
Gelöst bin ich [und] die, die im Lichtglanz sind,
Offen steht die Unterwelt,
Und NN ist herausgegangen am Tage, um alles zu tun,
Was er wünscht, unter den Lebenden.“(1)
(Ägypt. Totenbuch, 1993, S. 45-46, Spruch 2)
Die Ägypter kanten sie also noch, die Vorbereitung auf den Tod, auf das Dasein im Jenseits.
Die Ägypter kanten sie also noch, die Vorbereitung auf den Tod, auf das Dasein im Jenseits. Nahezu ganz verschwunden ist bei uns inzwischen der Glaube an eine jenseitige, göttliche Welt. Um so mehr glauben wir an die hiesige, diesseitige und materielle Welt, so wie sie uns durch die Wissenschaft erforscht und dargestellt wird. Die Wissenschaft hat inzwischen die religio weitgehend verdrängt und ersetzt. Am Anfang dieses Wertewandels hatte einer der Begründer der modernen, wissenschaftlichen Weltsicht, Johannes Kepler in die Einleitung seines Hauptwerkes „De harmonice mundi« bezeichnenderweise den Satz geschrieben:
„Ich habe die goldenen Gefäße der Ägypter geraubt…“(2)
(KEPLER, 2005, S. 572)
Die Frage, die für Kepler noch am wichtigsten war: Warum hat Gott das so gemacht?, wurde seither aus der Wissenschaft verbannt.
In diesem Werk veröffentlichte Kepler sein 3. Gesetz der Bewegungen der Himmelsmechanik. Später stellte Newton diese Gleichung um und entdeckte so das Gravitationsgesetz. Die göttlich gedachte Himmelsmechanik wurde dadurch auf die Erde geholt und wurde zur irdisch-materiellen Mechanik. Die Frage, die für Kepler noch am wichtigsten war: „Warum hat Gott das so gemacht?“, wurde seither aus der Wissenschaft verbannt. Von dieser Zeit an galt es, sich die Erde, das Diesseits zu erobern und auszubeuten. Fragen nach einem »Warum?« stellen heute nur noch Laien und Kinder, denen man ihre Dummheit nachsieht. Mit dem Drang des Wissenschaftlers, herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält, hat sich Goethe in seinem „Faust“ auseinander gesetzt. Er lässt den Doktor Faust gleich in der ersten Szene den Satz sagen:
„Wie alles sich zum Ganzen webt, eins in dem andern wirkt und lebt, wie Himmelskräfte auf und niedersteigen und sich die goldenen Eimer reichen…“
(GOETHE, 1979, S. 12)
Also auch hier: die goldenen Gefäße! Am Vorgehen der Wissenschaft übt Goethe zeitlebens Kritik. So lässt er im Faust 1 den Mephisto sagen:
Dichter und Künstler aller Zeiten haben immer darum gewußt und es uns durch ihre Werke verkündet.
„Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben,
sucht erst den Geist heraus zu treiben,
dann hat er die Teile in seiner Hand,
s´ fehlt, leider! nur das geistige Band.“
(GOETHE, 1979, S. 33)
Auch Goethe hat noch von der anderen Welt gewusst, wie er deutlich in seinem Gedicht an den Mond zum Ausdruck bringt:
„Füllest wieder Busch und Tal
Still im Nebelglanz
Lösest endlich auch einmal
meine Seele ganz…“
(GOETHE, 1789)
Dichter und Künstler aller Zeiten haben immer darum gewusst und es uns durch ihre Werke verkündet. Ganz deutlich setzt sich Rilke mit der anderen Existenz in seinen „Duineser Elegien“ auseinander. So heißt es in der ersten Elegie:
„Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen, kaum erlernte Gebräuche nicht mehr zu üben, Rosen und andern eigens versprechenden Dingen nicht die Bedeutung menschlicher Zukunft zu geben; das, was man war in unendlich ängstlichen Händen, nicht mehr zu sein, und selbst den eigenen Namen wegzulassen wie ein zerbrochenes Spielzeug. Seltsam, die Wünsche nicht weiterzuwünschen. Seltsam, alles, was sich bezog, so lose im Raume flattern zu sehen. Und das Totsein ist mühsam und voller Nachholn, daß man allmählich ein wenig Ewigkeit spürt.– Aber Lebendige machen alle den Fehler, daß sie zu stark unterscheiden. Engel (sagt man) wüßten oft nicht, ob sie unter Lebendigen gehn oder Toten. Die ewige Strömung reißt durch beide Bereiche alle Alter immer mit sich und übertönt sie in beiden.“
(RILKE, 1955, S. 9)
…obwohl er das Jenseits leugnet, wirkt er ständig »dort« hinein – und bewirkt dadurch, dass auch das Jenseits „hier“ hinein, ins Diesseits wirkt.
Und Saint Exypéry macht die schlichte Aussage:
„Denn deine gesamte Vergangenheit
ist nur eine Geburt des heutigen Tages.“
(EXYPÉRY, 1957, S. 157)
Als bewiesene Tatsache gilt heute, dass Wohlstand und bessere medizinische Versorgung eine stetig wachsende Lebensdauer bewirkt haben und bewirken.
Es entzieht sich allerdings dem rational Denkenden, denn der reine Rationalist muss zwischen Leben und Tod, Diesseits und Jenseits unterscheiden. Für ihn kann es nur begrenzte Systeme geben. So ist es ihm selbstverständlich, dass auch das Leben begrenzt und vergänglich ist. Er braucht nicht zu fragen, was danach sein wird. Durch seine Haltung kann er weder zum Wesen des Lebens noch des Todes Aussagen machen. Und so leugnet er das Leben, wie auch den Tod. Was wir Leben und Tod nennen ist ihm nur eine graduell unterschiedliche Form von Materie. Doch, obwohl er das Jenseits leugnet, wirkt er ständig »dort« hinein – und bewirkt dadurch, dass auch das Jenseits „hier“ hinein, ins Diesseits wirkt. An den folgenden Beispielen soll das verdeutlicht werden.
Es wird aber auch immer deutlicher, dass mit der Zahl der Lebensjahre nicht nur ein quantitatives Mehr verbunden sein kann, sondern es will sich dadurch auch ein qualitatives Mehr Ausdruck verschaffen.
Als bewiesene Tatsache gilt heute, dass Wohlstand und bessere medizinische Versorgung eine stetig wachsende Lebensdauer bewirkt haben und bewirken. Die Menschen in unserer Kultur werden größer und haben eine erheblich längere Lebensdauer. Lag in früheren Jahrhunderten die Lebenserwartung bei 30–40 Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts bei 60 – 70 Jahren, so nimmt die Zahl der über Hundertjährigen gegenwärtig zu. Um 2030 soll die Lebensdauer bei bis zu 120 Jahren liegen. Es wird aber auch immer deutlicher, dass mit der Zahl der Lebensjahre nicht nur ein quantitatives Mehr verbunden sein kann, sondern es will sich dadurch auch ein qualitatives Mehr Ausdruck verschaffen. Von immer mehr Menschen wird heute das eigene Leben als ein individueller Entwicklungsweg aufgefasst. Den zu gehen braucht Zeit. Vieles reift erst mit den Jahren heran. Manches kann nur nach langer Lebenserfahrung erlebt werden. Ein längeres Leben bedeutet somit auch, diesen Entwicklungsweg weiter zu gehen – mit allen Konsequenzen. Den meisten Menschen war das in der Vergangenheit nicht möglich, sie mussten ihre Lebensreise oft schnell beenden. Somit ist das Durchleben des hohen Alters für alle Zeitgenossen, für die Alten wie für die gleichzeitig lebenden Jungen, ein bisher unbetretenes Neuland. Wir Jüngeren betrachten die oft uralten Menschen mit ihren Lähmungen, Verwirrtheiten und allerlei Eigentümlichkeiten, die allesamt für die Betroffenen wahrscheinlich eine Qual darstellen, so dass wir voller Mitleid den Ausspruch machen: »Das ist ja die Hölle!« In der Tat drängt sich oft die Frage auf: Womit hat dieser Mensch das nur verdient? Warum muss er diese Strafen, diese Qualen erleiden? Ist er nicht schon in seinem Leben durch so viele Unannehmlichkeiten und Schmerzen gegangen, warum muss er jetzt das auch noch erleiden?
Beschreibungen, was die Seele nach dem Tode durchmacht, finden sich in allen Kulturen.
Hier liegt der Vergleich mit den Darstellungen der Menschen aus früheren Jahrhunderten nahe, in denen von einem göttlichen Gericht und von Höllenqualen der Sünder berichtet wurde. Heute glauben viele, die Kirche hätte diese Geschichten nur erfunden, um damit ihre Macht zu sichern. Derartige Beschreibungen, was die Seele nach dem Tode durchmacht, finden sich aber in allen Kulturen. Die Ägypter wurden hier schon erwähnt. Aber selbst 100.000 Jahre alte Grabfunde mit ihren Nahrungsvorräten lassen den Schluss zu, dass schon die Neandertaler an ein Jenseits glaubten. Können denn all die Geschichten erfunden sein? Haben sich die Menschen über viele Jahrtausende hinweg geirrt oder täuschen lassen?
Indem wir unser diesseitiges Leben verlängerten, haben wir gleichzeitig einen Teil der Jenseitigkeit zu uns geholt, um es schon hier zu durchleben.
Wenn wir so sehr am Diesseits hängen und den Tod so weit wie möglich herausschieben, verschieben wir damit nicht auch die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits?
Und ein Alzheimerpatient, in welcher Welt wandelt er? Nimmt er nicht vorweg, was sonst erst mit dem Tod eintritt: Das große Vergessen?
Auf jeden Fall haben sich diese Bilder tief ins sogenannte Unterbewusstsein jedes Einzelnen eingegraben, sodass ihre Symbolik von allen Menschen verstanden wird. Sie gehören, wie C. G. Jung sagt, zum kollektiven Unbewussten. Auf dieser Ebene trägt jeder Mensch eine Ahnung von diesen Vorgängen in sich. Solange das irdische Leben im allgemeinen in der vierten oder fünften Dekade endete, konnten die Menschen nur einen Teil ihrer Entwicklung hier, im Diesseits durchlaufen und mussten den weiteren Weg im Jenseits durchleben. Indem wir unser diesseitiges Leben verlängerten, haben wir m. E. gleichzeitig einen Teil der Jenseitigkeit zu uns geholt, um es schon hier zu durchleben. Ist es nicht auch konsequent den eigenen Entwicklungsweg ganz zu gehen? Wenn wir heute so sehr am Diesseits hängen und den Tod so weit wie möglich herausschieben, verschieben wir damit nicht auch die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits? Ist vielleicht ein halbseitig Gelähmter mit einer Hälfte schon Drüben? Und ein Alzheimer-Patient, in welcher Welt wandelt er? Nimmt er nicht vorweg, was sonst erst mit dem Tod eintritt: Das große Vergessen? Und schließlich die Apparatemedizin, die lediglich die biologischen Lebensfunktionen aufrecht erhält und den Menschen ans Diesseits bindet, während ihn das Jenseits schon anzieht? Die seit ehedem göttliche Willkür von Geburt und Tod wird immer mehr eine menschliche Willkür. Wir entscheiden, ob wir einen Jungen, ein Mädchen oder gar keine Kinder haben wollen. Wir lassen gesunde Kinder in diese Welt und Kranken verwehren wir den Zutritt. Und züchten wir einst Menschen, die sich genau gleichen und sich gegenseitig als Organspender dienen sollen, um so den Tod vielleicht eines Tages ganz zu verhindern? Die Menschen stehen heute (und das bezieht sich auf den Einzelnen, wie auf die Menschheit als Ganzes) dem Jenseits nicht mehr nur gegenüber:– sie befinden sich in einer Welt, die gleichzeitig diesseitig wie jenseitig ist.
Abb. 5: »Weltgerichtstryptichon«, Hieronimus Bosch. Ausschnitt aus der Mitteltafel. Wien, Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste
Die Menschen stehen heute (und das bezieht sich auf den Einzelnen, wie auf die Menschheit als Ganzes) dem Jenseits nicht mehr nur gegenüber:– sie befinden sich in einer Welt, die gleichzeitig diesseitig wie jenseitig ist.
„Diesseitig bin ich gar nicht fassbar,
Denn ich wohne grad so gut bei den Toten,
wie bei den Ungeborenen.
Etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich.
Und noch lange nicht nahe genug.“
(KLEE, 1996, S. 14)
In seinem letzten Buch: „Kraft aus der Stille“, in dem sich J.-E. Berendt sehr intensiv mit dem Tod auseinandersetzt, schreibt er:
„Wir verstecken den Tod hinter seiner Ursache. (…) Denn: Wir sterben. Punktum. Wenn nicht an dieser Krankheit, dann an einer anderen viele auch ohne Krankheit. Wir sterben am Zur-Neige-Gehen des uns zugemessenen Kelches am Leben. Die Krankheit ist nur ein Mittel dazu. Das Leben verfügt über zahlreiche anderen Mittel dazu: Unfälle, Katastrophen, Dummheiten, einfach Erlöschen… All diese vielen Mittel, die zum Reichtum des Lebens gehören. Wir sterben am Leben. Leben stirbt an sich selbst. Leben will Tod. Warum? Um ganz, um vollständig zu werden.“(BEREND, 2000, S. 240)
Das Leben reümieren
Doch es gibt nicht nur die Angst vor dem Tod. Viele alte Menschen sagen immer wieder: »Ach, wenn ich doch nur sterben könnte!« Diese Menschen haben ihr aktives Leben ja schon gelebt. Ihre vorerst letzte Aufgabe in diesem Leben ist die Entwicklungsaufgabe, die Naomi Feil bezeichnet mit: „Das Leben resümieren.“(FEIL, 1990, S. 13) (siehe Kap. 3.7) Dies ist sicherlich eine große Aufgabe. Leider gibt es einige, die dieser Aufgabe nicht gewachsen sind oder sich ihr nicht gewachsen fühlen. Sie laufen Gefahr, von der Macht der Erinnerungsbilder, die immer auch mit Gefühlen verbunden sind, aus der Bahn geworfen zu werden. Das raubt ihnen fast den Verstand. Sie werden verwirrt. Dies geht möglicherweise so weit, dass sie nur noch »Dahinvegetieren.« Ähnlich wie Säuglinge auf äußere Hilfe angewiesen sind, um in das irdische Leben hinein zu wachsen, sind die Hochbetagten oft nur in der Lage, sich zu vollenden, indem sich Pflegekräfte um ihre letzten irdischen Bedürfnisse kümmern. Ihre aktiven, diesseitigen, irdisch- materiellen Aufgaben haben sie hinter sich gelassen. Sie benötigen auch die Leiblichkeit – fast – nicht mehr. Für ihr bisheriges Leben sind sie gewissermaßen schon gestorben. Ihr weiteres Dasein gehorcht anderen Maßstäben.
Ähnlich wie Säuglinge auf äußere Hilfe angewiesen sind, um in das irdische Leben hinein zu wachsen, sind die Hochbetagten oft nur in der Lage, sich zu vollenden, indem sich Pflegekräfte um ihre letzten irdischen Bedürfnisse kümmern.
In den letzten Jahrzehnten häufen sich Berichte von Menschen, die sogenannte Nah-Tod-Erlebnisse hatten. Diese Menschen waren für kurze Zeit klinisch tot, sind aber wieder ins diesseitige Leben zurückgekehrt und berichten von dem, was sie »Dort« erlebt haben. Einschub: Das Wort »Tod«, im Niederdeutschen »Dot« gesprochen, hat nach sprachgeschichtlicher Betrachtung die Bedeutung von »Dort« sowie auch »Tor.«
Nah-Tod von Mensch und Menschheit
Auch in den Schilderungen der Zurückgekehrten heißt es, dass die Leben-Tod-Grenze in ein Schwingen geraten ist. Die Grenze wird unscharf und durchlässig. Sie ist nur eine Illusion. Als erstes erlebten diese Menschen ihr ganzes zurückliegendes Leben in einer zeitfreien Abfolge. In einer Gesamtschau wurde ihnen alles gleichzeitig und dennoch bis ins kleinste Detail bewusst. Mit dem Zustand dieser Grenzgänger vergleicht Jean Gebser den gegenwärtigen Zustand unserer Kultur und der Erde. Wie in einem Tableau überblickt der Mensch die gesamte geologische, biologische und kulturelle Entwicklung der Erde und der Menschheit. Die ganze Menschheit steht an solch einer Grenze, an solch einem Nah-Tod-Erleben. In der Tat dürfte sich jeder von uns dieser Situation bewusst sein, wie nah sich die Menschheit am Tod und Untergang ihrer Kultur und auch des ganzen Planeten befindet.
Suchen nicht diese Alten nach einem Weg, den auch wir als Ganzes gehen können?
Wir, die wir in unseren Alltagssorgen stecken, die unseren einzigen Maßstab bilden, kommen durch eben diese Geschäftigkeit nicht dazu, uns den entscheidenden Fragen des Lebens zu stellen.
Lassen sich diese beiden Situationen nicht vergleichen: die Alten, die vor der Schwelle des individuellen Todes stehen, und diese immer weiter herausschieben, sie noch lebend überschreiten oder daran verrückt werden – und im Großen, die menschlichen Kulturen, die den Tod massenhaft in sekundenschnelle hervorrufen, ihn aber auch über seine „natürliche“ Grenze hinausschieben können? Durch die Medien kann jeder entfernteste Tod in unsere Stube geholt und durch die gelebte Wirklichkeit der Tod in der eigenen Stube in weiteste Ferne gerückt werden. So wie wir den Tod in der eigenen Umgebung meiden, so meiden wir die Alten, die uns die ständige Gegenwart des Todes bewusst werden lassen. Haben wir Angst, wir könnten erleben, wie diese Alten in ihrer Aufgabe versagen und uns dadurch die Gefahr des eigenen Versagens deutlich machen? Denn so wie die Alten am Ende ihres Lebens stehen, so befinden wir uns am Ende unserer Kulturepoche, an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Auch diesen Tod versuchen wir aufzuhalten. Dem Schicksal eines einzelnen Alten kann ich gleichgültig gegenüber sein, aber gegenüber dem Schicksal, oder besser gesagt, dem Geschick unserer ganzen Kultur kann ich mich nicht verschließen. Könnten da nicht gerade diese Alten mit ihren persönlichen Entwicklungsaufgaben uns allen eine Hilfe sein? Hängt vom Meistern ihrer letzten Arbeit nicht auch das Gelingen unseres Wandels ab? (siehe Kap. 4.4, S. 354) Suchen nicht diese Alten nach einem Weg, den auch wir als Ganzes gehen können? Wir, die wir in unseren Alltagssorgen stecken, die unseren einzigen Maßstab bilden, kommen durch eben diese Geschäftigkeit nicht dazu, uns den entscheidenden Fragen des Lebens zu stellen. Die Alten haben sich – oder wir haben sie – von dieser Alltagslast weitgehend gelöst. Sie sind frei für diese entscheidende Auseinandersetzung.
Die persönliche Entwickelung als ein Prozess der Selbstbefreiung.
Wenn nun tatsächlich diese Parallelität besteht, wie sollen wir als ganze Kultur von den persönlichen Errungenschaften eines alten oder auch vieler alter Menschen Vorteile haben? Wenn die Alten ihren Weg, ihre Lösung finden, wenn sie ihre Lebensaufgabe meistern und das Wissen darum ins Grab mitnehmen, was haben wir anderen davon? Kann es denn für uns überhaupt eine Bedeutung haben? Hier haben wir es mit einem ganzheitlichen Phänomen zu tun. Jeder wichtige Gedanke, jede Idee und jede Bewusstseinsleistung, die einmal aufgebracht wurde, ist fortan unverlierbar. Dann, wenn die Zeit dafür reif ist, will sagen, die Menschen es fassen können, liegt diese Idee geradezu in der Luft. Man sagt dann: »Mir ist eine Idee gekommen«, also nicht : »Ich hatte diese Idee.«
Entwicklungsaufgaben lassen sich nicht verdrängen.
Worin besteht nun diese Entwicklungsaufgabe? Einen Hinweis kann uns die alte Schreibweise des Wortes geben. Noch vor 100 Jahren sprach man von Entwickelung. Dem lag offenbar die Vorstellung zu Grunde, dass da etwas im Verborgenen liegt, was es zu entwickeln, frei zu legen galt. Auch kann dieses Verborgene verwickelt, also gewissermaßen gefangen sein. Von diesen Gedanken ausgehend ließe sich die persönliche Entwickelung als ein Prozess der Selbstbefreiung auffassen. Auch diese Betrachtungsweise, das Leben als eine Fülle von Verwickelungen aufzufassen hat ja schon Tradition. Hatten die Menschen diese Verwickelungen früher als Ausdruck göttlicher Fügung begriffen, erkannten sie später, dass sie sich selbst in diese Verwicklungen begeben und sich auch wieder aus ihnen lösen können – und auch müssen. Wie viele Unruhen und neue Verwicklungen sind dadurch entstanden, dass viele sich dieser so sehr notwendigen Entwicklungsarbeit zwar bewusst geworden waren, aber vor ihr weglaufen wollten. Die Angst, dieser Aufgabe, sich selbst zu entwickeln, seine eigenen Verwickelungen aufzulösen, nicht gewachsen zu sein ist oft so groß, dass ganze Völker lieber fragwürdigen Führern die Verantwortung für ihr eigenes Geschick, und das, der ganzen Kultur abgetreten haben. Eines hat die Geschichte deutlich gezeigt: Entwicklungsaufgaben lassen sich nicht verdrängen. Ihre Verdrängung führt zu immer verworreneren Verwicklungen, die für die betroffenen Menschen immer Blut und Tränen bedeuten. Nur durch das bewusste Annehmen der Aufgabe kann sich der Einzelne, kann sich die Kultur aus den Verwicklungen lösen. Wer eine Lebensaufgabe angenommen hat, für den hat sein Leben fortan eine neue Qualität.
Sein bisheriges Leben, seine Täuschungen und Verwicklungen aufgeben.
Der andere Teil des Wortes Entwicklungsaufgabe ist die Aufgabe. Im Wort Aufgabe steckt eine doppelte Bedeutung. Aufgabe im Sinne von »eine Aufgabe übernehmen« und der andere Sinn ist »aufgeben, aufhören etwas abschließen, sich von etwas verabschieden«. In der Tat ist ja jede Aufgabe solch ein zweischneidiges Schwert. Übernehme ich eine Aufgabe, was hier bedeutet, nehme ich meine Entwicklungsaufgabe, und somit mein Schicksal an, beinhaltet dies gleichzeitig die Aufgabe meines bisherigen Lebens und Leidens. Vielleicht erschließt sich auf diese Weise der Sinn des Christuswortes:
„Wer das ewige Leben erlangen will, verkaufe seinen Reichtum,
verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.“
(Eben dem Christus in dir)
(1985, Mt 16,24-28; Mk 8,34-9,1; Lk 9,23-25)
Liegt nicht gerade die Entwicklungsaufgabe des Alters darin, sich den Selbsttäuschungen zu verleugnen, um sich wirklich selbst zu finden, sich selbst zu retten?
Sich selbst verleugnen könnte hier meinen: Sein bisheriges Leben, seine Täuschungen und Verwicklungen aufgeben. Sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet, sein Schicksal anzunehmen und zu tragen und die Schmerzen, die das Aufgeben der alten Verwicklungen verursacht, durchzustehen. Dem Christus in mir folgen bedeutet meinem ureigenen Wesenskern, meiner inneren Stimme zu folgen. Dadurch sucht man nicht mehr Halt an den Täuschungen und an Vergänglichem. Diese Aufgabe zu lösen kommt dem Tod einer Teilpersönlichkeit, des Anteils mit dem man sich bisher identifiziert hat, gleich. Wer das zu leisten imstande war, hat auch den leiblichen Tod nicht zu fürchten. Denn der Tod lässt sich nicht umgehen, sondern nur überwinden.
„Ihr fürchtet euch vor dem Tod, aber seid getrost,
ich habe den Tod überwunden!“
(1985, Johannes 16.33)
Liegt nicht gerade die Entwicklungsaufgabe des Alters darin, sich den Selbsttäuschungen zu verleugnen, um sich wirklich selbst zu finden, sich selbst zu retten? Alles was es im Leben an Verwickelungen gab und alles damit verbundene eigene Handeln, Fühlen und Denken nicht mehr als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, sondern als das Verdecken des wahren Persönlichkeitskerns aufzufassen?
MenschSein heißt Ganz-Sein.
Hermann Hesses „Steppenwolf“ leidet darunter, dass er zwei Seelenanteile in sich trägt, die er nicht miteinander vereinbaren kann: Den normalen, einfachen Menschen, der sich nach Sicherheit und gesellschaftlicher Anerkennung sehnt und den unbeherrschten Steppenwolf, der das Leben genießen und frei sein will. Zum Schluss erkennt er, dass er in Wirklichkeit noch sehr viel mehr Seelenanteile in sich birgt. Der Steppenwolf entstand als Auseinandersetzung Hesses mit seiner eigenen seelischen Krise und seiner Begegnung mit C.G. Jung und der Psychoanalyse.
Abb. 6: »Abfahrt«, Max Beckmann, 1932-1933. Triptichon
Nicht alle Teilpersönlichkeiten werden von uns geschätzt.
„Das Leben ist Marter, alle Art von Schmerz – körperlicher und geistiger Schmerz. Auf dem rechten Flügel sehen Sie sich selbst, wie sie versuchen, Ihren Weg in der Dunkelheit zu finden. Sie erleuchten Zimmer und Treppenhaus mit einer elenden Funzel, als Teil ihres Selbst schleppen Sie die Leiche ihrer Erinnerungen, ihrer Übeltaten und Misserfolge, den Mord, den jeder irgendwann in seinem Leben begeht. Sie können sich nie von ihrer Vergangenheit befreien, Sie müssen diesen Leichnam tragen, während das Leben dazu die Trommel schlägt.“(BECKMANN, 1978, S. 100)
Mensch-sein heißt: Ganzsein. Dennoch drückt sich diese Ganzheit durch verschiedene Aspekte der Persönlichkeit aus. Aber nicht alle Teilpersönlichkeiten werden von uns geschätzt. Viele hassen, leugnen und verdrängen wir ein Leben lang. Bewusst oder Unbewusst. Das kostet viel Kraft und wenn im Alter die Kraft nachlässt, kommen sie alle zum Vorschein und fordern ihren Tribut. Wir hatten die unliebsamen Teilpersönlichkeiten längst vergessen und uns eingebildet, sie existierten tatsächlich nicht mehr.
Solange die Teilpersönlichkeiten unerkannt bleiben, wirken sie wie Fremde, die uns von außen angreifen und bedrohen.
Betrachten wir psychotherapeutisch unsere Teilpersönlichkeiten, so kann sich, was anfangs vielleicht bedrohlich und übermächtig wirkte, auf sehr unterschiedliche und individuelle Weise verwandeln. Ist zunächst oft eine große Distanz zu einer Teilpersönlichkeit erforderlich, so gelingt es über mehrere Sitzungen, Verständnis für die Teilpersönlichkeit zu entwickeln, um sie allmählich zu wandeln und als Bestandteil der eigene Persönlichkeit zu akzeptieren und sie schließlich zu integrieren. Auf dem Weg dorthin können z. B. Bilder entstehen, anhand derer die Wirkung und die Bedeutung der Teilpersönlichkeit für die Person wahrgenommen und im Laufe des Prozesses gewandelt werden können. Auch für den Malenden selbst ist es manchmal einfacher, diesem eigenen Selenanteilen zu begegnen, wenn er mit Farbe und Pinsel nach außen gesetzt wurde und nun als Gegenüber betrachtet werden kann. Im weiteren Prozess kann dann ein Dialog geführt werden.
…um uns Gelegenheit zu geben, alle Teilpersönlichkeiten zu einem Ganzen zu integrieren, müssen wir uns mit ihnen auseinander setzen.
In seinen Vorstellungen oder in der Meditation kann die Person erneut in die Situation gehen, sich bildlich ausmalen, wie die Szene, als sie geschah, hätte verlaufen können. So kann die Szene erneut unter anderen Bedingungen durchgespielt und anders erlebt werden. Auch die Gefühle, die sich dabei einstellen, werden andere sein. Vielleicht gibt es tatsächlich die Möglichkeit im Leben die Situation auf diese neue Art zu leben. Aber auch, wenn dies nicht geht, haben die entstandenen Bilder die eigene Haltung, die Stimmungen und die Beziehungen zu den Personen gewandelt.
Solange die Teilpersönlichkeiten unerkannt bleiben, wirken sie wie Fremde, die uns von außen angreifen und bedrohen. Die Konfrontation mit den eigenen Schattenseiten – das ist »die Hölle.« Doch nicht um uns zu quälen, sondern, um uns Gelegenheit zu geben, alle Teilpersönlichkeiten zu einem Ganzen zu integrieren, müssen wir uns mit ihnen auseinander setzen. Das gehört zu unserem Schicksal (siehe hierzu Kap. 3.10).
„Nur wenn wir das Schicksal wirkend und früh vollziehen,
wird uns im Rest statt der Qual vielleicht die Freiheit verliehen.“
(GEBSER, 1986, Bd. 7, S. 299)
Wenn wir unsere Schattenseiten als Teil unserer Selbst akzeptieren, werden wir nicht frei von ihnen, sondern frei über sie bestimmen können.
Im Märchen vom Rumpelstilzchen tauchte das Rumpelstilzchen immer dann auf, wenn sich die Prinzessin sicher fühlte und erfolgreich im Leben war. Dann forderte es jedes Mal seinen Preis. Bezeichnenderweise forderte es das, was für die Prinzessin am Wertvollsten war: Ihr Kind. Als es der Prinzessin mit Hilfe guter Freunde gelungen war, Rumpelstilzchen beim Namen zu nennen, verlor dieses alle Macht über sie und löste sich selbst auf. Das Rumpelstilzchen ist die dunkle, die weltabgewandte Schattenseite unserer Seele. Auch mit ihr müssen wir uns anfreunden und sie erkennen, dann wirkt sie nicht mehr gegen uns, um uns zu bedrohen und uns in ständiger Angst zu halten. Wenn wir unsere Schattenseiten als Teil unserer Selbst akzeptieren, werden wir nicht frei von ihnen, sondern frei über sie bestimmen können. Es ist eine Forderung, die das Leben an uns, an jeden Einzelnen in seiner ganz individuellen Weise stellt. Spätestens im hohen Alter müssen wir dieser Forderung gerecht werden. Ganz gleich wer oder was wir im Leben waren: Landwirt, Direktor, Hausfrau oder Präsident der Vereinigten Staaten, jeder soll ganz sein bzw. es werden! Das ist wohl die größte und ehrenvollste Aufgabe des Lebens an uns. Also: Sich entwickeln!
Ganz gleich wer oder was wir im Leben waren: Landwirt, Direktor, Hausfrau oder Präsident der Vereinigten Staaten, jeder soll ganz sein, bzw. es werden!
„Das Leben jedes Menschen ist ein Weg zu sich selber hin, der Versuch eines Weges, die Andeutung eines Pfades. Kein Mensch ist jeweils ganz und gar er selbst gewesen; jeder strebt danach, es zu werden, einer dumpfer, einer lichter, jeder wie er kann. Jeder trägt Reste seiner Geburt, Schleim und Eierschalen einer Urwelt bis zum Ende mit sich hin. Mancher wird niemals Mensch, bleibt Frosch, bleibt Eidechse, bleibt Ameise. Mancher ist oben Mensch und unten Fisch. Aber jeder ist ein Wurf der Natur nach dem Menschen hin. Uns allen sind die Herkünfte gemeinsam, die Mütter, wir alle kommen aus dem selben Schlunde; aber jeder strebt, ein Versuch und Wurf aus den Tiefen, seinem eigenen Ziele zu. Wir können einander verstehen, aber deuten kann jeder nur sich selbst.“(HESSE, 1921, S. 11)
Sich selbst beobachten, als einen Fremden.
Wie kommen wir zu unserem „Ich“?
Seinem Hauptwerk gab der österreichische Schriftsteller Robert Musil den Titel: „Der Mann ohne Eigenschaften“