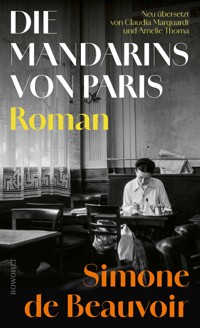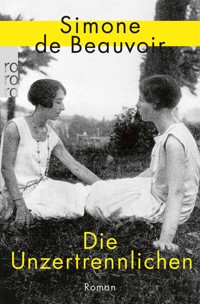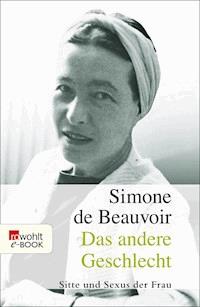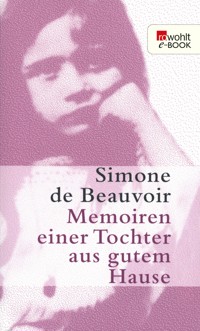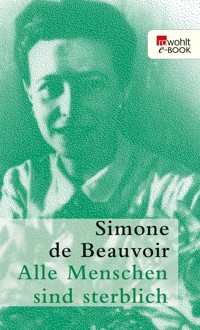
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Fosca, dem ungewöhnlichen Helden des Romans, dem auf geheimnisvolle Weise Unsterblichkeit verliehen ist, erleben wir sechs Jahrhunderte europäischer Geschichte in blutvollen Gestalten und abenteuerlichen Ereignissen. Foscas wechselvolle Schicksale lassen in ihm die tragische Erkenntnis reifen, daß die Sehnsüchte der Menschen ewig unerfüllbar und ihre Hoffnungen immer vergeblich sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Simone de Beauvoir
Alle Menschen sind sterblich
Aus dem Französischen übertragen von Eva Rechel-Mertens
Prolog
Der Vorhang ging auf; Regine lächelte und verneigte sich; im Lichterspiel des großen Kronleuchters flatterten rosa Flecken über die bunten Abendkleider und die dunklen Röcke der Herren hin; in jedem Gesicht waren Augen, und auf dem Grunde aller dieser Augen verneigte sich Regine und lächelte dabei; ein Grollen von Katarakten, ein Rollen wie von Lawinen erfüllte das alte Theater; eine ungestüme Gewalt riß sie von der Erde fort und warf sie zum Himmel empor. Sie verneigte sich nochmals. Der Vorhang fiel, und sie fühlte, daß Floras Hand in der ihrigen lag; heftig ließ sie sie fallen und ging dem Ausgang zu.
«Fünf Vorhänge sind nicht schlecht», sagte der Regisseur.
«Für ein Provinztheater!»
Sie ging die Stufen zum Foyer hinab. Dort warteten sie mit Blumen; im Nu fiel sie auf die Erde zurück. Solange sie im Dunkeln saßen, unsichtbar, namenlos, wußte man nicht, wer sie waren; man konnte glauben, man stünde vor einer Versammlung von Göttern; doch wenn man sie einzeln vor sich sah, fühlte man sich armen, unbedeutenden Wesen gegenüber. Alle sagten das, was sie sagen mußten: «Wirklich genial! Überwältigend!», und ihre Augen leuchteten vor Begeisterung: eine kleine Flamme, die im rechten Augenblick entzündet und sparsam wieder ausgelöscht wurde, wenn man sie nicht mehr brauchte. Auch Flora umringten sie; sie hatten ihr Blumen mitgebracht, und solange sie mit ihr sprachen, zündeten sie die Flamme in ihren Augen an. Als wenn man uns beide gleichzeitig lieben könnte, dachte Regine empört, die Schwarze und die Blonde, jede abgeschlossen in ihrer Eigenart! Flora lächelte. Nichts hinderte sie, zu glauben, sie sei genauso talentvoll und so schön wie Regine.
Roger wartete auf Regine in ihrer Garderobe; er umarmte sie. «So gut wie heute abend hast du noch nie gespielt», sagte er.
«Zu gut für dies Publikum», gab Regine zurück.
«Sie haben tüchtig geklatscht», bemerkte Annie dazu.
«Oh, für Flora so gut wie für mich.»
Sie setzte sich an den Frisiertisch und begann sich zu kämmen, während Annie ihr Kleid aufhakte. Flora, dachte sie, kümmert sich nicht um mich, ich sollte mir ihretwegen auch keine Gedanken machen. Aber sie machte sich Gedanken und hatte sogar im Mund einen bitteren Geschmack davon.
«Stimmt es, daß Sanier hier ist?» fragte sie.
«Ja. Er ist mit dem Acht-Uhr-Zug aus Paris gekommen. Offenbar will er mit Flora das Wochenende verbringen.»
«Er treibt es furchtbar mit ihr», meinte sie.
«Ja. Das kann man sagen.»
Sie erhob sich und ließ ihr Kleid auf den Boden fallen. Sie machte sich nichts aus Sanier, fand ihn sogar eher ein bißchen lächerlich; aber Rogers Worte hatten ihr doch einen Stoß versetzt.
«Ich frage mich, was Mauscot dazu sagt.»
«Er sieht Flora vieles nach», meinte Roger.
«Und Sanier findet sich mit Mauscots Vorhandensein ab?»
«Ich denke mir», meinte Roger, «er weiß nicht genau Bescheid.»
«Das denke ich mir auch.»
«Sie warten im Royal auf uns, sie wollen noch etwas mit uns trinken. Meinst du, wir gehen hin?»
«Aber gewiß doch. Gehen wir.»
Ein kühler Wind strich vom Fluß her zur Kathedrale hin, deren gezackte Türme man sah. Regine fröstelte. «Wenn ‹Wie es euch gefällt› ein Erfolg wird, mache ich nie wieder eine Provinztournee.»
«Es wird ein Erfolg», sagte Roger. – Er drückte Regines Arm an sich. «Du wirst eine große Schauspielerin.»
«Sie ist eine große Schauspielerin», wies Annie ihn zurecht.
«Nett, daß du das meinst.»
«Meinst du es denn nicht?» fragte Roger.
«Was beweist das schon?» sagte sie. Sie zog den Schal fester um den Hals. «Es müßte ein Zeichen kommen. Man müßte zum Beispiel plötzlich eine Aureole um den Kopf haben, so daß man wüßte, man ist wirklich eine zweite Duse oder Rachel…»
«Auch Zeichen werden kommen», meinte Roger vergnügt.
«Keines wird zuverlässig sein. Was für ein Glück für dich, daß du nicht ehrgeizig bist.»
Er lachte: «Warum machst du es mir nicht nach?»
Sie lachte auch, war aber nicht froh dabei: «Weil ich eben nicht kann», sagte sie.
Eine rotleuchtende Grotte tat sich am Ende der finsteren Straße auf. Das war das Royal. Als sie eintraten, sah sie sie gleich mit dem übrigen Ensemble an einem Tisch sitzen. Sanier hatte den Arm um Floras Schultern gelegt, er hielt sich sehr gerade in seinem eleganten Anzug aus bestem englischem Stoff und sah sie mit Blicken an, die Regine kannte, war sie ihnen doch oft genug in Rogers Augen begegnet; Flora lächelte und zeigte dabei ihre schönen Kinderzähne; sie hörte gleichsam in sich selbst die Worte, die er eben gesagt haben mochte und die er sagen würde: Eines Tages wirst du eine große Schauspielerin sein. Du bist nicht wie andere Frauen. Regine nahm an Rogers Seite Platz. Sanier täuscht sich, dachte sie, und Flora täuscht sich auch; sie ist ein kleines Mädchen ohne wahres Genie; keine andere Frau kann sich mit ihr vergleichen. Aber wie das beweisen? Flora fühlt in sich die gleiche Sicherheit wie ich. Und sie macht sich über mich keinerlei Gedanken; während sie wie eine Wunde in meinem Herzen schwärt. Ich werde es beweisen, dachte sie leidenschaftlich.
Sie nahm einen kleinen Spiegel aus der Handtasche und zog den Bogen ihrer Lippen nach; sie hatte das Bedürfnis, sich im Spiegel zu sehen; sie liebte ihr Gesicht; sie liebte den lebendigen Ton ihrer blonden Haare, die stolze Strenge der Nase und der hohen Stirn; die warme Glut ihres Mundes, die Kühnheit der blauen Augen; sie war schön, von einer so spröden und einsamen Schönheit, daß sie zunächst überraschte. Ach! dachte sie, könnte ich doch aus zwei Wesen bestehen, einem, das spricht, und einem, das zuhören kann, einem, das lebt, und einem anderen, das nur zuschauen darf: wie würde ich mich lieben! Keinen Menschen auf der Welt würde ich dann beneiden. Sie schloß die Handtasche. In dieser gleichen Minute lächelten Millionen Frauen ihrem Bild wohlgefällig zu.
«Tanzen wir?» fragte Roger.
«Nein, ich habe keine Lust.»
Die beiden anderen waren aufgestanden, sie tanzten; sie tanzten schlecht, aber wußten es nicht und waren glücklich dabei. In ihren Augen stand Liebe: die Gesamtheit der Liebe; zwischen ihnen spielte sich das große Drama der Menschen ab, als habe niemals zuvor jemand auf Erden geliebt und als ob Regine nie Liebe empfunden hätte. Zum erstenmal begehrte ein Mann in Angst und Zärtlichkeit eine Frau, und zum erstenmal spürte eine Frau, wie sie in den Armen des Mannes zu einem Idol aus Fleisch und Blut erstand. Ein neuer Frühling brach blütenschauernd auf, einmalig wie jeder Frühling, und Regine war bereits tot. Sie grub ihre spitzen Nägel in die Fläche ihrer Hand. Es gab da nichts abzustreiten; kein Erfolg, kein Triumph konnten ungeschehen machen, daß in diesem Augenblick Flora in Saniers Herzen in höchster Glorie erstrahlte.
«Ich werde es nicht aushalten, ich halte es nicht aus.»
«Du willst doch nicht nach Hause?» fragte Roger.
«Nein.»
Sie wollte dableiben; sie wollte ihnen zusehen. Sie sah sie an und dachte: Flora lügt Sanier an; Sanier täuscht sich über Flora, ihre Liebe beruht auf einem Mißverständnis. Aber da Sanier nichts von Floras Falschheit wußte und Flora sich daran zu denken enthielt, unterschied sich ihre Liebe, sobald sie sich selbst überlassen waren, in nichts von wahrer großer Leidenschaft. Warum bin ich so beschaffen? fragte Regine sich. Wenn Leute um mich her leben, lieben und glücklich sind, habe ich das Gefühl, daß sie an mir einen Mord begehen.
«Du siehst heute abend so traurig aus», sagte Sanier.
Regine fuhr zusammen. Sie hatten gelacht, getanzt und gehörig getrunken. Die Tanzfläche war jetzt fast leer; sie hatte gar nicht gemerkt, wie die Zeit verrann.
«Wenn ich gespielt habe», sagte sie, «bin ich immer traurig.» Sie nahm sich zusammen und lächelte. «Du hast Glück, daß du Schriftsteller bist: deine Bücher bleiben. Uns hört man nicht lange zu.»
«Was macht das?» fragte Sanier. «Hauptsache, daß man Erfolg hat mit dem, was man gerade macht.»
«Wofür?» sagte sie. «Für wen?»
Er war ein klein bißchen betrunken; sein Gesicht blieb ganz unverändert, wie aus Holz geschnitten, aber die Adern an seiner Stirn traten stärker hervor. Mit Wärme fuhr er fort: «Ich bin sicher, daß ihr alle beide ganz ungewöhnlich Karriere machen werdet.»
«Soviel Leute machen Karriere!» gab Regine zurück.
Er lachte: «Du bist anspruchsvoll.»
«Ja. Das ist mein Laster.»
«Oder die oberste Tugend.»
Er blickte sie auf eine freundschaftliche Weise an, und das war schlimmer, als hätte er sie verächtlich von sich gewiesen. Er sah sie, schätzte sie ab und liebte Flora indessen. Allerdings war er Rogers Freund, und niemals hatte Regine ihn zu verführen versucht. Aber ihr genügte, daß er sie kannte und doch in Flora verliebt sein konnte.
«Ich werde müde», sagte Flora.
Die Musiker waren schon dabei, ihre Instrumente einzupacken; sie gingen. Flora entfernte sich an Saniers Arm. Regine hakte Roger ein; sie schritten durch eine enge Straße, deren Häuserfronten frisch getüncht und mit Wahrzeichen aus buntem Glas geschmückt waren: «Zur Grünen Mühle», «Zum Blauen Affen», «Zum Schwarzen Kater»; alte Frauen saßen auf der Türschwelle und riefen sie an, als sie vorübergingen. Dann kamen sie in bürgerliche Straßen mit dichten Fensterläden, in die herzförmige Öffnungen geschnitten waren. Es wurde schon hell, doch schlief noch die ganze Stadt. Auch das Hotel war noch nicht wach.
Roger streckte sich gähnend: «Ich bin furchtbar müde.»
Regine trat an das Fenster, das auf den kleinen Hotelgarten ging, und zog den Rolladen hoch.
«So ein Mann!» sagte sie. «Ist der jetzt schon aufgestanden? Warum steht der wohl so früh auf?»
Auf einem Liegestuhl ruhte der Mann, regungslos wie ein Fakir. Jeden Morgen war er da. Er las nicht, schlief, sprach mit niemandem; mit weit geöffneten Augen starrte er zum Himmel empor; ohne sich zu bewegen, lag er da auf dem Rasen, vom Morgengrauen bis in die Nacht.
«Kommst du nicht schlafen?» fragte Roger.
Sie zog auch noch den anderen Vorhang auf und machte das Fenster zu. Roger sah sie lächelnd an. Sie würde unter die Decke gleiten, sie würde ihren Kopf auf das gewölbte Kopfkissen legen, und er würde sie in seine Arme nehmen; dann würde niemand mehr auf der Welt sein als sie und er. Und in einem anderen Bett würde Flora mit Sanier… Sie ging auf die Tür zu.
«Nein, ich gehe frische Luft schöpfen.»
Sie schritt über den Flur und hinunter durch das schweigende Treppenhaus, in dem kupferne Wärmpfannen schimmerten; es graute ihr davor, einfach einzuschlafen; während man schlief, wachten andere, und man vermochte nichts über sie. Sie drückte die Tür zum Garten auf: eine grüne Rasenfläche, die von kiesbestreuten Wegen und vier Mauern umgeben war, an denen eine magere Virginiarebe wuchs. Sie streckte sich auf einem Liegestuhl aus. Der Mann hatte nicht mit der Wimper gezuckt. Er schien niemals etwas zu sehen oder zu hören. Ich beneide ihn. Offenbar weiß er nicht, wie weit die Erde ist und wie kurz das Leben; er weiß nichts davon, daß andere existieren. Er begnügt sich mit diesem viereckigen Stück Himmel über seinem Kopf. Ich selber möchte, daß alles mir gehörte, als liebte ich nur gerade dies eine auf der Welt; aber ich will alles; und meine Hände sind leer. Ich beneide ihn. Sicherlich kennt er gar nicht diesen nagenden Überdruß.
Sie warf den Kopf zurück und blickte zum Himmel auf: ich bin da, und über mir ist da dieser Himmel, das ist alles und ist genug. Aber sie täuschte sich selbst. Sie konnte nicht hindern, daß sie an Flora dachte, die jetzt in Saniers Armen lag und an sie nicht dachte. Sie blickte auf den Rasen. Es war ein sehr altes Leiden. Sie lag auf einem ganz gleichen Rasen, die Wange gegen die Erde gedrückt, Insekten liefen im Schatten des Grases umher, und der Rasen war ein unendlicher, einförmiger Wald, in dem sich Tausende von kleinen grünen Lanzen streckten, alle ganz gleich, ganz ähnlich, und die einen verdeckten den anderen die Welt. Angsterfüllt hatte sie gedacht: Ich will kein Grashalm sein. Sie wandte den Kopf. Auch dieser Mann dachte nicht an sie; er unterschied sie kaum von den Bäumen und von den Stühlen, die verstreut auf dem Rasen standen; sie war nur ein Stück der Dekoration. Er hatte etwas Aufreizendes; sie hatte Lust, seine Ruhe zu stören und für ihn zu existieren. Er brauchte nur zu sprechen; dann würde sofort alles einfach sein: wenn sie antworteten, war das Geheimnis verschwunden, sie wurden durchsichtig, wurden hohl, und man warf sie gleichgültig fort, es war so leicht, daß sie an diesem Spiel kaum noch Vergnügen hatte, sie war im voraus gewiß, daß sie gewinnen würde. Aber dieser ruhige Mann da drüben regte sie auf. Sie sah ihn prüfend an. Er war eher schön, mit großer, gebogener Nase, er schien sehr groß und von athletischem Bau; er schien jung zu sein; wenigstens war seine Haut, die Färbung seiner Haut die eines jungen Mannes. Er schien nicht zu merken, daß jemand in seiner Nähe war; sein Gesicht war so unbewegt wie das eines Toten, seine Augen blieben leer. Wie sie ihn so ansah, beschlich sie etwas wie Furcht. Sie stand wortlos auf.
Er mußte wohl etwas hören, denn er sah sie an. Jedenfalls ruhte sein Blick auf ihr, und sie lächelte flüchtig. Die Augen des Mannes hingen an ihr, daß es fast unverschämt war; aber er sah sie nicht. Sie wußte nicht, was er sah, und einen Augenblick lang dachte sie: Bin ich denn gar nicht da? Oder bin ich es nicht? Einmal hatte sie solche Augen gesehen, als ihr Vater ihre Hand hielt, auf seinem Bett ausgestreckt, ein Röcheln tief in der Kehle; er hielt ihre Hand, und sie hatte schon keine Hand mehr. Sie blieb wie angewurzelt stehen, stimmlos, gesichtslos, wesenlos: eine bloße Attrappe. Dann kam sie wieder zu sich. Sie machte einen Schritt. Der Mann schloß die Augen. Wenn sie sich nicht bewegt hätte, so schien es ihr, hätten sie in Ewigkeit einander angeschaut.
«So ein komischer Mensch!» sagte Annie. «Er ist nicht einmal zum Mittagessen in das Haus gegangen.»
«Ja, komisch», sagte Regine.
Sie reichte Sanier eine Tasse Kaffee. Durch die Verandafenster blickte man in den Garten, man sah den Gewitterhimmel, den Mann auf dem Liegestuhl mit seinen schwarzen Haaren, den Flanellhosen und dem weißen Hemd. Immer blickte er zu der gleichen Ecke des Himmels auf mit Augen, die nichts sahen. Regine hatte diesen Blick nicht vergessen; sie hätte gern gewußt, wie sich die Welt präsentierte, wenn man sie mit solchen Augen anstarrte.
«Ein Neurastheniker», sagte Roger.
«Damit erklärt man nichts», gab Regine zurück.
«In meinen Augen ist er ein Mann, der nicht glücklich war», meinte Annie. «Was halten Sie davon, holde Königin?»
«Vielleicht», sagte Regine.
Vielleicht lag auf diesen Augen ein für immer erstarrtes Bild wie ein Nebelfleck. Wie mochte sie ausgesehen haben? Wodurch verdiente sie solches Glück? Regine strich sich mit der Hand über die Stirn. Die Hitze lastete. Sie fühlte, wie die Luft auf ihre Schläfen drückte.
«Noch eine Tasse Kaffee?»
«Nein», sagte Sanier. «Ich habe Flora versprochen, sie um drei Uhr zu treffen.»
Er stand auf, und Regine dachte: Jetzt oder nie.
«Versuchen Sie doch, Flora zu überzeugen, daß diese Rolle nichts für sie ist», sagte sie. «Sie schadet sich nur und hat nichts davon.»
«Ich werde es versuchen. Aber sie hat ihren Kopf für sich.»
Regine hüstelte. Sie fühlte einen Druck im Hals. Aber jetzt oder nie. Sie durfte Roger nicht ansehen, nicht an die Zukunft denken, an gar nichts denken, nur springen. Sie stellte ihre Tasse auf die Untertasse.
«Man müßte sie Mauscots Einfluß entziehen. Er berät sie schlecht. Wenn sie noch lange bei ihm bleibt, verdirbt sie sich die Karriere.»
«Mauscot?» fragte Sanier zurück.
Seine Oberlippe legte die Zähne bloß; das war seine Art zu lächeln; doch er war rot geworden, und auf seiner Stirn waren die Adern geschwollen.
«Was? Wissen Sie das nicht?» sagte Regine.
«Nein», sagte Sanier.
«Aber das weiß doch jeder», rief Regine aus. «Das geht doch schon zwei Jahre lang.» Und sie fügte hinzu: «Er hat Flora sehr genützt.»
Sanier zog seine Jacke glatt. «Davon wußte ich nichts», sagte er geistesabwesend. Er reichte Regine die Hand hin: «Auf bald.»
Seine Hand war warm. Er ging ruhig und etwas steif auf die Tür zu, der Zorn machte ihn befangen. Alle schwiegen. Es war geschehen. Niemand konnte es mehr ungeschehen machen. Regine war sich genau bewußt, daß sie nie im Leben das Klirren vergessen würde, mit dem sie die Tasse niedergesetzt hatte, niemals den schwarzen Kaffeerand auf der gelben Untertasse.
«Regine! Wie konntest du nur!» rief Roger.
Seine Stimme bebte; seine zärtliche Art, die vertraute Heiterkeit seines Blicks waren wie ausgelöscht; er war ein Fremder, ein Richter. Regine stand allein auf der Welt. Sie errötete und haßte sich selbst deswegen.
«Du weißt ganz genau, daß ich keine Heilige bin», brachte sie langsam hervor.
«Aber was du getan hast, ist einfach niederträchtig.»
«So nennt man so etwas, ja», gab sie zu.
«Was hast du gegen Flora? Was habt ihr miteinander gehabt?»
«Nichts.»
Roger ließ seinen Blick trauernd über sie gleiten: «Ich verstehe dich nicht», sagte er.
«Es gibt nichts zu verstehen.»
«Versuche doch wenigstens, es mir zu erklären», sagte er. «Ich muß ja sonst denken, du hast aus purer Bosheit gehandelt.»
«Denke, was du willst», stieß sie heftig hervor. Sie packte die bestürzte Annie am Handgelenk: «Und dir verbiete ich, über mich urteilen zu wollen», zischte sie.
Sie ging zur Tür hinaus. Draußen sah man förmlich, wie der bleierne Himmel auf der Stadt lastete, kein Lüftchen regte sich. Regine fühlte, wie Tränen ihr in die Augen stiegen. Als wenn es so etwas wie pure Bosheit gäbe! Als wenn man bös zum Vergnügen war! Sie würden nie verstehen, auch Roger verstand sie nicht. Sie waren gleichgültig, oberflächlich; sie spürten nicht in der Brust dieses tödliche Brennen. Ich bin nicht von ihrer Art. Sie ging rascher zu, durch eine enge Gasse, in der ein Wassergraben floß; zwei kleine Buben jagten einander und verfolgten sich lachend in einen Abtritt hinein, ein kleines Mädchen mit krausem Haar spielte Ball gegen eine Hauswand. Niemand achtete auf sie: eine Vorübergehende. Wie können sie sich nur abfinden? fragte sie sich. Ich finde mich niemals ab. Eine Blutwelle stieg ihr ins Gesicht. Jetzt wußte es Flora schon, und heute abend im Theater würden es alle erfahren. Auf dem Grund ihrer Augen würde sie ihr Bild erkennen: neidisch, treulos, von kleinlichem Haß erfüllt. Jetzt haben sie ein Übergewicht über mich, und mit welcher Wonne werden sie mich verachten. Selbst an Roger hatte sie keinen Halt mehr. Er starrte sie mit trostlosen Blicken an: treulos, neidisch und böse.
Sie setzte sich auf eine steinerne Fassung des kleinen Wasserlaufs; in einem der elenden Häuser kratzte eine Geige; sie hätte einschlafen und viel, viel später, weit von hier, wieder aufwachen mögen; lange saß sie unbeweglich da; plötzlich spürte sie Tropfen auf der Stirn und sah, wie die Oberfläche des Wassers sich zu kräuseln begann; es regnete. Sie nahm ihre Wanderung wieder auf. Sie wollte mit ihren geröteten Augen nicht in ein Café treten, sie wollte nie wieder zurück ins Hotel.
Die Straße mündete auf einen Platz, auf dem eine kalte gotische Kirche stand; in ihrer Kindheit hatte sie Kirchen geliebt, und an ihrer Kindheit hing sie sehr; sie trat in die Kirche ein. Sie kniete vor den Hauptaltar und legte den Kopf in die Hände. «Mein Gott, der Du auf den Grund meines Herzens blickst…» Oftmals hatte sie früher so gebetet in den Tagen der Herzensnot; und Gott las in ihr, er gab ihr immer recht; in jenen Zeiten träumte sie davon, eine Heilige zu werden, sie schlief nachts auf dem platten Boden. Aber es gab im Himmel schon zu viele Erwählte, zu viele Heilige. Gott liebte alle Menschen, sie mochte sich nicht mit diesem allumfassenden Wohlwollen begnügen; so hatte sie aufgehört, an einen Gott zu glauben. Ich brauche ihn nicht, dachte sie und hob den Kopf empor. Getadelt, verfemt, verpönt – was macht das alles aus, wenn ich mir selber treu geblieben bin? Ich bleibe mir selber treu, ich lasse mich selbst nicht im Stich. Ich werde sie zwingen, mich so leidenschaftlich zu bewundern, daß jede meiner Gesten ihnen heilig ist. Eines Tages werde ich um meine Stirn einen Glorienschein spüren.
Sie schritt aus der Kirche und winkte ein Auto herbei. Es regnete immer noch, und in ihrem Herzen war eine große, friedliche Kühle. Sie hatte die Scham überwunden. Ich bin allein, ich bin stark, dachte sie, und ich habe getan, was ich wollte. Ich habe bewiesen, daß ihre Liebe nur eine Lüge war, ich habe Flora meine Existenz zum Bewußtsein gebracht. Mögen sie mich verachten, mich niederträchtig finden: gewonnen habe ich doch.
Als sie durch die Hotelhalle schritt, war es fast dunkel geworden. Sie trat ihre nassen Schuhe an der Strohmatte ab und warf einen Blick durch die Scheiben; der Regen klatschte schräg auf die Rasenfläche und die Kieswege nieder; der Mann lag immer noch auf seinem Deckstuhl, er hatte sich nicht gerührt. Regine wendete sich an das Zimmermädchen, das gerade einen Stoß Teller in den Speisesaal trug.
«Haben Sie gesehen, Blanche?»
«Was?» fragte das Mädchen.
«Einer Ihrer Gäste ist da draußen im Regen eingeschlafen. Er wird sich eine Lungenentzündung holen. Man sollte ihn hereinschaffen.»
«Ach der», sagte Blanche. «Versuchen Sie doch mal, mit dem ein Wort zu reden. Es ist, als wäre er taub. Ich habe ihn am Arm geschüttelt, es war mir nur um den Stuhl, der geht ja kaputt bei der Nässe… Er hat mich nicht einmal angeguckt.» Sie schüttelte ihren rotblonden Schopf und setzte noch hinzu: «Das ist ein Phänomen…»
Sie hatte Lust, weiterzuschwatzen, aber Regine hatte keine Lust, ihr länger zuzuhören. Sie stieß die Tür zum Garten auf und näherte sich dem Mann.
«Sie sollten hereinkommen», sagte sie sanft. «Merken Sie nicht, daß es regnet?»
Er wendete den Kopf, sah sie an, und diesmal wußte sie, daß er sie wirklich sah.
«Sie müssen ins Haus kommen», wiederholte sie.
Er blickte zu dem dunklen Himmel auf und dann zu Regine hin; seine Lider flatterten, als wenn dies wenige Licht, das noch auf Erden verweilte, ihn schon blendete; er schien darunter zu leiden.
Sie sagte noch einmal: «Kommen Sie herein. Sie werden ja sonst krank!»
Er bewegte sich nicht. Sie sprach nicht mehr, doch er horchte noch, so als ob ihre Worte aus der Ferne kämen und als ob es ihm Mühe machte, sie richtig zu verstehen. Seine Lippen bewegten sich: «Das hat keine Gefahr», sagte er.
Regine drehte sich auf die rechte Seite, sie war nicht mehr müde, konnte sich aber nicht zum Aufstehen entschließen; es war erst elf Uhr, und sie wußte nicht, wie sie den langen Tag zu Ende bringen sollte, der sie vom Abend trennte. Durch das Fenster sah sie ein Stück Himmel, das frisch geputzt und wie glänzend wirkte: auf Regen folgt Sonnenschein. Flora hatte ihr keine Vorwürfe gemacht, sie war eine Frau, die Scherereien nicht liebte; und Roger lächelte wieder. Man hätte glauben können, es sei nichts vorgefallen. Tatsächlich fiel ja auch niemals etwas vor.
Sie schrak zusammen. «Wer klopft da?»
«Nur das Zimmermädchen, sie will das Tablett holen», sagte Annie.
Das Mädchen trat ein; sie nahm das Tablett vom Nebentisch und bemerkte dabei mit ihrer schartigen Stimme: «Es ist schön heute morgen.»
«Es scheint so», gab Regine zurück.
«Wissen Sie, daß dieser Verrückte von 52 bis zum späten Abend im Garten geblieben ist?» sagte das Zimmermädchen. «Und heute morgen ist er fort mit seinen nassen Kleidern, er hat sich nicht umgezogen.»
Annie trat ans Fenster und blickte hinaus: «Seit wann ist er im Hotel?»
«Es wird jetzt vier Wochen sein. Sobald die Sonne aufgeht, begibt er sich in den Garten; und abends kommt er erst wieder ins Haus. Er deckt sein Bett nicht auf, um sich schlafen zu legen.»
«Und wann ißt er denn?» fragte Annie. «Bekommt er seine Mahlzeiten auf das Zimmer?»
«Niemals», erklärte das Mädchen. «Während dieser vier Wochen hat er keinen Fuß aus dem Hotel gesetzt, und niemand hat ihn besucht. Es sieht so aus, als wenn er nicht ißt.»
«Vielleicht ein Fakir», meinte Annie.
«Er hat sicher was zu essen in seinem Zimmer», sagte Regine.
«Ich habe niemals etwas gesehen», sagte das Zimmermädchen.
«Er versteckt es irgendwo…»
«Vielleicht.» Das Mädchen lächelte und ging zur Tür.
Annie schaute einen Augenblick aus dem Fenster, dann drehte sie sich um: «Ich möchte doch gern wissen, ob er Vorräte in seinem Zimmer hat.»
«Wahrscheinlich.»
«Ich möchte es wirklich wissen», sagte Annie.
Sie schritt resolut aus dem Zimmer, und Regine streckte sich gähnend aus; mit Widerwillen betrachtete sie die bäuerlichen Möbel, den hellen Kretonne an den Wänden. Sie haßte diese anonymen Hotelzimmer, durch die so viele Leute gegangen waren, ohne Spuren zurückzulassen, und in denen sie niemals eine Spur lassen würde. Alles wird genauso sein, und ich bin nicht mehr da. So ist der Tod, dachte sie. Wenn man wenigstens in der Luft so etwas wie eine Einbuchtung zurückließe, in der sich der Wind mit Stöhnen fängt; aber nein; keine Runzel, kein Fältchen. Eine andere Frau wird in diesem Bett liegen… Sie schlug die Decken zurück. Die Tage waren ihr so karg zugemessen, daß sie nicht eine Minute davon verlieren sollte, und da saß sie nun fest in dieser tristen Provinz, wo sie nur die Zeit totschlagen konnte, die Zeit, die sowieso so rasch stirbt. Diese Tage sollten mir nicht angerechnet werden, dachte sie. Man müßte Rücksicht darauf nehmen, daß ich sie ja gar nicht gelebt habe. Das würde für mich vierundzwanzig mal acht bedeuten, eine Reserve von 192Stunden, die ich in jenen Perioden zusetzen könnte, wo die Tage zu kurz sind…
«Regine!» rief Annie. Mit geheimnisvoller Miene stand sie in der Zimmertür.
«Was ist denn?»
«Ich habe gesagt, ich hätte meinen Schlüssel im Zimmer gelassen und habe im Büro einen Passepartout verlangt», sagte Annie. «Kommen Sie mit zum Fakir. Wir wollen doch mal sehen, ob er Eßvorräte hat.»
«Wie kannst du so neugierig sein», sagte Regine.
«Sind Sie es nicht mehr?» gab Annie zurück.
Regine trat ans Fenster und lehnte sich hinaus, um nach dem Mann zu sehen, der unbeweglich dalag. Es war ihr eigentlich gleich, ob er aß oder nicht. Was sie hätte erforschen mögen, war das Geheimnis seines Blicks.
«Kommen Sie», drängte Annie. «Wissen Sie nicht mehr, wie komisch es war, als wir in das kleine Haus in Rosay eingebrochen sind?»
«Ich komme», sagte Regine.
Sie folgte Annie durch den leeren Korridor.
Annie steckte den Schlüssel ins Schloß, und die Tür ging auf. Sie traten in ein Zimmer mit ländlichen Möbeln, die mit hellem Kretonne bezogen waren. Die Rolläden waren heruntergelassen, die Sonnenstores geschlossen.
«Du bist sicher, daß dies sein Zimmer ist?» fragte Regine. «Es sieht so unbewohnt aus.»
«Ich bin ganz sicher», bestätigte Annie.
Regine drehte sich langsam um sich selbst. Man sah keine Spur einer menschlichen Gegenwart: kein Buch, kein Papier, kein Zigarrenstummel. Annie öffnete einen normannischen Schrank: er war leer.
«Wo versteckt er seine Vorräte?» fragte Annie.
«Vielleicht im Badezimmer», meinte Regine.
Es war schon sein Zimmer. Über dem Waschbecken war ein Rasiermesser, ein Pinsel, eine Zahnbürste, Seife; das Rasiermesser sah wie alle anderen aus, die Seife war richtige Seife, es waren alles normale, ganz unverdächtige Dinge. Regine machte die Tür eines Wandschranks auf. Auf einem Brett lag reine Wäsche, und an einem Haken hing eine Flanelljacke. Sie griff in eine der Taschen hinein.
«Jetzt wird es interessant», sagte sie.
Sie zog die Hand heraus: es lagen lauter Goldstücke darin.
«Lieber Gott!» rief Annie aus.
In der anderen Tasche steckte ein Stück Papier. Es war eine Bescheinigung, ausgestellt von einer Heilanstalt an der unteren Seine. Der Mann litt an Gedächtnisschwund. Er behauptete, er heiße Raymond Fosca. Man kannte weder seinen Geburtsort noch sein Alter, und nach einem Aufenthalt in der Heilanstalt, über dessen Dauer nichts gesagt war, hatte man ihn vor vier Wochen entlassen.
«Ach», meinte Annie in enttäuschtem Ton. «Dann hatte also Monsieur Roger doch recht. Er ist einfach verrückt.»
«Natürlich ist er verrückt», sagte Regine. Sie tat das Papier an seinen Platz. «Ich wüßte gern, warum man ihn dort eingeliefert hat.»
«Auf alle Fälle hat er nirgends Vorräte versteckt», sagte Annie. «Er ißt nicht.» Sie sah sich ratlos um: «Er ist vielleicht wirklich ein Fakir», sagte sie. «Auch Fakire können verrückt sein.»
Regine ließ sich in einem Rohrstuhl neben dem unbeweglichen Mann nieder, und dann rief sie ihn an: «Raymond Fosca!»
Er richtete sich auf. Er blickte Regine an.
«Woher wissen Sie meinen Namen?» fragte er.
«Ach! Ich zaubere ein bißchen», gab Regine zurück. «Das wird Sie ja nicht wundern, Sie sind ja auch ein Zauberer: Sie leben, ohne zu essen.»
«Das wissen Sie auch?» fragte er.
«Ich weiß viele Dinge.»
Er ließ sich wieder zurücksinken. «Lassen Sie mich», sagte er, «und gehen Sie fort. Niemand hat das Recht, mich hierher zu verfolgen.»
«Niemand verfolgt Sie», sagte sie. «Ich wohne seit ein paar Tagen in diesem Hotel und beobachte Sie. Ich wünschte, Sie teilten mir Ihr Geheimnis mit.»
«Was für ein Geheimnis? Ich habe kein Geheimnis.»
«Ich möchte, daß Sie mir sagen, wie Sie es machen, daß Sie sich nie langweilen.»
Er antwortete nicht. Er hatte die Augen geschlossen.
Wieder rief sie ihn leise an: «Raymond Fosca! Hören Sie mich?»
«Ja», sagte er.
«Ich nämlich langweile mich», sagte sie.
«Wie alt sind Sie?» fragte Fosca.
«Achtundzwanzig Jahre.»
«Da haben Sie höchstens noch fünfzig Jahre zu leben», sagte er. «Das geht doch schnell vorbei.»
Sie legte ihm die Hand auf die Schulter und schüttelte ihn heftig: «Was», rief sie aus, «Sie sind jung, Sie sind stark, und dabei leben Sie, als wenn Sie ein Toter wären!»
«Ich habe nichts Besseres zu tun», sagte er.
«Dann sehen Sie sich danach um», sagte sie. «Wollen wir es gemeinsam tun?»
«Nein.»
«Sie sagen nein, ohne mich überhaupt eines Blickes gewürdigt zu haben. Sehen Sie mich doch mal an.»
«Es lohnt sich nicht», antwortete er. «Ich habe Sie schon hundertmal gesehen.»
«Doch von weitem nur…»
«Von weitem und in der Nähe!»
«Wann denn?»
«Zu allen Zeiten», sagte er, «überall.»
«Aber das war doch ich nicht», sagte sie. Sie beugte sich zu ihm: «Sie müssen mich unbedingt ansehen. Sagen Sie jetzt, haben Sie mich schon jemals gesehen?»
«Vielleicht nicht», sagte er.
«Das wußte ich doch.»
«Um der Liebe Gottes willen, gehen Sie fort», sagte er. «Gehen Sie fort, sonst fängt alles wieder von vorne an.»
«Und wenn alles wieder von vorn anfinge?» sagte sie.
«Du willst diesen Narren wirklich nach Paris mitnehmen?» fragte Roger.
«Ja, ich will ihn heilen», sagte Regine.
Sorgfältig bettete sie ihr Kleid aus schwarzem Samt in den Koffer.
«Warum?»
«Es amüsiert mich», sagte sie. «Du glaubst nicht, was für Fortschritte er schon in diesen vier Tagen gemacht hat. Wenn ich jetzt zu ihm spreche, so weiß ich, daß er mich hört, selbst wenn er keine Antwort gibt. Und oft antwortet er auch.»
«Und wenn du ihn dann geheilt hast?»
«Dann interessiert er mich nicht mehr», gab sie strahlend zurück.
Roger legte den Bleistift hin und sah Regine an. «Du machst mir angst», sagte er. «Du bist ja ein richtiger Vamp.»
Sie neigte sich näher zu ihm und legte ihm den Arm um den Hals: «Ein Vamp, der dir nie sehr weh getan hat.»
«Oh, das kann noch kommen», äußerte er mißtrauisch.
«Du weißt ganz genau», sagte sie und lehnte ihr Gesicht an seine Wange, «daß du von mir nichts zu fürchten hast.»
Sie liebte seine überlegte Zärtlichkeit, seine kluge Ergebenheit; er gehörte ihr mit Leib und Seele an, und sie liebte ihn so sehr, wie sie überhaupt jemanden zu lieben vermochte, der nicht sie selber war.
«Geht die Arbeit gut voran?» fragte sie.
«Ich glaube, ich habe eine gute Idee für die Walddekoration.»
«Dann lass’ ich dich lieber allein. Ich gehe nach meinem Patienten schauen.»
Sie ging den Flur entlang und klopfte an der Tür von Nummer 52.
«Herein.»
Sie machte die Tür auf und ging bis in die Tiefe des Zimmers.
«Kann ich Licht machen?» fragte sie.
«Ja.»
Sie knipste. Auf dem Tisch am Kopfende des Bettes bemerkte sie einen Aschenbecher voller Stummel und ein Paket Zigaretten.
«Sieh da, Sie rauchen?» fragte sie.
Er hielt ihr das Päckchen hin: «Es muß Ihnen doch eine Genugtuung sein.»
«Mir? Warum?»
«Die Zeit bewegt sich wieder für mich.»
Sie setzte sich auf einen Stuhl und zündete eine Zigarette an. «Sie wissen, daß wir morgen reisen», sagte sie.
Er war am Fenster stehengeblieben und blickte zum Sternenhimmel empor. «Immer dieselben Sterne», sagte er.
«Wir reisen morgen früh», wiederholte sie. «Sind Sie auch bereit?»
Er kam und setzte sich Regine gegenüber. «Warum geben Sie sich mit mir ab?»
«Ich bin entschlossen, Sie zu heilen.»
«Ich bin nicht krank.»
«Sie weigern sich, zu leben.»
Er sah sie mit kühlem Interesse an: «Sagen Sie, lieben Sie mich?»
Sie begann zu lachen: «Das ist meine Sache».
«Das dürfen Sie nämlich nicht», sagte er.
«Ich brauche keinen Rat.»
«Es ist aber ein ganz besonderer Fall», sagte er.
Von oben herab erwiderte sie: «Ich weiß.»
«Und was wissen Sie denn?» fragte er gedehnt.
Sie hielt seinen Blicken stand: «Ich weiß, daß Sie aus einer Heilanstalt kommen und an Amnesie leiden.»
Er lächelte. «Ach!»
«Wieso, ach?»
«Wenn ich das Glück hätte, mich nicht erinnern zu können…»
«Das Glück!» rief sie aus. «Man darf niemals seine Vergangenheit verleugnen.»
«Wenn ich kein Erinnerungsvermögen hätte, wäre ich beinahe ein Mensch wie andere auch. Ich könnte Sie vielleicht lieben.»
«Ich erlasse es Ihnen», sagte sie. «Sie können ganz beruhigt sein, ich liebe Sie nämlich nicht.»
«Sie sind schön», sagte er. «Sie sehen, ich mache schnelle Fortschritte. Jetzt weiß ich schon, daß Sie schön sind.»
Sie beugte sich zu ihm vor und legte ihre Hand auf sein Handgelenk: «Kommen Sie mit mir nach Paris.»
Er zögerte. «Warum nicht?» erwiderte er ohne Freudigkeit. «Das Leben ist nun doch einmal wieder in Bewegung geraten.»
«Und Sie bedauern es?»
«Oh, ich bin nicht böse auf Sie. Auch ohne Sie wäre es eines Tages passiert. Einmal ist es mir gelungen, sechzig Jahre lang den Atem anzuhalten. Aber als Sie mich dann an der Schulter faßten…»
«Sechzig Jahre!»
Er lächelte. «Sechzig Sekunden, wenn Sie wollen», sagte er. «Was liegt schon daran? Es gibt Augenblicke, in denen die Zeit stillsteht.» Er blickte lange auf seine Hände: «Augenblicke, in denen man jenseits des Lebens steht und alles übersieht. Und dann kommt die Zeit wieder in Gang, das Herz schlägt, man streckt die Hand aus, man setzt den Fuß wieder einen Schritt vor; man weiß dann noch, doch man sieht nicht mehr.»
«Ja», sagte sie. «Man stellt fest, daß man in seinem Zimmer sitzt und sich die Haare kämmt.»
«Man muß sich nun einmal kämmen. Alle Tage sogar.»
Er beugte den Kopf, sein Gesicht verfiel. Eine lange Weile sah sie ihn schweigend an.
«Sagen Sie, sind Sie lange in der Anstalt gewesen?»
«Dreißig Jahre», sagte er.
«Dreißig Jahre? Und wie alt sind Sie jetzt?»
Er antwortete ihr nicht.
«Und was macht Ihr Fakir?» fragte Laforêt.
Lächelnd goß Regine die Portweingläser voll: «Er ißt zweimal am Tag in der Stadt, er trägt Anzüge von der Stange und ist so langweilig wie ein Büroangestellter. Ich habe ihn zu gut geheilt.»
Roger rückte näher an Dulac heran: «In Rouen haben wir einen armen Geistesgestörten getroffen, der sich für einen Fakir hält. Regine hat den Versuch unternommen, ihn zur Vernunft zu bringen.»
«Und Sie haben es fertiggebracht?» fragte Dulac.
«Sie bringt alles fertig, was sie sich vornimmt», sagte Roger. «Sie ist eine enorme Frau.»
Regine lächelte: «Entschuldigen Sie mich einen Augenblick», sagte sie. «Ich muß sehen, wie weit das Essen ist.»
Sie ging durch das Studio hindurch; auf ihrem Nacken fühlte sie Dulacs Blick; er schätzte als Kenner den Schwung ihrer Beine ab, die Rundung ihrer Taille, die Geschmeidigkeit ihrer Gestalt. Wie ein Pferdehändler.
Sie öffnete die Küchentür: «Geht alles gut?»
«Ja», sagte Annie. «Aber was ist mit dem Auflauf?»
«Stelle ihn in den Ofen, sobald Madame Laforêt erscheint. Sie kommt sicher sehr bald.»
Sie tauchte den Finger in die Sauce des canard à l’orange: nie war sie besser geraten.
«Bin ich heute abend auch schön?»
Kritisch sah Annie sie an: «Sie sehen besser aus, wenn Sie die Haare in Zöpfe geflochten haben.»
«Ich weiß», sagte Regine. «Aber Roger hat mir geraten, alle meine Eigenheiten etwas zurückzustellen. Diese Leute wollen banale Schönheiten sehen.»
«Schade», sagte Annie.
«Nur keine Angst. Sobald ich zwei oder drei Filme gedreht habe, werde ich sie zwingen, mein Gesicht so hinzunehmen, wie es wirklich ist.»
«Sieht Dulac aus, als ob er hingerissen wäre?»
«Den reißt man nicht so leicht hin.» Zwischen den Zähnen murmelte sie: «Ich hasse diese Sklavenhändler.»
«Machen Sie vor allem keinen Krach», meinte Annie besorgt. «Trinken Sie nicht soviel, und verlieren Sie nicht die Geduld.»
«Ich werde geduldig wie ein Engel sein. Ich werde über Dulacs sämtliche Witze lachen. Und wenn ich mit ihm zu Bett gehen muß, dann meinetwegen auch das.»
Annie fing zu lachen an: «Das wird er gar nicht verlangen.»
«Egal. Ich verkaufe mich ebenso gern en gros wie en détail.» Sie warf einen Blick in das Stück Spiegel, das über dem Ausguß hing: «Ich darf nicht mehr lange warten», sagte sie.
Die Flurglocke schrillte auf; Annie stürzte zur Tür, und Regine machte weiter ihr Gesicht zurecht; sie haßte diese Frisur und ihr auf Star geschminktes Gesicht; sie haßte dieses Lächeln, das sie schon im voraus auf ihren Lippen spürte, und den gesellschaftsmäßigen Tonfall ihrer Stimme.
«Es ist erniedrigend», sagte sie wütend zu sich selbst; und dann dachte sie: Später räche ich mich dafür.
«Es war gar nicht Madame Laforêt», sagte Annie. Sie blieb mit bestürzter Miene in der Küchentür stehen.
«Wer war es denn?» fragte Regine.
«Der Fakir», sagte Annie.
«Fosca? Was will der denn hier? Hoffentlich hast du ihn nicht hereingelassen.»
«Nein. Er wartet im Vorzimmer.»
Regine zog die Küchentür hinter sich zu.
«Mein lieber Fosca», sagte sie in kühlem Ton, «es tut mir wirklich furchtbar leid. Aber ich kann Sie jetzt unmöglich empfangen. Ich hatte Sie doch gebeten, nicht zu mir zu kommen.»
«Ich wollte hören, ob Sie nicht krank sind. Seit drei Tagen schon habe ich Sie nicht gesehen.»
Sie blickte ihn mit unterdrückter Gereiztheit an. Er hielt den Hut in der Hand und trug einen Gabardinemantel. Er sah wie verkleidet aus.
«Sie hätten ja telefonieren können», sagte sie ohne Freundlichkeit.
«Ich wollte wissen», sagte er.
«Na gut, also jetzt wissen Sie. Entschuldigen Sie mich, aber ich habe heute abend Gäste, und es ist etwas sehr Wichtiges. Ich komme mal wieder bei Ihnen vorbei, sobald ich eine Minute frei bin.»
Er lächelte: «Ein Abendessen, das ist doch nichts Wichtiges», sagte er.
«Es handelt sich um meine Karriere», sagte sie. «Ich habe Aussicht, einen fabelhaften Start beim Film zu bekommen.»
«Auch Filme sind nicht wichtig.»
«Und was Sie mir zu sagen haben, ist von hervorragender Wichtigkeit?» fragte sie gereizt.
Von neuem schellte es.
«Kommen Sie hier herein», sagte Regine. Sie schob ihn durch die Küchentür. «Sage, daß ich gleich komme, Annie.»
Fosca lächelte: «Wie gut das hier drinnen riecht!» Von einer Kristallschale nahm er ein rosa Petit Four und steckte es in den Mund.
«Wenn Sie mit mir zu reden haben, so reden Sie, aber beeilen Sie sich», sagte sie.
Er blickte sie freundlich an.
«Sie haben mich nach Paris kommen lassen», äußerte er dann. «Sie haben mir zugesetzt, ich solle mich wieder zum Leben aufraffen. Nun müssen Sie mir aber auch das Leben erträglich machen. Sie dürfen mich nicht drei Tage lang einfach sitzenlassen, ohne daß ich Sie sehe.»
«Drei Tage ist nicht viel», sagte sie.
«Für mich ist es viel. Bedenken Sie doch, daß ich nichts anderes zu tun habe, als auf Sie zu warten.»
«Daran sind Sie selber schuld», antwortete sie. «Es gibt doch tausend Dinge, die man unternehmen kann. Ich kann mich doch nicht von morgens bis abends mit Ihnen beschäftigen.»
«Sie haben es gewollt», sagte er. «Sie haben gewollt, daß ich Sie sehe. Alles übrige ist im Dunkeln geblieben. Aber Sie existieren, und in mir ist Leere.»
«Soll ich jetzt den Auflauf in den Ofen schieben?» fragte Annie.
«Wir essen gleich», sagte Regine. «Hören Sie», fuhr sie fort, «wir reden später über alles. Ich besuche Sie bald.»
«Morgen», sagte er.
«Ganz richtig, morgen schon.»
«Um wieviel Uhr?»
«Gegen drei.» Sie schob ihn sanft zur Tür.
«Ich hätte Sie gern jetzt gesehen», sagte er. «Ich gehe.» Er lächelte: «Aber Sie müssen kommen.»
«Ich komme», sagte sie.
Hinter ihm schloß sie heftig die Tür.
«Eine Frechheit! Er könnte doch wirklich auf mich warten! Wenn er wiederkommt, laß ihn nicht herein.»
«Der Arme, er ist doch nicht richtig im Kopf», sagte Annie.
«Er kommt mir gar nicht mehr so vor.»
«Seine Augen sind sonderbar.»
«Aber ich bin ja schließlich auch keine barmherzige Schwester», meinte Regine noch. Sie trat in den Salon und ging lächelnd auf Madame Laforêt zu. «Entschuldigen Sie mich», sagte sie. «Denken Sie nur, ich war einem Fakir in die Hände gefallen.»
«Sie hätten ihn einladen sollen», sagte Dulac.
Alles lachte.
«Noch etwas Marc?» fragte Annie.
«Gern.»
Regine trank noch ein wenig Marc und rollte sich vor dem Feuer zusammen; sie fühlte sich warm, sie fühlte sich wohl. Das Radio spielte leise eine Jazzmelodie, Annie hatte eine Lampe angezündet und legte sich die Karten. Regine tat nichts; sie blickte in die Flamme hinein, sie schaute die Wände des Studios an, auf denen verzerrte Schatten tanzten, und fühlte sich glücklich dabei. Die Probe war sehr gut verlaufen; Laforêt, der mit Komplimenten gewöhnlich so geizig war, hatte sie lebhaft beglückwünscht; ‹Wie es euch gefällt› würde ein Erfolg sein, und nach ‹Wie es euch gefällt› war Großes zu erwarten. Ich bin jetzt nahe am Ziel, dachte sie und lächelte dabei. Wie oft, wenn sie zu Hause in Rosay vor dem Feuer lag, hatte sie sich geschworen: Ich werde geliebt werden und glücklich sein; sie hätte jetzt gern das leidenschaftliche kleine Mädchen von damals bei der Hand genommen, sie in dies Zimmer geführt und zur ihr gesagt: «Ich halte dein Versprechen. Das ist aus dir geworden.»
«Es schellt», sagte Annie.
«Geh nachsehen, wer es ist.»
Annie lief in die Küche. Wenn sie dort auf einen Stuhl stieg, konnte sie durch ein kleines Fenster auf den Treppenflur schauen.
«Es ist der Fakir.»
«Ich ahnte so etwas. Mach nicht auf», sagte Regine.
Die Schelle ertönte ein zweites Mal.
«Er wird die ganze Nacht schellen», sagte Annie.
«Schließlich wird er es müde werden.»
Es trat Stille ein; dann folgte eine Serie von dringenden und langen Klingelzeichen, die schließlich wieder verstummten.
«Du siehst, er ist fort», sagte Regine.
Sie schlug die Zipfel ihres Morgenrocks über ihre Beine und knäuelte sich wieder auf dem Teppich zusammen. Aber das Schrillen der Klingel hatte genügt, um das Glück dieses Augenblicks doch ein wenig zu trüben. Die übrige Welt auf der anderen Seite der Tür hatte sich bemerkbar gemacht; Regine war nicht mehr allein mit sich selbst. Sie betrachtete den Lampenschirm aus Pergament, die japanischen Masken, alle die Sächelchen, die sie sich einzeln ausgesucht hatte und die ihr so viele köstliche Augenblicke ins Gedächtnis riefen; sie schwiegen, die Minuten waren verwelkt; diese jetzige würde wie die übrigen welken. Das kleine, glühende Mädchen war tot, die junge, lebenssüchtige Frau würde gleichfalls sterben, und die große Schauspielerin, die sie so gerne werden wollte, war auch dem Tode geweiht. Vielleicht würden die Männer sich noch eine Weile an ihren Namen erinnern. Aber der ganz bestimmte Geschmack des Lebens auf ihren Lippen, diese Leidenschaft, die in ihrem Herzen brannte, die Schönheit der roten Flammen und ihre geheimen Phantasmagorien würde niemand mehr kennen.
«Hören Sie», sagte Annie. Sie hatte mit verblüffter Miene den Kopf gehoben. «Da ist jemand in Ihrem Schlafzimmer», sagte sie.
Regine blickte auf die Tür. Die Klinke bewegte sich.
«Erschrecken Sie nicht», sagte Fosca. «Ich bitte um Entschuldigung, aber Sie schienen mein Läuten nicht zu hören.»
«Aber der ist ja wie der Leibhaftige!» rief Annie aus.
«Nein», sagte Fosca. «Ich bin einfach durchs Fenster gestiegen.»
Regine stand auf: «Ich bedaure», sagte sie, «daß das Fenster nicht geschlossen war.»
«Ich hätte einfach die Scheiben zerschlagen.»
Fosca lächelte, und sie lächelte auch.
«Furchtsam sind Sie nicht», sagte sie.
«Nein, ich habe nie Angst», sagte er. «Das ist in meinem Falle übrigens kein Verdienst.»
Sie wies auf einen Stuhl und schenkte zwei Gläser voll.
«Setzen Sie sich.»
Er setzte sich. Er war an drei Stockwerken hochgeklettert, hatte dabei riskiert, den Hals zu brechen, und traf sie mit unordentlicher Frisur, glänzendem Gesicht und in einen verdrückten blaßrosa Kimono gehüllt. Er war entschieden im Vorteil.
«Du kannst schlafen gehen, Annie», sagte sie.
Annie beugte sich zu Regine vor und drückte ihr einen Kuß auf die Wange.
«Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie mich», sagte sie.
«Ja», sagte Regine. «Und träume nur nicht schlecht.»
Die Tür schloß sich hinter ihr.
Regine blickte Fosca groß an. «Nun, und?» sagte sie.
«Sie sehen ja», sagte er. «Mir entkommen Sie nicht so leicht. Wenn Sie mich nicht mehr besuchen, besuche ich Sie eben. Und wenn Sie mir Ihre Tür verschließen, so komme ich durchs Fenster herein.»
«Sie werden mich noch zwingen, mir Gitter vor die Fenster machen zu lassen», bemerkte sie kühl.
«Ich werde vor der Tür auf Sie warten, Ihnen auf der Straße folgen…»
«Und was bezwecken Sie damit?»
«Ich werde Sie sehen», sagte er. «Und Ihre Stimme hören.» Er stand auf und trat an den Sessel heran, in den sie sich gesetzt hatte. «Ich werde Sie in meinen Händen halten», sagte er und faßte ihre Schultern dabei.
«Sie brauchen mich nicht so stark zu drücken», sagte sie. «Der Gedanke, daß Sie sich unbeliebt machen, stört Sie wohl weiter nicht, wie?»
«Was kann das für mich bedeuten?» Er blickte sie mitleidig an. «Bald werden Sie tot sein, und alle Ihre Gedanken werden mit Ihnen sterben.»
Sie stand auf und zog sich etwas zurück. «In diesem Augenblick lebe ich noch.»
«Ja», sagte er, «und ich sehe Sie.»
«Und Sie sehen nicht, daß Sie mir lästig fallen?»
«Ich sehe es. Ihre Augen sind schön, wenn Sie zornig sind.»
«Meine Gefühle also zählen nicht für Sie?»
«Sie werden die erste sein, die sie vergessen wird.»
«Ach», rief sie ungeduldig aus. «Sie sprechen zu mir immer von der Zeit, wenn ich tot sein werde! Aber selbst wenn Sie mich in der nächsten Minute töteten, würde das nichts ändern. Ihre Gegenwart ist mir unangenehm in diesem Augenblick.»
Er lachte: «Ich will Sie nicht töten», sagte er.
«Das möchte ich auch hoffen.»
Sie setzte sich, aber sie fühlte sich keineswegs sicher in seiner Gegenwart.
«Warum lassen Sie mich im Stich?» fragte er. «Warum geben Sie sich mit diesen Eintagsfliegen ab und niemals mit mir?»
«Was für Eintagsfliegen?»
«Diese kleinen Menschen, die wieder verschwinden werden. Mit denen lachen Sie.»
«Kann ich etwa mit Ihnen lachen?» fragte sie gereizt. «Sie wissen ja nichts Besseres zu tun, als mich anzustarren, ohne etwas zu sagen. Sie weigern sich zu leben. Ich liebe das Leben, verstehen Sie mich?»
«Schade», sagte er.
«Wieso?»
«Es geht so schnell vorbei.»
«Fangen Sie schon wieder an?»
«Schon wieder. Immer wieder.»
«Können Sie gar nicht mal von etwas anderem reden?»
«Aber wie können Sie denn an etwas anderes denken?» fragte er. «Wie bringen Sie es fertig, zu denken, Sie hätten sich auf einer Welt häuslich eingerichtet, die Sie doch in wenigen Jahren wieder verlassen werden, nachdem Sie kaum angekommen sind?»
«Ich wenigstens werde gelebt haben, wenn ich sterbe», sagte sie. «Sie sind schon jetzt ein Toter.»
Er neigte den Kopf und blickte auf seine Hände.
«Auch Beatrice meinte das», sagte er. «Ein Toter.»
Er hob wieder den Kopf.
«Alles in allem haben Sie recht. Warum sollten Sie an den Tod denken, da Sie ja doch sterben werden? Für Sie wird es einfach sein, er kommt eines Tages von selbst. Sie werden gar nicht nötig haben, darüber nachzudenken.»
«Und Sie?»
«Ich?» fragte er.
Er sah sie an. Es war ein so verzweifelter Blick, daß sie sich fürchtete vor dem, was er sagen würde. Aber er sagte nur: «Das ist etwas anderes.»
«Wieso?» fragte sie.
«Ich kann es nicht erklären.»
«Sie können, wenn Sie wollen.»
«Ich will aber nicht.»
«Es würde mich interessieren.»
«Nein», sagte er. «Es würde alles verändern zwischen uns.»
«Gerade darum. Sie würden mir vielleicht weniger langweilig vorkommen.»
Er blickte ins Feuer, seine Augen leuchteten über der großen, gebogenen Nase, dann erlosch sein Blick.
«Nein.»
Sie stand auf. «Na gut! Dann gehen Sie aber nach Hause, wenn Sie mir nichts Unterhaltenderes zu sagen haben.»
Er erhob sich ebenfalls: «Wann besuchen Sie mich?»
«Sobald Sie sich entschließen, mir Ihr Geheimnis zu verraten», sagte sie. Foscas Antlitz wurde hart: «Gut. Kommen Sie morgen.»
Sie lag auf dem Eisenbett, dem schrecklichen Eisenbett mit den abblätternden Stäben; sie sah ein Stück gelber Bettdecke und den Nachttisch aus falschem Marmor, den staubigen Fliesenboden; aber nichts berührte sie mehr, weder der Ammoniakgeruch noch das Lärmen der Kinder auf der anderen Seite der Wand; alles das existierte weder nahe noch ferne von ihr. Sie bewegte sich nicht. Es gab keine Stunde mehr, keinen Tag, weder Zeit noch Ort. Draußen irgendwo war die Sauce der Hammelkeule erstarrt; irgendwo auf den Brettern wurde ‹Wie es euch gefällt› geprobt, und niemand wußte, wo die Rosalinde geblieben war. Irgendwo richtete sich ein Mann hoch auf den Wällen auf und streckte die gebietenden Hände zu einer großen roten Sonne empor.
«Glauben Sie wirklich an das alles?» fragte sie.
«Es ist die Wahrheit», sagte er. Er zuckte die Achseln. «Früher schien das nicht so etwas Außergewöhnliches zu sein.»
«Es müßte doch Leute geben, die sich an Sie erinnern.»
«Es gibt Orte, an denen noch von mir die Rede ist. Aber nur so wie von einer alten Legende.»
«Sie könnten sich also einfach aus dem Fenster stürzen?»
Er wandte den Kopf und sah das Fenster an: «Ich würde dabei riskieren, mich schwer und auf lange Zeit zu verletzen. Ich bin nicht unverwundbar. Aber mein Körper findet sich immer wieder zusammen.»
Sie reckte sich auf und sah ihn fest an: «Sie glauben wirklich, daß Sie niemals sterben werden?»
«Selbst wenn ich sterben will», sagte er, «kann ich es einfach nicht.»
«Ach!» sagte sie. «Wenn ich mich für unsterblich hielte!»
«Was wäre dann?»
«Die Welt wäre mein.»
«Das habe ich auch gedacht», sagte er. «Aber vor langer Zeit.»
«Warum denken Sie es nicht mehr?»
«Sie können sich das nicht vorstellen: ich werde immer da sein, immer und ewig da.» Er senkte den Kopf in die Hände.
Sie blickte zur Decke auf und wiederholte für sich: «Ich werde immer da sein, immer und ewig da.»
Es gab da einen Mann, der das zu denken wagte, einen Mann, der stolz und einsam genug war, um sich unsterblich zu glauben. Ich habe mir oft gesagt: ich bin allein. Ich habe mir gesagt: nie bin ich einem Mann oder einer Frau begegnet, die meinesgleichen war. Aber niemals habe ich mir zu sagen gewagt: ich bin unsterblich.
«Ach!» sagte sie. «Ich möchte glauben können, daß ich niemals in der Erde verfaulen werde.»
«Es ist ein furchtbarer Fluch», sagte er. Er blickte auf sie hin: «Ich lebe und habe kein Leben. Ich werde niemals sterben und habe doch keine Zukunft. Ich bin niemand. Ich habe keine Geschichte und habe kein Gesicht.»
«Doch», sagte sie leise, «ich sehe Sie.»
«Sie sehen mich», sagte er.
Er strich mit der Hand über seine Stirn.
«Wenn man wenigstens wirklich ein absolutes Nichts sein könnte! Aber es gibt immer wieder andere Menschen auf Erden, die einen sehen. Sie sprechen, und man muß sie hören, man muß ihnen Antwort geben, man muß wieder zu leben beginnen, wenn man auch weiß, daß man nicht existiert. Und das hört niemals auf.»
«Aber Sie existieren doch», sagte sie.
«Ich existiere für Sie, jetzt. Aber existieren Sie?»
«Sicherlich», sagte sie. «Und Sie auch.» Sie faßte ihn am Arm: «Fühlen Sie nicht meine Hand auf Ihrem Arm?»
Er blickte auf ihre Hand. «Diese Hand, ja, aber was bedeutet das schon?»
«Es ist meine Hand», sagte Regine.
«Ihre Hand.» Er zögerte. «Sie müßten mich lieben», sagte er. «Und ich müßte Sie lieben. Dann wären Sie da, und ich wäre, wo Sie jetzt sind.»
«Mein armer Fosca», sagte sie. «Ich liebe Sie nicht», fügte sie hinzu.
Er sah ihr ins Gesicht und brachte langsam, mit aufmerksamer Miene, die Worte hervor: «Sie lieben mich nicht.» Er schüttelte den Kopf. «Nein», sagte er. «Es hat keinen Zweck. Sie müßten sagen: ‹Ich liebe Sie.›»
«Aber Sie lieben mich ja auch nicht», sagte sie.
«Ich weiß es nicht», sagte er. Er beugte sich über sie. «Ich weiß, daß Ihr Mund existiert», sagte er unerwartet rauh. Seine Lippen preßten sich auf Regines Mund: sie machte die Augen zu. Nacht brach auf einmal aus; vor Jahrhunderten hatte sie begonnen, und niemals würde sie enden. Ein aus der Tiefe der Zeiten kommendes brennendes, wildes Verlangen ließ sich nieder auf ihren Mund, und sie gab sich dem Kuß hin. Es war der Kuß eines Narren, in einem Zimmer, das nach Ammoniak roch.
«Lassen Sie mich», sagte sie und stand auf. «Ich muß jetzt gehen!»
Er machte keine Bewegung, um sie zurückzuhalten.
Sobald sie die Schwelle der Wohnung überschritten hatte, tauchten Roger und Annie aus ihrem Studio auf.
«Woher kommst du denn?» fragte Roger. «Warum bist du nicht zum Abendessen gekommen? Warum hast du bei der Probe gefehlt?»
«Ich habe», sagte Regine, «nicht auf die Zeit geachtet.»
«Nicht auf die Zeit geachtet? Mit wem warst du denn zusammen?»
«Man kann doch nicht immer die Augen auf der Uhr haben», rief sie ungeduldig. «Als wenn alle Stunden immer gleich aussähen! Als hätte es einen Sinn, damit die Zeit zu messen!»
«Was ist in dich gefahren?» fragte Roger. «Woher kommst du denn?»
«Ich hatte so ein schönes Essen gekocht», sagte Annie. «Es gab Käsekrapfen.»
«Krapfen…» sagte Regine.
Sie fing zu lachen an. Um sieben Uhr Käsekrapfen, und um acht Uhr Shakespeare. Jedes Ding an seinem Platz, jede Minute an ihrem Platz: nur nichts umkommen lassen, es ist noch schnell genug aus. Sie setzte sich und zog langsam ihre Handschuhe aus. Da drüben gibt es in einem Zimmer mit staubigem Fußboden einen Mann, der sich für unsterblich hält.
«Bei wem warst du denn?» fing Roger wieder an.
«Bei Fosca.»
«Wegen Fosca hast du deine Probe versäumt?» rief er in ungläubigem Ton aus.
«Eine Probe ist doch nicht so etwas Wichtiges», sagte sie.
«Regine, sag mir die Wahrheit», sagte Roger. Er blickte ihr in die Augen und fragte in seiner direkten Art: «Was ist vorgefallen?»
«Ich war bei Fosca und habe dabei die Zeit vergessen.»
«Du wirst eben auch schon verrückt», sagte Roger.
«Ich wollte, es wäre so», sagte sie.
Sie ließ ihre Blicke rundum schweifen. Mein Salon. Meine Sachen. Er liegt auf der gelben Bettdecke dort, wo ich nicht mehr bin, und er glaubt das Lächeln Dürers gesehen zu haben, die Augen KarlsV.Er wagt es wirklich, zu glauben…
«Er ist ein sehr merkwürdiger Mensch», sagte sie.
«Er ist ein Narr», gab Roger zurück.
«Nein. Viel merkwürdiger. Er hat mir anvertraut, daß er unsterblich ist.»
Verächtlich blickte sie die beiden an; sie sahen töricht aus…
«Unsterblich?» stieß Annie hervor.
«Er ist im 13.Jahrhundert geboren», erklärte ihnen Regine mit unbeteiligter Stimme. «Im Jahre 1848 ist er in einem Wald eingeschlafen und sechzig Jahre dort geblieben, dann hat er dreißig Jahre in einer Anstalt zugebracht.»
«Hör doch», sagte Roger, «mit diesem Unsinn auf.»
«Warum sollte er denn nicht unsterblich sein?» fragte sie herausfordernd. «Mir kommt das nicht wunderbarer vor, als daß man stirbt und geboren wird.»
«Aber ich bitte dich», rief Roger.
«Und selbst wenn er nicht unsterblich ist, so hält er sich doch dafür.»
«Das ist eine klassische Form von Größenwahn», äußerte Roger, «und nicht interessanter, als wenn sich jemand für Karl den Großen hält.»
«Wer sagt dir denn», warf Regine ein, «daß ein Mann, der sich für Karl den Großen hält, nicht interessant ist?» Zornröte stieg ihr auf einmal ins Gesicht. «Glaubt ihr beiden denn, ihr wäret so interessant?»
«Sie sind nicht eben höflich», entgegnete Annie in verletztem Ton.
«Und ihr möchtet», sagte Regine, «daß ich euch ähnlich wäre. Und ich habe auch angefangen, so ähnlich zu werden wie ihr.»
Sie stand auf, ging auf ihr Schlafzimmer zu und schloß geräuschvoll die Tür hinter sich. Kleine Menschen. Kleine Existenzen. Warum bin ich nicht auf dem Bett geblieben? Warum habe ich Angst gehabt? Bin ich denn so feige? Er geht durch die Straßen, ganz bescheiden mit seinem Filzhut und Gabardinemantel und denkt: Ich bin unsterblich. Die Welt ist sein, und die Zeit ist sein, und ich bin nur ein Insekt: Mit der Fingerspitze strich sie über die Narzissen, die auf dem Tisch standen. Wenn ich nun auch glaubte, daß ich unsterblich bin? Der Duft der Narzissen stirbt nicht, und auch dies Fieber nicht, das meine Lippen schwellt. Ich bin unsterblich. Sie zerdrückte die Narzissen zwischen ihren Händen. Es hatte keinen Zweck. Der Tod war in ihr, und sie wußte es und hatte ihn bereitwillig in sich aufgenommen. Noch zehn Jahre schön sein, Phaedra und Cleopatra spielen, im Herzen der sterblichen Menschen ein blasses Erinnern lassen, das allmählich zu Staub zerfiele, dieser bescheidene Ehrgeiz hatte ihr bisher genügt. Sie zog die Nadeln aus ihrem Haar, und die schweren Flechten fielen ihr über die Schultern herab. Eines Tages werde ich alt sein, eines Tages tot, eines Tages vergessen. Und während ich das denke, gibt es einen Menschen, der denkt: Ich bin immer da.
«Es war ein Triumph!» sagte Dulac.
«Es gefällt mir besonders», äußerte Frenaud, «daß Ihre Rosalinde auch in Männerkleidern soviel Koketterie und schillernde Anmut bewahrt.»
«Sprechen wir nicht mehr von Rosalinde», sagte Regine, «sie ist tot.»
Der Vorhang war gefallen, Rosalinde war tot, sie würde jeden Abend sterben, und ein Tag würde kommen, an dem sie nicht wieder zum Leben erwachen würde. Regine griff zum Sektglas und leerte es in einem Zug; ihre Hand zitterte; seit sie die Bühne verlassen hatte, war sie nicht einen Augenblick aus dem Zittern gekommen.
«Ich möchte mich amüsieren», sagte sie in kläglichem Ton.
«Wir können ja zusammen tanzen», sagte Annie.
«Nein. Ich will mit Sylvia tanzen.»
Sylvia warf einen Blick auf das gesittete Publikum, das rings an den Tischen saß: «Fürchten Sie nicht, daß wir furchtbar auffallen werden?»
«Und wenn man Komödie spielt, fällt man da nicht auf?» gab Regine zurück.
Sie legte den Arm um Sylvia; sie stand nicht sehr fest auf den Füßen, aber sie hatte die Gabe, immer noch tanzen zu können, auch wenn sie nicht mehr gehen konnte; das Orchester spielte einen Rumba, und sie tanzte nach Art der Neger mit unanständigen Gesten. Sylvia schien sehr verlegen, sie trat vis-à-vis von Regine von einem Fuß auf den andern und wußte nicht, wo sie mit ihrem Körper bleiben sollte, lächelte aber doch höflich und machte gute Miene. Alle hatten dies selbe Lächeln auf ihren Gesichtern. Heute abend konnte sie tun, was sie wollte, und alle würden es gutheißen. Jäh hielt sie inne mit Tanzen.
«Du wirst niemals tanzen lernen», sagte sie. «Du bist zu vernünftig.»
Sie sank in ihren Sessel zurück.
«Gib mir eine Zigarre», sagte sie zu Roger.
«Es wird dir übel werden», wandte Roger ein.
«Gut. Dann übergebe ich mich. Das ist mal was anderes.»
Roger reichte ihr eine Zigarre, sie zündete sie sorgfältig an und nahm einen ersten Zug; ein beißender Geschmack erfüllte ihren Mund; das war wenigstens etwas, was gegenwärtig, intensiv, was wirklich vorhanden war. Alles andere schien so fern: die Musik, die Stimmen, das Lachen, die bekannten und die unbekannten Gesichter, deren zerflatternde Bilder die Spiegel des Restaurants unendlich oft wiederholten.
«Du bist sicher todmüde», sagte Merlin.
«Ich habe vor allem Durst.»
Sie stürzte noch ein Glas herunter. Trinken, immer nur trinken. Und dennoch war es in ihrem Herzen kalt. Eben noch brannte sie: sie waren aufgestanden, sie riefen nach ihr und klatschten in die Hände. Jetzt schliefen oder schwatzten sie, und sie selber war kalt. Schläft er jetzt wohl auch? Er hatte nicht geklatscht; er saß da und sah sie an. Aus dem Grunde der Ewigkeit hat er mich angesehen, und Rosalinde ist dadurch unsterblich geworden.
«Wenn ich es glaubte», sagte sie. «Wenn ich es glauben könnte?» Sie bekam den Schlucken, und ihr Gaumen war pelzig. «Warum singt keiner?» fragte sie. «Man singt, wenn man lustig ist. Ihr seid doch lustig? Wie?»
«Wir sind glücklich über Ihren Triumph», sagte Sanier mit seinem warmen und dabei ernsten Blick.
«Also müßt ihr singen.»
Sanier lächelte und stimmte halblaut einen amerikanischen Schlager an.
«Lauter», sagte sie.