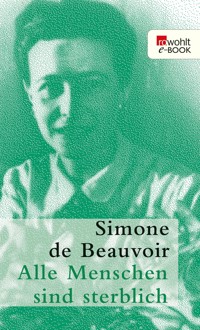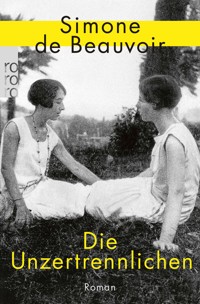9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ménage-à-trois im Paris der 30er Jahre Das schillernde Milieu der Pariser Boheme. Die Schriftstellerin Françoise, eine der schönsten Frauengestalten der französischen Literaturszene, und der Schauspieler und Regisseur Pierre, durch Liebe und geistige Interessen eng verbunden, billigen sich die äußerste Freiheit zu. Diese wird plötzlich zur Bedrohung, als eine reizvolle Unbekannte aus der Provinz in ihre Kreise eindringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 782
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Simone de Beauvoir
Sie kam und blieb
Roman
Aus dem Französischen übertragen von Eva Rechel-Mertens
Für Olga Kosakievicz
«Ebenso muß jedes Bewußtsein
auf den Tod des anderen gehen.»
Hegel
Erster Teil
Erstes Kapitel
Françoise blickte auf. Gerberts Finger tanzten über die Tasten, er stierte wild auf das Manuskript; offenbar war er müde; auch Françoise hätte schlafen mögen, aber ihre eigene Müdigkeit war etwas Vertrautes, Behagliches; die schwarzen Ringe um Gerberts Augen wollten ihr nicht gefallen; sein Gesicht war glanzlos und hart, man sah ihm seine Zwanzig fast an.
– Wollen wir lieber Schluss machen?, fragte sie.
– Nein, nein, es geht noch, gab Gerbert zurück.
– Es handelt sich auch nur noch um eine Szene, die ich ins Reine bringen muss, bemerkte Françoise.
Sie wendete die Seite um. Es hatte eben zwei geschlagen. Gewöhnlich war um diese Zeit keine lebende Seele mehr im Theater; heute Nacht aber lebte es; die Schreibmaschine klapperte, die Lampe goss über die Wände einen rosigen Schein. Ich bin da, mein Herz schlägt. Das Theater hat heute Nacht ein lebendiges Herz.
– Ich arbeite gern bei Nacht, sagte sie.
– Ja, meinte Gerbert, es ist dann still.
Er gähnte. Der Aschenbecher war mit Enden von englischen Zigaretten gefüllt, zwei Gläser und eine leere Flasche standen auf einem Seitentisch. Françoise ließ den Blick über die Wände ihres kleinen Arbeitsraumes gleiten, die rosig durchhauchte Luft strahlte von Wärme und menschlicher Gegenwart. Da draußen war das seelenlose schwarze Theater mit seinen verlassenen Korridoren und der großen Höhlung mittendrin.
– Wollen Sie nicht noch etwas trinken?, fragte sie.
– Da sage ich nicht nein, meinte er.
– Ich gehe in Pierres Garderobe und hole noch eine Flasche.
Sie verließ das Studio. Auf den Whisky war sie gar nicht so wild, die dunklen Korridore zogen sie an. Wenn sie nicht da war, existierte alles das, der Staub, das Halbdunkel, die trostlose Öde für niemand, es existierte überhaupt nicht. Aber nun war sie da, und das Rot des Teppichs drang durch das Dunkel wie ein schüchternes Nachtlicht. Solche Macht hatte sie: ihre Gegenwart riss die Dinge aus ihrem Nichtsein heraus, gab ihnen Farbe und Duft. Sie ging die Treppe hinunter und betrat den Zuschauerraum; es war wie eine Sendung, die ihr zuteil geworden war, sie musste diesen verlassenen, nachterfüllten Raum zur Existenz erwecken. Der eiserne Vorhang war heruntergelassen, die Wände rochen nach frischer Farbe; die roten Plüschsessel warteten reglos aufgereiht. Eben noch warteten sie auf nichts. Jetzt war sie da, und sie streckten ihr die Arme entgegen. Sie blickten auf die eisenverkleidete Bühne, sie riefen nach Pierre, nach Rampenlicht und einer andächtig lauschenden Menge. Man sollte immer dableiben und diesem einsamen Warten ewige Dauer verleihen; aber dann müsste man auch noch gleichzeitig in der Requisitenkammer, in den Garderoben und im Erfrischungsraum sein, überall zugleich. Sie ging durchs Proszenium auf die Bühne; sie öffnete die Tür zum Foyer und stieg hinunter in den Hof, auf dem die alten Versatzstücke schimmelten. Sie war die Einzige, für die jetzt diese verlassenen Stätten, diese verschlafenen Dinge einen Sinn besaßen; sie war da, sie gehörten ihr. Die Welt gehörte ihr.
Sie trat durch die kleine Eisentür vor dem Bühnenausgang auf den dahinterliegenden Platz. Alles ringsum schlief, die Häuser, das Theater waren in Schlaf versunken; ein einziges Fenster war rosig erhellt. Sie setzte sich auf eine Bank, der Himmel strahlte von Schwärze über den Kastanien. Hier fühlte man sich wie im Herzen einer ruhigen Provinzstadt. In diesem Augenblick bedauerte sie nicht, dass Pierre nicht bei ihr war, es gab Freuden, die sie in seiner Gegenwart nicht erlebte: alle Freuden der Einsamkeit; seit acht Jahren schon lebte sie ohne sie, und manchmal tat es ihr Leid. Sie lehnte sich an das harte Holz der Bank; ein rascher Schritt hallte auf dem Asphalt des Gehsteigs; in der Allee fuhr ein Lastwagen vorbei. Es gab nur dies: das Geräusch der Bewegung, den Himmel, das schlummernde Laub und ein beleuchtetes Fenster in einer schwarzen Hauswand; keine Françoise mehr; niemand mehr.
Françoise sprang auf; es war seltsam, wieder jemand zu werden, nur einfach eine Frau, eine Frau, die Eile hat, weil eine dringende Arbeit auf sie wartet, und dieser Augenblick war nur ein Augenblick ihres Lebens wie alle anderen. Sie legte die Hand auf den Türgriff und drehte sich noch einmal mit verkrampftem Herzen um. Es war eine Flucht, war Verrat. Die Nacht würde nun von neuem diesen kleinen, kleinstädtischen Platz überfluten; der rosige Schein im Fenster würde vergebens schimmern, er leuchtete für niemand mehr. Die Süße dieser Stunde war dann für immer verloren. So viel Süße verloren für die ganze Welt. Sie durchschritt den Hof und stieg die grüne Holzstiege hinauf. Diese Art von Trauer hatte sie sich längst abgewöhnt. Es gab nichts Wirkliches außer dem eigenen Leben. Sie trat in Pierres Garderobe, nahm eine Flasche Whisky aus dem Schrank und lief schnell in ihr Studio hinauf:
– Das gibt uns neue Kraft, sagte sie. Wie wollen Sie ihn haben, mit Wasser oder pur?
– Pur, sagte Gerbert.
– Können Sie dann nachher auch noch allein nach Hause gehen?
– O ja! Ich fange jetzt an, gab Gerbert würdevoll zurück, Whisky zu vertragen.
– Sie fangen an…, meinte Françoise.
– Wenn ich erst einmal reich bin und allein wohne, habe ich bestimmt immer eine Flasche Vat 69 im Schrank, sagte Gerbert.
– Mit Ihrer Karriere wird es dann aus sein, meinte Françoise. Sie blickte ihn beinahe zärtlich an. Er hatte jetzt die Pfeife hervorgeholt und stopfte sie mit größter Aufmerksamkeit. Es war seine erste Pfeife. Jeden Abend, wenn sie mit ihrer Flasche Beaujolais fertig waren, legte er sie auf den Tisch und sah sie mit den Augen eines Kindes an; er rauchte zu einem Cognac oder Marc. Und dann gingen sie durch die Straßen, mit von der Tagesarbeit, von Wein und schärferen Drinks noch etwas benommenen Köpfen. Gerbert nahm lange Schritte, das schwarze Haar fiel ihm ins Gesicht, die Hände hatte er in den Taschen. Das war jetzt zu Ende; sie würde ihn noch oft wiedersehen, aber nur noch mit Pierre, mit all den anderen; sie würden wieder wie zwei Fremde sein.
– Für eine Frau können Sie übrigens auch gut Whisky vertragen, stellte Gerbert unparteiisch fest.
Er sah Françoise prüfend an: – Sie haben heute zu viel gearbeitet, Sie sollten ein bisschen schlafen. Wenn Sie wollen, wecke ich Sie.
– Nein, ich möchte lieber fertig werden, sagte Françoise.
– Haben Sie keinen Hunger? Soll ich nicht ein paar Brote holen gehen?
– Danke, sagte Françoise. Sie lächelte ihm zu. Er war so zuvorkommend, so aufmerksam; immer wenn sie mutlos wurde, brauchte sie nur seine heiteren Augen anzusehen, und schon kehrte ihr Vertrauen zurück. Sie hätte gern Worte gefunden, ihm zu danken.
– Es ist beinahe schade, sagte sie, dass wir fertig sind; ich hatte mich so an die Zusammenarbeit mit Ihnen gewöhnt.
– Aber das Einstudieren wird ja erst recht amüsant, meinte Gerbert. Seine Augen blitzten, seine Wangen hatten Farbe bekommen durch den Alkohol.
– Wie schön zu denken, dass in drei Tagen alles wieder losgeht. Ich schwärme immer für den Saisonbeginn!
– Ja, es macht Spaß, sagte Françoise. Sie zog ihre Papiere wieder zu sich heran. Diese zehn Tage des ausschließlichen Beisammenseins sah er offenbar ohne Bedauern zu Ende gehen; an sich war es natürlich, auch sie würde ihnen nicht nachtrauern; schließlich konnte sie nicht verlangen, dass nur Gerbert etwas dabei empfand.
– Jedes Mal, sagte Gerbert, wenn ich durch dies totenstille Theater muss, verspüre ich etwas wie Grauen; es ist so ein düsterer Vorgeschmack. Ich habe doch tatsächlich geglaubt, diesmal würde es das ganze Jahr geschlossen bleiben.
– Es hat nicht viel gefehlt, sagte Françoise.
– Wenn es nur anhält, meinte Gerbert.
– Sicherlich, entschied Françoise.
Sie hatte niemals an Krieg geglaubt; der Krieg, das war wie Tuberkulose oder ein Eisenbahnunglück; mir kann das nicht passieren; so etwas kommt nur bei anderen vor.
– Können Sie sich vorstellen, dass ein wirklich großes Unglück Sie selber treffen könnte?
Gerbert verzog das Gesicht.
– Nur zu gut, meinte er.
– Ich nicht, sagte Françoise. Es lohnte sich gar nicht, darüber nachzudenken. Mit Gefahren, gegen die man machtlos ist, musste man natürlich rechnen, aber Krieg war etwas, was sich jedem menschlichen Maßstab entzog. Wenn er eines Tages ausbrach, hatte nichts mehr Bedeutung, nicht einmal, ob man lebte oder starb.
– Aber er wird nicht kommen, wiederholte sich Françoise. Sie beugte sich über das Manuskript; die Schreibmaschine klapperte, das Zimmer roch nach englischen Zigaretten, nach Tinte und nach Nacht. Draußen, vor dem Fenster, schlief der kleine Platz in gesammelter Ruhe unter dem schwarzen Himmel; mitten durch die einsame Landschaft rollte irgendwo ein Zug. Ich bin da. Für mich, die ich da bin, existiert der Platz und der fahrende Zug. Ganz Paris, und die ganze Erde in dem verschatteten rosigen Licht dieses kleinen Büros. Und diese Minute enthält alle langen Jahre des Glücks. Ich bin da, im Herzen meines Lebens.
– Schade, dass man schlafen muss, meinte Françoise.
– Leider, meinte Gerbert, merkt man nicht, wenn man schläft. Sobald man es merkt, wacht man auch schon auf. Man hat nichts Rechtes davon.
– Aber finden Sie es nicht fabelhaft, wenn man wach ist, und alle andern schlafen? Françoise legte ihren Füllfederhalter hin und lauschte. Kein Geräusch war zu hören, der Platz war schwarz, das Theater schwarz.
– Ich würde mir gern vorstellen, alles schliefe, und nur Sie und ich wären lebendig auf Erden.
– Da überläuft es mich eher, meinte Gerbert. Er warf die lange schwarze Haarsträhne zurück, die ihm in die Augen fiel. Das ist, wie wenn ich an den Mond denke: Eisberge und Gletscherspalten und nirgends eine Menschenseele. Wer sich da zum ersten Male hinauftraut, dem graut wirklich vor nichts.
– Ich würde nicht nein sagen, wenn man mich ließe, sagte Françoise. Sie blickte Gerbert an. Gewöhnlich lebten sie so nebeneinanderher, und sie war zufrieden damit, ihn nahe bei sich zu fühlen, ohne dass sie miteinander redeten. Heute aber hatte sie Lust, mit ihm zu sprechen.
– Es ist doch komisch, meinte sie, sich die Dinge vorzustellen, wie sie sind, wenn man nicht da ist.
– Ja, komisch, antwortete er.
– Es ist so, als wenn man sich vorstellen will, man sei tot, aber man kann es nicht, weil man doch immer dabei voraussetzt, dass man noch in einer Ecke steht und alles mit ansieht.
– Zu dumm, was man alles nie sehen wird, sagte Gerbert.
– Früher hat es mich ganz unglücklich gemacht, zu denken, dass ich immer nur ein armseliges Stückchen von der Welt sehen würde. Sie auch?
– Vielleicht, gab Gerbert zu.
Françoise lächelte. Wenn man mit Gerbert sprach, stieß man oft auf Widerstand, aber es war schwer, ihm eine positive Äußerung zu entlocken.
– Jetzt aber bin ich ganz ruhig, denn ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass die Welt mir überallhin folgt, wohin ich mich auch begebe. Seitdem bin ich sicher davor, etwas zu bedauern.
– Was zu bedauern?, fragte Gerbert.
– Dass ich immer in meiner eigenen Haut bleiben muss auf dieser weitläufigen Erde.
– Ja, besonders, wo Ihr Leben eigentlich schon so geordnet ist.
– Er war immer so diskret. Diese Andeutung einer Frage war für seine Verhältnisse schon geradezu kühn. Fand er, dass ihr Leben schon allzu geordnet sei? Kritisierte er sie? Ich frage mich, was er von mir denkt. Dies Studio, das Theater, mein Hotelzimmer, Bücher, Papiere, meine Tätigkeit. Ein geordnetes Dasein.
– Ich bin zu der Einsicht gekommen, dass man resignieren und sich für eine Sache entscheiden muss.
– Ich mag nicht wählen, warf Gerbert ein.
– Anfangs ist es mir auch schwer gefallen, aber jetzt macht es mir nichts mehr, denn jetzt kommt es mir so vor, als ob die Dinge, die für mich nicht mehr existieren, überhaupt nicht mehr existieren.
– Wie meinen Sie das?, fragte Gerbert.
Françoise zögerte. Sie spürte das selber sehr stark; die Korridore, der Zuschauerraum, die Bühne verschwanden zwar nicht, wenn sie die Tür hinter sich schloss; aber sie existierten doch nur hinter der Tür und gewissermaßen von ferne. In der Ferne auch rollte der Eisenbahnzug durch die Felder, in denen sich im Dunkel der Nacht das trauliche Leben in dem kleinen Studio fortsetzte.
– Das ist so wie mit den Mondlandschaften, meinte Françoise. Es hat keine Wirklichkeit. Es ist nur vom Hörensagen da. Fühlen Sie das nicht?
– Nein, sagte Gerbert, ich glaube nicht.
– Stört es Sie denn nicht, dass Sie immer nur eine Sache auf einmal sehen können?
Gerbert dachte nach.
– Was mich stört, sagte er, das sind die andern Menschen; es ist mir grauenhaft, wenn man zu mir von jemandem spricht, und noch dazu mit Bewunderung. Da lebt so ein Kerl, irgendwo, und weiß überhaupt nicht, dass es mich gibt.
Es war selten, dass er so viel über sich selber sagte. Spürte auch er diese aufregende Intimität – eine Intimität, die noch alles offen ließ – der letzten gemeinsamen Stunden? Sie allein lebten in diesem warmen Lichtkreis. Für beide dasselbe Licht und dieselbe Nacht. Françoise betrachtete Gerberts schöne grüne Augen unter den gebogenen Wimpern, seinen lebendigen Mund. – Wenn ich gewollt hätte… Es war vielleicht noch nicht einmal zu spät. Aber was konnte sie wollen?
– Ja, es tut weh, sagte sie.
– Sobald man ihn dann kennt, wird es besser, meinte Gerbert.
– Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die anderen auch ein Bewusstsein haben und sich selbst von innen heraus begreifen, genauso wie man selber es tut, sagte Françoise. Ich bin immer erschrocken, wenn mir das einmal aufgeht. Man hat dann ein Gefühl, als sei man ein Bild im Gehirn eines anderen. Aber es kommt ja fast niemals vor, und auch niemals so, dass es einem ganz deutlich wird.
– Es stimmt aber, fiel Gerbert lebhaft ein, und deshalb ist es mir auch so unangenehm, wenn jemand zu mir von mir selber spricht, auch wenn er es freundlich meint. Es kommt mir dann jedes Mal vor, als maße der andere sich eine Überlegenheit an.
– Mir ist es gleichgültig, meinte Françoise, was die Leute von mir denken.
– Ja, man kann allerdings nicht sagen, dass Eigenliebe Ihre Stärke ist.
– Es geht mir mit ihren Gedanken ebenso wie mit ihren Äußerungen und ihren Gesichtern: das sind alles nur Stücke meiner eigenen Welt. Elisabeth wundert sich immer, dass ich nicht ehrgeizig bin, aber das kommt eben auch daher. Ich habe nicht nötig, mir in der Welt eine bevorzugte Stellung zu verschaffen, es kommt mir vielmehr so vor, als hätte ich schon so ganz gut darin Fuß gefasst.
Sie blickte ihn lächelnd an:
– Und Sie? Sie sind ja auch nicht ehrgeizig.
– Nein, sagte Gerbert, wozu auch? Er zögerte. Dennoch würde ich gern eines Tages ein guter Schauspieler sein.
– So, wie ich gern ein gutes Buch schreiben würde. Die Arbeit, die man macht, macht man eben gern gut. Aber nicht wegen Ruhm und Ehre.
– Nein, gab Gerbert zu.
Ein Milchwagen fuhr unterm Fenster vorbei. Durch Châteauroux war der Zug bereits durch, bald würde er in Vierzon sein. Gerbert gähnte, und seine Augen waren leicht gerötet wie bei einem schlummernden Kind.
– Sie sollten schlafen gehen, sagte Françoise.
Gerbert rieb sich die Augen.
– Wenn wir es Labrousse zeigen wollen, muss es ganz fertig sein, beharrte er eigensinnig. Er griff zur Flasche und goss sich einen tüchtigen Schluck Whisky ein.
– Außerdem bin ich nicht schläfrig, sondern habe Durst! Er trank und stellte das Glas wieder hin. Dann überlegte er:
– Vielleicht bin ich im Grunde doch müde.
– Müde oder durstig, das müssen Sie selber wissen, meinte Françoise vergnügt.
– Ich weiß das niemals so genau, stellte Gerbert fest.
– Wissen Sie was?, sagte Françoise. Ich bin mir jetzt klar, was Sie tun müssen. Sie legen sich auf den Diwan und schlafen. Inzwischen gehe ich die letzte Szene noch einmal durch. Sie tippen sie dann, während ich zum Bahnhof gehe und Pierre abhole.
– Und Sie selbst?, fragte Gerbert.
– Wenn ich fertig bin, schlafe ich auch. Auf dem Diwan ist Platz, Sie stören mich nicht. Nehmen Sie sich ein Kissen, und decken Sie sich gut zu.
– Schön, sagte Gerbert.
Françoise dehnte sich einen Augenblick und griff dann wieder zur Feder. Gleich darauf sah sie sich um. Gerbert lag mit geschlossenen Augen auf dem Rücken; gleichmäßige Atemzüge kamen aus seinen Lippen hervor. Er schlief bereits. Er war schön. Lange blickte sie ihn an, dann ging sie an die Arbeit. Da drüben, im fahrenden Zug, schlief auch Pierre, den Kopf ans Lederkissen gelehnt, mit unschuldsvollem Gesicht. Er wird aus dem Abteil springen und sich recken mit seiner kleinen Gestalt; und dann wird er über den Bahnsteig gelaufen kommen und meinen Arm nehmen.
– So!, sagte Françoise. Befriedigt prüfte sie das Manuskript. Wenn er es doch gut finden möchte. Ich glaube, er findet es gut. Sie schob den Sessel zurück. Ein rosiger Schein stieg am Himmel auf. Sie zog die Schuhe aus und ließ sich neben Gerbert unter die Decke gleiten. Er seufzte, sein Kopf wendete sich auf dem Kissen von einer Seite zur andern und blieb an ihrer Schulter liegen.
– Armer kleiner Gerbert, dachte sie, wie müde er schon war. Sie zog die Decke ein bisschen herauf, dann lag sie unbeweglich mit offenen Augen da. Auch sie war voller Müdigkeit, doch wollte sie noch nicht schlafen. Sie blickte auf Gerberts frische Augenlider, die langen Mädchenwimpern; er schlief, wunschlos, entspannt. Sie fühlte am Hals das Schmeicheln seines weichen schwarzen Haars.
– Das ist alles, was ich jemals von ihm haben werde, dachte sie.
Es gab Frauen, die diese schönen Haare streichelten – Haare, die an chinesische Damen erinnerten – und die ihre Lippen auf diese kindlichen Lider drückten, die diesen langen schmalen Körper in die Arme schlossen. Eines Tages würde er zu einer von ihnen sagen: Ich liebe dich.
Françoise fühlte, wie ihr Herz sich zusammenzog. Noch war Zeit. Sie konnte ihre Wange an seine lehnen und ganz laut die Worte sagen, die ihr auf die Lippen kamen.
Sie schloss die Augen. Sie konnte nicht sagen: Ich liebe dich. Sie konnte es nicht denken. Sie liebte Pierre. In ihrem Leben war kein Raum für eine andere Liebe.
Und doch würde es Freuden geben, die diesen ähnlich wären, dachte sie mit einer Art von Angst. Der Kopf lag schwer auf ihrer Schulter. Was aber Wert gehabt hätte, war nicht diese drückende Last, sondern Gerberts Zärtlichkeit, sein Vertrauen, seine Selbstaufgabe, Liebe, mit der sie selbst ihn überschüttete. Nur dass Gerbert schlief und dass Liebe und Zärtlichkeit Traumgebilde waren. Wenn sie ihn in den Armen hielte, könnte sie vielleicht weiterträumen; aber durfte man unternehmen, eine Liebe zu träumen, die man nicht ernstlich leben will?
Sie blickte Gerbert an. Sie war frei in Worten und Gebärden. Pierre ließ sie vollkommen frei. Aber Gebärden und Worte würden nur Lügen sein, so, wie schon das Gewicht dieses Kopfes an ihrer Schulter lügenhaft war. Gerbert liebte sie nicht; sie konnte nicht wünschen, dass er sie liebte.
Der Himmel rötete sich hinter dem Fenster. Françoise fühlte in ihrem Herzen eine Traurigkeit, die herb und rosig war wie diese frühe Stunde. Dennoch bedauerte sie nichts; sie hatte nicht einmal ein Recht auf die Melancholie, die lastend auf ihren müden Gliedern lag. Es war ein endgültiger, ein unbelohnter Verzicht.
Zweites Kapitel
Im Hintergrund des maurischen Cafés auf rauen Wollkissen sitzend sahen Françoise und Xavière der arabischen Tänzerin zu.
– So möchte ich tanzen können, bemerkte Xavière; ihre Schultern zuckten, ein Wiegen ging durch ihren Leib. Françoise blickte sie lächelnd an; es tat ihr Leid, dass der Tag sich schon seinem Ende zuneigte; Xavière war reizend gewesen.
– Im Eingeborenenviertel von Fes haben Labrousse und ich Nackttänzerinnen gesehen, sagte sie, aber das sah denn doch gar zu sehr nach anatomischem Anschauungsunterricht aus.
– Was du schon alles gesehen hast!, meinte Xavière mit einem Anflug von Neid.
– Das wirst du alles auch noch sehen, begütigte Françoise.
– Ach, meinte Xavière, wer weiß.
– Du wirst ja nicht dein Leben lang in Rouen bleiben wollen.
– Was soll ich denn machen?, gab Xavière niedergeschlagen zurück. Nachdenklich blickte sie auf ihre Hände, es waren die roten Hände eines Landmädchens, die zu den schmalen Handgelenken nicht passten. Vielleicht kann ich auf den Strich gehen, aber dafür bin ich noch nicht abgebrüht genug.
– Das ist allerdings ein angreifendes Metier, weißt du, fiel Françoise lachend ein.
– Es ist nichts weiter dazu nötig, als dass man keine Angst vor den Leuten hat, meinte Xavière nachdenklich; sie warf den Kopf zurück. Ich mache schon Fortschritte. Wenn mir einer auf der Straße zu nahe kommt, schreie ich nicht mehr.
– Und du gehst auch bereits allein ins Café; das ist schon sehr schön, fügte Françoise hinzu.
Xavière sah sie etwas zweifelnd an: – Ja, aber ich habe dir nicht alles gesagt. In dem kleinen Dancing, in dem ich gestern war, hat mich ein Matrose zum Tanzen aufgefordert, und ich habe gedankt. Ich habe rasch meinen Calvados ausgetrunken und bin feige davongelaufen. Sie schnitt ein Gesicht. Calvados schmeckt abscheulich.
– Das wird ein schöner Rachenputzer gewesen sein, meinte Françoise. Ich glaube, du hättest ruhig mit deinem Matrosen tanzen können. Ich habe in meiner Jugend einen Haufen derartiger Dummheiten gemacht, und es ist niemals schlecht ausgegangen.
– Nächstes Mal sage ich ja, meinte Xavière.
– Hast du keine Angst, dass deine Tante einmal nachts aufwacht? Ich kann mir vorstellen, dass das doch leicht passieren könnte.
– Sie würde nicht wagen, meinte Xavière überlegen, zu mir hereinzukommen. Sie lächelte und wühlte in ihrer Handtasche: Ich habe eine kleine Zeichnung für dich gemacht.
Eine Frau, die Françoise etwas ähnlich sah, stand an einen Bartisch gelehnt; ihre Wangen waren grün und ihr Kleid gelb angetuscht. Darunter hatte Xavière mit großen violetten Buchstaben geschrieben: Der Weg des Lasters.
– Du musst mir eine Widmung draufschreiben, sagte Françoise. Xavière sah erst auf Françoise, dann auf die Zeichnung. Schließlich schob sie sie von sich fort.
– Das ist zu schwierig, meinte sie.
Die Tänzerin bewegte sich jetzt nach der Mitte des Saales zu; ihre Hüften wogten, ihr Leib erbebte im Rhythmus des Tamburins.
– Es sieht aus, meinte Xavière, als habe sie einen Teufel im Leib, der von ihr ausfahren möchte. Fasziniert beugte sie sich vor. Françoise fand, es sei ein guter Einfall von ihr gewesen, hierher zu gehen; niemals hatte Xavière so lange von sich gesprochen; sie hatte eine reizende Art, Geschichten zu erzählen. Françoise rückte sich behaglich in den Kissen zurecht; auch sie war sehr empfänglich für diesen gefälligen Flitter hier; aber was sie besonders entzückte, war, dass sie diese kleine traurige Existenz an sich geheftet hatte; denn jetzt gehörte ihr Xavière, wie ihr Gerbert und Ines und die Canzetti gehörten; nichts gab Françoise ein solches Gefühl von Freude wie diese Art des Besitzens; Xavière folgte aufmerksam den Bewegungen der Tänzerin, sie konnte ihr eigenes Gesicht nicht sehen, das von Leidenschaft verschönt war, ihre Hand spürte die Konturen der Tasse, um die sie sich fest geschlossen hatte, aber nur Françoise hatte ein Gefühl für die Umrisse dieser Hand: Xavières Gebärden, ihr Gesicht, ihr Leben brauchten Françoise, um zu existieren. In sich selbst betrachtet war Xavière in diesem Augenblick nur ein Geschmack von Kaffee, eine aufpeitschende Musik, ein Tanz, ein flüchtiges Wohlgefühl; für Françoise aber ergaben Xavières Kindheit, ihre leeren Tage, ihr Überdruss eine romantische Geschichte, die ebenso wirklich war wie die zärtliche Modellierung ihrer Wangen; und diese Geschichte endete genau hier, unter diesen bizarren Draperien, in dieser Minute ihres Lebens, da Françoise sich nach Xavière umwandte und sie betrachtete.
– Es ist schon sieben, sagte Françoise. Es war sterbenslangweilig, dass sie den Abend mit Elisabeth verbringen musste, aber es ging nicht anders. Gehst du heut Abend mit Ines aus?
– Ich werde wohl müssen, meinte Xavière ohne Begeisterung.
– Wie lange bleibst du noch in Paris?
– Ich fahre morgen. Xavière sah wütend aus. Morgen ist das alles noch da, und ich bin in Rouen.
– Warum machst du nicht einen Stenographiekursus mit, wie ich dir geraten hatte?, sagte Françoise. Ich würde eine Stellung für dich finden. Xavière hob mutlos die Achseln.
– So etwas kann ich nicht, sagte sie.
– Aber bestimmt, das ist doch nicht schwer, meinte Françoise.
– Meine Tante hat nochmals versucht, mir das Stricken beizubringen, sagte Xavière, aber mein letzter Strumpf war eine Katastrophe. Sie blickte Françoise düster und irgendwie herausfordernd an. Sie hat Recht: es wird nie was aus mir.
– Sicher keine gute Hausfrau, warf Françoise heiter hin. Aber es geht ja auch ohne das.
– Es ist nicht wegen des Strumpfes, fuhr Xavière mit unglücklicher Miene fort, aber es ist ein Symbol.
– Du verlierst zu schnell den Mut, meinte Françoise. Du möchtest doch aber gern fort aus Rouen? Hält dich nichts dort fest?
– Ich hasse sie alle, erklärte Xavière. Ich hasse diese schmutzige Stadt und die Männer auf den Straßen mit ihren klebrigen Blicken.
– Es wird ja nicht mehr lange dauern, meinte Françoise beschwichtigend.
– Das dauert, sagte Xavière. Sie stand auf. Ich gehe jetzt nach Hause.
– Warte, ich komme mit, sagte Françoise.
– Nein, bitte, lass dich nicht stören. Ich habe dir schon den ganzen Nachmittag weggenommen.
– Du hast mir nichts weggenommen, erwiderte Françoise. Wie komisch du bist! Verwundert musterte sie Xavières mürrische Miene; man wurde wirklich nicht klug aus dieser jungen Person; mit dem kleinen Béret, unter dem sich ihre blonden Haare versteckten, sah sie fast wie ein Junge aus, und doch war es ein Jungmädchengesicht, das Françoise ein halbes Jahr zuvor so gut gefallen hatte. Das Schweigen zwischen ihnen hielt an.
– Sei bitte nicht böse, sagte Xavière. Ich habe scheußliches Kopfweh. Mit gequälter Miene tupfte sie auf ihre Schläfen. Es muss an dem Rauch liegen; hier tut es weh, und da.
Ihre unteren Augenlider waren geschwollen, sie sah gelblich aus; tatsächlich konnte man kaum noch atmen in der von schwerem Weihrauchduft und Tabakrauch durchzogenen Luft. Françoise rief nach der Bedienung.
– Schade, sagte sie, wenn du nicht so müde wärst, hätte ich dich heute Abend in die Tanzbar mitgenommen.
– Ich denke, du willst eine Freundin besuchen, sagte Xavière.
– Die wäre mitgekommen, es ist die Schwester von Labrousse, so eine Rothaarige mit Herrenschnitt, du musst sie bei der hundertsten Aufführung von «Philoktet» gesehen haben.
– Ich erinnere mich nicht, sagte Xavière. Ihr Blick belebte sich. Ich erinnere mich nur an dich; du hattest einen langen, ganz engen schwarzen Rock an, eine Hemdbluse aus Silberlamé und ein silbernes Netz im Haar; du warst schön.
– Françoise lächelte; sie war nicht schön, aber ihr Gesicht gefiel ihr, es war ihr jedes Mal eine angenehme Überraschung, wenn sie ihm im Spiegel begegnete. In der übrigen Zeit dachte sie gar nicht darüber nach.
– Und du trugst ein bezauberndes blaues Plisseekleid, sagte sie, und hattest einen Schwips.
– Das Kleid habe ich bei mir, sagte Xavière. Ich ziehe es dann heute Abend an.
– Ist das auch klug, wenn du Kopfschmerzen hast?
– Ich habe keine mehr, sagte Xavière. Es muss nur so ein Anfall gewesen sein. Ihre Augen blitzten, und ihre Haut hatte wieder den schönen Perlmutterton.
– Dann also abgemacht, sagte Françoise; sie gingen jetzt durch die Tür. Ich denke mir nur, Ines wird böse sein, wenn sie auf dich gerechnet hat.
– Dann ist sie eben böse, meinte Xavière mit hochmütig schmollendem Gesicht.
Françoise hielt ein Taxi an.
– Ich setze dich jetzt bei ihr ab, und um halb zehn treffen wir uns im ‹Dôme›. Du brauchst auf dem Boulevard Montparnasse nur immer geradeaus zu gehen.
– Ich weiß Bescheid, sagte Xavière.
Françoise setzte sich im Taxi neben sie und schob ihren Arm unter den ihren.
– Ich bin froh, dass wir noch ein paar gute Stunden vor uns haben.
– Ich bin auch froh, stimmte Xavière leise ein.
Das Taxi hielt an der Ecke der Rue de Rennes. Xavière stieg aus, und Françoise fuhr weiter zum Theater. Pierre war in seiner Garderobe, er saß im Schlafrock da und aß ein Schinkenbrot.
– Wie war die Probe? Gut?, fragte Françoise.
– Gute Arbeit, ja, sagte Pierre. Er zeigte auf das Manuskript, das auf dem Schreibtisch lag.
– Das ist jetzt fein so. Ausgezeichnet sogar.
– Wirklich? Da bin ich aber froh! Es hat mir ein bisschen wehgetan, den Tod des Lucilius zusammenzustreichen, aber offenbar musste es sein.
– Es musste sein, sagte Pierre. Der Akt bekommt einen ganz anderen Rhythmus dadurch. Er biss in sein Sandwich. Hast du zu Abend gegessen? Willst du ein Sandwich haben?
– Gern, sagte Françoise; sie nahm eines und sah Pierre vorwurfsvoll an. Du ernährst dich nicht richtig, du siehst ja ganz elend aus.
– Ich will nicht dick werden, sagte Pierre.
– Cäsar war nicht mager, sagte Françoise; sie lächelte. Und wenn du die Hausmeistersfrau mal anriefest, sie soll uns eine Flasche Château-Margaux besorgen?
– Das ist kein schlechter Gedanke, bemerkte Pierre. Er nahm den Hörer ab, während Françoise es sich auf dem Diwan bequem machte; dort schlief Pierre, wenn er die Nacht nicht bei ihr verbrachte; sie hatte diese Garderobe gern.
– Kommt gleich, bemerkte Pierre.
– Ich bin so froh, sagte Françoise. Ich hatte schon Angst, ich käme mit dem dritten Akt nie zu Rande.
– Du hast es ganz großartig gemacht, sagte Pierre. Er beugte sich über sie und küsste sie. Françoise schlang die Arme um seinen Hals. Das alles verdanke ich dir, sagte sie. Weißt du noch, was du damals auf Delos zu mir sagtest? Du wolltest dem Theater etwas vollkommen Neues bringen? Nun, siehst du, diesmal ist es da.
– Meinst du wirklich?, fragte Pierre.
– Du etwa nicht?
– Doch, beinahe.
Françoise musste lachen.
– Natürlich glaubst du es, du siehst ja ganz verzückt aus. Ach, Pierre! Wenn wir nicht zu viel Geldsorgen haben, wird es ein himmlisches Jahr!
– Sowie wir ein bisschen reicher sind, kaufen wir einen neuen Mantel für dich.
– Ich habe mich an den alten so gewöhnt.
– Das sieht man nur zu deutlich, meinte Pierre. Er setzte sich auf einen Sessel dicht zu Françoise.
– Hast du dich mit der Kleinen gut unterhalten?
– Sie ist nett. Schade, dass sie in Rouen verkommt.
– Hat sie dir viele Geschichten erzählt?
– O ja, alles Mögliche. Ich erzähle dir ein andermal.
– Dann bist du also zufrieden? Es war kein verlorener Tag?
– Ich höre gern zu, wenn jemand erzählt, sagte Françoise.
Es klopfte, und die Tür ging auf. Die Pförtnerin brachte feierlich ein Tablett mit zwei Gläsern und einer Flasche Wein.
– Danke, sagte Françoise. Sie schenkte ein.
– Und bitte schön, sagte Pierre, ich bin für niemand da.
– Gewiss, Herr Labrousse, sagte die Frau und ging. Françoise griff nach ihrem Glas und biss in das zweite Schinkenbrot.
– Ich will Xavière heute Abend mitnehmen, sagte sie. Wir wollen irgendwo tanzen gehen. Das macht mir Spaß. Ich hoffe, sie neutralisiert Elisabeth ein bisschen für mich.
– Sie muss ja selig sein, meinte Pierre.
– Das arme Mädel, sie bricht mir das Herz. Es ist ihr so furchtbar, dass sie wieder nach Rouen muss.
– Kann man sie denn gar nicht da herausholen?, meinte Pierre.
– Nicht so leicht, antwortete Françoise. Sie ist so schlapp, so entschlusslos; sie hat gar keinen Trieb, irgendetwas zu lernen; ihr Onkel aber hat mit ihr nichts anderes im Sinne als eine Heirat mit einem frommen Mann und eine große Familie.
– Du solltest sie in die Hand nehmen, meinte Pierre.
– Wie soll ich das denn machen? Ich sehe sie einmal im Monat.
– Warum lässt du sie nicht nach Paris kommen, fragte Pierre. Dann könntest du sie im Auge behalten und zum Arbeiten bringen; sie soll doch Schreibmaschine lernen; irgendwo unterbringen wird man sie dann schon.
– Das erlaubt ihre Familie niemals, sagte Françoise.
– Dann soll sie es eben ohne Erlaubnis tun. Ist sie noch nicht mündig?
– Doch, sagte Françoise. Aber da liegt nicht die eigentliche Schwierigkeit. Ich kann mir nicht denken, dass sie ihr die Polizei auf den Hals schicken würden.
Pierre lächelte.
– Wo liegt dann die Schwierigkeit?
Françoise zögerte; wenn sie ehrlich war, hatte sie niemals geglaubt, dass eine Schwierigkeit bestände.
– Also, du stellst dir ernstlich vor, dass wir sie hier in Paris auf unsere Kosten leben lassen, bis sie etwas findet?
– Warum nicht?, meinte Pierre. Man muss es ihr so hinstellen, als borgten wir ihr das Geld.
– Ja, natürlich, sagte Françoise. Sie wunderte sich immer wieder, wie Pierre es verstand, mit drei Worten tausend unerwartete Lösungen zu schaffen; wo andere unüberwindliche Schwierigkeiten sahen, entdeckte Pierre ein Neuland von Möglichkeiten, mit denen er völlig nach Belieben schaltete. Das war das Geheimnis seiner Kraft.
– Wir haben im Leben so viel Glück gehabt, sagte Pierre. Wir sollten keine Gelegenheit versäumen, andere daran teilnehmen zu lassen.
Françoise starrte etwas fassungslos auf den Grund ihres Glases.
– Einerseits, sagte sie, lockt mich das ja sehr. Aber ich müsste mich dann wirklich mit ihr beschäftigen, und ich habe doch gar keine Zeit.
– Du kleine Arbeitsbiene, du, sagte Pierre zärtlich. Françoise errötete leicht.
– Du weißt, sagte sie, mir bleibt wirklich nicht viel Muße.
– Ich weiß, sagte Pierre. Aber weißt du, es ist komisch, wie du dich immer vor allem Neuen zurückziehst.
– Das einzige Neue, das mich interessiert, ist unsere gemeinsame Zukunft, antwortete Françoise. Was willst du, ich bin halt zu glücklich so! Das ist nur deine Schuld.
– Oh, das soll auch kein Tadel sein, sagte Pierre; im Gegenteil, du bist eben eine viel geschlossenere Persönlichkeit als ich. Bei dir gibt es keinen falschen Ton.
– Du legst eben nicht so viel Wert auf dein Leben an sich. Bei dir zählt nur die Arbeit, sagte Françoise.
– Das stimmt, gab Pierre zu; ratlos biss er an seinem Nagel herum. Abgesehen von meinen Beziehungen zu dir, gehe ich völlig planlos und leichtfertig damit um.
Er biss sich weiter auf den Finger; er würde erst Ruhe geben, wenn er Blut fließen sah.
– Aber sobald ich mit der Canzetti endgültig auseinander bin, hat das auch ein Ende.
– Das sagst du so, meinte Françoise.
– Ich werde es durch die Tat beweisen, sagte Pierre.
– Du hast Glück, deine Geschichten gehen immer so glatt aus.
– Das kommt nur daher, meinte Pierre, dass alle diese Frauenzimmer gar nicht wirklich Wert auf mich legen.
– Ich glaube nicht, dass die Canzetti irgendwie berechnend ist, hielt ihm Françoise entgegen.
– Nein, um eine Rolle zu bekommen, tut sie es wohl nicht; aber sie hält mich für einen großen Mann und meint, dass das Genie ihr auf diesem Wege ins Gehirn steigen könnte.
– Auch das, rief Françoise lachend, kommt vor.
– Mir machen diese Geschichten keinen Spaß mehr, sagte Pierre. Wenn ich noch von Natur ein so großer Liebhaber wäre; aber nicht einmal die Entschuldigung habe ich. Er blickte Françoise verlegen an. Woran mir liegt, das ist jedes Mal der Anfang. Kannst du das verstehen?
– Vielleicht, sagte Françoise, aber mich selbst würde niemals ein Abenteuer interessieren, das nicht irgendwie weitergeht.
– Nein?, sagte Pierre.
– Nein, gab sie zurück, ich kann einfach nicht; ich bin treu von Natur.
– Zwischen uns beiden, sagte Pierre, kann weder von Treue noch von Untreue die Rede sein; er zog Françoise an sich heran; wir beide sind einfach eins; du weißt, das ist wahr, man kann einen von uns ohne den anderen gar nicht richtig beschreiben.
– Das liegt nur an dir, sagte Françoise. Sie nahm Pierres Gesicht in die Hände und bedeckte seine Wangen, auf denen sich der Pfeifengeruch mit einem völlig unerwarteten, kindlichen Duft von frischem Backwerk mischte, mit Küssen. Wir sind nur eins, wiederholte sie bei sich selbst. Solange sie irgendetwas, was geschehen war, Pierre noch nicht erzählt hatte, war es nicht ganz wahr; es schwebte dann noch reglos und ungewiss in einer Art von Nimbus umher. Früher, als Pierre ihr noch scheue Bewunderung einflößte, gab es eine Menge Dinge, die sie auf diese Weise einfach verschwinden ließ: fragwürdige Gedanken, unüberlegte Handlungen; wenn sie nicht davon sprach, war es beinahe so, als wäre es nicht geschehen; das ergab unterhalb der eigentlichen Existenz ein dichtes Gestrüpp von schamhaft verborgenen Dingen, in dem man ganz allein war und zu ersticken drohte. Dann, ganz allmählich, hatte sie sich daran gewöhnt, alles mitzuteilen; es gab für sie nun kein Alleinsein mehr, aber sie fühlte sich dafür aus diesem unterirdischen Dickicht erlöst. Alle Momente ihres Lebens, die sie Pierre anvertraute, gab er ihr hell durchleuchtet, geglättet, abgerundet zurück, und es wurden nun Augenblicke ihres gemeinsamen Daseins daraus. Sie wusste, dass sie für ihn die gleiche Rolle spielte; er war ohne Winkelzug, ohne Scham, nicht ganz offen einzig, wenn er unrasiert war oder kein frisches Hemd angezogen hatte; dann konnte er so tun, als sei er erkältet, und behielt hartnäckig den Seidenschal um den Hals. Er wirkte dann wie vor der Zeit vergreist.
– Jetzt werde ich dich verlassen müssen, stellte sie mit Bedauern fest. Willst du nachher hier schlafen, oder kommst du zu mir?
– Ich komme zu dir, sagte Pierre. Ich möchte dich so früh wie möglich wieder sehen.
Elisabeth wartete schon im ‹Dôme›, Sie rauchte und starrte ins Leere. Irgendetwas stimmt nicht, dachte Françoise. Sie war sorgfältig zurechtgemacht, aber ihr Gesicht sah verquollen und müde aus. Als sie Françoise bemerkte, schien sie mit einem Lächeln rasch ihre Gedanken fortzuscheuchen.
– Guten Tag, sagte sie, wie bin ich froh, dich zu sehen.
– Ich freue mich auch, sagte Françoise. Sag, es macht dir doch nichts, wenn wir die kleine Pagès mitnehmen? Sie möchte für ihr Leben gern einmal in ein Dancing gehen; wir können uns ja unterhalten, während sie tanzt, sie wird uns nicht lästig fallen.
– Ich habe, sagte Elisabeth, seit Ewigkeiten keinen Jazz mehr gehört, es wird mir Vergnügen machen.
– Ist sie denn noch nicht da? Françoise blickte sich fragend um. Das wundert mich eigentlich. Sie wandte sich zu Elisabeth. Wie wird es denn mit der Reise?, fragte sie heiter. Du fährst sicher morgen schon ab?
– Du stellst dir das so einfach vor, gab Elisabeth mit unangenehmem Lachen zurück. Offenbar könnte Suzanne sich Kummer machen deswegen, und Suzanne ist doch vom September her noch so mitgenommen.
Das also war es… Françoise blickte Elisabeth mit empörtem Mitleid an, Claude benahm sich wirklich unglaublich ihr gegenüber.
– Als wenn du nicht auch mitgenommen wärest.
– Ja, aber ich bin eine klar blickende, tapfere Person, erklärte Elisabeth ironisch. Die Frau, die niemals Szenen macht.
– Jedenfalls, bemerkte Françoise, macht sich Claude aus Suzanne nichts mehr. Sie ist alt und verspießt.
– Er macht sich nichts mehr aus ihr, gab Elisabeth zu. Aber Suzanne ist eine Art Aberglauben bei ihm. Er ist überzeugt, dass er ohne sie zu nichts kommen wird. Elisabeth schwieg einen Augenblick und sah angestrengt dem Rauch ihrer Zigarette nach. Sie bewahrte stets Haltung, aber wie düster mochte es in ihrem Herzen aussehen! Sie hatte so viel von dieser Reise erhofft: Vielleicht würde dies lange Zusammensein zu zweien endlich dazu führen, dass Claude sich zur Trennung von seiner Frau entschlösse. Françoise war skeptisch geworden. Seit zwei Jahren wartete Elisabeth jetzt auf die entscheidende Stunde. Aber sie spürte Elisabeths Enttäuschung mit einem gespannten Gefühl im Herzen, als sei sie selbst daran schuld.
– Man muss zugeben, dass Suzanne nicht untüchtig ist, sagte Elisabeth. Sie blickte Françoise voll ins Gesicht. Jetzt bemüht sie sich, Claudes Stück bei Nanteuil unterzubringen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb er noch in Paris bleiben will.
– Nanteuil, antwortete Elisabeth zerstreut. So eine komische Idee. Unruhig blickte sie nach der Tür. Warum nur Xavière nicht kam?
– Natürlich ist es dumm. Elisabeth fuhr mit Entschiedenheit fort: Es ist ja vollkommen klar, dass nur Pierre «Die Teilung» auf die Bühne bringen kann. Er selber würde als Ahab einfach fabelhaft sein.
– Ja, das ist eine schöne Rolle, meinte Françoise.
– Meinst du, das könnte ihn locken?, fragte Elisabeth. Ihre Stimme hatte jetzt den Ton eines angstvollen Appells.
– «Die Teilung» ist ein sehr interessantes Stück, sagte Françoise. Nur liegt es so gar nicht auf der Linie dessen, was Pierre mit seiner Bühne vorhat. Weißt du was?, fuhr sie eifrig fort. Warum versucht es Claude mit seinem Stück nicht einmal bei Berger? Soll Pierre vielleicht ein Wort an ihn schreiben?
Elisabeth schluckte schwer.
– Du bist dir vielleicht nicht ganz klar darüber, was es für Claude bedeuten würde, wenn Pierre sein Stück nähme. Er zweifelt neuerdings so sehr an sich selbst. Nur Pierre könnte ihm da helfen.
Françoise blickte zur Seite. Battiers Stück war schauderhaft. Es anzunehmen kam gar nicht in Frage. Aber sie wusste, welche Hoffnungen Elisabeth auf diese letzte Chance setzte; mit ihrem verfallenen Gesicht vor Augen fühlte sie etwas wie Gewissensbisse. Sie täuschte sich nicht darüber, wie sehr ihre Existenz und ihr Beispiel auf Elisabeths Dasein lasteten.
– Offen gesagt, ich glaube nicht, dass daraus etwas wird, sagte sie.
– Aber «Lucius und Armanda» war doch ein schöner Erfolg, meinte Elisabeth.
– Gerade deswegen, gab Françoise zurück. Nach «Julius Cäsar» will Pierre jemand Unbekannten bringen.
Françoise hielt inne. Mit Erleichterung stellte sie fest, dass Xavière soeben kam. Sie war sorgfältig frisiert, eine leichte Puderschicht überdeckte ihre etwas starken Backenknochen und ließ die fleischige Nase feiner erscheinen.
– Ihr kennt euch ja, sagte sie. Lächelnd begrüßte sie Xavière. Du kommst aber spät. Sicher hast du noch nicht zu Abend gegessen. Iss doch hier etwas.
– Nein, danke, ich habe keinen Hunger, sagte Xavière. Sie setzte sich und hielt den Kopf gesenkt; sie schien sich nicht ganz behaglich zu fühlen. Ich habe mich verlaufen, sagte sie.
Elisabeth ließ den Blick forschend auf ihr ruhen; offenbar schätzte sie sie ab.
– Verlaufen?, fragte sie. Woher kommen Sie denn?
Xavière blickte Hilfe suchend auf Françoise.
– Ich weiß auch nicht, sagte sie, wie es möglich war. Ich bin den Boulevard entlanggegangen, er nahm und nahm kein Ende, und auf einmal war ich in einer stockdunklen Straße mit Bäumen. Ich muss am ‹Dôme› vorbeigelaufen sein, ohne ihn zu sehen.
Elisabeth lachte leise auf.
– Dazu gehört schon viel guter Wille, sagte sie.
Xavière warf ihr einen düstern Blick zu.
– Hauptsache, du bist da, bemerkte Françoise. Wollen wir in die ‹Prärie› gehen? Es ist nicht mehr, was es früher war, aber immer noch nett.
– Ganz wie du willst, sagte Elisabeth.
Sie verließen das Café. Auf dem Boulevard Montparnasse fegte ein mächtiger Wind die Platanenblätter von den Bäumen; Françoise ließ sie unter ihren Füßen rascheln, es erinnerte an trockene Nüsse und Glühwein.
– Ich bin jetzt mindestens seit einem Jahr nicht in der ‹Prärie› gewesen, sagte sie.
Niemand bemerkte etwas dazu. Xavière schlug fröstelnd den Mantelkragen hoch. Elisabeth hatte ihren Schal in der Hand behalten, sie schien weder die Kälte zu spüren noch irgendetwas zu sehen.
– Wie voll das heute schon ist, sagte Françoise. Alle Barstühle waren besetzt; sie entschied sich für einen Tisch, der etwas abseits stand.
– Für mich einen Whisky, sagte Elisabeth.
– Zwei Whisky, sagte Françoise. Und du?
– Dasselbe wie du, sagte Xavière.
– Drei Whisky, sagte Françoise. Der Geruch nach Alkohol und Rauch erinnerte sie an ihre Jugendtage; sie hatte immer die Jazzmusik, das gelbe Licht und das Gewimmel in solchen Nachtlokalen geliebt. Wie leicht war es, in einem Gefühl der Fülle zu leben, wenn man sich an einem Ort bewegte, der gleichzeitig die Ruinen von Delphi, die kahlen Höhen der Provence und diese menschliche Fauna aufwies! Lächelnd blickte sie zu Xavière hinüber.
– Sieh mal da an der Bar die Blonde mit der Stupsnase: sie wohnt in meinem Hotel; stundenlang läuft sie auf dem Flur auf und ab mit nichts als einem hellblauen Nachthemd an; ich glaube, sie hat es auf den Neger abgesehen, der das Zimmer über mir hat.
– Sie ist nicht hübsch, stellte Xavière fest; dann riss sie plötzlich die Augen weit auf. Aber daneben die Brünette ist schön. Mein Gott, ist die fabelhaft!
– Dann lass dir sagen, dass sie einen Catchchampion zum Freunde hat; man sieht sie hier überall zusammen herumlaufen, sie halten sich immer beim kleinen Finger.
– Oh!, rief Xavière in empörtem Ton.
– Ich kann nichts dafür, sagte Françoise.
Xavière stand auf; zwei junge Leute waren offenbar in der Absicht, die Damen aufzufordern, an den Tisch getreten.
– Nein, ich tanze nicht, sagte Françoise.
Nach kurzem Zögern erhob sich auch Elisabeth.
– In diesem Augenblick hasst sie mich, dachte Françoise. Am Nebentisch hielten sich eine etwas mitgenommene Blonde und ein sehr junger Mann zärtlich bei den Händen; der junge Mann sprach mit leidenschaftlicher Stimme leise auf sie ein; die Frau lächelte mit aller Vorsicht so, dass kein Fältchen die Maske auf ihrem nicht mehr ganz frischen Gesicht zerstörte; die kleine Hotelhure tanzte mit einem Matrosen, mit halb geschlossenen Augen drängte sie sich dicht an ihn; die dunkle Schöne saß auf einem Barhocker und verzehrte gelangweilt Bananenscheiben. Françoise lächelte hochmütig; alle diese Männer und Frauen waren völlig davon in Anspruch genommen, einen Augenblick ihrer kleinen privaten Biographie zu durchleben; Xavière tanzte, und eine Welle von Zorn und Verzweiflung durchflutete Elisabeth. Aber hier mitten in dieser Tanzbar bin ich selbst, unpersönlich und frei. Ich sehe alle diese Existenzen, alle diese Gesichter nebeneinander vor mir. Wenn ich mich von ihnen abwendete, würden sie auf der Stelle auseinander fallen wie eine Landschaft, in der niemand lebt.
Elisabeth kam wieder an den Tisch.
– Du weißt, sagte Françoise, es tut mir Leid, aber das lässt sich nicht arrangieren.
– Ja natürlich!, sagte Elisabeth, ich verstehe… Ihr Gesicht verlor den strengen Ausdruck; sie konnte nicht lange zornig bleiben, vor allem nicht, wenn andere Menschen da waren.
– Will es mit Claude im Augenblick nicht recht gehen?, fragte Françoise.
Elisabeth schüttelte den Kopf; ihr Gesicht verzog sich so stark, dass Françoise schon glaubte, sie werde zu weinen anfangen; aber sie fasste sich wieder.
– Claude ist mitten in einer Krise, sagte sie. Er sagt, er kann nicht arbeiten, solange sein Stück nicht angenommen ist und er sich nicht wirklich frei davon fühlt. Wenn er solche Zustände hat, ist er fürchterlich.
– Aber du, gab Françoise zu bedenken, kannst doch nichts dafür.
– Aber auf mich fällt immer alles zurück, sagte Elisabeth. Ihre Lippen fingen von neuem zu zittern an. Weil ich doch eine starke Frau bin. Er kann sich nicht vorstellen, dass eine starke Frau ebenso sehr leidet wie eine andere, sagte sie in einem Ton leidenschaftlichen Mitleids mit sich selbst.
Sie brach in Schluchzen aus.
– Meine arme Elisabeth!, sagte Françoise und fasste sie bei der Hand.
So von Tränen überströmt bekam Elisabeths Gesicht etwas Kindliches.
– Es ist zu dumm, sagte sie; sie tupfte sich die Augen ab. So kann es ja nicht weitergehen, immer mit Suzanne zwischen uns.
– Was möchtest du?, fragte Françoise. Dass er sich scheiden lässt?
– Er lässt sich niemals scheiden. Elisabeth weinte jetzt offenbar aus Wut. Liebt er mich denn überhaupt? Selbst ich weiß ja nicht einmal mehr, ob ich ihn eigentlich liebe. Sie blickte Françoise verstört an. Seit zwei Jahren kämpfe ich um diese Liebe, ich gehe dabei zugrunde, ich habe alles geopfert und weiß jetzt nicht einmal, ob wir uns lieben.
– Sicher liebst du ihn, behauptete Françoise; sie war sich dabei ihrer Feigheit bewusst. Im Augenblick bist du böse auf ihn, da fühlst du natürlich nichts, aber das hat doch nichts zu sagen. Sie musste Elisabeth unter allen Umständen beruhigen; was sie entdecken würde, wenn sie eines Tages bis zum Letzten ehrlich mit sich war, würde fürchterlich sein; offenbar fürchtete auch sie sich davor, ihre klare Einsicht machte immer zur rechten Zeit Halt.
– Ich weiß es nicht mehr, beharrte Elisabeth.
Françoise drückte stärker ihre Hand, sie war wirklich bewegt.
– Claude ist schwach, das ist alles, aber er hat doch tausendmal bewiesen, dass er an dir hängt. Sie hob den Kopf. Xavière war an den Tisch getreten und betrachtete die Szene mit einem sonderbaren Lächeln.
– Setz dich doch, sagte Françoise etwas verlegen.
– Nein, ich gehe noch wieder tanzen, antwortete Xavière; auf ihrem Gesicht war Verachtung und etwas wie Bosheit zu lesen. Françoise empfand diese kalte Kritik wie einen Schlag.
Elisabeth hatte sich gefasst; sie puderte ihr Gesicht.
– Man muss Geduld haben, sagte sie. Sie hatte ihre Stimme wieder in der Gewalt. Es kommt auch darauf an, wie man ihn nimmt. Ich habe vor Claude immer meine Karten zu offen aufgedeckt, und damit imponiert man ihm nicht.
– Hast du ihm jemals klar und deutlich gesagt, dass du diese Situation nicht ertragen kannst?
– Nein, sagte Elisabeth. Man muss noch warten damit. Sie hatte jetzt wieder den kundigen, harten Ausdruck im Gesicht.
Liebte sie Claude? Sie hatte sich ihm nur an den Hals geworfen, um auch ihrerseits eine große Liebe zu haben; die Bewunderung, die sie ihm entgegenbrachte, war nur eine Art, sich vor Pierre zu schützen. Um ihn litt sie in einer Weise, an der weder Françoise noch Pierre etwas ändern konnten.
– Was für ein Durcheinander, dachte Françoise mit einem Gefühl der Beängstigung.
Elisabeth hatte den Tisch verlassen, sie tanzte jetzt mit geschwollenen Augen und schmerzlich verzogenem Mund. Françoise verspürte etwas wie Neid. Elisabeths Gefühle mochten zwar falsch sein, ihre Berufung nicht echt, ihr Leben in seiner Gesamtheit nicht wahr, aber jedenfalls war ihr Schmerz im Augenblick ein starker, ein wirklicher Schmerz. Françoise sah sich nach Xavière um. Sie tanzte mit etwas zurückgeworfenem Kopf und ekstatischem Gesichtsausdruck; sie hatte noch kein eigenes Leben, für sie war alles noch möglich, und dieser zauberhafte Abend war unbekannter Verheißungen voll. Für das junge Mädchen wie für die Frau mit dem schweren Herzen hatte dieser Augenblick einen intensiven, unvergesslichen Geschmack. Und ich?, fragte sich Françoise. Sie war Zuschauerin. Aber diese Jazzmusik, der Whiskygeschmack und das orangefarbene Licht waren doch nicht nur ein Schauspiel, man musste doch irgendetwas finden, was man daraus machen konnte. Aber was? In Elisabeths scheuer, gequälter Seele nahm die Musik ganz allmählich die Farbe der Hoffnung an; Xavière verwandelte sie in leidenschaftliche Erwartung. Nur Françoise fand nichts in sich, was zu der aufwühlenden Stimme des Saxophons passen wollte. Sie suchte nach einer Sehnsucht, nach etwas Verlorenem; aber hinter ihr, vor ihr, lag nichts als helles, unfruchtbares Glück. Pierres Name würde niemals in ihr Schmerz hervorrufen können. Und Gerbert? Um Gerbert regte sie sich nicht auf. Es gab für sie kein Wagnis, weder Hoffnung noch Furcht; nur dies Glück, auf das sie selbst keinen Einfluss hatte; zwischen ihr und Pierre war kein Missverständnis möglich. Was auch der eine oder andere tat, nichts war unwiderruflich schlimm. Wenn sie eines Tages versuchen würde zu leiden, würde er sie so gut verstehen, dass das Glück sich gleich wieder narbenlos über ihr schließen würde. Sie zündete sich eine Zigarette an. Nein, sie fand nichts anderes als die gegenstandslose Klage, dass eigentlich nichts zu beklagen sei. Ihr Hals war wie zugeschnürt, ihr Herz schlug rascher als sonst, aber sie konnte nicht einmal glauben, dass sie ernstlich des Glückes müde sei; dieses Unbehagen brachte ihr keine aufrührende Enthüllung; es war nur ein zufälliger Zustand wie viele andere, eine kurze und keineswegs ungewöhnliche Stimmung, die sich in eitel Frieden auflösen würde. Sie ließ sich nie mehr von der Macht des Augenblicks erschüttern, sie wusste zu genau, dass keiner mehr etwas Entscheidendes bedeutete. ‹Gefangen im Glück›, murmelte sie; aber sie spürte, wie etwas in ihrem Innern dazu lächelte.
Françoise blickte matt auf die leeren Gläser und den Aschenbecher, der die vielen Zigarettenenden nicht mehr aufnehmen konnte; es war vier Uhr morgens, Elisabeth war schon lange fort, aber Xavière hatte noch immer vom Tanzen nicht genug; Françoise tanzte nicht, und um die Zeit totzuschlagen, hatte sie zu viel getrunken und zu viel geraucht; der Kopf wurde ihr schwer, und ihr Körper schmerzte vor Müdigkeit.
– Ich glaube, jetzt wäre es Zeit aufzubrechen, meinte Françoise.
– Schon!, rief Xavière. Enttäuscht sah sie Françoise an. Bist du müde?
– Etwas, sagte Françoise; sie zögerte. Du könntest ja noch ohne mich bleiben, fügte sie hinzu. Du bist ja auch sonst schon allein in einem Tanzlokal gewesen.
– Wenn du gehst, erklärte Xavière, gehe ich mit dir.
– Aber ich möchte dich nicht zwingen, nach Hause zu gehen, meinte Françoise.
Xavière zuckte mit ergebener Miene die Achseln.
– Oh, ich kann auch nach Hause gehen, sagte sie.
– Nein, es wäre doch zu schade, entschied Françoise; sie lächelte. Also, bleiben wir noch ein bisschen. Xavières Antlitz hellte sich auf.
– Es ist hier so fabelhaft, findest du nicht? Sie lächelte einen jungen Mann an, der sich vor ihr verbeugte, und folgte ihm auf die Tanzfläche. Françoise zündete sich eine neue Zigarette an; schließlich zwang sie ja nichts, ihre Arbeit gleich morgen wieder aufzunehmen; es war ja freilich eigentlich sinnlos, hier die Stunden zu vergeuden, wo sie nicht einmal tanzte, aber wenn man sich erst einmal darauf eingestellt hatte, hatte auch dies langsame Versinken im Nichtstun seinen Reiz; seit Jahren war es nicht vorgekommen, dass sie nur so dasaß in Tabak- und Alkoholgeruch und Träumereien und Überlegungen nachhing, die zu gar nichts führten.
Xavière kam an ihren Platz neben Françoise zurück.
– Warum tanzt du nicht?, fragte sie.
– Ich tanze schlecht, sagte Françoise.
– Dann langweilst du dich sicher?, fragte Xavière in kläglichem Ton.
– Aber gar nicht. Ich sehe gern zu. Ich finde es sehr reizvoll, der Musik zuzuhören und die Leute anzuschauen.
Sie lächelte; sie hatte es Xavière zu verdanken, dass sie diese Stunde, diese Nacht verbrachte; warum sollte sie ablehnen, ihrem Leben so viel jugendfrischen Überschwang zuzuführen, wie er sich ihr hier bot? Ein junges Wesen in ihrem Leben mit ganz neuen Bedürfnissen, einem scheuen Lächeln und unerwarteten Reaktionen?
– Doch, ich kann mir denken, sagte Xavière, dass das nicht amüsant für dich ist. Ihr Gesicht verdüsterte sich von neuem; auch sie sah im Grunde müde aus.
– Aber ich sage dir doch, dass ich ganz zufrieden bin, wiederholte Françoise; sie strich leicht über Xavières Handgelenk. Ich bin doch gern mit dir.
Xavière lächelte unüberzeugt; Françoise blickte sie freundschaftlich an; sie begriff nicht mehr, weshalb sie Pierre einen gewissen Widerstand entgegengesetzt hatte; gerade das unbestimmte Gefühl von Wagnis und Geheimnis machte ihr jetzt auf die Sache Lust.
– Weißt du, fing sie unvermittelt an, was ich gedacht habe heute Nacht? Du wirst doch niemals zu etwas kommen, wenn du in Rouen bleibst. Es gibt nur eine Lösung für dich: du ziehst ganz nach Paris.
– Hierher ziehen? Hier leben?, fragte Xavière erstaunt. Ach, ich möchte gern!
– Ich sage das nicht nur so, erklärte Françoise; sie zögerte, weil sie plötzlich Bedenken hatte, Xavière könne sie aufdringlich finden. Du könntest es doch so machen, dass du vorerst einmal herkommst, in mein Hotel, wenn du willst; ich würde dir die Mittel vorstrecken, und du könntest irgendwas lernen, Stenographie zum Beispiel; oder ich weiß noch was Besseres: eine Freundin von mir leitet ein Schönheitsinstitut; sie könnte dich anstellen, sowie du die Prüfung abgelegt hast.
Xavières Miene verfinsterte sich.
– Mein Onkel, sagte sie, wird das niemals erlauben.
– Dann verzichtest du eben auf seine Erlaubnis. Hast du etwa Angst vor ihm?
– Nein, antwortete Xavière. Sie blickte aufmerksam auf ihre spitzen Nägel; mit ihrem blassen Teint, ihren langen blonden Haarsträhnen, die vom Tanzen aufgelöst waren, sah sie jammervoll aus wie eine auf dem Trockenen gestrandete Medusa.
– Nun also?, fragte Françoise.
– Entschuldige mich, sagte Xavière. Sie stand auf, weil einer ihrer Tänzer ihr ein Zeichen machte, und sah gleich wieder animierter aus. Françoise sah ihr verwundert nach; Xavière war so merkwürdig sprunghaft in ihren Stimmungen; es war doch sonderbar, dass sie sich nicht einmal die Mühe genommen hatte, den Vorschlag, den Françoise ihr machte, etwas genauer zu prüfen. Und doch war dieser Plan das einzig Vernünftige. Sie wartete mit einiger Ungeduld auf die Rückkehr Xavières.
– Nun?, fragte sie. Was hältst du von meinem Plan?
– Welcher Plan?, fragte Xavière zurück. Sie schien aufrichtig erstaunt.
– Dass du ganz nach Paris kommst, sagte Françoise.
– O Paris!, antwortete Xavière.
– Aber es ist ganz ernst gemeint, sagte Françoise. Es kommt mir vor, als hältst du das für bloße Phantasterei.
Xavière zuckte die Achseln.
– Aber das geht doch nicht, sagte sie.
– Du musst es nur wollen, sagte Françoise. Was hindert dich denn daran?
– Es ist undurchführbar, meinte Xavière mit verdrießlicher Miene. Sie blickte um sich. Es wird hier jetzt trist, oder findest du nicht? Die Leute sehen alle aus, als fallen ihnen die Augen zu; sie hocken hier nur noch herum, weil sie nicht mehr die Kraft haben, sich endlich aufzuraffen.
– Gut, gehen wir!, sagte Françoise. Sie ging durch das Lokal zur Tür; die erste Morgendämmerung brach gerade an. Wir könnten ein bisschen gehen, schlug sie vor.
– Ja, das könnten wir, meinte Xavière; sie zog ihren Mantel fest um den Hals und ging mit raschen Schritten voraus. Weshalb wollte sie, dachte Françoise, ihr Angebot nicht ernstlich in Erwägung ziehen? Es störte sie, neben sich dies kleine Menschenwesen voll feindseliger, eigensinniger Gedanken zu spüren.
– Ich muss sie überzeugen, dachte Françoise. Bislang waren die Unterredung mit Pierre, die unbestimmten Träumereien des Morgens, der Anfang ihrer Unterhaltung darüber nur ein Spiel gewesen; doch jetzt bekam alles Wirklichkeit: der Widerstand Xavières war etwas Wirkliches, etwas, womit Françoise fertig werden musste. Etwas in ihr lehnte sich dagegen auf; sie hatte so ganz unter dem Eindruck gestanden, Xavière zu beherrschen, sie bis in ihre Vergangenheit und bis in die unvorhergesehensten Wendungen ihrer Zukunft hinein als ihr Eigentum betrachten zu können! Und nun stieß sie auf diesen eigensinnigen Widerstand, an dem ihr eigener Wille zerbrach.
Xavière ging immer schneller und zog dabei schmerzlich die Augenbrauen zusammen; es war nicht möglich, sich zu unterhalten. Françoise schritt eine kurze Weile schweigend hinter ihr her, dann verlor sie die Geduld.
– Ist es dir auch nicht unangenehm, wenn wir noch etwas gehen?, fragte sie.
– Nein, gar nicht, sagte Xavière; eine tragische Grimasse entstellte ihr Gesicht. Ich hasse nur die Kälte.
– Das hättest du doch sagen sollen, rief Françoise. Wir gehen ins erste beste Café, das wir geöffnet finden.
– Nein, nein, wir wollen ruhig spazieren gehen, wenn du nun einmal Lust dazu hast, sagte Xavière mit standhafter Selbstverleugnung.
– Ich habe gar nicht mehr solche Lust, sagte Françoise. Ich tränke gern einen heißen Kaffee.
Sie verlangsamten jetzt den Schritt; in der Nähe vom Bahnhof Montparnasse, Ecke Rue d’Odessa, drängten sich Menschen an der Theke eines Café Biard. Françoise ging hinein und setzte sich ganz hinten in eine Ecke.
– Zwei Kaffee, bestellte sie.
An einem der Tische schlief, völlig vornübergesunken, eine Frau; Handkoffer und Bündel bedeckten den Boden; an einem anderen Tisch saßen drei bretonische Bauern und schlürften bedächtig ihren Calvados. Françoise blickte auf Xavière.
– Ich verstehe dich nicht, sagte sie.
Xavière warf ihr einen beunruhigten Blick zu.
– Ärgerst du dich über mich?
– Ich bin enttäuscht, sagte Françoise. Ich hatte geglaubt, du würdest den Mut finden, meinen Vorschlag anzunehmen.
Xavière zögerte mit der Antwort; gequält schaute sie sich nach allen Seiten um.
– Ich will keine Gesichtsmassagen machen, stieß sie schließlich gequält hervor.
Françoise musste lachen.
– Aber niemand zwingt dich dazu. Ich könnte auch eine andere Beschäftigung für dich finden, als Mannequin zum Beispiel; oder am besten lernst du wirklich Stenographie.
– Ich will aber nicht Stenotypistin oder Mannequin werden, erklärte Xavière aufgebracht.
Françoise war jetzt wirklich mit ihrer Weisheit zu Ende.
– Ich habe mir vorgestellt, dass das nur ein Anfang sein sollte. Wenn du erst einmal irgendeine Stelle hättest, könntest du ja immer noch sehen. Was würde dich denn tatsächlich interessieren? Studieren oder Zeichnen oder Theaterspielen?
– Ich weiß nicht, meinte Xavière. Überhaupt nichts Bestimmtes. Muss man denn absolut etwas tun?, fragte sie nicht ohne Überheblichkeit.
– Ein paar Stunden langweilige Arbeit scheint mir doch kein zu hoher Preis für deine Selbständigkeit, sagte Françoise.
Xavières Miene drückte tiefen Widerwillen aus.
– Ich hasse diese Art von Rechnung, sagte sie; wenn man nicht leben kann, wie man möchte, soll man überhaupt nicht leben.
– In Wirklichkeit wirst du dich nie umbringen, sagte Françoise nachgerade etwas weniger freundlich. Da könntest du ebenso gut versuchen, zu leben wie andere Leute auch.
Sie nahm einen Schluck von dem Kaffee; es war so richtig ein Kaffee der ersten Morgenstunden, bitter und stark gezuckert, von der Art, wie man ihn auf dem Bahnsteig nach einer durchreisten Nacht oder in einem Landgasthaus vor dem Warten auf den ersten Omnibus bekommt. Der fade Erdgeschmack stimmte Françoise etwas nachsichtiger.
– Wie müsste denn dein Leben sein, damit es dir selbst gefiele?, fragte sie wesentlich freundlicher.
– Wie es war, als ich klein war, sagte Xavière.
– So, dass die Dinge an dich herankommen, ohne dass du sie aufsuchen musst? Wie früher, als dein Vater dich auf seinem großen Pferd mitnahm?
– Ach, ich denke noch an viele andere Augenblicke, meinte Xavière. Wenn er mich früh um sechs mit auf Jagd nahm, und auf dem Gras waren ganz frische Spinnweben. Das war wunderbar.
– Aber in Paris, sagte Françoise, würdest du ebenso starke Freuden finden. Denke doch, Musik, Theater, Tanzen.
– Und ich müsste es machen wie deine Freundin: aufpassen, wie viel ich trinke, und immer auf die Uhr sehen, weil ich am nächsten Morgen wieder an die Arbeit muss.
Françoise fühlte sich verletzt; auch sie hatte auf die Uhr gesehen. ‹Es ist, als wäre sie böse auf mich; aber warum denn nur?›, dachte sie. Diese neue Xavière, missmutig und unberechenbar, interessierte sie.
– Schließlich findest du dich jetzt mit einer Existenz ab, die viel kümmerlicher ist als die ihrige, sagte sie. Und zehnmal weniger frei. Im Grunde ist es einfach so, dass du Angst hast; vielleicht nicht einmal vor deinen Angehörigen; aber du hast Angst, deine kleinen Gewohnheiten aufzugeben, Angst vor der Freiheit.