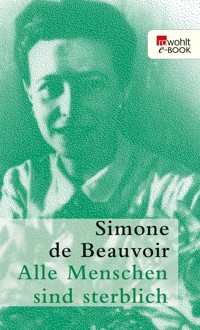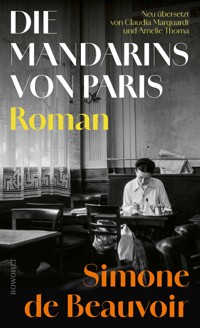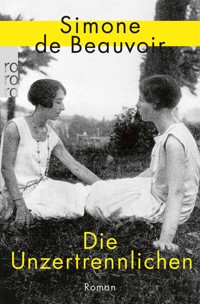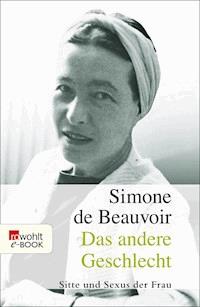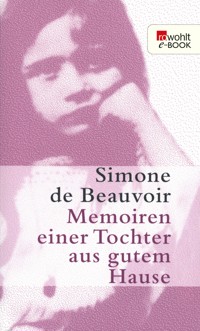9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«Simone de Beauvoir gehört zu jenen außergewöhnlichen Menschen, die ihre Zeit geprägt haben. Ihr Leben, ihre Werke und ihre Kämpfe haben zum Fortschritt des Bewußtseins der Männer und Frauen von heute in Frankreich und in der Welt beigetragen.» (François Mitterrand) «Eines der eindrücklichsten Bücher von Simone de Beauvoir handelt vom Tod ihrer eigenen Mutter. Die Schriftstellerin erzählt, wie sie tage- und nächtelang am Sterbebett weilte und wachte; wie sie der Frau, die ihr das Leben geschenkt hatte, in den allerletzten Tagen näherkam. Dem Buch gab Simone de Beauvoir einen wehmütigen, beinahe staunenden Titel: ‹Une mort très douce›. Jetzt ist sie, 78 Jahre alt, ‹so sanft› entschlafen.» (Die ZEIT)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Simone de Beauvoir
Ein sanfter Tod
Über dieses Buch
«Simone de Beauvoir gehört zu jenen außergewöhnlichen Menschen, die ihre Zeit geprägt haben. Ihr Leben, ihre Werke und ihre Kämpfe haben zum Fortschritt des Bewusstseins der Männer und Frauen von heute in Frankreich und in der Welt beigetragen.» (François Mitterrand)
«Eines der eindrücklichsten Bücher von Simone de Beauvoir handelt vom Tod ihrer eigenen Mutter. Die Schriftstellerin erzählt, wie sie tage- und nächtelang am Sterbebett weilte und wachte; wie sie der Frau, die ihr das Leben geschenkt hatte, in den allerletzten Tagen näherkam. Dem Buch gab Simone de Beauvoir einen wehmütigen, beinahe staunenden Titel: ‹Une mort très douce›. Jetzt ist sie, 78 Jahre alt, ‹so sanft› entschlafen.» (Die ZEIT)
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1964 unter dem Titel «Une Mort très douce» bei Librairie Gallimard, Paris.
Das Umschlagfoto zeigt Simone de Beauvoir mit ihrer Mutter (1954).
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2014
Copyright © 1965 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Une Mort très douce» Copyright © 1964 by Éditions Gallimard, Paris
Umschlaggestaltung
ISBN 978-3-644-03281-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Am Donnerstag, dem ...
Dass meine Mutter ...
Kaum war ich ...
Mittags rief ich ...
Ihr Leben lang ...
Was wäre geschehen, ...
Poupette übernachtete bei ...
Warum hat der ...
Meiner Schwester
Geh nicht so fügsam in die gute Nacht,
Nein, brennen soll das Alter,
Wenn der Tag sich neigt,
Wüte, ja wüte gegen das Sterben des Lichts.
Dylan Thomas
Am Donnerstag, dem 24. Oktober 1963, um vier Uhr nachmittags, war ich in meinem Zimmer im Hotel Minerva in Rom; ich sollte am nächsten Morgen wieder nach Hause fliegen und ordnete gerade Papiere, als das Telefon klingelte. Aus Paris rief mich Bost an: «Ihre Mutter hat einen Unfall erlitten», sagte er. Ich dachte: Ein Auto hat sie überfahren. Auf ihren Stock gestützt, ist sie mühsam vom Fahrdamm auf den Bürgersteig gehumpelt, und ein Auto hat sie überfahren. «Sie ist im Badezimmer hingefallen und hat sich den Schenkelhalsknochen gebrochen», sagte Bost. Er wohnte im selben Haus wie sie. Als er am Abend vorher gegen zehn Uhr mit Olga die Treppe hinaufgegangen war, hatten sie vor sich drei Leute bemerkt, eine Dame und zwei Polizisten. «Es ist über dem zweiten Stock», sagte die Dame. Ob Frau de Beauvoir etwas zugestoßen sei? Ja. Sie sei hingefallen. Zwei Stunden lang war sie auf dem Boden herumgekrochen, bevor sie das Telefon erreichte. Sie hatte eine Freundin, Frau Tardieu, gebeten, die Tür einschlagen zu lassen. Bost und Olga hatten die Gruppe bis in die Wohnung begleitet. Sie hatten Mama in ihrem Morgenrock aus rotem Cordsamt auf dem Fußboden vorgefunden. Frau Dr. Lacroix, die im Hause wohnt, hatte einen Bruch des Schenkelhalsknochens festgestellt; Mama war in die Unfallstation des Boucicaut-Krankenhauses gebracht worden und hatte die Nacht in einem Krankensaal verbracht. «Ich lasse sie aber in die C.-Klinik überführen», sagte mir Bost; «dort operiert einer der besten Knochenchirurgen, Professor B. Sie hat widersprochen; sie hatte Angst, es würde für Sie zu kostspielig. Schließlich aber habe ich sie überzeugen können.»
Arme Mama! Fünf Wochen davor, bei meiner Rückkehr aus Moskau, hatte ich mit ihr zusammen gegessen; wie gewöhnlich sah sie schlecht aus. Vor nicht allzu langer Zeit hatte sie sich geschmeichelt, dass man ihr ihr Alter nicht anmerke; jetzt freilich war darüber keine Täuschung möglich: Sie war eine sehr verbrauchte Frau von siebenundsiebzig Jahren. Trotz der Kuren in Aix-les-Bains und der Massagen hatte sich das Hüftleiden, das sich nach dem Kriege bemerkbar gemacht hatte, von Jahr zu Jahr verschlimmert: Sie brauchte eine ganze Stunde dazu, eine Runde um den Häuserblock zu machen. Trotz der sechs Aspirintabletten, die sie täglich nahm, war sie leidend und schlief schlecht. Seit zwei oder drei Jahren, besonders seit dem letzten Winter, hatte ich sie immer mit bläulichen Ringen um die Augen gesehen, mit spitzer Nase und eingefallenen Wangen. Nichts Ernstes, sagte ihr Arzt, Doktor D.: Leberbeschwerden und Darmträgheit; er verschrieb ihr einige Arzneien und Tamarindenmarmelade gegen die Verstopfung. Damals war ich gar nicht erstaunt, dass sie sich «kaputt» fühlte; mich bekümmerte aber, dass sie einen schlechten Sommer verbracht hatte. Sie hätte den Sommer über in einem Hotel oder in einem Kloster, das Pensionsgäste aufnahm, leben können. Doch sie rechnete damit, wie jedes Jahr von meiner Cousine Jeanne nach Meyrignac eingeladen zu werden, oder nach Scharrachbergen, wo meine Schwester wohnte. Beiden war das nicht möglich gewesen. Sie war im leeren, regnerischen Paris geblieben. «Mich, die ich niemals Trübsal geblasen habe, hat es erwischt», sagte sie. Zum Glück hatte meine Schwester sie kurz nach meiner Durchreise für zwei Wochen im Elsass bei sich aufgenommen. Jetzt waren ihre Freunde wieder in Paris, und ich kam auch zurück; ohne diesen Knochenbruch hätte ich sie sicherlich bei heiterer Stimmung wiedergefunden. Ihr Herz war in ausgezeichnetem Zustand, ihr Blutdruck der einer jungen Frau: Einen gewaltsamen Unfall hatte ich für sie nie befürchtet.
Gegen sechs Uhr rief ich sie in der Klinik an. Ich sagte ihr, ich sei zurückgekommen, und kündigte ihr meinen Besuch an. Sie antwortete mir mit unsicherer Stimme. Professor B. nahm den Hörer: Er würde sie am Samstagmorgen operieren.
«Du hast mir zwei Monate lang nicht geschrieben», sagte sie, als ich auf ihr Bett zuging. Ich widersprach: Wir hätten uns doch wiedergesehen, von Rom aus hätte ich ihr geschrieben. Mit ungläubiger Miene hörte sie mir zu. Ihre Stirn und ihre Hände glühten, ihr leicht verzerrter Mund brachte nur mühsam Worte hervor, und geistig war sie getrübt. War das die Wirkung des Aufschlags? Oder war im Gegenteil ihr Sturz durch einen Schwächeanfall hervorgerufen worden? Sie hatte immer einen Tic gehabt. (Nein, immer nicht, aber seit langem schon. Seit wann?) Sie zwinkerte mit den Augen, ihre Brauen zogen sich nach oben, ihre Stirn legte sich in Falten. Während meines Besuches ließ diese unruhige Bewegung kein einziges Mal nach. Und wenn ihre glatten gewölbten Augenlider zufielen, bedeckten sie ihre Augäpfel völlig. Dr. J., ein Assistenzarzt, kam vorbei und sagte, die Operation sei nicht nötig, der Schenkelknochen habe sich nicht verschoben, drei Monate Ruhe, und er sei wieder angeheilt. Mama schien erleichtert. Unzusammenhängend erzählte sie von ihrer Anstrengung, zum Telefon zu kommen, von ihrer Angst und von Bosts und Olgas Hilfsbereitschaft. Im Morgenrock, ohne Gepäck, war sie ins Boucicaut-Krankenhaus gebracht worden; sie konnte nichts mitnehmen. Am nächsten Tage hatte Olga ihr Toilettengegenstände gebracht, Kölnischwasser und ein hübsches weiß-wollenes Bettjäckchen. Als Mama ihr dankte, hatte Olga erwidert: «Aber gnädige Frau, ich tue das, weil ich Sie gern habe.» Mama wiederholte mehrmals träumerisch und noch ganz erfüllt: «Sie hat gesagt, ich tue das, weil ich Sie gernhabe.»
«Sie war so bestürzt darüber, Umstände zu machen, so überschwänglich dankbar für das, was man für sie tat: Es zerriss einem das Herz», sagte Olga abends zu mir. Entrüstet erzählte sie von Dr. D. Verstimmt darüber, dass man Frau Dr. Lacroix gerufen hatte, hatte er abgelehnt, Mama am Donnerstag im Krankenhaus zu besuchen. «Ich habe zwanzig Minuten am Telefon gehangen», sagte Olga. «Nach diesem Schock, nach dieser Nacht im Krankenhaus hätte Ihre Mutter Zuspruch von dem ihr vertrauten Arzt gebraucht. Er wollte von nichts wissen.» Bost glaubte nicht, dass Mama einen Anfall erlitten habe: Als er ihr hochgeholfen hatte, war sie etwas verstört, aber bei klarem Bewusstsein gewesen. Allerdings bezweifelte er, dass sie innerhalb von drei Monaten wiederhergestellt würde: Für sich genommen sei der Bruch des Schenkelhalsknochens nicht bedenklich; aber lange Unbeweglichkeit rufe Schorfwunden hervor, die bei alten Menschen nicht zuheilten. Die Bettlägerigkeit erschöpfe die Lungen, und der Kranke könne sich eine Lungenentzündung zuziehen, die ihn hinwegraffe. Mich beunruhigte das nicht sonderlich. Trotz ihres körperlichen Schadens war meine Mutter robust. Und letzten Endes war sie in dem Alter, wo man stirbt.
Bost hatte meiner Schwester Bescheid gesagt, mit der ich mich am Telefon lange unterhielt. «Darauf war ich gefasst», sagte sie. Im Elsass hatte sie Mama so gealtert und geschwächt gefunden, dass sie zu Lionel gesagt hatte: «Den Winter wird sie nicht überstehen.» Eines Nachts hatte Mama heftige Unterleibsschmerzen gehabt: Fast hätte sie verlangt, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Doch am nächsten Morgen hatte sie sich wieder erholt. Und als sie sie im Wagen zurückgebracht hatten – «begeistert, entzückt» von ihrem Aufenthalt –, war sie wieder zu Kräften gekommen und hatte ihre Heiterkeit wiedergefunden. Mitte Oktober jedoch, etwa zehn Tage vor ihrem Unfall, hatte Francine Diato meine Schwester angerufen: «Eben habe ich bei Ihrer Mutter gegessen. Ich fand ihren Zustand so schlecht, dass ich Ihnen Bescheid sagen wollte.» Unter einem Vorwand war meine Schwester nach Paris gekommen und hatte Mama zu einem Röntgenarzt gebracht. Nach Prüfung der Aufnahmen hatte ihr der Arzt kategorisch erklärt: «Es besteht kein Grund zur Besorgnis: Am Darm hat sich ein Divertikel gebildet, eine Tasche voller Exkremente, die die Entleerung erschwert. Außerdem isst Ihre Mutter zu wenig, was Mangelerscheinungen zur Folge haben kann: In Gefahr ist sie aber nicht.» Er hatte Mama geraten, sich besser zu ernähren, und hatte ihr neue, sehr wirksame Heilmittel verordnet. «Trotzdem war ich besorgt», sagte Poupette. «Ich habe Mama gebeten, eine Nachtschwester zu nehmen. Sie hat das nicht gewollt. Die Vorstellung, dass eine Unbekannte bei ihr schliefe, war ihr unerträglich.» Poupette und ich kamen überein, sie sollte zwei Monate später nach Paris kommen, wenn ich nach Prag reisen würde.
Am nächsten Tage war Mamas Mund noch entstellt, und sie konnte nur mit Mühe sprechen; ihre langen Lider verschleierten ihre Augen, und ihre Brauen zuckten. Ihr rechter Arm, den sie sich zwanzig Jahre früher bei einem Sturz vom Fahrrad gebrochen hatte, war schlecht geheilt; ihr gerade erst erlittener Sturz hatte ihren linken Arm steif gemacht: Beide konnte sie kaum bewegen. Zum Glück wurde sie mit größter Sorgfalt gepflegt. Ihr Zimmer ging auf einen Garten weitab vom Straßenlärm. Das Bett war umgestellt worden und stand jetzt mit der Längsseite am Fenster, sodass sich das an der Wand angebrachte Telefon in ihrer Reichweite befand. Ihr Oberkörper wurde durch Kissen hochgehalten, sodass sie eher saß als lag: So würden ihre Lungen nicht überanstrengt. Ihre Luftmatratze, die mit einem elektrischen Apparat verbunden war, vibrierte und massierte sie: So würden die Schorfwunden vermieden. Jeden Morgen kam eine Krankengymnastin, um ihre Beine in Bewegung zu halten. Die von Bost angedeuteten Gefahren schienen gebannt. Mit leicht schläfriger Stimme erzählte Mama, dass ein Zimmermädchen ihr das Fleisch schneide, ihr beim Essen helfe und die Mahlzeiten vorzüglich seien. Im Boucicaut-Krankenhaus dagegen habe man ihr Blutwurst mit Kartoffeln vorgesetzt! «Blutwurst! Für die Kranken!» Sie war gesprächiger als am Tage davor. Noch einmal machte sie die zwei angsterfüllten Stunden durch, in denen sie am Boden gelegen und nicht gewusst hatte, ob es ihr gelingen würde, das Telefonkabel zu erreichen und den Apparat zu sich heranzuziehen. «Einmal, als wir allein waren, habe ich zu Frau Marchand gesagt: ‹Ein Glück, dass es das Telefon gibt.› Sie antwortete: ‹Man muss aber auch herankommen können.›» Sentenziös wiederholte Mama mehrmals die letzten Worte und fügte hinzu: «Wenn ich nicht drangekommen wäre, dann wäre ich verloren gewesen.»
Hätte sie so laut rufen können, dass man sie gehört hätte? Nein, sicherlich nicht. Ich stellte mir ihre Notlage vor. Sie glaubte an den Himmel; doch trotz ihres Alters, ihrer Gebrechen und Beschwerden war sie ungestüm der Erde verhaftet und empfand vor dem Tode ein animalisches Grauen. Meiner Schwester hatte sie von einem Albtraum erzählt, der immer wiederkehrte: «Ich werde verfolgt, ich laufe und laufe und stoße gegen eine Mauer; ich muss über diese Mauer springen und weiß nicht, was dahinter ist; ich habe Angst. Der Tod selbst erschreckt mich nicht: Ich habe Angst vor dem Sprung», hatte sie zu meiner Schwester gesagt. Als sie auf dem Fußboden kroch, glaubte sie, der Augenblick für den Sprung sei gekommen. Ich fragte sie: «Hast du dir sehr weh getan, als du hinfielst?» «Nein. Das weiß ich nicht mehr. Es tat mir nicht einmal weh.» Sie hat also das Bewusstsein verloren, dachte ich. Sie erinnerte sich daran, ein Schwindelgefühl empfunden zu haben, und fügte hinzu, sie habe einige Tage vorher, nachdem sie eines der neuen Medikamente genommen, gespürt, wie ihre Beine versagten: Sie habe sich gerade noch rechtzeitig auf das Sofa legen können. Misstrauisch sah ich mir die Flaschen an, die sie sich – mit verschiedenen anderen Sachen zusammen – von unserer jungen Cousine Marthe Cordonnier aus ihrer Wohnung hatte bringen lassen. Ihr lag daran, mit dieser Behandlung fortzufahren: War das richtig?
Gegen Abend besuchte sie Professor B., und ich begleitete ihn in den Korridor hinaus: Wenn meine Mutter erst wiederhergestellt sei, sagte er, werde sie nicht schlechter laufen können als früher. «Sie wird ihre bescheidene frühere Lebensweise wiederaufnehmen können.» Ob er nicht glaube, dass sie einen Schlaganfall erlitten habe? Das glaubte er keineswegs. Er schien fassungslos, als ich ihm mitteilte, sie leide unter Darmbeschwerden. Das Krankenhaus hatte ihm einen Schenkelhalsbruch gemeldet, und daran hatte er sich gehalten. Er würde sie von einem Internisten untersuchen lassen.
«Du wirst genauso gut laufen können wie früher», sagte ich zu Mama. «Du wirst dein früheres Leben wiederaufnehmen können.» «In diese Wohnung werde ich nie wieder meine Füße setzen. Ich will sie nicht wiedersehen. Niemals. Um nichts auf der Welt.»
Auf diese Wohnung war sie so stolz gewesen! Die andere, in der rue de Rennes, war ihr zuwider geworden, seit mein Vater, der mit zunehmendem Alter hypochondrisch wurde, sie mit den Ausbrüchen seiner schlechten Laune erfüllt hatte. Nach seinem Tode – auch Großmutter war kurz danach gestorben – hatte Mama sich von ihren Erinnerungen befreien wollen. Mehrere Jahre vorher war eine ihrer Freundinnen in eine Atelierwohnung gezogen, und diese moderne Einstellung hatte Mama geblendet. Aus bekannten Gründen war es im Jahre 1942 leicht, eine Wohnung zu bekommen, und sie konnte ihren Traum verwirklichen: In der rue Blomet mietete sie eine Atelierwohnung mit einer Loggia. Sie verkaufte den Schreibtisch aus geschwärztem Birnbaum, das Esszimmer im Stile Henri II., das Ehebett und den Flügel; die anderen Möbel und ein Stück des alten roten Plüschs behielt sie. An die Wände hängte sie Bilder von meiner Schwester. In ihr Schlafzimmer stellte sie ein Sofa. Beschwingt ging sie die Innentreppe hinauf und hinunter. Eigentlich fand ich diese Wohnung nicht sehr anheimelnd: Sie lag im zweiten Stock, und trotz der großen Fenster drang wenig Licht hinein. In den oberen Räumen – Schlafzimmer, Küche, Bad – war es immer dunkel. Dort hielt Mama sich auf, seit jede Treppenstufe ihr ein Stöhnen entrang. Im Laufe von zwanzig Jahren waren Wände, Möbel, Teppiche, war alles verschmutzt und abgenutzt worden. Als die Wohnung im Jahre 1960 den Eigentümer gewechselt und Mama geglaubt hatte, ausziehen zu müssen, hatte sie erwogen, sich in ein Altersheim zurückzuziehen. Sie hatte aber nichts gefunden, was ihr zusagte, und hing auch an ihrem Zuhause. Als sie erfuhr, dass man sie nicht vor die Tür setzen dürfe, war sie in der rue Blomet geblieben. Doch jetzt würden ihre Freundinnen und ich für sie ein Altersheim suchen, wo sie sich einrichten könnte, sobald sie genesen wäre. «Du wirst niemals in die rue Blomet zurückkommen, das verspreche ich dir», sagte ich.
Am Sonntag hatte sie die Augen noch halb geschlossen, ihr