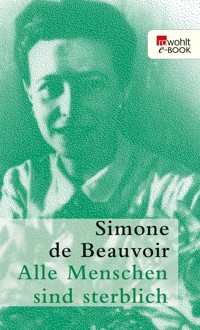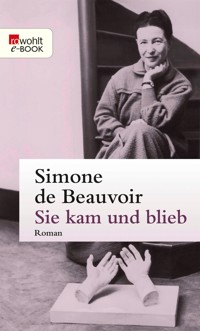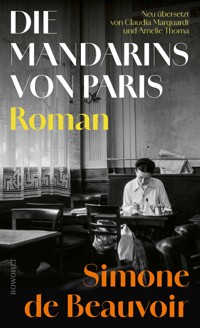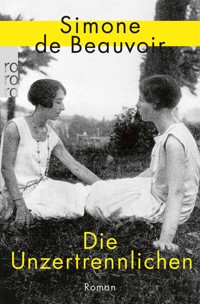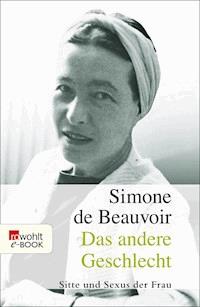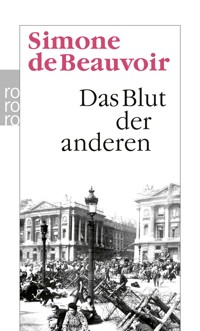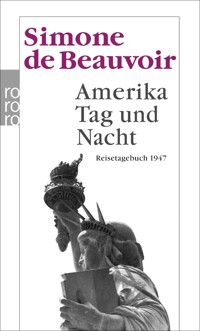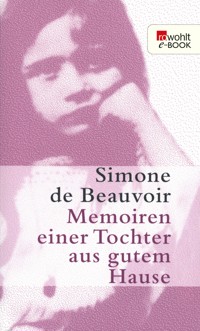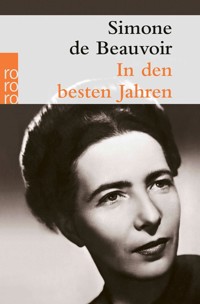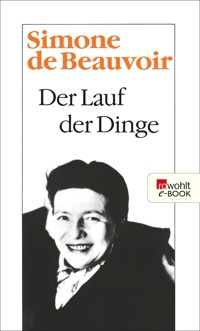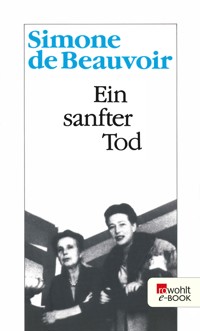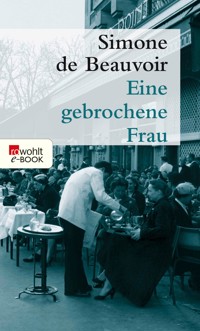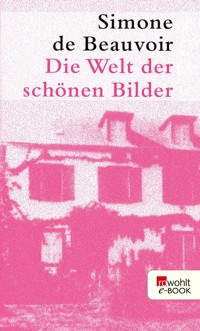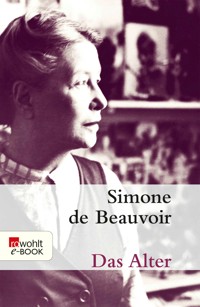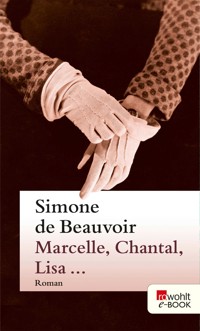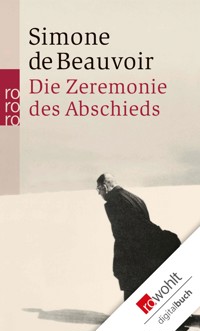
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Beauvoir: Memoiren
- Sprache: Deutsch
Die Zeremonie des Abschieds - Simone de Beauvoirs ergreifender Bericht über die letzten Lebensjahre Jean-Paul Sartres. In diesem ungewöhnlichen und meisterhaften Buch schildert Simone de Beauvoir die letzten zehn Jahre im Leben des bedeutenden Philosophen und Schriftstellers Jean-Paul Sartre. Sie berichtet von den intensiven Gesprächen, die sie im Sommer und Herbst 1974 in Rom und Paris mit ihm führte – über sein Leben und Werk, über Herkunft und Einflüsse, Liebe und Freundschaft, Freiheit und Glück, und schließlich über den Tod. De Beauvoir gewährt dem Leser einen intimen Einblick in Sartres Gedankenwelt und ihre enge Beziehung zu ihm. Mit großer Offenheit und Sensibilität zeichnet sie das Porträt eines Mannes, der wie kein anderer das philosophische Denken des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Die Zeremonie des Abschieds ist nicht nur eine zutiefst persönliche Hommage an Jean-Paul Sartre, sondern auch ein bedeutendes Zeugnis einer der wichtigsten intellektuellen Freundschaften unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 923
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Simone de Beauvoir
Die Zeremonie des Abschieds
August - September 1974
Über dieses Buch
Dieses Buch enthält den ergreifenden Bericht der Autorin über die letzten zehn Lebensjahre Jean-Paul Sartres und die Gespräche, die sie im Sommer und Herbst 1974 in Rom und Paris mit ihm führte – über sein Leben und Werk, über Herkunft und Einflüsse, Liebe und Freundschaft, Freiheit und Glück, über den Tod.
«Das in jeder Hinsicht ungewöhnliche und meisterhafte Buch ist die souveränste Arbeit, die Sartre nach seinem Tod gewidmet wurde.» (Wilfried Wiegand, Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Impressum
Die französische Originalausgabe erschien 1981 unter dem Titel «La Cérémonie des adieux suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre août–septembre 1974» bei den Éditions Gallimard, Paris.
Uli Aumüller übersetzte die Seiten 13–207 und 367–700, Eva Moldenhauer die Seiten 211–367.
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2012
Copyright © 1983 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«La Cérémonie des adieux suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre août–septembre 1974» Copyright © 1981 by Éditions Gallimard, Paris
Umschlaggestaltung any.way, Cathrin Günther
(Umschlagfoto: Foto von Jean-Paul Sartre: Antanas Sutkus. Courtesy: Anya Stonelake/White Space Gallery)
ISBN Buchausgabe 978-3-499-15747-9 (9. Auflage 2012)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-01761-0
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Die Zeremonie des Abschieds
Vorwort
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
Gespräche mit Jean-Paul Sartre
Vorwort
Simone de Beauvoir Sie ...
SdeB Setzen wir ...
SdeB Sie hatten ...
SdeB Auch als ...
SdeB Ich wollte ...
SdeB Warum lesen ...
SdeB Wir haben ...
SdeB Wir wollten ...
SdeB Wir haben ...
SdeB Ich möchte ...
SdeB Mir scheint, ...
SdeB Sprechen wir ...
SdeB Letztes Mal ...
SdeB Was können ...
SdeB Alle Leute, ...
SdeB Ihnen scheint ...
SdeB In unserem ...
SdeB Ich möchte, ...
SdeB Ich möchte ...
SdeB Sie haben ...
Für diejenigen,die Sartre geliebt haben,die ihn liebenund lieben werden
Die Zeremonie des Abschieds
Vorwort
Dies ist das erste – und wahrscheinlich das einzige – meiner Bücher, das Sie nicht gelesen haben werden, bevor es gedruckt wird. Es ist gänzlich Ihnen gewidmet und erreicht Sie nicht.
Als wir jung waren und wenn einer von uns am Ende einer hitzigen Diskussion lauthals triumphierte, sagte er zum anderen: «Sie sind in Ihrer kleinen Kiste!» Sie sind in Ihrer kleinen Kiste; Sie werden nicht herauskommen, und ich werde Ihnen nicht dorthin folgen: Selbst wenn man mich neben Ihnen beerdigt, wird kein Weg von Ihrer Asche zu meinen sterblichen Überresten führen.
Dieses Sie, das ich benutze, ist eine Illusion, ein rhetorischer Kunstgriff. Niemand hört es; ich spreche zu niemandem. In Wirklichkeit sind es die Freunde Sartres, die ich anspreche: jene, die mehr über seine letzten Lebensjahre erfahren möchten. Ich habe sie erzählt, so wie ich sie erlebt habe. Ich habe ein bisschen von mir gesprochen, denn der Chronist ist Teil seiner Chronik, aber so wenig wie möglich. Einmal, weil das nicht mein Thema ist; und zum andern trifft zu, was ich auf die Frage von Freunden, wie ich es aufnähme, als Antwort notierte: «Das kann man nicht sagen, das kann man nicht schreiben, das kann man nicht denken; das lebt man, das ist alles.»
Dieser Bericht basiert im Wesentlichen auf dem Tagebuch, das ich in den zehn Jahren geführt habe. Und auch auf zahlreichen Zeugenaussagen, die ich gesammelt habe. Ich danke all denen, die mir in schriftlicher oder mündlicher Form geholfen haben, das Ende Sartres aufzuzeichnen.
1970
Während seiner gesamten Existenz hat Sartre nie aufgehört, sich neu in Frage zu stellen. Ohne das zu verleugnen, was er seine «ideologischen Interessen» nannte, wollte er doch nicht in ihnen entfremdet werden, deshalb hat er oft gewählt, «gegen sich zu denken», indem er mühsame Anstrengungen machte, «Knochen in seinem Kopf zu zerbrechen». Die Ereignisse von ’68, in die er verwickelt gewesen ist und die ihn tief berührt haben, waren für ihn Anlass für eine neuerliche Revision; er fühlte sich als Intellektueller in Frage gestellt, und das veranlasste ihn in den beiden folgenden Jahren, über die Rolle des Intellektuellen nachzudenken und die Auffassung, die er von ihr hatte, zu modifizieren.
Er hat sich oft darüber geäußert. Bis dahin[a] hatte Sartre den Intellektuellen als «Techniker des praktischen Wissens» aufgefasst, der zerrissen war vom Widerspruch zwischen der Universalität des Wissens und dem Partikularismus der herrschenden Klasse, deren Produkt er war: Er verkörperte so das unglückliche Bewusstsein, wie Hegel es definiert. Seinem Gewissen mit ebendiesem schlechten Gewissen Genugtuung leistend, meinte er, es erlaube ihm, sich dem Proletariat zuzuordnen. Jetzt dachte Sartre, man müsse über dieses Stadium hinausgehen: Dem klassischen Intellektuellen stellte er den neuen Intellektuellen entgegen, der in sich das intellektuelle Moment negiert, um so einen neuen Status im Volk zu finden; der neue Intellektuelle sucht in der Masse aufzugehen, um der wirklichen Universalität zum Sieg zu verhelfen.
Noch ohne diese Richtlinie klar aufgezeichnet zu haben, hatte Sartre versucht, sie zu befolgen. Im Herbst ’68 hatte er die Herausgabe eines Blattes, Interluttes, übernommen, das, mal vervielfältigt, mal gedruckt, in den Aktionskomitees zirkulierte. Er war mehrmals mit Geismar zusammengetroffen und hatte sich lebhaft für eine Idee interessiert, die dieser ihm Anfang 1969 unterbreitet hatte: eine Zeitung herauszugeben, in der die Massen zu den Massen sprechen sollten, oder besser, in der das Volk, dort, wo seine Kämpfe es wieder konstituiert hatten, zu den Massen sprechen sollte, um sie in diesen Prozess einzubeziehen. Nach einem ersten Ansatz fiel das Projekt ins Wasser. Aber es kam zustande, als Geismar sich der Gauche Prolétarienne (G.P.) anschloss und Maoisten mit ihm La Cause du Peuple gründeten. Die Zeitung hatte keinen Besitzer. Sie wurde direkt oder indirekt von den Arbeitern geschrieben und von Aktivisten verkauft. Ihr Ziel war es, eine Vorstellung von den in Frankreich seit 1970 geführten Kämpfen der Arbeiter zu vermitteln. Sie zeigte sich häufig feindselig gegenüber Intellektuellen und anlässlich des Prozesses von Roland Castro[b] gegenüber Sartre selbst.
Durch Vermittlung Geismars traf Sartre jedoch mit mehreren Mitgliedern der G.P. zusammen. Als der Herausgeber von La Cause du Peuple, Le Dantec, dann der Stellvertretende Herausgeber, Le Bris, verhaftet wurden, weil in manchen Artikeln des Blattes heftige Angriffe gegen das Regime vorgebracht worden waren, schlugen Geismar und andere Sartre vor, deren Nachfolger zu werden. Er nahm ohne Zögern an, weil er meinte, das Gewicht seines Namens könnte den Maoisten nützlich sein. «Ich habe zynisch meine Bekanntheit in die Waagschale geworfen», sollte er später während eines Vortrags in Brüssel sagen. Von da an fühlten die Maoisten sich veranlasst, ihr Urteil und ihre Taktik in Bezug auf die Intellektuellen zu revidieren.
In Alles in allem[c] habe ich den Prozess gegen Le Dantec und Le Bris geschildert, der am 27. Mai stattfand und in dem Sartre als Zeuge aufgerufen wurde. Am selben Tag gab die Regierung die Auflösung der Gauche Prolétarienne bekannt. Kurz zuvor hatte in der Mutualité ein Meeting stattgefunden, bei dem Geismar das Publikum aufgerufen hatte, am 27. Mai auf die Straße zu gehen, um gegen den Prozess zu protestieren: Er sprach nur acht Minuten und wurde trotzdem festgenommen.
Die erste von Sartre herausgegebene Nummer von La Cause du Peuple war am 1. Mai 1970 erschienen. Die Staatsgewalt hielt sich nicht an ihn, sondern der Innenminister ließ jede Nummer an ihrer Quelle beschlagnahmen: Zum Glück gelang es dem Drucker, die meisten Exemplare vor der Beschlagnahmung herauszuschaffen. Daraufhin griff die Regierung sich die Verkäufer, die wegen Neubildung einer aufgelösten Vereinigung vor ein Sondergericht kamen. Ich habe auch erzählt, wie Sartre, ich und zahlreiche Freunde die Zeitung im Zentrum von Paris verkauft haben, ohne ernstlich behelligt zu werden. Eines Tages wurden die Autoritäten diesen vergeblichen Kampf leid, und La Cause du Peuple wurde an den Kiosken vertrieben. Eine Vereinigung der «Freunde von La Cause du Peuple» wurde gegründet, deren Vorsitz Michel Leiris und ich übernahmen. Zuerst wurde uns die Eintragung als Verein verweigert; wir mussten das Verwaltungsgericht anrufen, damit wir sie erhielten.
Im Juni beteiligte sich Sartre an der Gründung der Roten Hilfe, deren Hauptstützen Tillon und er waren. Ziel der Organisation war der Kampf gegen die Repression. In einem zum großen Teil von Sartre verfassten Text erklärte das Comité d’Initiative Nationale unter anderem:
«Die Rote Hilfe ist ein eingetragener, unabhängiger demokratischer Verein. Ihr Hauptziel ist die politische und juristische Verteidigung der Opfer der Repression und deren materielle und moralische Unterstützung sowie die Unterstützung ihrer Familien, ohne jedes Veto …
… Es ist nicht möglich, Gerechtigkeit und Freiheit zu verteidigen, ohne die Solidarität des Volkes zu organisieren. Die Rote Hilfe, aus dem Volk hervorgegangen, wird diesem bei seinem Kampf dienen.»
Die Organisation bestand aus den wichtigsten gauchistischen Gruppen, Témoignage chrétien und verschiedenen Persönlichkeiten. Ihre politische Plattform war sehr breit. Sie wollte sich hauptsächlich der von Marcellin nach der Auflösung der G.P. gestarteten Verhaftungswelle widersetzen. Eine große Zahl von militanten Genossen war in Haft. Informationen über ihren Fall mussten zusammengetragen und Aktionen erdacht werden. Die Rote Hilfe zählte mehrere tausend Mitglieder. Basiskomitees wurden in verschiedenen Pariser Vierteln und in der Provinz gebildet. Unter den Provinzkomitees war das in Lyon am aktivsten. In Paris befasste sich die Organisation besonders mit den Problemen der Gastarbeiter. Obwohl diese Gruppen im Prinzip politisch sehr eklektisch waren, waren es die Maoisten, die in ihnen die stärkste Aktivität entfalteten und sie mehr oder weniger in die Hand nahmen.
Wenn Sartre seinen politischen Aufgaben auch eifrig nachging, so widmete er doch den größten Teil seiner Zeit seiner literarischen Arbeit. Er beendete den dritten Band seines großen Werkes über Flaubert. 1954 hatte Roger Garaudy ihm vorgeschlagen: «Versuchen wir ein und dieselbe Person zu interpretieren, ich mit der marxistischen Methode, Sie mit der existentialistischen.» Sartre hatte Flaubert gewählt, den er in Was ist Literatur?[d] sehr schlechtgemacht hatte, der ihn jedoch betört hatte, als er seine Korrespondenz gelesen hatte: Was ihn an Flaubert anzog, war der dem Imaginären eingeräumte Vorrang. Sartre hatte damals ein Dutzend Hefte vollgeschrieben, dann eine Studie von tausend Seiten verfasst, die er 1955 aufgegeben hatte. 1968 bis 1970 nahm er sie wieder auf und schrieb sie vollständig um. Er gab ihr den Titel Der Idiot der Familie[e] und schrieb sie mit großer Energie flüssig herunter. «Es ging darum, eine Methode vorzuführen und einen Menschen.»
Er hat sich mehrfach über seine Absichten geäußert. In seinem Gespräch mit Contat und Rybalka erläuterte er, dass es sich nicht um eine wissenschaftliche Arbeit handle, da er nicht Definitionen benutze, sondern Begriffe, und der Begriff ja ein Denken ist, das Zeit in sich einführt: der Begriff der Passivität zum Beispiel. Er nahm Flaubert gegenüber eine empathische Haltung ein. «Das ist mein Ziel: zu beweisen, dass jeder Mensch vollständig erkennbar ist, vorausgesetzt, man benutzt die geeignete Methode und hat die nötigen Dokumente.» Er sagte auch: «Wenn ich zeige, wie Flaubert sich selbst nicht kennt und sich zugleich doch ausgezeichnet versteht, weise ich auf das hin, was ich das Erlebte (le vécu) nenne, das heißt, das Leben im Einverständnis mit sich selbst, ohne dass eine Erkenntnis, ein thetisches Bewusstsein angegeben wäre.»
Seine Maoisten-Freunde verurteilten dieses Unternehmen mehr oder weniger: Es wäre ihnen lieber gewesen, Sartre hätte irgendeine kämpferische Abhandlung oder einen großen volkstümlichen Roman geschrieben. Doch in der Hinsicht war er nicht bereit, irgendeinem Druck nachzugeben. Er verstand den Standpunkt seiner Genossen, teilte ihn aber nicht: «Wenn ich den Inhalt betrachte», sagte er in Bezug auf Der Idiot der Familie, «habe ich den Eindruck zu fliehen, wenn ich dagegen die Methode betrachte, habe ich das Gefühl, aktuell zu sein.»
In dem Vortrag, den er später in Brüssel hielt, kam er auf die Frage zurück. «Ich bin seit siebzehn Jahren an eine Arbeit über Flaubert gefesselt, die die Arbeiter nicht interessieren kann, da sie in einem komplizierten und bestimmt bürgerlichen Stil geschrieben ist … Ich bin daran gebunden, das soll heißen: Ich bin siebenundsechzig Jahre alt, ich arbeite daran, seit ich fünfzig bin, und vorher träumte ich davon … Insofern ich den Flaubert schreibe, bin ich ein Enfant terrible der Bourgeoisie, das zurückgewonnen werden muss.»
Sein Grundgedanke war, dass es in jedem beliebigen Moment der Geschichte, wie dessen sozialer und politischer Kontext auch sein mochte, wesentlich bliebe, die Menschen zu verstehen, und dass sein Essay über Flaubert dazu beitragen könnte.
Sartre war also mit seinen verschiedenen Engagements zufrieden, als wir, nach einem glücklichen Aufenthalt in Rom, im September 1970 nach Paris zurückkehrten. Er wohnte in einer nüchternen kleinen Wohnung in der zehnten Etage eines Hauses am Boulevard Raspail, gegenüber vom Friedhof Montparnasse und ganz in meiner Nähe. Er fühlte sich dort wohl. Er führte ein ziemlich von Gewohnheiten geprägtes Leben. Er sah regelmäßig alte Freundinnen: Wanda K., Michèle Vian und seine Adoptivtochter Arlette Elkaïm, bei der er zweimal in der Woche übernachtete. Die anderen Abende verbrachte er bei mir. Wir unterhielten uns, wir hörten Musik: Ich hatte mir eine umfassende Schallplattensammlung zugelegt, die ich jeden Monat erweiterte. Sartre interessierte sich sehr für die Wiener Schule – vor allem für Berg und Webern – und für zeitgenössische Komponisten: Stockhausen, Xenakis, Berio, Penderecki und viele andere. Aber er kehrte gern zu den großen Klassikern zurück. Er liebte Monteverdi, Gesualdo, die Opern von Mozart – vor allem Così fan tutte – und von Verdi. Während dieser «Kammerkonzerte» aßen wir ein hartgekochtes Ei oder eine Scheibe Schinken und tranken etwas Scotch. Ich wohne in einem «Künstlerstudio mit Loggia», wie die Definition der Immobilienagenturen lautet. Ich lebe tagsüber in einem großen Raum mit hoher Decke. Über eine Innentreppe gelangt man in ein Zimmer, das durch eine Art Balkon mit dem Badezimmer verbunden ist. Sartre schlief oben und kam morgens herunter, um mit mir Tee zu trinken. Manchmal holte ihn eine seiner Freundinnen, Liliane Siegel, ab und ging mit ihm in einem kleinen Bistro in der Nähe seiner Wohnung einen Kaffee trinken. Häufig besuchte Bost ihn abends bei mir. Ziemlich häufig auch Lanzmann, dem er sich durch viele Gemeinsamkeiten verbunden fühlte, trotz mancher Meinungsverschiedenheiten in der israelisch-palästinensischen Frage. Besonders liebte er die Samstagabende, die Sylvie mit uns verbrachte, und das sonntägliche Mittagessen, das wir zu dritt in der Coupole einnahmen. Ab und zu trafen wir auch verschiedene Freunde.
Nachmittags arbeitete ich bei Sartre. Ich wartete auf das Erscheinen von Das Alter und dachte an einen letzten Band meiner Memoiren. Er revidierte und überprüfte in Der Idiot der Familie das Porträt des Doktor Flaubert. Es war ein prächtiger Herbst, blau und golden: Das Jahr[f] versprach sehr schön zu werden.
Im September nahm Sartre an einem großen Meeting teil, das von der Roten Hilfe veranstaltet wurde, um das Massaker von König Hussein von Jordanien an den Palästinensern anzuprangern. Sechstausend Menschen waren gekommen. Sartre traf dort Jean Genet, den er lange nicht gesehen hatte. Genet hatte sich den Schwarzen Panthern angeschlossen, über die er im Nouvel Observateur einen Artikel geschrieben hatte, und war im Begriff, nach Jordanien zu fahren, wo er in ein Palästinenserlager gehen wollte.
Seit langem hatte Sartres Gesundheitszustand mich nicht mehr beunruhigt. Obwohl er täglich zwei Päckchen Boyard rauchte, hatte seine Gefäßerkrankung sich nicht verschlimmert. Sehr plötzlich, Ende September, hat die Angst mich überfallen.
An einem Samstagabend haben wir mit Sylvie bei «Dominique» gegessen, und Sartre hat viel Wodka getrunken. Wieder bei mir zu Haus, war er schläfrig, dann ist er fest eingeschlafen, wobei er seine Zigarette fallen ließ. Wir haben ihm nach oben in sein Zimmer geholfen. Am nächsten Morgen schien er bei bester Gesundheit und ist zu sich nach Hause gegangen. Aber als wir, Sylvie und ich, ihn um zwei Uhr zum Essen abholen wollten, stieß er gegen alle Möbel. Beim Verlassen der Coupole taumelte er, obwohl er sehr wenig getrunken hatte. Wir haben ihn im Taxi zu Wanda, in die Rue du Dragon, gebracht, und beim Aussteigen wäre er fast gestürzt.
Es war schon vorgekommen, dass er Schwindelanfälle hatte: 1968 in Rom, als er an der Piazza Santa Maria in Trastevere aus dem Auto stieg, hatte er so sehr geschwankt, dass Sylvie und ich ihn stützen mussten. Ohne dem große Bedeutung beizumessen, war ich erstaunt gewesen, denn er hatte nichts getrunken! Aber nie zuvor waren diese Störungen so ausgeprägt gewesen, und ich ahnte, wie ernst sie waren. In meinem Tagebuch habe ich notiert: «Dieses Studio, das seit meiner Rückkehr so heiter war, hat die Farbe gewechselt. Der schöne flauschige Teppich ruft Trauer wach. So wird man leben müssen, bestenfalls noch mit Momenten des Glücks und der Freude, aber mit der schwebenden Bedrohung: das Leben in Klammern gesetzt.»
Während ich diese Zeilen übertrage, wundere ich mich: Woher kam diese düstere Vorahnung? Ich denke, dass ich trotz meiner scheinbaren Ruhe seit mehr als zwanzig Jahren ständig auf der Hut gewesen war. Das erste Alarmzeichen war 1954, am Ende von Sartres Reise in die UdSSR, sein krankhaft erhöhter Blutdruck gewesen, der im Krankenhaus behandelt werden musste. Im Herbst 1958 hatte ich Angst[g] gehabt: Nur knapp war Sartre einem Anfall entronnen. Und seitdem bestand die Bedrohung weiter: Seine Arterien, seine Schlagäderchen seien zu eng, hatten mir die Ärzte gesagt. Jeden Morgen, wenn ich ihn wecken ging, vergewisserte ich mich schnell, dass er atmete. Ich war nicht wirklich beunruhigt; es war eher eine Wahnvorstellung, die aber etwas bedeutete. Sartres neue Beschwerden haben mich gezwungen, mir in dramatischer Weise eine Hinfälligkeit bewusstzumachen, von der ich im Grunde genau wusste.
Am nächsten Tag hatte Sartre sein Gleichgewicht annähernd wiedergefunden und hat seinen Hausarzt, Doktor Zaidmann, aufgesucht, der Untersuchungen anordnete und Sartre empfahl, sich bis zur Untersuchung durch einen Spezialisten am Sonntag darauf nicht anzustrengen. Dieser Spezialist, Professor Lebeau, hat sich nicht eindeutig äußern wollen: Die Gleichgewichtsstörungen konnten durch eine Störung im Innenohr oder im Gehirn verursacht sein. Auf seinen Vorschlag hin wurde ein Enzephalogramm gemacht, das keine Anomalie zeigte.
Sartre war erschöpft: Er hatte einen Abszess am Mund, und eine Grippe war im Anzug. Aber mit unbändiger Freude hat er Gallimard am 8. Oktober das voluminöse Manuskript des Flaubert übergeben.
Die Maoisten hatten für ihn eine Reise nach Fos-sur-Mer und in andere Industriezentren organisiert, damit er dort die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter studieren konnte. Am 15. Oktober haben seine Ärzte ihm die Reise untersagt. Außer Zaidmann hatte er Spezialisten aufgesucht, die seine Augen, Ohren, seinen Schädel und sein Gehirn untersucht hatten: nicht weniger als elf Arztbesuche. Sie hatten schwere Durchblutungsstörungen in der linken Gehirnhälfte (dem Sitz der Sprache) und eine Verengung der Blutgefäße festgestellt. Er sollte weniger rauchen und sich eine Reihe stärkender Spritzen geben lassen. In zwei Monaten sollte noch ein Enzephalogramm gemacht werden. Wahrscheinlich wäre er dann geheilt. Aber er durfte sich nicht überanstrengen, vor allem körperlich. Tatsächlich hatte er jetzt, wo der Flaubert fertig war, keinen Grund, sich anzustrengen. Er las Manuskripte, Kriminalromane und träumte vage von einem Theaterstück. In diesem Oktober schrieb er auch ein Vorwort für die Ausstellung von Rebeyrolle, der dieser den Titel Coexistences gegeben hatte. Wir liebten seine Bilder sehr. Er hatte zwei Tage mit uns in Rom verbracht und unsere größten Sympathien gewonnen. Als wir seine Frau kennenlernten, eine lebhafte und witzige kleine Armenierin, fanden wir auch sie sehr sympathisch. Wir sollten sie in den folgenden Jahren ziemlich häufig wiedersehen. Sie waren mit Franqui befreundet, dem Journalisten, der uns 1960 nach Kuba eingeladen hatte und der inzwischen ins Exil gegangen war, weil er in Opposition zu Castros prosowjetischer Politik stand.
Trotz seiner gesundheitlichen Beschwerden setzte Sartre seine politischen Aktivitäten fort. Zu der Zeit fand bei Simon Blumenthal, dem Drucker von La Cause du Peuple, die Aktion statt, über die ich in Alles in allem berichtet habe. Durch Geismar hatte Sartre Glucksmann kennengelernt: Sartre hat ihm ein Interview gegeben, in dem er die in La Cause du Peuple abgedruckte Analyse der Arbeiterkämpfe in Frankreich wiederaufnahm. (Dieses Gespräch wurde am 22. Oktober vom Hessischen Rundfunk gesendet.)
Am 21. Oktober fand der Prozess gegen Geismar statt. Bei dem Meeting, an dem er sich beteiligt hatte, um gegen die Verhaftung von Le Dantec und Le Bris zu protestieren, hatten die fünftausend Anwesenden gerufen: «Am 27. alle auf die Straße!» Mehrere Redner waren aufgetreten: Einzig Geismar war verhaftet worden, offensichtlich wegen seiner Zugehörigkeit zur G.P. Die Demonstration vom 27. war übrigens unblutig verlaufen: Die C.R.S.[h] hatte Tränengas eingesetzt, die Demonstranten hatten ein paar Schraubenbolzen geworfen, niemand war verletzt worden. Nichtsdestoweniger wurde ein drastischer Urteilsspruch erwartet. Sartre war als Zeuge vorgeladen. Aber anstatt vor der bürgerlichen Justiz die konventionelle Rolle zu spielen, die ihm zugewiesen war, zog er es vor, in Billancourt vor Arbeitern zu sprechen. Die Direktion erlaubte ihm nicht, die Fabrik zu betreten. Auf der anderen Seite hatte die KP um acht Uhr morgens ein Flugblatt verteilen lassen, das die Renault-Arbeiter vor ihm warnte. Er sprach draußen auf einer Tonne stehend durch ein Megaphon vor einem ziemlich kleinen Publikum: Ihr müsst sagen, ob die Aktion von Geismar gut ist oder nicht. Ich will auf der Straße aussagen, weil ich ein Intellektueller bin und weil ich denke, dass die Verbindung zwischen dem Volk und den Intellektuellen, die im 19. Jahrhundert bestand – nicht immer, die aber zu sehr guten Ergebnissen geführt hat –, heute wiederhergestellt werden sollte. Seit fünfzig Jahren sind das Volk und die Intellektuellen getrennt, sie müssen jetzt wieder eins werden.»
Sartres Gegner bemühten sich nach Kräften, seinen Auftritt lächerlich zu machen. Die KP hielt ihm entgegen, die Verbindung zwischen dem Volk und den Intellektuellen sei gesichert, da diese sich in großer Zahl in der Partei einschrieben. Indessen wurde Geismar zu achtzehn Monaten Haft verurteilt.
Sartre beteiligte sich an der Konzeption einer neuen Zeitung, J’accuse, deren Null-Nummer am 1. November erschien. Er stand dem Team, das sie herausgab, nahe, unter anderen Linhart, Glucksmann, Michèle Manceaux, Fromanger, Godard. Diese Zeitung wurde nicht von militanten Genossen redigiert, sondern veröffentlichte große Reportagen von Intellektuellen. Sartre schrieb einige Artikel für sie. Nur zwei Nummern folgten auf die erste: Die eine erschien am 15. Januar 1971, die andere am 15. März. Liliane Siegel war unter ihrem Mädchennamen Sendyk Herausgeberin. Sie blieb es, als J’accuse mit La Cause du Peuple fusionierte. Sie wurde also zusammen mit Sartre Mitherausgeberin von La Cause du Peuple – J’accuse. Und da die Regierung Sartre nicht verhaften wollte, war sie es, die sich zweimal auf der Anklagebank wiederfand, während Sartre zu ihren Gunsten aussagte.
Indessen machte seine Gesundheit mir weiter Sorgen. Wenn er langweilige Momente verbrachte – und er nahm allerhand Lästiges auf sich –, trank er zu viel. Abends und sogar tagsüber war er oft schläfrig. Professor Lebeau, den er am 5. November konsultierte, sagte, diese Schläfrigkeit käme von den Medikamenten, die ihm gegen seine Schwindelanfälle verschrieben worden waren, und verringerte die Dosen. Am 22. November wurde wieder ein Enzephalogramm gemacht, das ganz und gar zufriedenstellend ausfiel, und kurz darauf versicherte Lebeau Sartre, dass er vollständig geheilt sei, dass er nicht mehr als jeder andere von Schwindelanfällen bedroht sei. Er war froh darüber, aber eine Sorge blieb ihm: seine Zähne. Er sollte ein Gebiss bekommen und fürchtete sich davor, aus Angst, nicht mehr in der Öffentlichkeit reden zu können und aus naheliegenden symbolischen Gründen. Tatsächlich aber leistete der Zahnarzt ausgezeichnete Arbeit, und Sartre war wieder beruhigt.
Er hat sich über das Erscheinen des Buches von Contat und Rybalka Les Écrits de J.-P. Sartre gefreut. Er korrigierte die Fahnen von Der Idiot der Familie. Als er im Dezember dem Prozess gegen die Grubenleitung vorsaß, ging es ihm bestens.
In Alles in allem habe ich über diesen Prozess berichtet, aber da Sartre ihm viel Bedeutung beimaß, will ich hier darauf zurückkommen. Im Februar 1970 wurden in Hénin-Liétard bei einer Schlagwetterexplosion sechzehn Bergleute getötet und mehrere andere verletzt. Da die Verantwortung der Grubenleitung auf der Hand lag, warfen einige nicht identifizierte junge Leute zur Vergeltung Molotowcocktails in die Direktionsbüros und lösten einen Brand aus. Die Polizei verhaftete ohne die Spur eines Beweises vier Maoisten und zwei Vorbestrafte. Ihr Prozess sollte am Montag, dem 14. Dezember, stattfinden, und die Rote Hilfe berief für Sonnabend, den 12. Dezember, in Lens ein Volkstribunal ein.
Um diese Sitzung vorzubereiten, fuhr Sartre, begleitet von Liliane Siegel, zu einer Befragung der Bergleute nach Bruay, wo er bei einem ehemaligen Bergmann, einem den Maoisten sehr nahestehenden Genossen namens André wohnte. Dessen Frau Marie hatte zum Abendessen ein Kaninchen zubereitet, ein Gericht, das Sartre verabscheute, das er höflich aufgegessen und das ihm einen zweistündigen Asthmaanfall beschert hat. Am nächsten Tag hat er Joseph getroffen, einen älteren Genossen, der ebenfalls in der Gegend bekannt war, und andere Bergleute. Dann hat er im Außenbezirk von Douai mit July gesprochen, einem wichtigen Mitglied der Ex-G.P., den Sartre gern mochte, wenn ihm dessen Siegesgewissheit auch auf die Nerven ging. Er besuchte auch Eugénie Camphin, eine halbblinde alte Frau, Mutter und Ehefrau von Bergarbeitern, die der Résistance angehört hatten und von den Deutschen erschossen worden waren.
Der Prozess rollte also am 12. Dezember im Rathaus von Lens ab und brachte mit vernichtender Deutlichkeit die Verantwortung der Grubenleitung ans Licht. Sartre fasste die Verhandlung in einer nachdrücklichen Anklagerede zusammen, die er folgendermaßen schloss: «Ich schlage Ihnen folgende Ergebnisse vor: Der Staat als Arbeitgeber ist schuldig an dem Mord vom 4. Februar 1970. Die Direktion und die für Grube 6 verantwortlichen Ingenieure sind seine Vollstrecker. Folglich sind sie ebenfalls des vorsätzlichen Mordes schuldig. Sie entscheiden sich vorsätzlich lieber für die Ausbeute als für die Sicherheit, das heißt, sie stellen die Produktion von Sachen über Menschenleben.» Am darauffolgenden Montag fand der Prozess der angeblichen Brandstifter statt, und sie wurden freigesprochen.
Kurz zuvor hatte Sartre sich bereit erklärt, außer La Cause du Peuple zwei weitere gauchistische Zeitungen herauszugeben: Tout, das Organ von Vive la Révolution, und La Parole du Peuple.
1971
Anfang Januar liefen in der UdSSR und in Spanien zwei Prozesse ab, die viel Aufsehen erregten: der Prozess von Leningrad und der von Burgos. Am 16. Dezember 1970 erschienen elf Sowjetbürger, ein Ukrainer, ein Russe, neun Juden, vor dem Leningrader Gericht. Sie hatten geplant, ein Flugzeug zu entführen, um ihr Land zu verlassen. Aber sie wurden verraten und in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni, noch bevor sie zur Tat geschritten waren, in verschiedenen Städten verhaftet. Zwei von ihnen wurden zum Tode verurteilt: Kusnetzow, der das Komplott organisiert hatte, Dymschitz, ein Linienpilot, der die Bedienung des Flugzeugs übernehmen sollte, nachdem die Besatzung gefesselt und ausgebootet worden war. Sieben Angeklagte bekamen zwischen zehn und vierzehn Jahren Zwangsarbeit, zwei weitere vier und acht Jahre.[a] Am 14. Januar 1971 fand in Paris eine große Sympathiekundgebung für sie statt, an der Sartre teilnahm. Auch Laurent Schwarz, Madaule, unser israelischer Freund Eli Ben Gal waren dabei. Alle verurteilten den Antisemitismus der UdSSR.
Im Prozess von Burgos wurde gegen Basken verhandelt, die der ETA angehörten und von Franco der Verschwörung gegen den Staat beschuldigt wurden. Gisèle Halimi nahm als Beobachterin daran teil und berichtete in einem bei Gallimard veröffentlichten Buch darüber. Sie bat Sartre um ein Vorwort, das er sehr bereitwillig schrieb. Er erklärte die Problematik der Basken, schilderte ihren Kampf und insbesondere die Geschichte der ETA. Er entrüstete sich über die Repression des Franco-Regimes im Allgemeinen und im Besonderen über die Art und Weise, wie der Prozess von Burgos abgelaufen war. Bei dieser Gelegenheit entwickelte er an einem bestimmten Beispiel eine Idee, die ihm am Herzen lag: den Widerspruch zwischen einem abstrakten Allgemeinen – auf das die Regierungen sich berufen – und dem einzelnen und konkreten Allgemeinen, so wie es sich in den Völkern, gebildet aus Menschen von Fleisch und Blut, verkörpert. Das Letztere ist es, versicherte er, was die Revolten der Kolonisierten – von außen oder von innen – fördern wollen, und das Letztere ist gültig, denn es erfasst die Menschen in ihrer Situation, ihrer Kultur, ihrer Sprache und nicht als leere Definitionen.
Gegen den zentralistischen und abstrakten Sozialismus pries Sartre «einen anderen Sozialismus, dezentralistisch und konkret: So ist die einzelne Allgemeinheit der Basken, die die ETA mit Recht dem abstrakten Zentralismus der Unterdrücker entgegensetzt». «Geschaffen werden müsste», sagte er, «der sozialistische Mensch auf der Grundlage seines Bodens, seiner Sprache und sogar seiner wiederbelebten Sitten und Gebräuche: Nur so wird der Mensch allmählich aufhören, das Produkt seines Produkts zu sein, um endlich der Menschensohn zu werden.»
Im gleichen Sinne hat Sartre zwei Jahre später eine Nummer von Les Temps Modernes (August–September 1973) den Forderungen der Bretonen, der Okzitanier, allen vom Zentralismus unterdrückten Minderheiten gewidmet.
Geismar war in der Santé inhaftiert. Obwohl er einen relativ privilegierten Strafvollzug genoss, solidarisierte er sich mit den anderen politischen Gefangenen, die in einen Hungerstreik getreten waren und für die Strafgefangenen wie für sich selbst erträglichere Haftbedingungen forderten. Einige Gauchisten beschlossen ebenfalls zu hungern, um deren Forderungen zu unterstützen. Sie wurden von einem progressiven Priester in der Saint-Bernard-Kapelle der Gare Montparnasse aufgenommen. Michèle Vian war unter den Hungerstreikenden, die Sartre ziemlich häufig besuchte. Er begleitete sie, als sie nach 21 Tagen ihr Fasten abbrachen und versuchten, eine Unterredung mit Pleven zu bekommen. Zu geschwächt, um einen langen Marsch zu machen, fuhren sie im Auto zur Place de l’Opéra, von wo sie zu Fuß zur Place Vendôme gingen. Sie sprachen im Justizministerium vor, aber Pleven weigerte sich, sie zu empfangen. Später kapitulierte Pleven. Er bewilligte den Häftlingen, die den Hungerstreik gemacht hatten, besondere Haftbedingungen und versprach, die Lage der Strafgefangenen zu verbessern: ein Versprechen, das kaum gehalten worden ist.
Am 13. Februar ließ Sarte sich von seinen maoistischen Genossen überreden, an einem ziemlich dummen Streich teilzunehmen: der Besetzung der Sacré-Cœur. Während einer Demonstration der Roten Hilfe war ein Genosse von Vive la Révolution durch eine Tränengasgranate im Gesicht verletzt worden. Um die öffentliche Meinung wachzurütteln, beschloss die G.P., die Basilika zu besetzen. Sie rechneten auf die Zustimmung von Monsignore Charles. Begleitet von Jean-Claude Vernier, Gilbert Castro, Liliane Siegel, betrat Sartre die Kirche, in der sich einige Genossen befanden, und verlangte, Monsignore Charles zu sprechen. Der Priester, an den er sich wandte, sagte ihm, er werde sein Ersuchen übermitteln. Eine Viertelstunde verging, ohne dass er zurückkam. Und dann schlossen sich alle Türen, außer einer, und die Demonstranten, deren Zahl groß geworden war, fühlten sich in der Falle. Castro und Vernier packten Sartre und Liliane und versteckten sie in einer Ecke, während durch die offen gebliebene Tür eingedrungene C.R.S.-Kräfte wahllos auf alle einschlugen. Castro und Vernier gelang es, Sartre und Liliane hinauszuschaffen; sie ließen sie in Lilianes Auto steigen und setzten sie in einem Café ab. Als sie etwas später zurückkamen, erzählten sie, dass die Auseinandersetzung sehr heftig gewesen sei. Einem jungen Mann war der Schenkel von einem Gitterstab durchbohrt worden. Sartre, den ich am Abend mit Sylvie besuchte, fand diese ganze Geschichte verheerend: Sie konnte die Genossen, auf die schon ein paar Tage zuvor am Ende einer Demonstration brutal eingeschlagen worden war, nur demoralisieren. Am 15. Februar gab er zusammen mit Jean-Luc Godard zu dieser Affäre eine Pressekonferenz, über die die Zeitungen ausführlich berichtet haben. Am 18. Februar zog er sich von der Roten Hilfe zurück, bei der seiner Ansicht nach die Maoisten zu viel Einfluss gewonnen hatten.[b]
Wenige Tage später wurde die Affäre Guiot bekannt: Es handelte sich um einen Gymnasiasten, den man fälschlich beschuldigte, einen Polizisten geschlagen zu haben, und der «in flagranti» verhaftet worden war. Die Gymnasiasten protestierten massiv: Zu Tausenden setzten sie sich auf die Fahrbahn des Quartier Latin, wo eine Unmenge Polizeiwagen standen. Guiot wurde schließlich freigesprochen. Aber in den Straßen von Paris blieb die Atmosphäre geladen: Überall an den Mauern und Wänden sah man große Fotos des verunstalteten Deshayes. Mitte März kam es zu einer außerordentlich schweren Auseinandersetzung zwischen Gauchisten und dem Ordre Nouveau[c]: Viele Polizisten wurden verletzt.
Sartre verfolgte diese Unruhe aufmerksam. Seine Gesundheit schien sehr gut. Er korrigierte die Fahnen von Der Idiot der Familie. Er wohnte allen Sitzungen der Temps Modernes bei, die bei mir stattfanden.
Anfang April sind wir nach Saint-Paul-de-Vence gefahren, Sartre mit Arlette im Zug, ich mit Sylvie im Auto. Das Hotel, in dem wir abgestiegen sind, lag am Rande des Städtchens, das tagsüber von Touristen wimmelte, morgens und abends aber ruhig war, genauso köstlich, wie wir es in Erinnerung hatten. Arlette und Sartre waren in einem Nebengebäude untergebracht. Ich wohnte mit Sylvie in einem Häuschen hinten in einem mit Orangenbäumen bepflanzten Garten. Wir hatten ein großes Zimmer, das auf eine winzig kleine Terrasse hinausging, und einen geräumigen, weiß verputzten Salon mit freiliegenden Balken und schönen Bildern von Calder in lebhaften Farben. Möbliert war er mit einem langen Holztisch, einem Sofa, einem Buffet und ging auf den Garten. Hier verbrachte ich die meisten meiner Abende mit Sartre. Wir tranken Scotch und unterhielten uns. Zu Abend aßen wir etwas Wurst oder eine Tafel Schokolade. Zum Mittagessen dagegen führte ich ihn in gute Restaurants der Umgebung. Manchmal aßen wir alle vier zusammen.
Am ersten Abend hatten wir uns über helle Festbeleuchtungen auf dem Hügel gegenüber von Saint-Paul gewundert: Das waren Treibhäuser, die nachts grell mit elektrischem Licht beleuchtet wurden.
Nachmittags lasen wir oft, jeder in seinem Zimmer. Oder wir machten Ausflüge und besuchten Plätze wieder, die wir geliebt hatten: Unter anderem waren wir glücklich, Cagnes wiederzusehen und das reizende Hotel, in dem wir vor vielen Jahren eine wunderbare Zeit verbracht hatten. An einem Nachmittag sind wir in der Maeght-Galerie gewesen, die wir schon kannten. Dort lief eine Char-Ausstellung. Die Bilder, die man um seine Manuskripte und Bücher herum ausgestellt hatte, waren sehr schön: von Klee, Vieira da Silva, Giacometti und viele von Miró, dessen Werke immer stärker wurden, je älter er wurde.
Am letzten Tag hat Sartre im Hotel ein Aïoli bestellt, das wir mangels Sonne in der «Wärmehalle» gegessen haben, einem hübschen großen Raum mit einem breiten Kamin und einer Bibliothek. Abends ist er im Zug mit Arlette abgereist. Sylvie und ich sind am nächsten Morgen mit dem Auto abgefahren. Sartre ist von seinen Ferien entzückt gewesen.
Er hat sich auch sehr gefreut, als er, wieder in Paris, von Gallimard eine riesige Kiste voller Exemplare von Der Idiot der Familie bekommen hat: 2000 bedruckte Seiten. Er hat mir gesagt, dass ihm das ebenso viel Freude machte wie das Erscheinen von Der Ekel. Es gab gleich sehr begeisterte Rezensionen.
Anfang Mai erfuhren wir von Pouillon vom Tod des Freundes, den ich in meinen Memoiren Pagniez genannt habe. Nach Pouillons Darstellung hatte sich Pagniez nach seiner Pensionierung so sehr gelangweilt, dass er einfach gestorben war: Er hatte eine Hepatitis gehabt, die sich zu einer Zirrhose verschlimmerte. Da Madame Lemaire schon vor ein paar Jahren gestorben war, versank mit ihm ein ganzer glücklicher Abschnitt unserer Vergangenheit. Aber Pagniez war uns seit langem gänzlich fremd geworden, und wir haben die Nachricht gleichgültig aufgenommen.
Ebenfalls Anfang Mai rief Goytisolo mit vor Erregung bebender Stimme bei Sartre an, um ihn zu bitten, einen sehr scharfen Brief zur Affäre Padilla an Fidel Castro zu unterzeichnen. Diese Affäre hatte mehrere Etappen: 1. die Verhaftung des in Kuba sehr bekannten Dichters Padilla unter der Anklage der Päderastie. 2. Ein höflicher Protestbrief, unterzeichnet von Goytisolo, Franqui, Sartre, mir und einigen anderen. 3. Padilla wird freigelassen und übt maßlose Selbstkritik, in der er Dumont und Karol beschuldigt, CIA-Agenten zu sein. Auch seine Frau übte Selbstkritik und erklärte, die Polizei habe sie «zartfühlend» behandelt. Diese Äußerungen riefen zahlreiche Proteste hervor. Unser ehemaliger kubanischer Dolmetscher, Arcocha, der ebenfalls im Exil lebte, schrieb in Le Monde, dass man, um solche Geständnisse zu bekommen, Padilla und seine Frau gefoltert haben müsste. Im Hintergrund dieser ganzen Geschichte wütete Lyssendro Otero, der uns 1960 fast während unserer gesamten Reise begleitet hatte: Er hatte jetzt die ganze Kultur unter sich. Goytisolo meinte, eine regelrechte Polizisten-Gang habe Kuba unter ihrer Knute. Wir haben erfahren, dass Castro Sartre jetzt als Feind betrachtete: Er stehe, sagte er, unter dem unseligen Einfluss von Franqui. In einer zu jener Zeit gehaltenen Rede griff Castro die meisten französischen Intellektuellen an. Sartre regte sich nicht darüber auf, denn er machte sich seit langem keine Illusionen mehr über Kuba.
Außer seinen Vertrauten und gauchistischen Genossen hat Sartre nach den Ferien mit mir einige Freunde getroffen. Tito Gerassi berichtete uns über die amerikanische Subkultur, Rossana Rossanda schilderte uns die Schwierigkeiten und Möglichkeiten ihrer Zeitung Manifesto, die von einem Wochenblatt zu einer Tageszeitung werden sollte. Robert Gallimard erzählte uns, was hinter den Kulissen der Verlage vorging. Wir haben mit dem ägyptischen Journalisten Ali zu Mittag gegessen, der uns 1967 auf unserer ganzen Ägyptenreise begleitet hatte. Anfang Mai haben wir unsere japanische Freundin Tomiko wieder getroffen: Sie hat uns von der langen Reise, die sie gerade durch Asien gemacht hatte, erzählt.
Am 12. Mai nahm Sartre an einer Demonstration vor dem Rathaus von Ivry teil: Behar Behala, ein leicht beschränkter Gastarbeiter, hatte einen Becher Joghurt aus einem Lieferwagen gestohlen; Polizisten hatten auf ihn geschossen und hatten ihn schwer verletzt. Die Rote Hilfe hatte Informationen gesammelt und eine Aktion gegen die Polizei organisiert.
Sartre hielt sich zu dieser Zeit viel bei mir auf, da sein Aufzug kaputt war. Wenn er die zehn Etagen bis zu seiner Wohnung hinaufsteigen musste, war er völlig erschöpft.
Am Dienstag, dem 18. Mai, ist Sartre wie jeden Dienstag abends zu mir gekommen: Er hatte den Montagabend und die Nacht bei Arlette verbracht. «Wie geht’s?», habe ich ihn wie gewohnt gefragt. «Na ja, nicht besonders.» Tatsächlich schwankte und stammelte er, sein Mund war ein bisschen verzerrt. Ich hatte am Vortag nicht gemerkt, dass er müde war, denn wir hatten Platten gehört und kaum gesprochen. Aber abends war er in schlechter Verfassung zu Arlette gekommen. Und morgens war er in dem Zustand, wie ich ihn jetzt sah, aufgewacht: Offensichtlich hatte er in der Nacht einen leichten Anfall gehabt. Seit langem befürchtete ich so etwas und hatte mir vorgenommen, nicht die Ruhe zu verlieren. Ich dachte an Freunde, die Ähnliches durchgemacht und es ohne Schaden überstanden hatten. Außerdem musste Sartre am nächsten Tag sowieso zum Arzt: Das beruhigte mich ein wenig, aber eben nur ein wenig. Ich musste mich sehr anstrengen, um meine Panik nicht zu verraten. Sartre verlangte seine gewohnte Menge Whisky, sodass er um Mitternacht überhaupt nicht mehr artikulieren konnte und sich mit großer Mühe ins Bett schleppte. Die ganze Nacht habe ich gegen die Angst gekämpft.
Am nächsten Morgen fuhr Liliane Siegel ihn zu Dr. Zaidmann. Er hat mich angerufen und gesagt, alles wäre in Ordnung: Er hätte einen Blutdruck von 180 – was bei ihm normal war –, und man würde sofort mit einer ernsthaften Behandlung anfangen. Etwas später rief Liliane an und war weniger optimistisch. Nach Zaidmanns Ansicht war die Krise schwerer als die im Oktober, und das Beunruhigende war, dass die Störungen so schnell wiederaufgetreten waren. Eine der Ursachen war wohl, dass Sartre seit März seine Medikamente nicht mehr einnahm. Es war auch schädlich für ihn, dass er ab und zu zehn Stockwerke hinaufstieg. Aber der Hauptgrund war eine starke Beeinträchtigung der Blutzirkulation in einem bestimmten Bereich des Gehirns, links.
Ich bin am Nachmittag bei Sartre gewesen, und es ging ihm weder besser noch schlechter. Zaidmann hatte ihm strikt verboten herumzulaufen. Zum Glück war sein Aufzug repariert. Abends hat Sylvie uns im Auto zu mir nach Hause gefahren und ist eine Weile bei uns geblieben. Sartre hat nur Fruchtsaft getrunken. Sie war fassungslos über sein Aussehen. Ich vermute, dass der Anfall – vielleicht ohne dass er sich dessen bewusst war – ein empfindlicher Schock für ihn gewesen war: Er wirkte sehr niedergeschlagen. Ständig fiel ihm seine Zigarette aus dem Mund. Sylvie hob sie auf, reichte sie ihm, er nahm sie, und sie entglitt seinen Fingern. Dieser Vorgang hat sich an diesem düsteren Abend ich weiß nicht wie oft wiederholt. Da eine Unterhaltung ausgeschlossen war, habe ich Platten aufgelegt, unter anderem das Requiem von Verdi, das Sartre sehr liebte und das wir uns oft anhörten. «Das passt zu den Umständen», hat er gemurmelt, und Sylvie und mir ist es kalt den Rücken heruntergelaufen. Sie ist wenig später gegangen, und Sartre hat sich kurz darauf zu Bett gelegt. Beim Aufwachen schien es ihm, dass er den rechten Arm kaum bewegen konnte, so schwer und taub war er. Als Liliane gekommen ist, um mit ihm zu frühstücken, hat sie mir zugeraunt: «Ich finde, er sieht schlechter aus als gestern.» Gleich nachdem sie weg waren, habe ich mit Professor Lebeau in der Klinik telefoniert. Er konnte nicht kommen, wollte aber einen anderen Spezialisten schicken. Ich bin zu Sartre in seine Wohnung gegangen, und um halb zwölf ist Dr. Mahoudeau gekommen. Er hat Sartre eine Stunde lang untersucht und hat mich beruhigt. Die Tiefensensibilität war nicht gestört, der Kopf war intakt, das leichte Stammeln kam von der Verzerrung des Mundes. Die rechte Hand war schwach: Sartre hatte immer noch Mühe, eine Zigarette zu halten. Er hatte einen Blutdruck von 140: das war ein schlimmer Abfall, zurückzuführen auf die Mittel, die er schluckte. Mahoudeau stellte ein neues Rezept aus und empfahl für die nächsten achtundvierzig Stunden größte Schonung. Sartre sollte viel ruhen und nie allein sein. Unter der Bedingung wäre er in zehn oder zwanzig Tagen ganz wiederhergestellt.
Sartre hatte alle Untersuchungen fügsam über sich ergehen lassen, aber er weigerte sich, das Bett zu hüten. Sylvie, die wegen Himmelfahrt schulfrei hatte, fuhr uns zur Coupole, wo wir zu dritt zu Mittag aßen. Sartre ging es deutlich besser. Sein Mund jedoch blieb verzerrt. Am nächsten Tag, als er im selben Lokal mit Arlette aß, hat François Périer ihn gesehen. Er ist an meinen Tisch gekommen und hat gesagt: «Übel, was er da hat, dieser schiefe Mund: Das ist sehr schlimm.» Zum Glück wusste ich, dass es diesmal nicht sehr schlimm war. Die folgenden Tage sind gut verlaufen, und am Montagvormittag hat Zaidmann mitgeteilt, dass die Behandlung bald beendet sein würde. Aber er hat hinzugefügt, dass die anschließende Rückkehr zum normalen Leben ziemlich lange dauern würde. Zu Arlette hat er sogar gesagt, dass Sartre vielleicht nie mehr ganz gesund werden würde.
Doch als wir am Mittwoch, dem 26. Mai, den Abend mit Bost verbracht haben, konnte er wieder gehen und sprechen und hatte seine gute Laune wiedergefunden. In seinem Beisein habe ich lachend zu Bost gesagt, dass ich mich bestimmt mit Sartre streiten müsste, um seinen Alkohol-, Tee-, Kaffee- und Aufputschmittelkonsum einzuschränken. Sartre ist zum Schlafen nach oben gegangen, und auf dem Balkon über meinem Studio hat er geträllert: «Ich will meinem Castor auch nicht den kleinsten Kummer machen …» Ich war gerührt. Und ich war auch gerührt, als er mir während eines Mittagessens in der Coupole ein dunkelhaariges junges Mädchen mit blauen Augen und einem etwas runden Gesicht gezeigt und mich gefragt hat: «Wissen Sie, an wen sie mich erinnert?» – «Nein.» – «An Sie, als Sie in ihrem Alter waren.»
Mit einer Sache haperte es: Seine rechte Hand blieb schwach. Er hatte Schwierigkeiten, Klavier zu spielen – was er bei Arlette gern tat – und Wörter zu Papier zu bringen. Aber augenblicklich war das nicht besonders wichtig. So lange, bis er seine Arbeit wiederaufnehmen konnte, korrigierte er die Fahnen von Situations VII und IX und hatte damit genug zu tun.
Im Juni gründete er mit Maurice Clavel die Presseagentur Libération. Sie unterzeichneten gemeinsam einen Text, in dem sie die Ziele der Agentur darstellten, die täglich Informationen veröffentlichen sollte:
«Wir wollen alle gemeinsam ein neues Instrument zur Verteidigung der Wahrheit schaffen … Es genügt nicht, die Wahrheit zu kennen, sie muss auch verbreitet werden. Die Agentur Libération wird nach strenger Überprüfung aller Fakten regelmäßig die Meldungen verbreiten, die sie erhält … Die Presseagentur Libération will eine neue Tribüne für die Journalisten sein, die denen alles sagen wollen, die alles wissen wollen. Sie wird dem Volk das Wort geben.»
Ende Juni bekam Sartre schreckliche Schmerzen an der Zunge. Er konnte weder essen noch sprechen, ohne dass es ihm weh tat. Ich habe zu ihm gesagt: «Das ist wirklich ein scheußliches Jahr: Andauernd haben Sie irgendwelche Beschwerden.» – «Ach, das macht nichts», hat er mir geantwortet. «Wenn man alt ist, ist das nicht mehr wichtig.» – «Wieso denn das?» – «Man weiß, dass es nicht mehr lange dauert.» – «Sie meinen, weil man stirbt?» – «Ja. Es ist normal, dass man nach und nach kaputtgeht. Wenn man jung ist, ist das etwas anderes.» Der Ton, in dem er das sagte, hat mich erschüttert: Er schien bereits auf der anderen Seite des Lebens. Diese Unbeteiligtheit fiel übrigens allen auf; er wirkte vielen Dingen gegenüber gleichgültig, wahrscheinlich weil er kein Interesse für sein eigenes Schicksal hatte. Oft war er zwar nicht traurig, aber doch abwesend. Nur während unserer Abende mit Sylvie sah ich ihn wirklich fröhlich. Im Juni haben wir Sartres siebzigsten Geburtstag bei ihr gefeiert, und er war strahlender Laune.
Er ist zu seinem Zahnarzt gegangen, und die Schmerzen haben aufgehört. Sofort wurden die Fortschritte deutlich, die er seit Mai gemacht hatte. Zaidmann meinte, dass er völlig wiederhergestellt wäre. Und Sartre hat mehrfach zu mir gesagt, dass er mit dem Jahr sehr zufrieden sei.
Trotzdem hatte ich Angst, mich von ihm zu trennen. Er wollte drei Wochen mit Arlette, drei Wochen mit Wanda verbringen, während ich mit Sylvie verreiste. Ich liebte diese Reisen, aber die Trennung von Sartre war immer ein kleiner Schock für mich. Diesmal habe ich mit ihm in der Coupole zu Mittag gegessen, wo Sylvie mich um vier Uhr abholen sollte. Ich bin drei Minuten vorher aufgestanden. Er hat undefinierbar gelächelt und hat zu mir gesagt: «Jetzt heißt es also Abschied nehmen!» Ich habe seine Schulter berührt, ohne zu antworten. Das Lächeln, der Satz haben mich lange verfolgt. Ich gab dem Wort «Abschied» den letzten Sinn, den es einige Jahre später bekommen sollte: Da aber war ich allein, es zu sagen.
Ich bin mit Sylvie nach Italien gefahren. Am nächsten Abend haben wir in Bologna übernachtet. Am Morgen sind wir über die Autobahn in Richtung Ostküste gefahren. Die Landschaft war in milden Nebel getaucht. In meinem ganzen Leben habe ich kein solches Gefühl von Absurdität und Verlassenheit gehabt: Was machte ich hier? Warum war ich hier? Meine Liebe zu Italien hat mich schnell wieder eingefangen. Aber jede Nacht vor dem Einschlafen habe ich lange geweint.
Mittlerweile reiste Sartre durch die Schweiz. Ab und zu versicherte er mir in einem Telegramm, dass es ihm gutginge. Aber als ich in Rom ankam, wo er sich mit mir treffen sollte, fand ich einen Brief von Arlette vor. Sartre hatte am 15. Juli einen Rückfall gehabt. Wie beim ersten Mal hatte sie es beim Aufwachen bemerkt. Sein Mund war noch verzerrter als im Mai, die Aussprache behindert, der Arm unempfindlich für kalt und warm. Sie hatte ihn zu einem Arzt in Bern gebracht, und Sartre hatte ihr, ganz außer sich, verboten, mich zu benachrichtigen. Drei Tage später war die Krise überstanden. Aber sie hatte mit Zaidmann telefoniert, der ihr gesagt hatte: «Wenn er solche Krämpfe bekommt, müssen seine Arterien sehr erschlafft sein.»
Ich habe ihn an der Stazione Termini abgeholt. Er hat mich angerufen, noch bevor ich ihn sah. Er trug einen hellen Anzug und eine Mütze. Sein Gesicht war durch einen Abszess am Zahn geschwollen, aber er schien bei guter Gesundheit. Wir haben uns in unserem kleinen Appartement im sechsten Stock des Hotels eingerichtet. Dazu gehörte eine Terrasse, von wo wir einen weiten Blick über den Quirinal, das Dach des Pantheons, Sankt Peter und das Kapitol hatten, dessen Lichter wir jede Nacht um zwölf ausgehen sahen. In diesem Jahr war ein Teil der Terrasse in einen Salon umgebaut worden, den eine Glaswand vom offenen Teil trennte: Hier konnten wir uns zu jeder Tageszeit aufhalten. Der Abszess ist abgeheilt, und Sartre hat keine Beschwerden mehr gehabt. Er wirkte nie mehr abwesend, war angeregt und lustig. Er blieb bis ein Uhr nachts auf und stand gegen halb acht wieder auf: Wenn ich gegen neun Uhr aus meinem Zimmer kam, fand ich ihn auf der Terrasse sitzend, die Schönheit Roms genießend und lesend. Nachmittags schlief er zwei Stunden, war aber nie mehr schläfrig. In Neapel hatte er mit Wanda lange Märsche gemacht: Unter anderem hatte er Pompeji noch einmal besucht. In Rom hatten wir wenig Lust spazieren zu gehen: Ohne uns wegzubewegen, waren wir überall.
Gegen zwei Uhr aßen wir in der Nähe des Hotels ein Sandwich; abends gingen wir zu Fuß zum Essen zur Piazza Navona oder in ein benachbartes Restaurant. Manchmal fuhr Sylvie uns im Auto nach Trastevere oder zur Via Appia Antica. Sartre setzte brav seine Schirmmütze auf, wenn er durch die Sonne ging. Er nahm vorschriftsmäßig seine Medikamente ein, trank zum Mittagessen ein einziges Glas Weißwein, zum Abendessen Bier und anschließend auf der Terrasse zwei Gläser Whisky. Keinen Kaffee und Tee nur zum Frühstück (in den anderen Jahren trank er um fünf Uhr wahnsinnig starke Aufgüsse). Er korrigierte den dritten Band von Der Idiot der Familie und zerstreute sich, indem er gialli, italienische Kriminalromane, las. Ab und zu trafen wir uns mit Rossana Rossanda, und eines Nachmittags besuchte uns unser jugoslawischer Freund Dedijer.
Wer Sartre während dieser römischen Ferien sah, hätte ihm noch zwanzig Lebensjahre vorhergesagt. Er rechnete übrigens selbst damit. Als ich mich eines Tages darüber beklagte, dass man immer auf dieselben gialli stieß, sagte er: «Das ist normal. Es gibt nur eine beschränkte Anzahl davon. Wir können nicht hoffen, in den nächsten zwanzig Jahren neue zu lesen.»
Wieder in Paris, ging es Sartre weiterhin sehr gut. Er hatte einen Blutdruck von 170, gute Reflexe. Er ging gegen Mitternacht zu Bett, stand um halb neun auf, schlief tagsüber nicht mehr. Er behielt eine leichte Lähmung im Mund, die ihm das Kauen erschwerte und ein gelegentliches Lispeln bewirkte. Er beherrschte seine Schreibhand nicht gänzlich. Aber er machte sich deswegen keine Sorgen. Er war Dingen und Menschen gegenüber wieder sehr aufgeschlossen. Die Begeisterung, mit der die beiden ersten Bände von Der Idiot der Familie aufgenommen worden waren, hatte ihn sehr berührt. Er übergab Gallimard den dritten Band und nahm den vierten in Angriff, in dem er sich mit Madame Bovary auseinandersetzen wollte. Er las und kritisierte sorgfältig das Manuskript meines nächsten Buches, Alles in allem, und gab mir sehr gute Ratschläge. Mitte November notierte ich: «Sartre geht es so gut, dass ich fast ruhig bin.»
Ende November nahm er mit Foucault und Genet an einer Demonstration teil, die im Quartier de la Goutte d’Or stattfand, als Protest gegen den Mord an Djelalli, einem fünfzehnjährigen Algerier. Der Concierge in seinem Haus hatte ihn am 27. Oktober mit einem Karabiner erschossen. Er machte zu viel Krach, erklärte er und behauptete ohne Angst, sich zu widersprechen, er hätte ihn für einen Dieb gehalten.
Sartre ging in der Rue Poissonnière vor Foucault und Claude Mauriac her, die ein Spruchband mit einem Aufruf an die Arbeiter des Viertels trugen. Die Polizisten erkannten ihn und griffen nicht ein. Er sprach durch ein Megaphon und machte die Einrichtung eines Informationsbüros des Komitees Djelalli bekannt, das vom nächsten Tag an im Gemeindesaal der Goutte d’Or geöffnet sein würde, bis sich ein anderer Raum gefunden hätte. Der Marsch ging bis zum Boulevard de la Chapelle. Foucault ergriff mehrfach das Wort. Sartre wollte sich gern an den Büroarbeiten beteiligen, aber Genet, mit dem er ein paar Tage später zu Mittag aß, riet ihm davon ab: Er fand ihn zu erschöpft.
Ich weiß nicht, ob Sartre diese Erschöpfung spürte, jedenfalls hat er am Abend des 1. Dezember unvermittelt zu mir gesagt: «Ich habe mein Gesundheitskapital verbraucht. Ich werde nicht älter als siebzig.» Ich habe protestiert. Und er: «Sie haben selbst gesagt, dass man einen dritten Anfall nur schwer übersteht.» Ich erinnerte mich nicht mehr, das gesagt zu haben. Das war zweifellos eine Warnung vor möglichen Exzessen gewesen. «Die Anfälle, die Sie gehabt haben, waren sehr leicht», habe ich ihm geantwortet. Er hat gesagt: «Ich glaube, dass ich den Flaubert nicht beenden werde.» – «Tut Ihnen das leid?» – «Ja, das tut mir leid.» Und er hat mit mir über seine Beerdigung gesprochen. Er wünschte eine sehr schlichte Feier und wollte eingeäschert werden. Vor allem wollte er nicht auf dem Friedhof Père-Lachaise zwischen seiner Mutter und seinem Stiefvater liegen. Er wünschte sich, dass viele Maoisten seinen Sarg geleiteten. Er dächte nicht oft daran, hat er mir gesagt, aber er dächte daran.
Zum Glück war seine Stimmung in diesem Punkt unbeständig. Am 12. Januar 1972 hat er vergnügt zu mir gesagt: «Vielleicht werden wir noch lange leben.» Und Ende Februar: «Oh, ich denke doch, dass ich in zehn Jahren noch da bin.» Von Zeit zu Zeit spielte er lachend auf seine «Mini-Lähmung» an, aber er hielt sich keineswegs für gefährdet.
1972
Da Plevens Versprechungen, die Haftbedingungen zu verbessern, nicht eingehalten worden waren, beschloss Sartre, im Justizministerium eine Pressekonferenz zu geben. Am 18. Januar 1972 traf er sich, begleitet von Michèle Vian, im Hôtel Continental mit Mitgliedern der Roten Hilfe und einigen Freunden: Deleuze, Foucault, Claude Mauriac. Zwei Übertragungswagen, von Radio Luxemburg und Europe 1, waren da. Die Delegation begab sich zur Place Vendôme und drang ins Justizministerium ein. Foucault sprach und verlas den Bericht der Häftlinge von Melun. Es wurde geschrien: «Pleven zurücktreten! Pleven an den Pranger! Pleven Mörder!» Die C.R.S. löste die Versammlung auf. Sie ergriffen Jaubert, einen Journalisten, der, als er versucht hatte, bei einem Schlagstockeinsatz gegen einen Gastarbeiter einzugreifen, so wüst verprügelt worden war, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.[a]
Sartre und Foucault intervenierten, damit er wieder freigelassen würde. Von dort begaben sich die Demonstranten zur Presseagentur Libération. Dort waren etwa dreißig Genossen und Journalisten, die nicht auf der Place Vendôme gewesen waren, unter ihnen Alain Geismar, der gerade aus der Haft entlassen worden war. Sartre setzte sich an einen Tisch neben Jean-Pierre Faye. Er gab einen humorvollen Bericht vom Ablauf der Ereignisse: «Die C.R.S. ist nicht besonders brutal gewesen», sagte er, «auch nicht besonders sanft, wie sie eben ist.» Als er zu Ende gesprochen hatte, löste sich die Versammlung auf, und er ging nach Haus.
Ein Unternehmen, zu dem er sich mit großem Vergnügen bereitfand, war der Film, den Contat und Astruc über ihn drehten. Umgeben von seinen Mitarbeitern der Temps Modernes[b], die ihm Fragen stellten, redete er, erzählte von sich. Im Allgemeinen wurde bei ihm gedreht, manchmal bei mir. Es war vielleicht etwas monoton, ihn immer mit denselben Gesprächspartnern konfrontiert zu sehen, aber dank seiner Vertrautheit mit ihnen hat er sich sehr ungezwungen und ausführlich geäußert. Er war angeregt, lustig, in bester Verfassung. Er hatte Die Wörter nicht fortgesetzt, weil er befürchtete, Madame Mancy Kummer zu bereiten, und weil andere Arbeiten ihn in Anspruch genommen hatten: Jetzt schilderte er die Wiederheirat seiner Mutter, seinen inneren Bruch mit ihr, sein Verhältnis zu seinem Stiefvater, sein Leben in La Rochelle, wo er, als Pariser eingeordnet und von seinen Mitschülern mehr oder weniger isoliert, die Einsamkeit und die Gewalt kennengelernt hatte. Mit elf Jahren hatte er plötzlich gemerkt, dass er nicht mehr an Gott glaubte, und etwa mit fünfzehn war für ihn die irdische Unsterblichkeit an die Stelle der Idee des ewigen Lebens nach dem Tode getreten. Damals hatte ihn das befallen, was er seine «Schreibneurose» nannte, und unter dem Einfluss seiner Lektüre hatte er angefangen, vom Ruhm zu träumen, den er damals mit Todesphantasien verband.
Anschließend beschrieb er seine Freundschaft mit Nizan, ihren Wettstreit, seine Entdeckung von Proust und Valéry. Zu jener Zeit, etwa mit achtzehn, hatte er angefangen, seine Ideen in alphabetischer Reihenfolge in ein Notizbuch einzutragen, ein Werbegeschenk von Midy-Zäpfchen, das er in der Metro gefunden hatte. Die wichtigste Idee war bereits die der Freiheit. Danach schilderte er kurz seine Jahre an der École Normale, die er glücklich verlebt hatte und in denen er mit Kameraden den tala[c] harmlose Streiche spielte. Zur Philosophie war er durch die Lektüre von Bergson gelangt, und seither war sie wesentlich für ihn geblieben: «Die Einheit dessen, was ich tue, ist die Philosophie.»
Dann erinnerte er sich an seinen Aufenthalt in Berlin, an den Einfluss, den Husserl auf ihn gehabt hatte, an seinen Beruf als Gymnasiallehrer, an seinen Widerwillen, erwachsen zu werden, und an die Neurose, die durch diese Abneigung und gleichzeitig durch seine Meskalinerfahrungen im Zusammenhang mit seiner Erforschung des Imaginären entstanden war. Er äußerte sich auch dazu, was Der Ekel und die Novelle Die Mauer für ihn dargestellt hatten.
Die folgenden Interviews befassten sich mit seinem Aufenthalt im Stalag XII D, der Entstehung und Aufführung von Bariona, seiner Rückkehr nach Paris, dem Theaterstück Die Fliegen. Dann mit der Existentialismus-Mode, den Angriffen, denen er Ende der vierziger Jahre ausgesetzt war, dem Sinn des literarischen Engagements und seinen politischen Positionen: sein Beitritt zum R.D.R.[d], der anschließende Bruch mit ihm, seine Entscheidung von 1952, sich den Kommunisten anzunähern, einmal wegen der Welle von Antikommunismus, die in Frankreich grassierte, und im Besonderen wegen der Affäre Duclos und den Brieftauben. Er erwähnte de Gaulle, diese «unheilvolle Figur in der Geschichte», und zeigte die Niedertracht der gegenwärtigen Gesellschaft auf.
Er stellte die moralischen Probleme dar, die ihn immer beschäftigt haben, und drückte reine Freude darüber aus, die gleiche Sorge in einer anderen Form bei seinen Maoisten-Freunden wiederzufinden, die Moral und Politik miteinander verbanden. Er definierte ausführlich seine Moral: «Für mich lag das Problem im Grunde darin, ob man zwischen Politik und Moral wählte oder ob Politik und Moral eins waren. Und jetzt bin ich zu einem Ausgangspunkt zurückgekommen, der aber, wenn Sie so wollen, dadurch bereichert ist, dass ich die Moral bei der Aktion der Massen sehe. Gegenwärtig stellt sich so ziemlich überall eine moralische Frage, eine moralische Frage, die nichts anderes ist als die politische Frage, und auf dieser Ebene bin ich zum Beispiel mit den Maos vollkommen einig … Ich habe im Grunde zweimal versucht, eine ‹Moral› zu schreiben, eine zwischen 1945 und 1947, eine völlig mystifizierte … und dann Notizen etwa um 1965 über eine andere ‹Moral›, mit dem Problem des Realismus und dem der Moral.»
Zum Abschluss ist er auf das Thema zurückgekommen, das ihm am wichtigsten war: der Gegensatz zwischen dem klassischen Intellektuellen und dem neuen Intellektuellen, der zu sein er jetzt gewählt hatte.
Der Film war noch nicht abgedreht, als am 24. Februar ein befreundeter belgischer Rechtsanwalt, Lallemant[e], Sartre im Namen der Vereinigung der jungen Anwälte von Brüssel zu einem Vortrag über die Repression einlud. Wir sind mit Sylvie, die fuhr, gegen ein Uhr mittags über die Autobahn losgefahren. Es war schönes sonniges Wetter, und wir haben auf einem Rastplatz haltgemacht, um Croissants und Schinken zu essen, die sie mitgebracht hatte. Wir sind um halb sechs angekommen und haben sofort das Hotel gefunden, in dem Zimmer für uns reserviert waren. Nachdem wir ausgepackt hatten, sind wir in die Bar gegangen, wo Lallemant und Verstraeten[f] zu uns gestoßen sind, und haben etwas getrunken. Verstraeten hatte immer noch seine schönen blauen Augen, aber er war so mager, dass er Conrad Veidt ähnelte. Wir haben mit ihnen und anderen Freunden im Cygne an der Grand-Place, die wir aufs Neue bewundert haben, zu Abend gegessen. Wir haben einen kleinen Spaziergang durch die benachbarten Gässchen gemacht und sind zur Kongresshalle gefahren.
Wir haben mit einem Blick gesehen, dass das Publikum absolut bürgerlich war: Die Frauen, in großer Toilette, kamen sichtlich gerade vom Friseur. Sartre, der seit ’68 klassische Anzüge und Krawatten aufgegeben hatte, trug an diesem Abend einen schwarzen Pullover, der tadelnde Blicke seitens der Anwesenden erntete. Tatsächlich hatte er mit diesen Leuten nichts zu tun, und wir haben nicht ganz verstanden, wieso Lallemant ihn eingeladen hatte.
Sartre hat ohne großen Schwung seinen Text über Klassenjustiz und Volksjustiz verlesen. «In Frankreich», sagte er, «existieren zwei Arten von Justizen: die eine, bürokratisch, die dazu dient, das Proletariat an seine Situation zu binden, die andere, wild, die das elementare Moment ist, durch das das Proletariat und die Plebs ihre Freiheit gegen die Proletarisierung