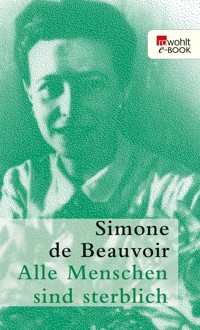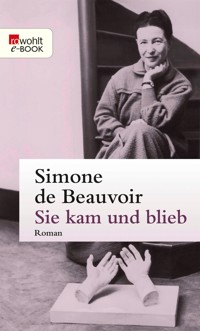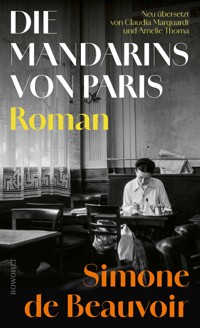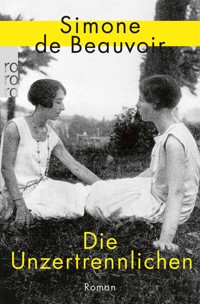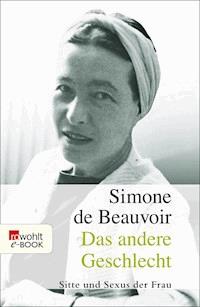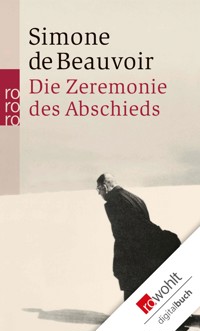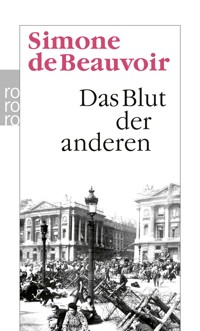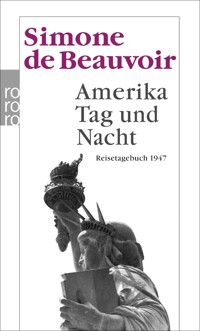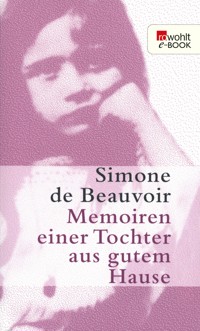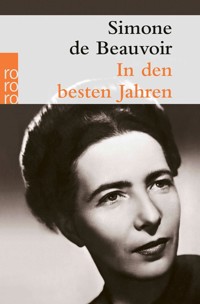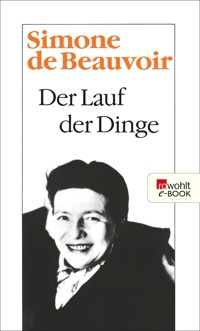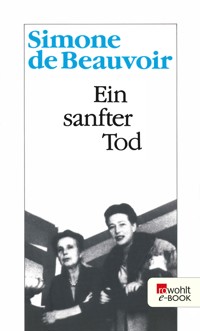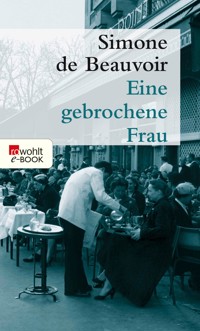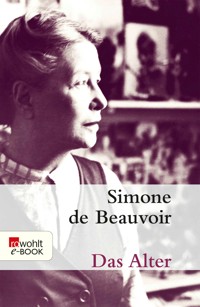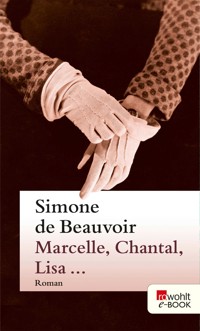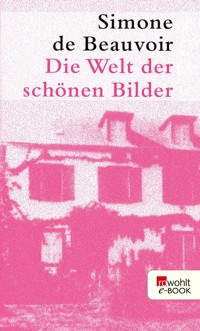
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Schärfe und Ironie schildert Simone de Beauvoir die Gesellschaft der Neureichen, in der Gefühle zu Werbespots werden. Die Menschen dieses Romans ersticken an den Lügen und Heucheleien der spätkapitalistischen Welt, beherrscht von Statussymbolen, von «schönen Bildern».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Simone de Beauvoir
Die Welt der schönen Bilder
Roman
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Für Claude Lanzmann
Erstes Kapitel
«Ein Oktober … wie man ihn selten erlebt», sagt Gisèle Dufrène; sie pflichten ihr bei, sie lächeln, Sommerhitze fällt vom graublauen Himmel – was haben die anderen, was ich nicht habe? –, sie lassen ihre Blicke das vollkommene Bild genießen, das in Plaisir de France und Votre Maison abgedruckt war: den Bauernhof, gekauft für ein Stück Brot – nun, sagen wir, für ein Stück Butterbrot – und hergerichtet von Jean-Charles für den Gegenwert einer Tonne Kaviar. («Auf zehntausend mehr oder weniger kommt’s mir nicht an», hatte Gilbert gesagt.) Die Rosen vor der Steinmauer, die Chrysanthemen, die Astern, die Dahlien, «die schönsten der ganzen Île-de-France», sagt Dominique: Die spanische Wand und die blauen und violetten Sessel – irrsinnig raffiniert! – heben sich stark vom Grün des Rasens ab, das Eis klirrt in den Gläsern, Houdan küsst Dominique die Hand, Dominique, sehr schlank in ihrer schwarzen Hose und der auffälligen Hemdbluse, die Haare hell, halb blond, halb weiß, von hinten könnte man sie für dreißig halten. «Dominique, niemand versteht es so gut wie Sie, Gäste zu empfangen.» (Genau in diesem Augenblick, in einem anderen, ganz anderen, genau gleichen Garten sagt jemand diese Worte, und das gleiche Lächeln legt sich über ein anderes Gesicht: «Was für ein herrlicher Sonntag!» Warum kommt mir dieser Gedanke?)
Alles ist vollkommen gewesen: die Sonne und die Brise, das Barbecue, die dicken Steaks, die Salate, die Früchte, die Weine. Gilbert hat von seinen Reisen und seinen Jagdausflügen nach Kenia erzählt und sich dann in dieses japanische Geduldspiel vertieft, noch sechs Steine müssen untergebracht werden, und Laurence hat vorgeschlagen, test du passeur zu spielen, sie haben begeistert mitgemacht, sie wundern sich zu gern über sich selbst, lachen zu gern über andere. Sie hat sich ziemlich verausgabt, deshalb fühlt sie sich jetzt niedergeschlagen, ich falle eben immer von einem Extrem ins andere. Louise spielt mit ihren Vettern hinten im Garten; Catherine liest vor dem Kamin, in dem ein schwaches Feuer flackert: Sie sieht aus wie alle glücklichen kleinen Mädchen, die auf einem Teppich liegend lesen. Don Quijote; letzte Woche Quentin Durward, davon wacht sie nachts nicht auf und muss weinen, also was ist es? Louise war ganz aufgeregt: Mama, Catherine hat Kummer, sie weint nachts. Die Lehrer gefallen ihr, sie hat eine neue Freundin, sie ist körperlich gesund, zu Hause geht es fröhlich zu.
«Wieder auf der Suche nach einem Slogan?», erkundigt sich Dufrène.
«Ich muss die Leute dazu überreden, dass sie ihre Wände mit Holz täfeln lassen.»
Das ist bequem: Sooft sie in Gedanken ist, glaubt man, sie sucht einen Slogan. Um sie herum spricht man vom missglückten Selbstmordversuch Jeanne Texciers. Eine Zigarette in der linken Hand, die rechte Hand geöffnet und abwehrend erhoben, als fürchte sie, unterbrochen zu werden, sagt Dominique mit ihrer autoritären, volltönenden Stimme: «So ungeheuer intelligent ist sie nicht, sie verdankt ihre Karriere ihrem Mann, aber trotzdem: Wenn man zu den Frauen gehört, die in Paris im Blickpunkt des Interesses stehen, führt man sich nicht auf wie eine Midinette!»
In einem anderen, ganz anderen, genau gleichen Garten sagt jemand: «Dominique Langlois verdankt ihre Karriere Gilbert Mortier.» Aber das ist ungerecht, sie hat 45 beim Rundfunk ganz klein angefangen und hat es einfach geschafft, sie hat gearbeitet wie ein Pferd, hat alle beiseitegedrängt, die ihr im Weg waren. Warum finden die Leute so viel Vergnügen daran, sich gegenseitig zu zerreißen? Sie sagen auch, Gisèle Dufrène denkt es, Mama habe sich Gilbert aus Berechnung geangelt: Gut, dieses Haus, ihre Reisen, das hätte sie sich ohne ihn nicht leisten können; aber er hat ihr vor allem etwas anderes gegeben; sie war völlig hilflos, nachdem sie Papa verlassen hatte (und er irrte im Haus umher wie eine ruhelose Seele, mit welcher Gefühllosigkeit ist sie gegangen, sowie Marthe verheiratet war); Gilbert verdankt sie es, dass sie zu dieser so selbstsicheren Frau wurde. (Natürlich könnte man sagen …)
Hubert und Marthe kommen aus dem Wald zurück, mit riesigen Sträußen von Zweigen. Den Kopf zurückgeneigt, ein starres Lächeln auf den Lippen, geht Marthe heiteren Schritts dahin: Eine Heilige, trunken von froher Gottesliebe, das ist die Rolle, die sie spielt, seit sie zum Glauben gefunden hat. Sie nehmen wieder ihre Plätze ein auf den blauen und violetten Kissen, Hubert zündet seine Pfeife an. Sein stereotypes Lächeln, sein Embonpoint. Wenn er reist, trägt er eine schwarze Brille: «Ich reise so gern inkognito.» Ein ausgezeichneter Zahnarzt, der in seinen Mußestunden gewissenhaft die Totovorschau studiert. Ich kann verstehen, dass Marthe sich einen Ausgleich hat einfallen lassen.
«In Europa findet man im Sommer keinen Strand, wo man auch nur genug Platz hat, um sich auszustrecken», sagt Dominique … «Auf den Bermudas gibt es endlose, fast einsame Badestrände, wo einen keiner kennt.»
«Also ein trautes Idyll», sagt Laurence.
«Und Tahiti? Warum sind Sie nicht wieder nach Tahiti gefahren?», fragt Gisèle.
«Tahiti – 1955 ging das noch. Heute ist es schlimmer als Saint-Tropez. Irrsinnig gewöhnlich …»
Vor zwanzig Jahren schlug Papa Florenz vor, Granada; sie sagte: «Da geht jedermann hin, das ist irrsinnig gewöhnlich …» Zu viert im Auto verreisen: Wie die Familie Kleinbürger, sagte sie. Er durchstreifte ohne uns Italien, Griechenland, und wir verbrachten die Sommerferien, wo es gerade ‹chic› war; oder sagen wir an Orten, die Dominique damals für chic hielt. Jetzt überquert sie den Ozean, um ihre Sonnenbäder zu nehmen. Weihnachten wird Gilbert sie nach Baalbek mitnehmen …
«In Brasilien soll es herrliche Strände geben, die leer sind», sagt Gisèle. «Und bei der Gelegenheit kann man einen Abstecher nach Brasilia machen. Ich möchte so gern Brasilia sehen!»
«Also ich wirklich nicht!», sagt Laurence. «Die großen Gebäudekomplexe in der Umgebung von Paris sind schon deprimierend genug! Eine ganze Stadt nach diesem Muster!»
«Du bist wie dein Vater – ein Vergangenheitsmensch», sagt Dominique.
«Wer ist das nicht?», wirft Jean-Charles ein. «Im Zeitalter der Raketen und der Automation haben die Menschen die gleiche Mentalität wie im neunzehnten Jahrhundert.»
«Ich nicht», sagt Dominique.
«Du, du bist in allem eine Ausnahme», sagt Gilbert in überzeugtem Ton (oder vielmehr in emphatischem Ton: Er hält immer Distanz zu seinen Worten).
«Jedenfalls sind die Arbeiter, die die Stadt gebaut haben, meiner Meinung: Sie wollten nicht aus ihren alten Holzhäusern heraus.»
«Ihnen blieb nichts anderes übrig, meine liebe Laurence», sagt Gilbert. «Die Mieten in Brasilia übersteigen bei weitem ihre Mittel.»
Ein leises Lächeln spielt um seinen Mund, als entschuldige er sich für seine Überlegenheit.
«Brasilia ist heute schon völlig überholt», sagt Dufrène. «In diesem Baustil hatten das Dach, die Tür, die Wand, der Kamin noch ihre eigene Funktion. Was man heute zu verwirklichen sucht, ist das synthetische Haus, in dem jedes Element polyvalent ist: Das Dach verschmilzt mit der Wand und endet mitten im Patio.»
Laurence ist unzufrieden mit sich; sie hat ganz offensichtlich etwas Dummes gesagt. Das kommt davon, wenn man über Dinge redet, von denen man nichts versteht. «Sprecht nicht über Dinge, von denen ihr nichts versteht», sagte Mademoiselle Houchet. Aber dann dürfte man ja nie den Mund aufmachen. Sie hört schweigend zu, während Jean-Charles die Stadt der Zukunft beschreibt. Unerklärlicherweise entzücken ihn diese zukünftigen Wunder, die er nie mit eigenen Augen sehen wird. Es hat ihn entzückt, zu erfahren, dass der Mensch von heute einige Zentimeter größer ist als der Mensch des Mittelalters, der wiederum größer war als der Mensch der vorgeschichtlichen Zeit. Glücklich, wer sich so begeistern kann. Wieder einmal und immer mit der gleichen Verve diskutierten Dufrène und Jean-Charles über die Krise der Architektur.
«Natürlich brauchten wir staatliche Kredite», sagt Jean-Charles, «aber der Staat kann eben nicht alles finanzieren. Und auf eigene Atomwaffen verzichten, das hieße ja sich außerhalb der Geschichte begeben.»
Keiner antwortet; in das Schweigen hinein tönt die schwärmerische Stimme Marthes: «Wenn nur alle Völker gemeinsam abrüsten würden! Habt ihr die letzte Botschaft Papst Pauls VI. gelesen?»
Dominique schneidet ihr ungeduldig das Wort ab: «Maßgebliche Leute haben mir versichert, dass die Menschheit, käme es zum Krieg, nach zwanzig Jahren doch wieder da angelangt wäre, wo sie heute ist.»
Gilbert hebt den Kopf, er hat nur noch vier Steinchen, die er unterbringen muss. «Es wird keinen Krieg geben. Die Kluft zwischen den kapitalistischen und den sozialistischen Ländern wird bald überbrückt sein. Denn heute – das ist die große Revolution des zwanzigsten Jahrhunderts – ist Erzeugen wichtiger als Besitzen.»
Warum dann Geld für Rüstungszwecke ausgeben?, fragt sich Laurence. Aber Gilbert kennt die Antwort, sie will sich nicht noch einmal blamieren. Übrigens hat Jean-Charles die Antwort schon geliefert: Ohne die Bombe würde man sich außerhalb der Geschichte begeben. Was heißt das eigentlich genau? Sicher wäre es eine Katastrophe, alle haben konsternierte Gesichter gemacht.
Gilbert wendet sich mit liebenswürdigem Lächeln an sie:
«Sie müssen am Freitag kommen. Ich führe Ihnen meine neue Hi-Fi-Anlage vor.»
«Die gleiche, die auch Karim und Alexander von Jugoslawien haben», sagt Dominique.
«Wirklich eine wunderbare Erfindung», sagt Gilbert. «Man kann nachher Musik aus einem gewöhnlichen Apparat gar nicht mehr hören.»
«Dann komme ich lieber nicht. Ich höre gern Musik.» (Das stimmt gar nicht. Ich sage das nur, um witzig zu sein.)
Jean-Charles ist anscheinend sehr interessiert: «Wie viel muss man mindestens für eine gute Hi-Fi-Anlage rechnen?»
«Für eine Mono-Anlage müssen Sie mindestens, allermindestens dreitausend Franc ausgeben. Aber davon hat man noch nicht viel.»
«Wenn man etwas wirklich Gutes haben will, muss man also so etwa mit zehntausend rechnen?», fragt Dufrène.
«Eine gute Mono-Anlage kostet zwischen sechs- und zehntausend. Bei Stereo müssen Sie mit zwanzigtausend rechnen. Ich würde jedoch sagen, lieber eine gute Mono als eine billige Stereo. Eine Anlage mit Vorverstärker, die schon ganz annehmbar ist, kostet so um die fünftausend.»
«Das sagte ich ja: mindestens zehntausend», stellt Dufrène mit einem Seufzer fest.
«Es gibt dümmere Arten, zehntausend Franc anzulegen», sagt Gilbert.
«Wenn Vergne das Projekt im Roussillon übertragen wird, dann leisten wir uns das auch», sagt Jean-Charles zu Laurence. Er wendet sich an Dominique:
«Er hat eine tolle Idee für einen dieser Bungalow-Komplexe, wie man sie dort unten jetzt baut.»
«Vergne hat tolle Ideen. Aber sie lassen sich oft nicht durchführen», sagt Dufrène.
«Sie werden durchgeführt werden. Kennen Sie ihn?», fragt Jean-Charles Gilbert. «Es ist einfach mitreißend, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ganze Studio ist von Begeisterung erfüllt. Man führt nicht aus – man schöpft.»
«Er ist der größte Architekt seiner Generation», stellt Dominique in entschiedenem Ton fest. «Vorderste Avantgarde im modernen Städtebau.»
«Ich bin trotzdem lieber bei Monnod», sagt Dufrène. «Wir schöpfen nicht, wir führen aus. Nur verdient man besser dabei.»
Hubert nimmt die Pfeife aus dem Mund:
«Ein Punkt, der des Überlegens wert ist.»
Laurence erhebt sich; sie lächelt ihrer Mutter zu:
«Darf ich mir einige von deinen Dahlien mitnehmen?»
«Aber natürlich.»
Marthe ist auch aufgestanden; sie geht mit ihrer Schwester hinaus:
«Hast du Papa am Mittwoch gesehen? Wie geht es ihm?»
«Bei uns ist er immer recht fröhlich. Er hat sich zur Abwechslung mal mit Jean-Charles gestritten.»
«Jean-Charles versteht Papa eben auch nicht.» Marthe befragt mit einem Blick den Himmel: «Papa ist so anders als andere Menschen. Auf seine Weise hat er zum Übernatürlichen Zugang. Die Musik, die Dichtung – für ihn ist das ein Gebet.»
Laurence beugt sich über die Dahlien; diese Sprache ist ihr peinlich. Gewiss, er hat etwas, was die anderen nicht haben, was ich nicht habe (aber was haben sie, was ich auch nicht habe?). Rosa, rot, gelb, orangefarben – sie hält die herrlichen Dahlien in der Hand.
«Ein schöner Tag, nicht wahr?», fragt Dominique.
«Ein herrlicher Tag», sagt Marthe voller Inbrunst.
«Ja, ein herrlicher Tag», wiederholt Laurence.
Das Tageslicht schwindet. Ihr tut es nicht leid, nach Hause zurückzukehren. Sie zögert. Sie hat bis zur letzten Minute gewartet; wenn sie ihre Mutter um etwas bitten soll, bekommt sie Hemmungen, wie damals, als sie fünfzehn war.
«Ich wollte dich noch etwas fragen …»
«Ja – was?» Dominiques Stimme ist kalt.
«Es ist wegen Serge. Er möchte gern von der Universität weg. Er würde am liebsten beim Rundfunk oder beim Fernsehen arbeiten.»
«Schickt dich dein Vater?»
«Ich habe Bernard und Georgette bei Papa getroffen.»
«Wie geht es ihnen? Machen sie noch immer auf Philemon und Baucis?»
«Oh, ich habe sie nur ganz kurz gesehen.»
«Sag deinem Vater ein für alle Mal, ich bin kein Stellenvermittlungsbüro. Ich finde, es ist schon ein wenig skandalös, wie man mich hier auszunutzen versucht. Ich habe nie von anderen Leuten Unterstützung erwartet.»
«Du kannst Papa nicht zum Vorwurf machen, dass er seinem Neffen helfen will», sagt Marthe.
«Ich mache ihm zum Vorwurf, dass er selber nichts zuwege bringt.» Mit einer Handbewegung schneidet Dominique alle Entgegnungen ab: «Wenn er Mystiker wäre, wenn er zu den Trappisten gegangen wäre, würde ich das begreifen.» (Das würdest du nicht, denkt Laurence.) «Aber er hat sich für die Mittelmäßigkeit entschieden.»
Sie verzeiht es ihm nicht, dass er Pressereferent bei der Deputiertenkammer geworden ist und nicht der große Anwalt, den sie zu heiraten geglaubt hatte. «Ein Abstellgleis», sagt sie.
«Es ist schon spät», sagt Laurence. «Ich gehe schnell hinauf und mache mich etwas zurecht.»
Sie kann es unmöglich zulassen, dass ihr Vater in ihrem Beisein angegriffen wird, und ihn verteidigen wäre noch schlimmer. Immer dieses Stechen in der Herzgegend, diese Gewissensbisse, wenn sie an ihn denkt. Völlig grundlos: Ich habe nie für Mama Partei ergriffen.
«Ich gehe auch hinauf – ich muss mich umkleiden», sagt Dominique.
«Ich kümmere mich um die Kinder», sagt Marthe.
Das ist bequem: Seit sie den Zustand der Heiligkeit erlangt hat, übernimmt sie alle undankbaren Aufgaben. Sie empfindet dabei so erhabene Wonnen, dass man sie ihr ohne Skrupel überlassen kann.
Während sie im Zimmer ihrer Mutter – ganz hübsch, dieser bäuerlich-spanische Stil – vor dem Spiegel steht, versucht Laurence es ein letztes Mal:
«Kannst du wirklich nichts für Serge tun?»
«Nein.»
Dominique tritt vor den Spiegel.
«Wie ich aussehe! Eine Frau in meinem Alter, die den ganzen Tag arbeitet und jeden Abend ausgeht, ist einfach erledigt. Ich brauchte mehr Schlaf.»
Im Spiegel sieht Laurence ihre Mutter prüfend an. Das vollkommene, das ideale Bild einer Frau, die mit Grazie alt wird. Die alt wird. Dieses Bild weist Dominique zurück. Zum ersten Mal kneift sie. Krankheit, Schicksalsschläge, das alles hat sie verkraftet. Und plötzlich steht Panik in ihren Augen:
«Ich kann einfach nicht glauben, dass ich eines Tages siebzig sein werde.»
«Keine Frau hält sich so gut wie du», sagt Laurence.
«Mit meiner Figur bin ich zufrieden, da beneide ich keine andere. Aber sieh dir das hier an.»
Sie deutet auf ihre Augen, ihren Hals. Ja, es lässt sich nicht leugnen, sie ist keine vierzig mehr.
«Du bist nun einmal keine zwanzig mehr», sagt Laurence. «Aber viele Männer ziehen reife Frauen vor. Und Gilbert liefert dir ja den Beweis …»
«Gilbert … Um ihn nicht zu verlieren, gehe ich so viel aus, obwohl es mich kaputtmacht. Das kann sich eines Tages gegen mich auswirken.»
«Ach was!»
Dominique zieht ihr Kostüm von Balenciaga an. Niemals Chanel, man gibt ein Vermögen aus, nur um auszusehen, als hätte man sich auf dem Flohmarkt eingekleidet. Sie murmelt:
«Dieses Biest von Marie-Claire. Sie weigert sich, in eine Scheidung einzuwilligen: nur weil sie mich damit ärgern kann.»
«Vielleicht gibt sie doch noch nach.»
Marie-Claire sagt bestimmt: dieses Biest von Dominique. Solange er mit Lucile de Saint-Chamont liiert war, wohnte Gilbert noch bei seiner Frau, und das Problem stellte sich gar nicht, da Lucile einen Mann und Kinder hatte. Dominique hatte ihn gezwungen, sich von Marie-Claire zu trennen; natürlich hat er nur nachgegeben, weil es ihm passte, aber Laurence hatte das Vorgehen ihrer Mutter doch als grausam empfunden.
«Übrigens hätte ein Zusammenleben mit Gilbert viele Risiken. Er liebt seine Freiheit.»
«Und du liebst die deine.»
«Ja.»
Dominique dreht und wendet sich vor dem dreiteiligen Spiegel und lächelt. In Wirklichkeit ist sie entzückt, bei den Verdelets soupieren zu können; mit Ministern zu Tische sitzen, das imponiert ihr. Wie gehässig ich bin!, sagt sich Laurence. Es ist doch ihre Mutter, sie hat sie gern. Aber es ist auch eine Fremde. Wer verbirgt sich hinter den Bildern, die in den Spiegeln umeinanderwirbeln? Vielleicht überhaupt niemand.
«Bei dir geht alles gut?»
«Sehr gut. Ich eile von Erfolg zu Erfolg.»
«Und die Kleinen?»
«Du hast sie ja gesehen. Sie blühen und gedeihen.»
Dominique stellt Fragen aus Prinzip, aber sie fände es indiskret, gäbe Laurence ihr beunruhigende oder auch nur etwas ausführlichere Antworten.
Im Garten hat sich Jean-Charles über Gisèles Sessel gebeugt: ein kleiner Flirt, der beiden schmeichelt (und Dufrène auch, glaube ich), sie geben sich gegenseitig das Gefühl, dass sie das Abenteuer haben könnten, das sie beide nicht wünschen. (Und wenn es nun doch einmal so weit käme? Ich glaube, das wäre mir egal. Es gibt also doch Liebe ohne Eifersucht?)
«Ich rechne am Freitag mit Ihnen», sagt Gilbert. «Es kommt gar keine Stimmung auf, wenn Sie nicht da sind.»
«Nun übertreiben Sie nicht!»
«Doch, so ist es, die reine Wahrheit.»
Er drückt Laurence mit einer Herzlichkeit die Hand, als verbände sie beide ein besonders inniges Verhältnis; eben wegen dieser Art finden ihn alle charmant:
«Bis Freitag.»
Alle wollen Laurence bei sich sehen, alle kommen gern zu ihr: Sie weiß wirklich nicht, warum.
«Ein wunderschöner Tag», sagt Gisèle.
«Bei dem Leben, das man in Paris führt, hat man eine solche Entspannung bitter nötig», sagt Jean-Charles.
«Einfach unentbehrlich», sagt Gilbert.
Laurence bringt die Kinder im Fond des Wagens unter, sichert die hinteren Türen, sie setzt sich vorn zu Jean-Charles, und dann fahren sie auf der schmalen Straße hinter dem Citroën Dufrènes her.
«Immer wieder erstaunlich, was für ein einfacher Mensch Gilbert geblieben ist», sagt Jean-Charles. «Wenn man an seine Position denkt, an seine Macht. Und nicht die geringste Spur von Wichtigtuerei.»
«Er hat sie nicht nötig.»
«Du magst ihn nicht, das ist verständlich. Aber sei nicht ungerecht.»
«Doch, ich mag ihn ganz gern.» (Mag sie ihn oder mag sie ihn nicht? Sie mag alle Menschen.) Gilbert hält keine hochtrabenden Reden, ja, aber jeder weiß ganz genau, dass er eine der beiden größten Firmen für elektronische Maschinen der Welt leitet, jeder kennt seine Rolle bei der Schaffung des Gemeinsamen Marktes.
«Ich frage mich, wie hoch sein Einkommen ist», sagt Jean-Charles. «Er kann so viel verdienen, wie er will.»
«Ich bekäme Angst, wenn ich so viel Geld hätte.»
«Er macht aber klugen Gebrauch davon.»
«Ja.»
Seltsam: Wenn Gilbert von seinen Reisen erzählt, kann er sehr amüsant sein. Eine Stunde später weiß man schon nicht mehr recht, was er gesagt hat.
«Ein wirklich angenehmes Wochenende!», sagt Jean-Charles.
«Ja, sehr angenehm.»
Und wieder fragt sich Laurence: Was haben sie, was ich nicht habe? Oh, kein Grund zur Beunruhigung! Es gibt solche Tage, wo man mit dem linken Bein aufsteht, an nichts Gefallen findet; sie sollte sich eigentlich daran gewöhnt haben. Und trotzdem fragt sie sich jedes Mal: Was stimmt bei mir nicht? Plötzlich ist sie gleichgültig, steht abseits, als ob sie nicht zu den anderen gehörte. Ihre Depression vor fünf Jahren, für die hat man ihr eine Erklärung gegeben; viele junge Frauen machen diese Art Krise durch; Dominique hat ihr geraten, sich nicht zu Hause zu verkriechen, zu arbeiten, und Jean-Charles ist einverstanden gewesen, als er sah, wie viel ich verdiente. Jetzt habe ich keinen Grund mehr für einen Nervenzusammenbruch. Immer Arbeit vor mir, Leute um mich herum, ich bin mit meinem Leben zufrieden. Nein, keinerlei Gefahr. Es ist nur eine vorübergehende Stimmung. Auch den anderen passiert das oft, davon bin ich überzeugt, und sie machen nicht gleich eine große Geschichte daraus. Sie dreht sich zu den Kindern um.
«Habt ihr euch gut unterhalten, ihr beiden?»
«O ja!», sagt Louise begeistert.
Ein Geruch von totem Laub weht durch das offene Fenster herein; die Sterne leuchten an einem Bilderbuchhimmel, und Laurence fühlt sich plötzlich sehr wohl.
Der Ferrari überholt sie, Dominique winkt, ihr leichtes Umhängetuch flattert im Wind, sie hat wirklich Schwung. Und Gilbert sieht gut aus für seine sechsundfünfzig Jahre. Ein ideales Paar. Sie hat doch recht gehabt, auf klaren Verhältnissen zu bestehen.
«Sie passen gut zueinander», sagt Jean-Charles. «Ein schönes Paar, für ihr Alter.»
Ein Paar. Laurence sieht Jean-Charles prüfend an. Sie fährt gern an seiner Seite. Er blickt aufmerksam vor sich auf die Straße, und sie sieht sein Profil, jenes Profil, das sie vor zehn Jahren so aufregend fand und das noch immer ihr Gefühl anrührt. Von vorn ist Jean-Charles nicht mehr ganz der Gleiche – sie sieht ihn nicht mehr mit dem gleichen Blick. Er hat ein kluges und energisches Gesicht, aber es ist – ja, wie soll man das ausdrücken, festgelegt, fixiert – wie alle Gesichter. Im Profil, im Halbdunkel, scheint der Mund unentschlossener, wirken die Augen träumerischer. So hat sie ihn vor elf Jahren gesehen, und so sieht sie ihn noch heute vor sich, wenn er nicht bei ihr ist und bisweilen, flüchtig, wenn sie im Auto neben ihm sitzt. Sie schweigen. Das Schweigen gleicht einer Komplizenschaft; es drückt eine tiefe Übereinstimmung aus, die sich nicht in Worte fassen lässt. Illusion vielleicht. Doch indes die Straße von den Rädern verschlungen wird und die Kinder schlummern und Jean-Charles schweigt, will Laurence daran glauben.
Jede Spur von Sorge ist verschwunden, als sich Laurence ein wenig später an ihren Schreibtisch setzt: Sie ist nur etwas müde, benommen von der frischen Luft, geneigt, sich jenem müßigen Umherschweifen der Gedanken zu überlassen, das Dominique jäh zu unterbrechen pflegte: «Träum nicht herum: tu etwas» – und das sie sich jetzt selbst versagt. Ich muss diesen Gedanken einfangen, denkt sie, während sie ihren Füllhalter aufschraubt. Welch hübsches Reklamebild, Sicherheit, Glück verheißend – zum Nutzen eines Möbel- oder Textilfabrikanten, eines Blumenhändlers. Das Paar, das im sanften Rauschen der Bäume den Bürgersteig dicht neben dem Geländer entlangschreitet, betrachtet im Vorübergehen das ideale Interieur: unter der hohen Stehlampe der junge, elegante Mann in seinem Angorapullover, der mit aufmerksamem Gesichtsausdruck in einer Illustrierten liest; die junge Frau, an ihrem Tisch sitzend, Füllhalter in der Hand, die Harmonie der schwarzen, der roten und gelben Töne, die (glücklicher Zufall) zu dem Rot und Gelb der Dahlien so gut passen. Vorhin, als ich sie pflückte, waren es lebendige Blumen. Laurence denkt an jenen König, der alles in Gold verwandelte, was er berührte, und an sein kleines, zu einer herrlichen, metallenen Puppe gewordenes Töchterchen. Alles, was sie, Laurence, berührt, wird zu einem Bild. Entscheiden Sie sich für Holztäfelung – dann verbinden Sie städtische Eleganz mit der Poesie der Wälder. Sie nimmt durch das Laubwerk hindurch das schwarze Plätschern des Flusses wahr; ein Boot fährt vorüber, mit seinem weißen Scheinwerfer die Ufer erforschend. Das Licht sprüht gegen die Fenster, es strahlt brutal die eng umschlungenen Liebenden an, Bild der Vergangenheit für mich, die ich das Bild ihrer zärtlichen Zukunft bin, mit Kindern, die sie sich in den Zimmern im Hintergrund schlafend vorstellen. Kinder schlüpfen in einen hohlen Baum hinein, und schon befinden sie sich in einem wunderbaren Zimmer mit natürlicher Holztäfelung. Eventuell noch weiter ausarbeiten.
Sie ist immer ein Bild gewesen. Dafür hat Dominique gesorgt, deren Kindheit unter dem faszinierenden Eindruck von Bildern stand, die so ganz anders waren als ihr eigenes Leben, Dominique, die mit all ihrer Intelligenz und Energie danach getrachtet hatte, diesen trennenden Graben auszufüllen. (Du weißt nicht, was es heißt, zerrissene Schuhe zu haben und durch den Strumpf hindurch zu spüren, dass man auf Speichelauswurf getreten ist. Du weißt nicht, was es heißt, wenn andere Mädchen mit sauber gewaschenen Haaren dich mustern und sich mit den Ellbogen anstoßen. Nein, du gehst nicht mit diesem Fleck auf dem Rock aus dem Haus, zieh dich um.) Kleines Mädchen, Teenager, junge Dame – immer untadelig, immer vollkommen. Du warst so sauber, so frisch, so vollkommen … sagt Jean-Charles.
Alles war sauber, frisch, vollkommen: das blaue Wasser des Schwimmbeckens, das von Luxus kündende Geräusch der Tennisbälle, die weißen, steinernen Gipfel, die geballten Wolken am klaren Himmel, der Duft der Tannen. Jeden Morgen beim Öffnen der Fensterläden betrachtete Laurence eine herrliche Fotografie auf Hochglanzpapier. Im Park des Hotels die Jungen und Mädchen, hell gekleidet, die Haut gebräunt, von der Sonne überglänzt wie schöne Kieselsteine. Und Laurence und Jean-Charles, hell gekleidet, gebräunt, von der Sonne überglänzt. Plötzlich eines Abends, bei der Rückkehr von einer Spazierfahrt, im parkenden Wagen, sein Mund auf meinem Mund – dieser Aufruhr, dieser Taumel. Damals bin ich tagelang, wochenlang kein Bild gewesen, sondern Fleisch und Blut, Verlangen, Sinnenlust. Und ich habe auch jene innere Ruhe verspürt, die ich einst empfand, wenn ich zu Füßen meines Vaters saß oder seine Hand in der meinen hielt … und dann abermals vor achtzehn Monaten, mit Lucien zusammen; das Feuer in meinen Adern und in meinen Gliedern dieses köstliche Zerfließen. Sie beißt sich auf die Lippe. Wenn Jean-Charles wüsste! In Wirklichkeit hat sich nichts verändert zwischen Laurence und ihm. Lucien – das läuft am Rande mit. Und außerdem erregt er ihre Gefühle nicht mehr so stark wie anfangs.
«Na, hast du schon eine Idee?»
«Sie wird schon kommen.»
Aufmerksamer Blick des Ehegatten, anmutiges Lächeln der jungen Frau. Man hat ihr oft gesagt, sie habe ein anmutiges Lächeln. Die Idee wird schon kommen; am Anfang ist es immer schwierig, es gilt, so vielen abgenutzten Klischees, so vielen Fallen aus dem Weg zu gehen. Aber sie versteht ihr Handwerk. Ich verkaufe keine Holztäfelungen: Ich verkaufe Sicherheit, Erfolg und einen Hauch Poesie dazu. Als Dominique ihr vorschlug, Papierbilder zu fabrizieren, gelang ihr dies so schnell und so vollkommen, dass man an eine Berufung hätte glauben können. Sicherheit. Holz entzündet sich nicht leichter als Stein oder Ziegelstein: Dies auszudrücken, ohne die Vorstellung eines Brandes zu erwecken – dazu braucht man Fingerspitzengefühl.
Sie steht unvermittelt auf. Weint Catherine auch heute Abend wieder?
Louise schlief. Catherine blickte zur Decke empor.
Laurence beugt sich über sie: «Du schläfst nicht, mein Schatz? Woran denkst du?»
«An nichts.»
Laurence gibt ihr einen Kuss, ist beunruhigt. Das ist gar nicht Catherines Art, sich so zu verschließen; sie ist stets offen und sogar mitteilsam. «Man denkt immer an etwas. Komm, sag’s mir. Versuch’s mal.»
Catherine zögert einen Augenblick; das Lächeln ihrer Mutter bringt sie zum Sprechen: «Mama, warum ist man auf der Welt?»
Das sind so die Fragen, die Kinder einem an den Kopf werfen, wenn man gerade daran denkt, Holztäfelungen an den Mann zu bringen. Schnell antworten: «Aber Schatz, Papa und ich, wir wären sehr traurig, wenn du nicht da wärst.»
«Aber wenn auch ihr nicht da wärt?»
Welche Angst in den Augen dieses kleinen Mädchens, das ich noch wie ein Baby behandle. Warum stellt sie sich diese Frage? Deshalb also weint sie nachts.
«Warst du heute Nachmittag nicht froh, dass wir alle da sind, du, ich, alle anderen?»
«Doch.»
Catherine scheint nicht ganz überzeugt zu sein.
Laurence hat eine Eingebung:
«Die Menschen sind da, um einander glücklich zu machen», sagt sie voller Schwung. Sie ist sehr stolz auf ihre Antwort.
Verschlossenen Gesichts denkt Catherine weiter nach; oder vielmehr, sie sucht nach Worten:
«Aber die Menschen, die nicht glücklich sind, warum sind die da?»
Da haben wir es, jetzt kommen wir zum springenden Punkt.
«Hast du unglückliche Menschen gesehen? Wo denn, mein Schatz?»
Catherine schweigt bedrückt. Wo? Goya ist immer fröhlich und spricht kaum Französisch. Sie wohnen in einem guten Viertel: keine Clochards, keine Bettler; also Bücher? Schulkameradinnen?