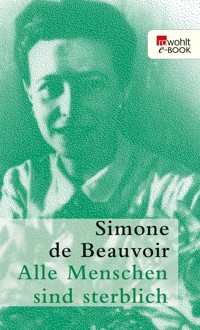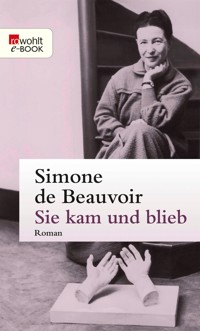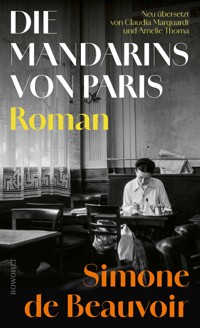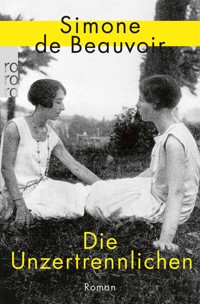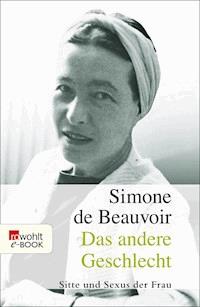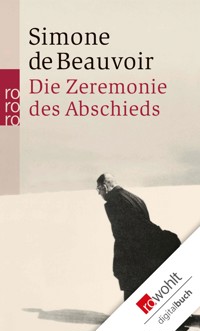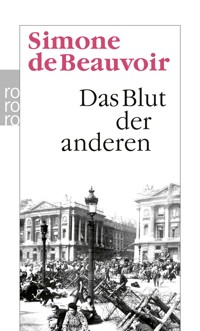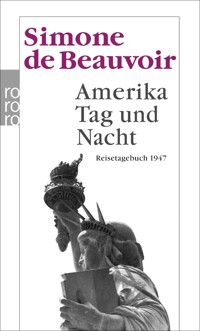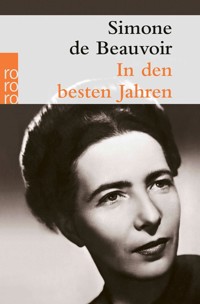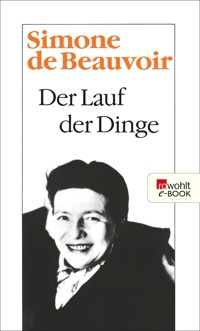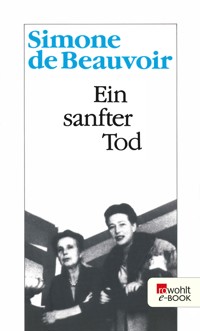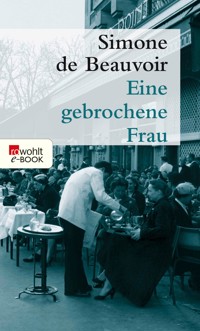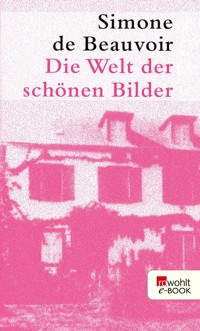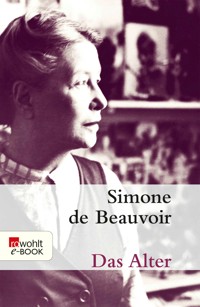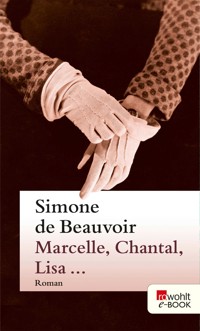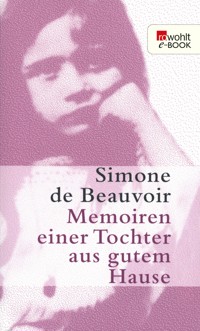
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Beauvoir: Memoiren
- Sprache: Deutsch
Ein inspirierendes Zeugnis der Selbstfindung und Emanzipation einer Frau in einer von Konventionen geprägten Zeit. In ihren Memoiren Memoiren einer Tochter aus gutem Hause erzählt Simone de Beauvoir mit schonungsloser Aufrichtigkeit die Geschichte ihrer Jugend bis zur schicksalhaften Begegnung mit Jean-Paul Sartre. Es ist zugleich die Geschichte ihrer Befreiung aus den Fesseln der bürgerlichen Denk- und Lebensformen des Elternhauses und damit ihrer Selbstfindung als Frau und Intellektuelle. De Beauvoir gewährt tiefe Einblicke in ihre Kindheit und Jugend im Paris der 1920er Jahre, geprägt von den Erwartungen und Konventionen ihrer Herkunft. Mit scharfem Blick und feiner Beobachtungsgabe schildert sie ihren Weg der Emanzipation, der sie schließlich zu einer der bedeutendsten Vordenkerinnen des Feminismus werden lässt. Ein bewegendes Zeitdokument und ein Schlüsselwerk der französischen Literatur, das auch heute noch durch seine Aktualität und Aussagekraft besticht. Memoiren einer Tochter aus gutem Hause ist ein Must-Read für alle, die sich für die Geschichte der Frauenbewegung, Existenzialismus und die faszinierende Persönlichkeit Simone de Beauvoirs interessieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Simone de Beauvoir
Memoiren einer Tochter aus gutem Hause
Über dieses Buch
Mit unbedingter Aufrichtigkeit erzählt hier eine der klügsten Frauen des Jahrhunderts die Geschichte ihrer Jugend bis zur Begegnung mit Jean-Paul Sartre. Dies ist zugleich die Geschichte ihres Weges aus dem Bann der konventionellen Denk- und Lebensformen des Elternhauses und damit ihrer Befreiung zu sich selbst.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1958 unter dem Titel «Mémoires d’une jeune fille rangée» bei Librairie Gallimard, Paris.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2014
Copyright © 1960 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Mémoires d’une jeune fille rangée» Copyright © Librairie Gallimard, Paris, 1958
Umschlaggestaltung Beate Becker
ISBN 978-3-644-03121-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Erster Teil
I
Zweiter Teil
II
Dritter Teil
III
Vierter Teil
IV
Hinweise
Erster Teil
I
Ich bin am 9. Januar 1908 um vier Uhr morgens geboren, und zwar in einem Zimmer mit weiß lackierten Möbeln, das nach dem Boulevard Raspail zu lag. Auf Familienfotografien, die aus dem folgenden Sommer stammen, sieht man junge Damen in langen Kleidern und straußfedergeschmückten Hüten sowie Herren mit ‹Kreissägen› und Panamas auf dem Kopf, die einem Baby zulächeln; das sind meine Eltern, mein Großvater, meine Onkel und Tanten – und ich. Mein Vater war damals dreißig Jahre alt, meine Mutter einundzwanzig, und ich war ihr erstes Kind. Ich wende eine Seite im Album um: Mama hält ein Baby auf dem Arm, doch das bin diesmal nicht mehr ich; ich trage bereits einen Plisseerock und eine Baskenmütze und bin zweieinhalb Jahre alt; inzwischen ist meine Schwester auf die Welt gekommen. Ich war, so scheint es, eifersüchtig, aber nur kurze Zeit. Solange ich mich zurückerinnern kann, war ich stolz darauf, die Ältere und damit die Erste zu sein. Als Rotkäppchen verkleidet, trage ich einen Korb am Arm mit einem Kuchen und einem Topf Butter darin; ich fühlte mich interessanter als das Baby, das ohne Hilfe noch nicht aus seiner Wiege herauskonnte. Ich hatte eine kleine Schwester, aber der Säugling ‹hatte› mich nicht.
Aus meinen ersten Jahren finde ich in mir nur noch einen unbestimmten Eindruck von etwas, das rot, schwarz und warm ist. Die Wohnung war rot, und rot auch der Moquetteteppich, das Renaissance-Speisezimmer, die gepresste Seide, die die Glastüren verkleidete, sowie die Plüschvorhänge in Papas Arbeitszimmer; das Mobiliar dieser geheiligten Stätte war aus schwarzem Birnbaumholz; ich kroch in die Höhlung unter dem Schreibtisch und hockte dort, in Finsternis gehüllt. Es war da dunkel, es war warm, und das Rot des Moquetteteppichs stach mir lebhaft in die Augen. So verging meine allererste Zeit. Ich schaute, tastete und machte in warmer Geborgenheit Bekanntschaft mit der Welt.
Mein tägliches gesichertes Sein verdankte ich Louise. Sie kleidete mich morgens an, zog mich abends aus und schlief nachts im gleichen Zimmer wie ich. Jung, ohne Schönheit und ohne Geheimnis, da sie – so glaubte ich wenigstens – nur dazu da war, über mich und meine Schwester zu wachen, erhob sie niemals die Stimme, niemals schalt sie uns ohne Grund. Ihr ruhiger Blick beschützte mich, während ich im Luxembourggarten Sandkuchen backte und meine Puppe Blondine im Arme wiegte, die in der Christnacht mitsamt dem Koffer, der ihre Ausstattung enthielt, vom Himmel herabgekommen war. Wenn es Abend wurde, setzte sich Louise zu mir, sah mit mir Bilderbücher an und erzählte mir Geschichten dazu. Ihre Gegenwart war für mich notwendig und erschien mir natürlich wie die des Bodens unter meinen Füßen.
In meine Mutter, die mir ferner und weit kapriziöser vorkam, war ich gewissermaßen verliebt; ich saß in der duftenden Wohligkeit ihrer Arme auf ihrem Schoß und bedeckte ihre Haut, die noch die einer jungen Frau war, mit Küssen; manchmal erschien sie des Nachts an meinem Bett, schön wie ein Gemälde in ihrem mit einer malvenfarbenen Blume geschmückten moosgrünen Kleid oder in der von schwarzen Jettperlen funkelnden Abendrobe. Wenn sie böse war, ‹sah sie mich groß an›; ich fürchtete diesen Gewitterblitz, der ihr Antlitz unschön erscheinen ließ; ich brauchte ihr Lächeln.
Meinen Vater bekam ich nur wenig zu Gesicht. Jeden Morgen begab er sich ins ‹Palais›, den Justizpalast, mit einer Mappe voller Dinge unter dem Arm, die man nicht anrühren durfte und die er seine Akten nannte. Er trug weder Voll- noch Schnurrbart, seine Augen waren blau und vergnügt. Wenn er abends heimkam, brachte er Mama Parmaveilchen mit, sie küssten einander und lachten. Papa lachte auch mit mir; er lehrte mich singen: C’est une auto grise … oder Elle avait une jambe de bois. Er verblüffte mich, indem er aus meiner Nasenspitze Zehn-Sous-Stücke zog. Er verstand mich zu amüsieren, und ich freute mich, wenn er sich mit mir beschäftigte; aber seine Rolle in meinem Leben war nicht sehr deutlich umrissen.
Die Hauptfunktion von Louise und Mama bestand darin, mich zu füttern, was für sie nicht immer eine leichte Aufgabe war. Durch den Mund trat die Welt auf sehr viel intimere Weise als durch Augen und Hände in mich ein. Ich nahm sie aber nicht einfach in Bausch und Bogen hin. Der fade Geschmack der Grünkernsuppe, des Haferschleims, der Brotsuppen entlockte mir sogar Tränen; schmieriges Fett, das klebrige Innere der Schaltiere widerten mich an; Schluchzen, Geschrei, Erbrechen waren die Folge davon; meine Antipathien waren so unüberwindlich, dass man darauf verzichtete, ihnen entgegenzutreten. Umgekehrt machte ich mir das Privileg der Kindheit, für die Schönheit, Luxus und Glück noch essbare Dinge sind, leidenschaftlich zunutze: In der Rue Vavin blieb ich starr vor Bewunderung in den Anblick der transparenten Fruchtpastenherrlichkeiten und des vielfarbigen Blütenflors der sauren Drops versunken stehen. Ich war ebenso begierig auf ihre Farben, Grün, Rot, Orange und Violett, wie auf das Gaumenvergnügen, das sie mir verhießen. Oft wurde mir das Glück zuteil, dass meine Bewunderung in genießerisches Schwelgen einmündete. Mama zerstampfte Pralinen in einem Mörser, sie mischte die körnig-pudrige Substanz mit einer gelben Creme; das Rosa der süßen Füllungen stufte sich in erlesenen Tönungen darin ab: Ich tauchte meinen Löffel in etwas wie Abendröte. An den Abenden, an denen meine Eltern Gäste hatten, vervielfältigten die Spiegel im Salon das Glitzern eines kristallenen Lüsters. Mama setzte sich an den Flügel, eine Dame im Tüllkleid spielte Geige und ein Vetter Cello. Ich zerdrückte zwischen den Zähnen die Schale einer verborgen gehaltenen Frucht, und eine lichtgefüllte Blase zerplatzte mit Johannisbeer- oder Ananasgeschmack gegen meinen Gaumen: Mir gehörten Farbe und funkelndes Licht, mir die Chiffonschals, die Diamanten, die Spitzen, mir das ganze Fest. Die Paradiese, in denen Milch und Honig fließen, haben mich niemals verlockt, aber ich neidete der ‹Dame Tartine› ihr Schlafzimmer, das aus einem Windbeutel bestand. Wenn die Welt, in der wir leben, um und um essbar wäre, welche Macht besäßen wir über sie! Als ich erwachsen war, hätte ich am liebsten die blühenden Mandelbäume abgeweidet und in die Pralinen des Sonnenuntergangs kräftig hineingebissen. Vor dem Himmel von New York kamen mir die Neonreklamen wie riesenhafte Leckereien vor, um die ich mich noch heute betrogen fühle.
Essen war nicht nur eine Entdeckungsreise und eine Eroberung, sondern auch die ernsteste meiner Verpflichtungen: «Einen Löffel für die Mama, einen für die Großmama … Wenn du nicht isst, wächst du auch nicht.» Ich wurde im Vorplatz mit dem Rücken an die Wand gestellt, dann zog man haarscharf über meinem Kopf einen Strich, der mit einem von früher verglichen wurde; ich war um zwei oder drei Zentimeter gewachsen, man gratulierte mir dazu, und ich bildete mir etwas darauf ein; manchmal jedoch erfasste mich auch Angst. Die Sonne legte sich schmeichelnd über das gewachste Parkett und die weiß lackierten Möbel. Ich betrachtete Mamas Armstuhl und dachte bei mir: ‹Ich werde mich nicht mehr auf ihren Schoß setzen können.› Plötzlich war da die Zukunft: Sie würde mich in ein anderes Wesen verwandeln, das ‹ich› sagte und das doch ich nicht mehr war. Ich habe alle Entwöhnung, allen Verzicht, alle Verlassenheit, alle aufeinanderfolgenden Tode schon früh vorausgeahnt. «Einen Löffel für Großpapa …» Aber ich aß schließlich doch und war stolz darauf, dass ich größer wurde; ich habe mir nie gewünscht, für immer ein kleines Kind zu bleiben. Ich muss diesen Konflikt wohl in aller Intensität durchlebt haben, da ich mich noch so gut in allen Einzelheiten an das Album erinnere, aus dem Louise mir die Geschichte von Charlotte vorlas. Eines Morgens fand Charlotte auf dem Stuhl an ihrem Bett ein rosa Zuckerei, das fast so groß war wie sie selbst; auch mich faszinierte es. Es war Mutterleib und Wiege in einem, und doch konnte man es essen. Da Charlotte jede andere Nahrung ablehnte, wurde sie Tag für Tag kleiner, bis sie geradezu winzig war; beinahe wäre sie in einem Kochtopf ertrunken, die Köchin warf sie aus Unachtsamkeit in einen Abfalleimer, eine Ratte trug sie fort. Sie wurde gerettet; jedoch von Schrecken und Reue erfasst, stopfte Charlotte sich nun so gierig voll, dass sie wie eine pralle Schweinsblase anschwoll und ihre Mutter mit diesem ballonförmig aufgetriebenen Ungeheuer schließlich zum Arzt gehen musste. Mit weise gemäßigtem Appetit betrachtete ich die Bilder, durch welche die von diesem vorgeschriebene Diät anschaulich dargestellt wurde: eine Tasse Schokolade, ein gekochtes Ei, ein goldbraun gebratenes Kotelett. Charlotte fand daraufhin wieder zu ihrem normalen Umfang zurück, und ich selbst ging heil und gesund aus einem Abenteuer hervor, das mich einmal auf die Dimensionen eines Embryos reduziert und ein andermal in eine dickliche Matrone verwandelt hatte.
Ich fuhr fort zu wachsen und wusste mich zum Exil verdammt; daraufhin suchte ich Hilfe bei meinem eigenen Bild. Morgens wickelte Louise mein Haar um einen Stock, und ich betrachtete mit einem Gefühl der Befriedigung mein von Korkzieherlocken umgebenes Gesicht. Brünette mit blauen Augen, hatte man mir gesagt, sind nichts Alltägliches, und ich hatte schon gelernt, alles Seltene auch für kostbar zu halten. Ich gefiel mir selbst und suchte zu gefallen. Die Freunde meiner Eltern bestärkten mich in meiner Eitelkeit: Sie schmeichelten mir auf höfliche Art, sie verwöhnten mich. Ich schmiegte mich gern an Pelze, an seidene Frauenmieder; Männer imponierten mir jedoch mehr mit ihren Schnurrbärten, ihrem Tabaksgeruch, ihren tiefen Stimmen, ihren Armen, die mich vom Boden hochhoben. Ich legte besonderen Wert darauf, ihre Aufmerksamkeit zu fesseln: Ich führte mich albern auf, rutschte unruhig hin und her und lauerte förmlich auf ein Wort, das mich meinem Limbus entreißen und mir endgültig in ihrer Welt Existenz verschaffen würde. Eines Abends wies ich in Gegenwart eines Freundes meines Vaters eigensinnig einen Teller mit Kochsalat zurück; auf einer Karte, die er aus den Ferien schrieb, erkundigte er sich scherzhaft: ‹Schwärmt Simone noch immer so sehr für Kochsalat?› Schriftlich Niedergelegtes genoss in meinen Augen durchaus noch einen Vorrang vor dem gesprochenen Wort: Ich war außer mir vor Stolz. Als wir Herrn Dardelle auf dem Platz vor Notre-Dame-des-Champs wieder begegneten, rechnete ich auf kleine Neckereien, über die ich entzückt gewesen wäre. Ich versuchte, dergleichen zu provozieren, fand jedoch keinerlei Echo bei ihm. Ich ließ nicht locker: Man hieß mich schweigen. Unter Schmerzen machte ich die Entdeckung, dass Ruhm vergänglich ist.
Enttäuschungen dieser Art blieben mir gewöhnlich erspart. Zu Hause rief der geringste Vorfall weitschweifige Kommentare hervor; meine Geschichten wurden gern angehört, meine komischen Ansprüche liebevoll weiterberichtet. Großeltern, Onkel, Tanten, Vettern, eine personenreiche Familie gewährleisteten meine Wichtigkeit. Im Übrigen blickte eine Fülle von übernatürlichen Wesen, um mein Wohl besorgt, auf mich herab.
Sobald ich gehen konnte, hatte Mama mich in die Kirche mitgenommen; sie hatte mir, in Wachs, aus Gips geformt, an die Wände gemalt, die Bilder des Jesuskindes, des Herrgotts, der Jungfrau Maria, der Engel gezeigt, von denen einer sogar ganz ähnlich wie Louise speziell meinem Dienste zugeteilt war. An meinem Himmel standen sternengleich Myriaden wohlwollender Augen.
Auf Erden gaben sich Mamas Mutter und Schwester recht aktiv mit mir ab. Großmama hatte rosige Wangen, weißes Haar und Ohrringe mit Diamanten; sie lutschte Gummibonbons, die hart und rund wie Schuhknöpfe waren und deren durchsichtige Farbtöne mich entzückten; ich hatte Großmama gern, weil sie alt war, und ich liebte Tante Lili wegen ihrer Jugend; sie lebte bei ihren Eltern, als sei sie noch ein Kind, wodurch sie mir näherstand als die andern Erwachsenen. Rotgesichtig, mit glattpoliertem Schädel und einem wie mit grauem, schmuddeligem Moos bewachsenen Kinn, ließ mich Großpapa gewissenhaft auf seiner Fußspitze reiten, doch seine Stimme war so kratzig, dass man niemals wusste, ob er Spaß machte oder schalt. Jeden Donnerstag aß ich bei den Großeltern zu Mittag; es gab gebratene Klopse oder Kalbsfrikassee, hinterher Pudding mit Fruchtsaft: Großmama verwöhnte mich. Nach dem Essen schlief Großpapa in einem Ohrenstuhl mit Gobelinbezug ein, und ich beschäftigte mich unter dem Tisch mit Spielen, die keinen Lärm verursachten. Wenn Großpapa fortgegangen war, holte Großmama aus dem Buffet den Metallkreisel hervor, auf den man, während er sich drehte, bunte Pappscheiben aufreihen musste; im Hinterteil eines Männchens aus Blei, den sie ‹Vater Kolik› nannte, zündete sie eine weiße Tablette an, aus der eine dünne braune Schlange hervorquoll. Sie spielte mit mir so manche Partie Domino, Schnippschnapp und Stäbchenspiel. Ich fand es immer ein wenig zum Ersticken in diesem Esszimmer, das mit Möbeln weit mehr vollgestopft war als die Hinterstube eines Antiquitätenhändlers; an den Wänden war keine Stelle mehr frei: Gobelins, Steingutteller, Bilder mit verräucherten Farben; in einem Haufen grüner Kohlköpfe lag ein toter Puter; die Tischchen waren mit Deckchen aus Samt, aus Plüsch, aus Spitzen belegt; die in einem kupfernen Cachepot eingekerkerten Aspidistren wirkten niederdrückend auf mich.
Manchmal ging Tante Lili mit mir aus; ich weiß nicht, welchem Zufall ich es verdankte, dass sie mich mehrmals zum Rennen mitnahm. Eines Nachmittags, als ich an ihrer Seite auf einer Tribüne in Issy-les-Moulineaux saß, sah ich am Himmel Doppel- und Eindecker kreisen. Wir verstanden uns gut. Eine meiner fernsten und nettesten Erinnerungen ist ein gemeinsamer Aufenthalt mit ihr in Châteauvillain, im Departement Haute-Marne, bei einer Schwester von Großmama. Da die alte Tante Alice seit langem schon Tochter und Gatten verloren hatte, siechte sie, noch dazu taub geworden, in einem großen, von einem Garten umgebenen Hause allein dahin. Die kleine Stadt mit ihren engen Gassen und niedrigen Häusern sah aus, als stamme sie aus meinem Bilderbuch; die mit kleeblatt- und herzförmigen Öffnungen versehenen Fensterläden wurden mit Riegeln an der Wand befestigt, die wie Männchen gestaltet waren; die Puffer waren Hände; ein imposantes Tor führt auf einen Park, in dem Damhirsche ästen; Heckenrosen rankten sich um einen steinernen Turm; die alten Fräulein in diesem kleinen Ort gaben sich viel mit mir ab. Mademoiselle Elise schenkte mir ein Lebkuchenherz. Mademoiselle Marthe besaß eine Maus mit magischen Fähigkeiten, die in einem Glaskästchen saß: Man steckte in einen Schlitz ein Papptäfelchen, auf dem eine Frage stand; die Maus lief im Kreise herum und stieß mit dem Schnäuzchen gegen ein Fach: Dort fand man die auf ein Stückchen Papier gedruckte Antwort. Was mich am meisten in Erstaunen setzte, waren die mit Kohlezeichnungen versehenen Eier, die Doktor Masses Hühner legten; ich holte sie mit eigenen Händen aus ihrem Versteck hervor, was mir später erlaubte, einer skeptischen kleinen Freundin fest entgegenzuhalten: «Ich habe sie doch selber eingesammelt!» In Tante Alices Garten liebte ich die sorglich geschnittenen Eiben, den frommen Buchsbaumduft und unter einer Weißbuche ein Objekt, das auf ähnlich köstliche Weise fragwürdig war wie etwa eine Uhr aus Fleisch: einen Felsen, der ein Möbel war, einen steinernen Tisch. Eines Morgens ging ein Gewitter nieder; ich amüsierte mich gerade mit Tante Lili im Speisezimmer, als der Blitz einschlug – ein Ereignis, das mich mit Stolz erfüllte. Immer wenn mir etwas widerfuhr, war ich umso stärker von meiner Wichtigkeit überzeugt. Auch eine noch subtilere Erfahrung wurde mir zuteil: Die Wand des Wirtschaftsgebäudes war mit Clematis bewachsen; eines Morgens beorderte mich Tante Alice streng zu sich; eine Blüte hatte am Boden gelegen; sie sagte mir auf den Kopf zu, ich hätte sie abgepflückt. Die Blumen im Garten anzurühren war ein Verbrechen, über dessen Schwere für mich keinerlei Zweifel bestand; ich hatte es jedoch nicht getan und wies alle Schuld von mir. Tante Alice glaubte mir nicht. Tante Lili aber trat temperamentvoll für mich ein. Sie repräsentierte in diesem Fall meine Eltern und hatte allein über mich Recht zu sprechen; Tante Alice mit ihrem alten, fleckigen Gesicht kam mir wie eine der bösen Feen vor, die die Kinder verfolgen; ich wohnte mit Behagen dem Kampfe bei, der zu meinem Nutzen von den Kräften des Guten gegen Irrtum und Ungerechtigkeit ausgefochten wurde. In Paris ergriffen Eltern und Großeltern aufgebracht meine Partei, ich genoss den Triumph meiner Tugend.
Beschützt, verhätschelt, angenehm unterhalten durch die unaufhörliche Neuheit aller Dinge, war ich ein ungemein vergnügtes kleines Ding. Dennoch stimmte etwas nicht, da ich fürchterliche Wutanfälle bekam, bei denen ich mich, rot-violett im Gesicht und wie von Krämpfen befallen, auf den Boden warf. Ich bin drei Jahre alt, wir essen auf der besonnten Terrasse eines großen Hotels – es war in Divonne-les-Bains – zu Mittag; ich bekomme eine rote Eierpflaume und fange an, die Haut davon abzuziehen. «Nein», sagt Mama; ich werfe mich brüllend auf den Zementboden nieder. Ich heule den ganzen Boulevard Raspail entlang, weil Louise mich vom Square Boucicaut weggeholt hat, wo ich Sandkuchen backte. In solchen Augenblicken bin ich weder für Mamas unheilverkündende Miene noch für die strenge Stimme Louises oder das außergewöhnliche Dazwischentreten von Papa empfänglich. Ich brüllte damals so laut und so lange, dass ich im Luxembourggarten des Öfteren als misshandeltes Kind angesehen wurde. «Die arme Kleine!», sagte eine Dame und reichte mir ein Bonbon. Ich dankte es ihr, indem ich mit Füßen nach ihr stieß. Dieser Zwischenfall machte von sich reden; eine fettleibige, schnurrbartgeschmückte Tante, die ‹schrieb›, berichtete darüber in der Poupée modèle. Ich teilte das Gefühl der Hochachtung meiner Eltern vor bedrucktem Papier: Dank der Erzählung, die Louise mir vorlas, fühlte ich mich als Persönlichkeit; allmählich gewann indessen etwas wie Unbehagen in mir die Oberhand. ‹Die arme Louise weinte oft bitterlich, wenn sie an ihre Lämmer dachte›, schrieb meine Tante. Louise weinte nie; sie hatte keine Lämmer, und außerdem liebte sie mich: Und wie kann man überhaupt ein kleines Mädchen mit Lämmern vergleichen? Ich bekam an jenem Tage eine Ahnung davon, dass die Literatur mit der Wahrheit nur vage Beziehungen unterhält.
Oft habe ich mich nach Sinn und Grund meiner Wutanfälle gefragt. Ich glaube, dass sie sich zum Teil durch eine stürmische Vitalität und eine Neigung zu einem Extremismus erklärten, auf welchen ich niemals verzichtet habe. Da meine Abneigung bis zum Erbrechen und meine Begierden bis zur Besessenheit gingen, trennte ein Abgrund die Dinge, die ich liebte, von denen, die mir zuwider waren. Ich war außerstande, den Sturz aus der Fülle ins Leere, aus der Seligkeit ins Grauen gelassen hinzunehmen; hielt ich diese Vorgänge freilich für schicksalgegeben, so resignierte ich; niemals habe ich meinen Groll an einem Objekt ausgelassen. Aber ich lehnte es ab, der ungreifbaren Macht der Worte zu weichen; was mich aufs tiefste empörte, war, dass ein beiläufig hingesagter Satz wie: ‹Man muss …, man darf nicht …› im Handumdrehen meine Unternehmungen und Freuden von Grund auf vernichtete. Die Willkür der Befehle und Verbote, auf die ich stieß, schien mir ein Beweis für ihre Substanzlosigkeit zu sein; gestern habe ich einen Pfirsich geschält; weshalb nicht heute die Pflaume? Weshalb muss ich mich von meinem Spiel gerade in dieser Minute trennen? Überall traf ich auf Zwang, jedoch nirgends auf Notwendigkeit. Im Innersten des Gesetzes, das steinern auf mir lastete, ahnte ich schwindelerregende Leere. In diesem Abgrund versank ich dann unter ohrenbetäubendem Geschrei. Indem ich mich strampelnd zu Boden warf, stemmte ich mich mit dem Gewicht meines Leibes gegen die nicht zu fassende Macht, die mich tyrannisierte; ich zwang sie dazu, Gestalt anzunehmen: Man packte mich, sperrte mich in die dunkle Kammer, wo sonst nur Besen und Staubwedel waren; ich stieß dann mit Händen und Füßen zum mindesten gegen wirkliche Wände, anstatt mit ungreifbaren Willensäußerungen in Konflikt zu geraten. Ich wusste, dass der Kampf vergeblich war; in dem Augenblick, da meine Mutter mir die von Saft tropfende Pflaume aus der Hand genommen oder Louise meine Schippe und die Förmchen in ihrer Einkaufstasche hatte verschwinden lassen, war ich bereits besiegt, doch ich ergab mich nicht. Ich setzte mich mit einer Niederlage gründlich auseinander. Mein stoßweises Schluchzen, die Tränen, vor denen ich nicht mehr sehen konnte, vernichtigten die Zeit, brachten den Raum zum Erliegen, ließen gleichzeitig das Objekt meiner Wünsche, doch auch die Hindernisse verschwinden, die mich davon trennten. Ich erlitt Schiffbruch in der Nacht völliger Machtlosigkeit; es blieb nichts mehr übrig als meine nackte Gegenwart, die sich in langgezogenen Heullauten manifestierte.
Nicht nur brachen die Erwachsenen meinen Willen, sondern ich musste mich noch dazu als eine Beute ihres privaten Bewusstseins fühlen. Dieses spielte mitunter die Rolle eines schmeichelnden Spiegels, doch hatte es auch die Macht, über mich einen bösen Zauber zu werfen; es verwandelte mich in ein Tier, in ein Ding: «Was für hübsche Waden die Kleine hat!», sagte eine Dame und bückte sich, um mich zu betasten. Hätte ich mir sagen können: ‹Wie dumm diese Dame ist, sie hält mich für ein Hündchen›, so wäre das meine Rettung gewesen. Doch hatte ich mit meinen drei Jahren noch nicht die Möglichkeit, mich anders dieser süßlichen Stimme, dieses genüsslichen Lächelns zu erwehren, als indem ich mich kreischend auf das Straßenpflaster warf. Später erlernte ich ein paar Abwehrmanöver, dafür jedoch wurde ich anspruchsvoller: Um mich zu verletzen, genügte es jetzt schon, dass man mich als Baby behandelte; obwohl meine Kenntnisse und Möglichkeiten noch vielen Beschränkungen unterlagen, hielt ich mich nichtsdestoweniger für eine Persönlichkeit. Auf der Place Saint-Sulpice habe ich, während meine Hand in der von Tante Marguerite lag, die sich nicht gut darauf verstand, mit mir zu reden, mich plötzlich mit einem deutlichen Gefühl der Überlegenheit gefragt: ‹Was sieht sie wohl in mir?› Mir war ja mein Inneres bekannt, von dem sie gar nichts wusste; durch den Augenschein getäuscht, ahnte sie angesichts meines unfertigen Körpers nicht, dass drinnen schon alles vorhanden war; ich nahm mir vor, wenn ich selber erwachsen wäre, nicht zu vergessen, dass man mit fünf Jahren als Individualität schon voll ausgebildet ist. Das übersahen die Erwachsenen, wenn sie mir Herablassung zeigten und mich dadurch kränkten. Ich war empfindlich wie ein Mensch, der ein Gebrechen hat. Wenn Großmama beim Kartenspiel mogelte, um mich gewinnen zu lassen, wenn Tante Lili mir ein zu leichtes Rätsel aufgab, geriet ich außer mir. Oft hatte ich die Großen im Verdacht, sie spielten Komödie vor mir; ich mutete ihnen dabei nicht zu, dass sie selbst es nicht merkten, sondern nahm vielmehr an, dass sie sich untereinander verabredeten, um mich zum Besten zu haben. Am Ende eines Festmahls wollte Großpapa mit seinem Glas mit mir anstoßen: Ich wand mich konvulsivisch am Boden. Louise nahm ein Taschentuch, um mir den Schweiß von der Stirn zu wischen: Ich wehrte mich erbost dagegen, ihre Geste kam mir unaufrichtig vor. Sobald ich mit Recht oder Unrecht den Eindruck bekam, man mache sich meine Arglosigkeit zunutze, um auf mich Einfluss zu nehmen, rebellierte ich.
Meine Heftigkeit wirkte einschüchternd auf meine Umgebung. Ich wurde gescholten, wenig gestraft; selten kam es vor, dass jemand mir eine Ohrfeige gab. «Wenn man Simone anrührt, wird sie violett», erklärte Mama. Einer meiner Onkel geriet so sehr außer sich, dass er darauf keine Rücksicht nahm: Ich war derart verdutzt, dass mein Anfall schlagartig endete. Man wäre vielleicht gar nicht schwer mit mir fertiggeworden, aber meine Eltern nahmen meine Wutanfälle ohnehin nicht tragisch. Papa – der damit irgendjemanden parodierte – stellte fest: «Dies Kind ist unsoziabel.» Er sagte auch, nicht ohne einen Anflug von Stolz: «Simone ist eigensinnig wie ein Maulesel.» Ich machte mir das zunutze und überließ mich umso mehr meinen Launen; ich war ungehorsam einzig um des Vergnügens willen, Befehle zu missachten. Auf Familienbildern streckte ich die Zunge heraus oder stelle mich mit dem Rücken zum Fotografen auf; alles um mich her lacht. Ähnliche Siege ermutigten mich, Regeln, Riten, Routine nicht für unüberwindlich zu halten. In ihnen wurzelte auch ein Optimismus bei mir, der allen Zähmungsversuchen widerstand.
Was meine Niederlagen anbetrifft, so erzeugten sie in mir weder das Gefühl der Demütigung noch etwa nachhaltigen Groll; wenn ich, nachdem ich mich ausgeheult und -geschrien hatte, endlich kapitulierte, war ich allzu erschöpft, um meinem Verdruss noch weiter nachzuhängen; oft hatte ich dann sogar den Anlass zum Widerstand schon vergessen. Voller Scham über einen Exzess, für den ich in meinem Innern keine Rechtfertigung mehr fand, verspürte ich nichts mehr außer Gewissensbissen; sie verflüchtigten sich jedoch schnell, denn es fiel mir nicht schwer, Verzeihung zu erlangen. Alles in allem bildeten meine Zornanfälle einen Ausgleich für meine Versklavung durch Gesetze; sie verhinderten, dass ich meinen Groll lautlos hinunterschluckte. Niemals stellte ich die Autorität etwa ernstlich in Frage. Das Verhalten der Erwachsenen war mir nur insoweit suspekt, als es das Zweideutige meiner Lage als Kind widerspiegelte: Gegen diese im Grunde lehnte ich mich auf. Ohne jeden Vorbehalt nahm ich jedoch die mir überlieferten Dogmen und die Werturteile hin, die mir dargeboten wurden.
Die beiden obersten Kategorien, die mein Universum bestimmten, waren Gut und Böse. Ich selber bewohnte die Region des Guten, in der – unauflöslich vereint – Glück und Tugend herrschten. Ich besaß die Erfahrung unverdienter Schmerzen: Es kam vor, dass ich mich stieß oder mir die Haut abschürfte; ein Anfall von Ekthyma hatte mich entstellt: Ein Arzt brannte meine Pusteln mit Silbernitrat aus, und ich schrie. Doch gingen solche Missgeschicke jedes Mal rasch vorbei und erschütterten nicht mein Credo, dass Freuden und Leiden der Menschen ihren Verdiensten entsprechen.
Da ich in so intimem Verkehr mit dem Guten lebte, hatte ich sehr bald heraus, dass es innerhalb dieser Kategorie Nuancen und Abstufungen gibt. Ich war ein braves kleines Mädchen, aber ich beging Fehler; Tante Alice betete viel, sie würde sicher einmal in den Himmel kommen, doch hatte sie sich mir gegenüber ungerecht gezeigt. Unter den Leuten, die ich lieben und wertschätzen sollte, befanden sich auch solche, die von meinen Eltern in manchen Punkten missbilligt wurden. Sogar Großpapa und Großmama entgingen nicht völlig ihrer Kritik: Sie hatten mit Vettern ‹gebrochen›, die Mama häufig besuchte und die ich selbst sehr nett fand. Dieses Wort ‹Bruch› mit seinem Unterton von etwas Irreparablem behagte mir durchaus nicht. Weshalb ‹bricht› man mit jemandem? Und wie macht man das? Es schien mir bedauerlich, mit andern gebrochen zu haben. Offen bekannte ich mich zu Mamas Handlungsweise. «Bei wem seid ihr gestern gewesen?», fragte mich Tante Lili. «Das sage ich euch nicht; Mama hat es mir verboten.» Sie tauschte mit ihrer Mutter einen langen Blick. Es kam auch vor, dass sie Bemerkungen machten, die eher abschätzig klangen: «Nun? Läuft deine Mama immer noch so viel herum?» Durch ihre Böswilligkeit setzten sie sich jedoch nur selbst in meinen Augen herab, ohne Mama zu treffen. Einfluss auf die Zuneigung, die ich ihnen entgegenbrachte, hatte das aber keineswegs. Ich fand ganz natürlich und in gewisser Weise sogar angemessen, dass diese Nebenpersonen nicht so unantastbar dastanden wie die Hauptgottheiten. Louise und meine Eltern besaßen allein das Monopol der Unfehlbarkeit.
Ein Feuerschwert trennte das Gute vom Bösen; diesem Letzteren hatte ich niemals ernstlich ins Auge geblickt. Manchmal wurde die Stimme meiner Eltern hart. Aus ihrer Empörung, ihrem Zorn erriet ich, dass es in ihrer Umgebung wahrhaft schwarze Seelen gab. Ich wusste freilich nicht, welche es waren, und auch ihre Verbrechen waren mir nicht bekannt. Das Böse hielt mir gegenüber noch immer einen gewissen Abstand ein. Nur unter dem Bilde mythischer Gestalten stellte ich mir seine Repräsentanten vor: Da waren der Teufel, die böse Fee, Aschenbrödels Schwestern. Da ich ihnen in Wirklichkeit niemals begegnet war, beschränkten sie sich für mich auf ihre reine Essenz. Der Böse sündigte, wie das Feuer brennt, ohne Pardon und ohne Berufungsrecht. Das Feuer war für ihn der natürliche Ort, die Höllenstrafe sein gerechtes Los, und es schien mir ketzerisch, angesichts seiner Qualen Mitleid zu empfinden. Tatsächlich erweckten die rot glühend gemachten Pantoffeln, die die Zwerge Schneewittchens Stiefmutter an die Füße zogen, oder die Flammen, in denen Luzifer schmorte, niemals eine wirkliche Vorstellung physischen Leidens bei mir. Menschenfresser, Hexen, Dämonen, Stiefmütter, Henker waren für mich unmenschliche Wesen, die eine abstrakte Macht vertraten und deren Qualen in ebenfalls abstrakter Form ein Symbol für die ihnen gebührende Niederlage waren.
Als ich mit Louise und meiner Schwester nach Lyon aufbrach, hegte ich die Hoffnung, das Böse endlich einmal mit aufgeklapptem Visier vor mir zu sehen. Wir waren von entfernten Vettern eingeladen, die in einem Vorort der Stadt ein von einem großen Park umgebenes Haus bewohnten. Mama erklärte mir, dass die kleinen Sirmione keine Mutter mehr hätten, dass sie nicht immer artig wären noch, wie es sich gehörte, ihr Abendgebet verrichteten; ich solle mir nichts daraus machen, falls sie über mich lachten, wenn ich selber zur Nacht betete. Ich hörte so etwas heraus, als halte ihr Vater, ein alter Professor der Medizin, nicht viel vom lieben Gott. Ich legte im Geiste bereits die weiße Tunika der hl. Blandine an, die den Löwen überantwortet wird, doch ich wurde enttäuscht, denn niemand stürzte sich auf mich. Wenn Onkel Sirmione das Haus verließ, murmelte er in seinen Bart: «Auf Wiedersehen, Gott behüte euch»; er war also doch kein Heide. Meine Vettern – sieben an der Zahl zwischen zehn und zwanzig Jahren – führten sich allerdings ziemlich merkwürdig auf; durch das Parkgitter bewarfen sie die Gassenjungen mit Steinen, sie prügelten sich untereinander und quälten ein schwachsinniges kleines Waisenmädchen, das bei ihnen wohnte; um die Kleine zu erschrecken, holten sie des Nachts ein Skelett aus dem Arbeitszimmer des Vaters und umhüllten es mit einem weißen Tuch. Obwohl diese Absonderlichkeiten mich etwas stutzig machten, kamen sie mir doch vergleichsweise harmlos vor; ich entdeckte darin noch nicht die wirkliche tiefe Schwärze des Bösen. Friedlich spielte ich zwischen Hortensienbüschen, und die schlimme Kehrseite dieser Welt blieb mir auch weiter verborgen.
Eines Abends jedoch hatte ich das Gefühl, der Boden schwanke unter meinen Füßen.
Meine Eltern waren uns nachgereist. Eines Nachmittags ging Louise mit mir und meiner Schwester zu einem Volksfest, wo wir uns sehr amüsierten. Als wir den Festplatz verließen, begann es schon dunkel zu werden. Wir schwatzten, lachten, und ich knabberte an einem jener künstlichen Objekte, die mir so gut gefielen – einer Schwalbe, die aus Lakritzen bestand –, als Mama an einer Straßenecke erschien. Sie trug einen Schal aus grünem Musselin um den Kopf, und ihre Oberlippe sah wie geschwollen aus: Was fiel uns denn ein, so spät nach Hause zu kommen? Sie war die Ältere, sie war die ‹gnädige Frau›, sie hatte das Recht, Louise zurechtzuweisen; aber ihre Stimme und ihr Gesichtsausdruck wollten mir nicht gefallen; es gefiel mir auch nicht, in Louises geduldigen Augen etwas aufglimmen zu sehen, was nicht durchaus von Ergebenheit sprach. An jenem Abend – oder war es ein anderer? In meinem Gedächtnis jedenfalls sind diese beiden Ereignisse eng miteinander verknüpft geblieben – hielt ich mich mit Louise und einer anderen Person, die ich nicht mehr zu identifizieren vermag, unten im Garten auf; es war dunkel; in der düsteren Fassade öffnete sich ein Fenster, hinter dem ein erleuchtetes Zimmer lag; man erkannte zwei Silhouetten und hörte erregte Stimmen. «Das sind Monsieur und Madame, die sich streiten», bemerkte Louise dazu. In diesem Augenblick geriet mein Weltbild ins Wanken. Es war doch ganz unmöglich, dass Papa und Mama sich als Feinde gegenüberstanden oder dass Louise ihre Feindin war; tritt aber das Unmögliche ein, so vermischen sich Himmel und Hölle, Licht und Finsternis. Ich stürzte in das Chaos zurück, das vor der Schöpfung da gewesen war.
Dieser Albdruck hielt nicht lange an; am folgenden Tag in der Frühe hatten meine Eltern das Lächeln und die Stimme wiedergefunden, die ich an ihnen kannte. Louises hämisches Kichern lag mir noch auf der Seele, doch setzte ich mich darüber hinweg; es gab viele kleine Fakten, die ich derart im Nebel verschwinden ließ.
Diese Fähigkeit, schweigend über Ereignisse hinwegzugehen, die ich gleichwohl deutlich genug erlebte, um sie nie zu vergessen, bleibt für mich einer der frappantesten Züge, wenn ich mich an meine ersten Jahre zurückerinnere. Die Welt, wie man sie mich kennen lehrte, gruppierte sich harmonisch um ein festes Koordinatensystem und war in klar unterschiedene Kategorien eingeteilt. Neutrale Begriffe gab es nicht; zwischen Verräter und Held, Abtrünnigem und Märtyrer war keine Mitte denkbar; jede Frucht, die man nicht essen konnte, war eine giftige Frucht; man wiegte mich fest in dem Glauben, dass ich sämtliche Mitglieder meiner Familie ‹liebte›, darunter auch Großtanten, an denen wahrlich nichts Gewinnendes war. Schon zur Zeit meines frühesten Stammelns strafte meine Erfahrung einen solchen Essenzialismus Lügen. Weiß war nur selten wirklich weiß, die Schwärze des Bösen blieb meinen Augen verborgen: Ich sah überall nur verschiedene Nuancen von Grau. Nur musste ich, sobald ich diese undeutlichen Abstufungen erfassen wollte, mich der Worte bedienen und fand mich dadurch in die Welt der starren Begriffe zurückversetzt. Was ich mit meinen Augen sah, was ich ein für alle Mal als Erfahrung buchte, musste sich wohl oder übel in diesen Rahmen einfügen; Mythen und Klischees bekamen den Vorrang vor der Wahrheit; unfähig, diese zu fixieren, ließ ich zu, dass sie in Bedeutungslosigkeit versank.
Da es mir nicht möglich war, außer mit Hilfe der Sprache zu denken, ging ich von der Voraussetzung aus, dass diese sich genau mit der Wirklichkeit decke; ich wurde durch die Erwachsenen, die ich für die Bewahrer des Absoluten hielt, in sie eingeweiht: Wenn sie eine Sache bezeichneten, glaubte ich, sie drückten damit ihre Substanzen in dem gleichen Sinne aus, wie man den Saft einer Frucht ‹ausdrückt›. Zwischen Wort und Ding stellte ich mir demgemäß nicht den kleinsten Abstand vor, der Raum für Irrtümer bot; so erklärt es sich, dass ich mich dem Wort kritiklos, ohne Nachprüfung unterwarf, selbst dann, wenn die Umstände mich zum Zweifel aufforderten. Zwei meiner Vettern Sirmione lutschten an Stangen aus Traubenzucker. «Es ist ein Abführmittel», erklärten sie augenzwinkernd; ihr hämisches Lachen belehrte mich, dass sie sich über mich lustig machten; dennoch verband sich dieses Wort von da an eng mit den weißlichen Stäbchen; ich trug kein Verlangen mehr danach, erschienen sie mir doch jetzt wie ein fragwürdiger Kompromiss zwischen Leckerei und Medikament.
Ich erinnere mich dennoch an einen Fall, in dem das Wort nicht die Oberhand über meine Einsicht gewann. Während der Ferien auf dem Lande wurden wir oft zum Spielen zu einem entfernten kleinen Vetter mitgenommen; er wohnte in einem schönen Haus inmitten eines großen Parks, und ich unterhielt mich gut mit ihm. «Dieser arme Idiot», sagte eines Abends mein Vater, als er von ihm sprach. Sehr viel älter als ich, kam mir Cendri schon deswegen ganz normal vor, weil ich ihn so gut kannte. Ich weiß nicht, ob mir jemand Idioten gezeigt oder beschrieben hatte; jedenfalls stellte ich sie mir mit einem nichtssagenden Lächeln und leeren Augen vor. Als ich Cendri wiedersah, suchte ich vergebens, dieses Bild mit dem seinen in Einklang zu bringen; vielleicht glich er im Innern, ohne dass man es ihm äußerlich ansah, dennoch einem Idioten, aber etwas in mir sträubte sich, ernstlich daran zu glauben. Aus dem Wunsche heraus, die Sache klarzustellen, dazu aber auch von dunklem Groll gegen meinen Vater geleitet, der meinen Spielkameraden derart beleidigt hatte, fragte ich seine Großmama: «Ist Cendri wirklich ein Idiot?» – «Aber nicht doch!», antwortete sie in gekränktem Ton. Sie musste doch ihren Enkel kennen. Konnte möglicherweise Papa sich im Irrtum befinden? Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte.
Ich hing nicht sonderlich an Cendri; der Zwischenfall setzte mich zwar in Erstaunen, ging mir aber nicht nahe. Die schwarze Magie der Worte wurde mir erst offenbar, als sie mich im Herzen traf.
Mama hatte gerade zum ersten Mal ein tangofarbenes Kleid an. Louise bemerkte daraufhin zu dem Stubenmädchen von vis-à-vis: «Haben Sie gesehen, wie sich unsere Gnädige heute aufgeputzt hat? Ist sie nicht wirklich überspannt?» An einem anderen Tage unterhielt sich Louise unten im Hausflur mit der Tochter der Hausmeistersfrau; zwei Stockwerke weiter oben saß Mama am Flügel und sang. «Ach Gott», meinte Louise, «unsere Gnädige schreit auch immer, als ob sie am Spieß steckte.» – ‹Überspannt›, ‹als ob sie am Spieß steckte.› Diese Ausdrücke hatten für meine Ohren einen abscheulichen Klang: Inwiefern betrafen sie Mama, die doch schön, elegant und zudem musikalisch war? Und dennoch hatte Louise das alles gesagt. Wie sollte ich dem begegnen? Gegen andere Leute wusste ich mich zu wehren; sie aber war die Gerechtigkeit und die Wahrheit in Person, und der Respekt, den ich vor ihr hatte, untersagte mir, ein Urteil über sie zu fällen. Es hätte nicht genügt, ihren Geschmack in Zweifel zu ziehen; um ihre Bosheit zu neutralisieren, musste man sie einem Anfall von schlechter Laune zuschreiben und damit unterstellen, dass sie sich mit Mama nicht gut stand; in diesem Fall jedoch musste eine von ihnen beiden im Unrecht sein! Nein, ich wollte, dass beide sonder Fehl dastünden. Ich gab mir Mühe, Louises Worte von jedem Sinn zu entkleiden: Nur bizarre Laute waren ihrem Munde aus Gründen entschlüpft, die mir verborgen blieben. Es gelang mir nicht unbedingt. Von da an kam es vor, dass mich, wenn Mama eine auffallende Toilette trug oder mit lauter Stimme sang, eine Art von Unbehagen befiel. Da ich andererseits die Erfahrung gemacht hatte, dass man nicht allen Aussprüchen Louises Beachtung schenken durfte, hörte ich nicht mehr mit der gleichen Gefügigkeit auf sie wie zuvor.
Immer bereit, mich zurückzuziehen, wenn meine Sicherheit mir bedroht vorkam, verweilte ich gern bei Problemen, hinter denen ich keine Gefahr vermutete. Das der Geburt zum Beispiel machte mir wenig zu schaffen. Man hatte mir zunächst erzählt, die Eltern kauften sich ihre Kinder; nun, diese Welt war so groß und mit so viel unbekannten Wunderdingen angefüllt, dass es ja sehr wohl auch irgendwo ein Babydepot geben mochte. Allmählich verblasste dieses Bild, und ich begnügte mich mit einer etwas vageren Lösung: «Gott erschafft die Kinder.» Er hatte ja auch die Erde aus dem Chaos erschaffen und Adam aus einem Erdenkloß geformt. Es wäre also gar nichts so Außergewöhnliches, wenn er in einem Babykörbchen einen Säugling entstehen ließ. Dieses Zurückgreifen auf Gottes Willen lullte meine Neugier ein; was die Sache im Ganzen betraf, fand sie sich damit erklärt. Hinsichtlich der Einzelheiten sagte ich mir, dass ich sie sicherlich nach und nach herausbekommen würde. Was mich eher beschäftigte, war das Bestreben meiner Eltern, gewisse Gespräche, die sie führten, vor mir geheim zu halten. Kam ich durch Zufall einmal dazu, so senkten sie die Stimmen oder verfielen in Schweigen. Es gab also Dinge, die ich zwar hätte verstehen können, aber nicht wissen sollte? Was für Dinge waren das denn? Weshalb verbarg man sie vor mir? Mama verbot Louise, mir eine der Geschichten von Madame de Ségur vorzulesen: Ich könne davon Angstzustände bekommen. Was geschah mit dem Burschen, der mit Tierfell bekleidet auf den Bildern zu sehen war? Vergebens fragte ich sie danach. ‹Ourson› wurde damit für mich zum Urbild alles Geheimnisvollen.
Die großen Mysterien der Religion waren zu fern und zu schwer begreifbar, um mir zu schaffen zu machen. Nachdenklich stimmte mich hingegen das Mirakel der Christnacht, das mir weitaus vertrauter war. Es kam mir unangemessen vor, dass das allmächtige Jesuskind Vergnügen daran fand, im Schornstein herunterzurutschen wie ein Kaminkehrerbube. Ich bewegte die Frage lang in meinen Gedanken und eröffnete mich schließlich meinen Eltern darüber, die denn auch Farbe bekannten. Was mich in Erstaunen setzte, war dabei jedoch, dass ich so fest an eine Sache hatte glauben können, die überhaupt nicht auf Wahrheit beruhte, das heißt, dass es falsche Gewissheiten gab. Ich zog jedoch damals noch keine praktischen Folgerungen daraus. Ich sagte mir nicht, dass meine Eltern, da sie mich hierin getäuscht hatten, mich möglicherweise auch weiterhin täuschen würden. Sicherlich würde ich ihnen eine Lüge, die mich im Innersten getroffen oder verwundet hätte, nicht leicht verziehen haben; ich hätte mich dagegen empört und wäre misstrauisch geworden. So fühlte ich mich jedoch ebenso wenig verletzt wie ein Zuschauer, dem ein Taschenspieler einen seiner Tricks aufdeckt; da ich seinerzeit mit dem größten Entzücken neben meinem Schuh die auf ihrem Koffer sitzende Puppe Blondine entdeckt hatte, war ich im Grunde also meinen Eltern fast dankbar für ihre Hinterlist. Vielleicht hätte ich ihnen eher gegrollt, wenn ich nicht nunmehr aus ihrem eigenen Munde die Wahrheit vernommen hätte. Indem sie selber zugaben, sie hätten mich getäuscht, gewannen sie mich aufs Neue durch ihre Offenheit. Sie sprachen eben heute zu mir wie zu einer Erwachsenen. Stolz auf meine neue Würde, fand ich mich leichthin damit ab, dass man das kleine Ding genarrt hatte, das ich nun nicht mehr war. Es erschien mir ganz normal, dass man meiner kleinen Schwester auch weiterhin Dinge vorgaukelte. Ich selbst war zu den Großen hinübergewechselt und nahm damit an, dass mir künftighin stets die Wahrheit offenbart werden würde.
Meine Eltern gingen freundlich auf alle meine Fragen ein; meine Unwissenheit verflüchtigte sich in dem Augenblick, da ich ihr Ausdruck gab. Dennoch gab es einen Mangel, dessen ich mir bewusst war: Unter den Augen der Erwachsenen verwandelten sich die in den Büchern aufgereihten schwarzen Flecke in Wörter; ich betrachtete sie: Sie waren auch mir zwar sichtbar, doch konnte ich sie nicht deuten. Schon frühzeitig hatte man mir Buchstaben zum Spielen gegeben. Mit drei Jahren schon erklärte ich, das O heiße O; das S war für mich ein S, wie ein Tisch ein Tisch war; ich kannte nahezu das gesamte Alphabet, aber die bedruckten Seiten blieben für mich auch weiterhin stumm. Eines Tages jedoch sprang in meinem Kopf der Funke über. Mama hatte auf dem Esszimmertisch die Regimbeaufibel aufgeschlagen; ich betrachtete das Bild einer Kuh, der ‹vache›, und die beiden Buchstaben c und h, die wie sch ausgesprochen wurden. Mit einem Male wurde mir klar, dass diese Zeichen nicht einen Namen trugen wie ein Gegenstand, sondern dass sie vielmehr einen Laut vorstellen. Ich begriff, was ein Schriftzeichen ist. Mit dem Lesenlernen ging es von da an schnell. Freilich blieb mein Denken noch einmal auf halbem Wege stehen. Ich sah in dem graphischen Bild die exakte Entsprechung des Lautes, der damit gemeint war; beide waren für mich ein Ausfluss der Sache, die sie ausdrücken sollten, sodass ihre Wechselbeziehung nicht willkürlich aufzulösen war. Die Erkenntnis des Zeichens schloss noch nicht unbedingt die einer bloßen Übereinkunft ein. Daher widersetzte ich mich mit aller Heftigkeit, als Großmama mich die Noten lehren wollte. Mit einer Stricknadel wies sie auf die runden Köpfe auf dem Liniensystem; diese Linie entsprach, so erklärte sie mir, einer bestimmten Taste auf dem Klavier. Warum? Wieso? Ich fand nichts Gemeinsames zwischen dem Notenpapier und dem Instrument. Wenn man mir ungerechtfertigten Zwang auferlegen wollte, empörte ich mich dagegen; ebenso lehnte ich Wahrheiten ab, die kein Absolutes darstellten. Ich wollte mich nur der Notwendigkeit fügen; menschliche Entscheidungen gingen mehr oder weniger aus bloßer Laune hervor, sie hatten nicht genügend Gewicht, um für mich zwingend zu werden. Tagelang beharrte ich bei meinem Eigensinn. Schließlich aber gab ich nach. Eines Tages kannte ich die Tonleiter, aber ich hatte den Eindruck, die Regeln eines Spiels erlernt, nicht aber eine wirkliche Kenntnis erworben zu haben. Hingegen kam ich mühelos mit der Arithmetik zurecht, denn ich glaubte an die Wirklichkeit der Zahlen.
Im Oktober 1913 – ich war damals fünfeinhalb Jahre alt – wurde beschlossen, mich in eine Privatschule mit dem verlockenden Namen ‹Cours Désir› zu schicken. Die Leiterin der Unterstufe, Mademoiselle Fayet, empfing mich in einem feierlichen, mit schweren Portieren verhangenen Arbeitszimmer. Während sie mit Mama sprach, strich sie mir liebevoll über das Haar. «Wir sind keine Lehrerinnen», erklärte sie, «sondern Erzieherinnen.» Sie trug einen hohen Spitzenkragen, einen langen Rock und kam mir etwas zu salbungsvoll vor: Mir war immer alles das lieber, wovon ein gewisser Widerstand ausging. Am Tage vor meinem ersten Unterricht hüpfte ich gleichwohl vor Vergnügen auf dem Vorplatz umher: «Morgen gehe ich zur Schule!» – «Du wirst das nicht immer so lustig finden», sagte Louise zu mir. Diesmal irrte sie sich, dessen war ich gewiss. Der Gedanke, von nun an ein Leben für mich allein zu haben, berauschte mich. Bis dahin hatte ich nur gleichsam nebenher mit Erwachsenen gelebt; von nun an aber würde ich meine Schultasche, meine Bücher und Hefte, meine Aufgaben haben; meine Wochen und Tage würden nach meinem eigenen Stundenplan ihre Einteilung erhalten; ich meinte eine Zukunft vor mir zu sehen, die, anstatt mich von mir selbst zu entfernen, einen festen Platz in meinem Gedächtnis einnehmen würde: Von Jahr zu Jahr würde ich immer reicher werden, aber dem kleinen Schulmädchen, dessen Geburtsstunde in diesem Augenblick schlug, dennoch die Treue bewahren.
Ich wurde nicht enttäuscht. An jedem Mittwoch und Samstag nahm ich eine Stunde lang an einer geheiligten Zeremonie teil, deren Pomp auf meine ganze Woche einen verklärenden Schimmer warf. Die Schülerinnen setzten sich ringsum an einen ovalen Tisch; von einer Art von Katheder aus führte Mademoiselle Fayet den Vorsitz; während oben aus ihrem Rahmen Adeline Désir, eine Bucklige, deren Seligsprechung man höheren Ortes zu erreichen trachtete, wachsam auf uns herniedersah. Auf schwarzen Moleskinsofas saßen, mit Stricken und Sticken beschäftigt, unsere Mütter aufgereiht. Je nachdem, ob wir mehr oder weniger artig gewesen waren, diktierten sie uns Betragensnoten zu, die wir am Ende des Unterrichts mit lauter Stimme als unangemessen zu bezeichnen pflegten. Mademoiselle Fayet trug sie in ihr Register ein. Mama erkannte mir eine Zehn nach der anderen zu: Eine Neun wäre uns beiden gegen die Ehre gewesen. Mademoiselle teilte uns ‹Satisfecits› aus, die wir jedes Trimester gegen Bücher mit Goldschnitt eintauschen durften. Dann stellte sie sich in den Türrahmen, spendete uns einen Kuss auf die Stirn und gute Ratschläge für das Herz. Ich konnte jetzt lesen, schreiben und ein wenig rechnen. Ich war die Glanznummer von Kursus ‹Null›. Als Weihnachten näher rückte, erhielt ich ein weißes Kleid mit einer goldenen Borte daran und stellte das Jesuskind dar. Die anderen kleinen Mädchen knieten vor mir nieder.
Mama wachte über meine schriftlichen Hausarbeiten und hörte mir meine Lektionen ab. Ich hatte Freude am Lernen. Die biblische Geschichte kam mir noch unterhaltsamer vor als die Kindermärchen, da die Wunder, die sie berichtete, wirklich geschehen waren. Ich war auch von den Tafeln im Atlas entzückt. Die Einsamkeit der Inseln, die Kühnheit der Kaps, die Zerbrechlichkeit der Landzungen, die die Halbinseln mit dem Festland verbinden, machten tiefen Eindruck auf mich; eine gleiche geographisch bedingte Ekstase habe ich noch einmal erlebt, als ich vom Flugzeug aus Korsika und Sardinien sich in die Bläue des Meeres einzeichnen oder in Calchis, von einer wirklichen Sonne bestrahlt, die vollkommene Idee eines zwischen zwei Meeren eingeengten Isthmus verwirklicht vor mir sah. Strenge Formen, fest in den Marmor der Geschichte eingemeißelte Episoden machten die Welt für mich zu einem Bilderbuch mit leuchtenden Farben, in dem ich mit Wonne blätterte.
Wenn ich so großes Vergnügen am Lernen fand, so kam es auch daher, dass mein Alltagsleben mich nicht mehr befriedigte. Ich wohnte in Paris in einer ganz von Menschenhand geschaffenen Dekoration: Sie bestand aus Straßen, Häusern, Trambahnen, Laternenpfählen und anderen der Nützlichkeit dienenden Gegenständen. Auf die Plattheit bloßer Begriffe zurückgeführt, entsprachen die Dinge einzig ihrer Funktion. Der Garten des Luxembourg mit den Gebüschgruppen, die man nicht berühren durfte, den Rasenflächen, deren Betreten verboten war, stellte für mich nichts weiter als einen Spielplatz dar. Hier und da freilich ahnte man durch einen Spalt, der sich auftat, hinter der bemalten Leinwand etwelche verborgene Tiefen. Die Schächte der Metro flohen ins Unendliche und schienen bis ins heimliche Herz der Erde vorzustoßen. Am Boulevard Montparnasse befand sich an der Stelle des heutigen Cafés ‹La Coupole› die Kohlenniederlage ‹Juglar›, aus der Männer mit geschwärzten Gesichtern und Jutesäcken auf dem Kopf zum Vorschein kamen: Unter den Haufen von Koks und Anthrazit herrschte ebenso wie im Ruß der Kamine auch bei hellem Tageslicht jene Finsternis, die einst Gott vom Licht geschieden hatte. Doch war sie durchaus meinem Zugriff entzogen. In dem umhegten Dasein, in das ich eingeschlossen war, gab es nicht vieles, was mich erstaunte, denn ich wusste noch nichts davon, wo die Macht des Menschen beginnt, noch wo sie ein Ende hat. Flugzeuge, lenkbare Luftschiffe, die zuweilen am Pariser Himmel erschienen, erregten weit mehr die Bewunderung der Erwachsenen als die meinige. Was Zerstreuungen anbelangt, so wurden mir solche kaum je geboten. Meine Eltern nahmen mich zum Einzug des englischen Königspaares mit an die Champs-Élysées; ich war manchmal Zeuge von Fastnachtsumzügen und sah den Trauerzug von Galliéni mit an. Ich nahm an Prozessionen teil und kniete vor Ruhealtären. Fast niemals wurde ich in den Zirkus geführt, selten zum Puppentheater. Ein paar Spielsachen, die ich besaß, amüsierten mich zwar, aber nur eine kleine Zahl nahm mich wirklich gefangen. Gern heftete ich meine Augen auf das Stereoskop, das zwei fotografische Platten zu einer räumlichen Szene umschuf, oder auf das Kineoskop, in dem ein rotierender Streifen von unbeweglichen Bildern den Eindruck eines galoppierenden Pferdes erzeugte. Man schenkte mir auch Albums, die mit einer Daumenbewegung lebendig zu werden schienen: Das kleine Mädchen, das auf den Blättern zunächst in seiner Haltung erstarrt zu sein schien, begann auf einmal zu hüpfen, der Boxer fing zu boxen an. Schattenspiele, Projektionen: Was mich bei allen optischen Wundern interessierte, war, dass sie unter meinen Augen immer wieder von neuem entstanden. Alles in allem konnten die bescheidenen Schätze meiner Stadtkindexistenz nicht mit denen rivalisieren, die meine Bücher bargen.
Alles das änderte sich, wenn ich die Stadt verließ und mich unter Tiere und Pflanzen, in die Natur mit ihren zahllosen verborgenen Möglichkeiten versetzt sah.
Wir verbrachten jeweils den Sommer im Limousin bei Papas Familie. Mein Großvater hatte sich auf einen Besitz in der Nähe von Uzerche zurückgezogen, den sein Vater erworben hatte. Er trug einen weißen Backenbart, eine Mütze, das Bändchen der Ehrenlegion und summte den ganzen Tag Melodien vor sich hin. Er nannte mir die Namen der Bäume, der Blumen und der Vögel. Pfauen schlugen ihr Rad vor dem mit Glyzinien und Bignonien bewachsenen Wohngebäude. Im Vogelhaus bewunderte ich Goldfasanen und Kardinäle mit rotem Kopf. Von künstlichen Wasserfällen unterbrochen und mit Seerosen bestanden, umschlang ein Wasserlauf, in dem Goldfische schwammen, mit seinen Fluten eine winzige Insel, die durch zwei Knüppelholzbrücken mit dem Lande verbunden war. Zedern, Wellingtonien, Blutbuchen, japanische Zwergbäumchen, Trauerweiden, Magnolien, Araukarien, immergrüne Pflanzen und solche, die sich im Herbst entlaubten, Baumgruppen, Gebüsche, Unterholz – das alles gab es in diesem Park, der nicht groß, aber doch so vielseitig war, dass ich mit seiner Erforschung niemals zu Ende kam. Wir verließen ihn um die Mitte der Ferien, um Papas Schwester zu besuchen, die mit einem Grundbesitzer in der Umgegend verheiratet war und zwei Kinder hatte. Sie holten uns mit dem ‹großen Break› ab, der von vier Pferden gezogen wurde. Nach dem Mittagessen in der Familie ließen wir uns auf den blauen Lederbänken nieder, die nach Staub und Sonne rochen. Mein Onkel ritt neben uns her. Nach einer Fahrt von zwanzig Kilometern waren wir in La Grillère. Ein Park, der ausgedehnter und naturhafter war als der von Meyrignac, dabei aber einförmiger, umgab ein hässliches, von Türmchen gekröntes, schindelgedecktes Schloss. Tante Hélène begegnete mir mit völliger Gleichgültigkeit. Onkel, vielmehr ‹Tonton› Maurice, schnurrbärtig, immer in hohen Stiefeln und mit der Reitpeitsche in der Hand, wirkte eher erschreckend auf mich. Doch war ich gern mit Robert und Madeleine zusammen, die fünf und drei Jahre älter waren als ich. Wie bei meinen Großeltern durfte ich auch bei meiner Tante beliebig auf dem Rasen herumlaufen und alles mit Händen berühren. Wenn ich im Boden grub, den Lehm knetete, unter meinen Füßen pralle Schoten zertrat, lernte ich, was weder Bücher noch Lehrmeister uns vermitteln. Ich machte Bekanntschaft mit Klee und Hahnenfuß, mit Phlox und dem leuchtenden Blau der Volubilis, dem Schmetterling, dem Sonnenkäferchen, dem Glühwurm, dem Tau, den Spinnweben und Marienfäden; ich machte die Erfahrung, dass das Rot des Stechapfels röter als das des Kirschlorbeers oder der Eberesche ist, dass der Herbst die Pfirsiche rötet und das Laub kupferfarben tönt, dass die Sonne am Himmel auf- und niedergeht, ohne dass man sie jemals sich bewegen sieht. Der Überschwang an Farben und Düften berauschte mich. Überall, im grünen Fischwasser, im Gewoge der Wiesen, unter dem sägeblättrigen Farnkraut, in der Tiefe des Unterholzes, verbargen sich Schätze, die ich zu entdecken brannte.
Seitdem ich zur Schule ging, nahm mein Vater an meinen Erfolgen, meinem Fortschritt mit Interesse teil; er nahm nun einen größeren Raum in meinem Leben ein. Es kam mir vor, als gehöre er einer rareren Gattung als die übrigen Menschen an. In dieser Zeit der Bärte und der Bacchantinnen überraschte sein glattrasiertes Gesicht mit dem ausdrucksvollen Mienenspiel; seine Freunde meinten, er sehe Rigadin gleich. Niemand in meiner Umgebung war so komisch, so interessant, niemand glänzte wie er; niemand hatte so viele Bücher gelesen, wusste so viele Gedichte auswendig oder diskutierte mit solcher Leidenschaft. Mit dem Rücken an den Kamin gelehnt, redete er viel und mit vielen Gesten; alle hörten ihm zu. Bei Familienzusammenkünften spielte er stets die erste Geige: Er rezitierte Monologe oder Le Singe von Zamacoïs und fand damit überall Beifall. Sein originellster Zug bestand darin, dass er in seinen Mußestunden gern Komödie spielte; wenn ich ihn auf Fotografien als Pierrot, als Cafékellner, als Soldaten oder Tragödin verkleidet sah, kam er mir wie eine Art von Zauberer vor; erschien er in Kleid und weißer Schürze, ein Häubchen auf dem Kopf und mit weit aufgerissenen blauen Augen in der Rolle einer idiotischen Köchin mit Namen Rosalie, musste ich Tränen lachen.
Alljährlich verbrachten meine Eltern drei Wochen in Divonne-les-Bains bei einer Liebhabertruppe, die auf der Bühne des Kasinos ihre Vorstellungen gab; sie sorgten für das Amüsement der Sommergäste, und der Direktor des Grandhotels gab ihnen gratis Quartier. Im Jahre 1914 sollten wir, Louise, meine Schwester und ich, in Meyrignac auf sie warten. Wir fanden dort meinen Onkel Gaston, Papas ältesten Bruder, und Tante Marguerite vor, deren Blässe und Magerkeit einschüchternd auf mich wirkten, ferner meine Cousine Jeanne, die ein Jahr jünger war als ich. Meine Schwester und Jeanne begaben sich gefügig unter meine Tyrannei. In Meyrignac spannte ich sie vor einen kleinen Wagen, und dann zogen sie mich in flottem Trab durch die Alleen des Parks. Ich erteilte ihnen Unterricht und verleitete sie zu Eskapaden, die ich aber wohlweislich auf der Zufahrtstraße zum Hause wieder beendete. Eines Morgens, als wir im Holzschuppen zwischen den frischen Sägespänen spielten, gab es auf einmal Alarm: Der Krieg war erklärt. Ich hatte das Wort ein Jahr zuvor in Lyon zum ersten Male gehört. In Kriegszeiten, hatte man mir gesagt, bringen die Leute andere Leute um, und ich hatte mich gefragt: Wohin entfliehe ich dann? Im Laufe des Jahres hatte Papa mir erklärt, Krieg bedeute den Einfall von Fremden in ein Land; von da an fürchtete ich die zahllosen Japaner, die damals an den Straßenecken Fächer und Lampions verkauften. Aber nein. Unsere Feinde waren die Deutschen mit den spitzen Helmen, die uns schon Elsass und Lothringen weggenommen hatten und deren groteske Hässlichkeit ich aus den ‹Hansi›-Albums kannte.
Ich wusste jetzt, dass nur Soldaten im Kriege einander töten, und ich hatte genügend Geographie gelernt, um mir die Grenze vom Limousin weit entfernt vorzustellen. Niemand in meiner Umgebung schien sich zu fürchten, und so beunruhigte denn auch ich mich nicht. Papa und Mama trafen unerwartet, verstaubt und wortreich ein: Sie hatten achtundvierzig Stunden auf der Eisenbahn verbracht. An den Einfahrten der Remisen wurden Requisitionsbefehle angeschlagen und Großpapas Pferde nach Uzerche gebracht. Die allgemeine Erregung, die dicken Überschriften des Courrier du Centre faszinierten mich; ich hatte immer gern, wenn irgendetwas geschah. Ich erfand Spiele, die den Umständen angepasst waren; ich selbst war Poincaré, meine Cousine König Georg V., meine Schwester der Zar. Wir hielten Konferenzen unter den Zedern ab und teilten den ‹Prussiens› Säbelhiebe aus.
Im September in La Grillère lernte ich meine Pflichten als Französin erfüllen. Ich half Mama bei der Herstellung von Scharpie, ich strickte einen Wollschal. Meine Tante Hélène ließ das Gig anspannen, wir fuhren zum Bahnhof, um hochgewachsenen Hindus in Turbanen Äpfel auszuteilen; sie revanchierten sich mit Buchweizen, von dem sie uns manche Handvoll spendeten; wir brachten den Verwundeten mit Käse und Pastete belegte Brote. Die Frauen aus dem Dorfe drängten sich mit Armen voller Lebensmittel an die Militärzüge heran. «Ein Andenken, ein Andenken!», bettelten sie; die Soldaten schenkten ihnen Mantelknöpfe und Patronenhülsen. Eine von ihnen reichte eines Tages einem deutschen Verwundeten ein Glas Wein. Ein Murren erhob sich ringsum. «Wieso!», sagte sie, «das sind auch Menschen.» Das Murren schwoll daraufhin an. Heiliger Zorn glomm sogar in Tante Hélènes zerstreuten Blicken auf. Die Boches waren Verbrecher von Geburt; sie erregten Hass mehr noch als Empörung. Man empört sich nicht wider Satan. Aber Verräter, Spione, schlechte Franzosen waren großartige Objekte der Entrüstung für unsere tugendhaften Herzen. Mit sorgfältig einstudiertem Abscheu maß ich diejenige mit dem Blick, die von da an nur noch ‹die Deutsche› hieß. Endlich hatte das Böse nun doch Gestalt angenommen.
Mit wahrem Überschwang machte ich die Sache des Guten zu meiner eigenen. Mein Vater, der seinerzeit wegen Herzbeschwerden zurückgestellt worden war, wurde nun dennoch eingezogen und den Zuaven zugeteilt. Ich besuchte ihn mit Mama in Villetaneuse, wo er seinen Dienst ableistete: Er hatte sich einen Bart stehenlassen, und der Ernst seiner Züge unter der ‹Chéchia› machte großen Eindruck auf mich. Ich musste mich seiner würdig erweisen. Auf der Stelle legte ich ein Zeugnis von mustergültigem Patriotismus ab, indem ich eine Zelluloidpuppe zertrat, auf der ‹Made in Germany› stand und die im Übrigen meiner Schwester gehörte. Nur mit Mühe hinderte man mich, mit der gleichen schmählichen Aufschrift versehene silberne Messerbänkchen aus dem Fenster zu werfen. In allen Vasen stellte ich Alliiertenfähnchen auf. Ich spielte den tapferen Zuaven, das heldenhafte Kind. Mit bunten Farbstiften schrieb ich: ‹Hoch Frankreich!› an alle Wände. Die Erwachsenen belohnten meine extreme Fügsamkeit. «Simone ist furchtbar chauvinistisch», pflegte man mit amüsiertem Stolz zu erklären. Ich nahm das Lächeln in Kauf und genoss das Lob. Irgendjemand machte Mama ein Stück horizontblaues Offizierstuch zum Geschenk; eine Schneiderin schnitt daraus für meine Schwester und mich Mäntel genau nach dem Muster der Militärmäntel zu. «Da seht nur, sogar ein Gürtel ist hinten daran», sagte meine Mutter zu ihren bewundernden oder sich wundernden Freundinnen. Kein anderes Kind trug ein derart originelles, derart französisches Kleidungsstück: Ich fühlte mich dadurch zu etwas Besonderem ausersehen.
Es gehört für ein Kind nicht viel dazu, ein kleiner Affe zu werden; früher schon trat ich gern in Erscheinung, aber ich weigerte mich, bei den von Erwachsenen inszenierten Komödien mitzutun; da ich jetzt zu alt war, um mich von ihnen streicheln, verwöhnen, hätscheln zu lassen, verlangte mich umso heftiger nach ihrer Anerkennung. Sie schlugen mir eine Rolle vor, die leicht zu spielen und außerdem kleidsam war: Ich stürzte mich eifrig darauf. Mit meinem horizontblauen Mantel angetan, sammelte ich Spenden auf einem der großen Boulevards vor der Tür eines franko-belgischen Hilfskomitees, das von einer von Mamas Freundinnen geleitet wurde. «Für die kleinen belgischen Flüchtlinge!» Die Geldstücke regneten nur so in mein blumengeschmücktes Körbchen, und das Lächeln der Vorübergehenden gab mir zu verstehen, was für eine bezaubernde kleine Patriotin ich sei. Doch eine Frau in Schwarz sah mich finster an: «Warum für die belgischen Flüchtlinge? Und die französischen?» Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Die Belgier waren unsere heroischen Verbündeten; aber schließlich, wenn man schon stolz auf seine Vaterlandsliebe war, sollte man ihnen freilich die Franzosen vorziehen; auf meinem eigensten Terrain fühlte ich mich geschlagen. Andere Schwierigkeiten kamen noch hinzu. Wenn ich des Abends den Raum des ‹Foyer› betrat, wurde ich mit Herablassung zu meinem Erfolg beglückwünscht. «Da kann ich ja meine Kohlen bezahlen!», sagte die Leiterin. Ich erhob Einspruch dagegen: «Das Geld soll doch für die Flüchtlinge sein.» Ich hatte Mühe zu begreifen, dass die Interessen hier nicht klar zu scheiden waren; ich hatte von einer eindrucksvolleren Hilfsaktion geträumt. Im Übrigen hatte Mademoiselle Fevrier einer Krankenschwester die Gesamtheit der Einnahme zugesagt und gestand ihr nicht, dass sie die Hälfte einbehielt. «Zwölf Franc, das ist fabelhaft!», sagte die Krankenschwester zu mir. Ich hatte vierundzwanzig eingenommen. Ich war außer mir. Man schätzte mich nicht meinem Werte entsprechend ein; ich hatte mich selbst für einen Star gehalten, während ich in Wirklichkeit nur eine Nebenrolle spielte, man hatte mich betrogen.