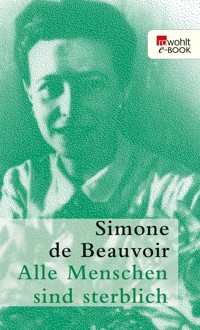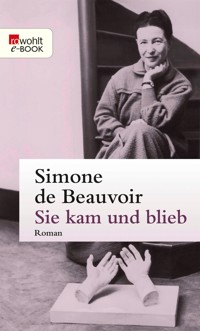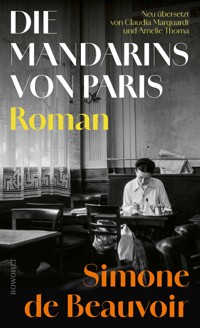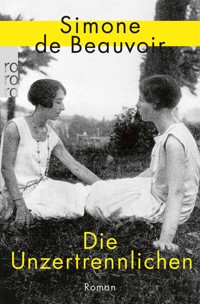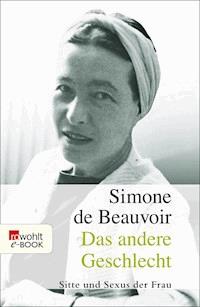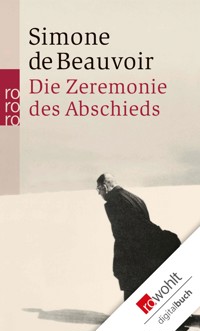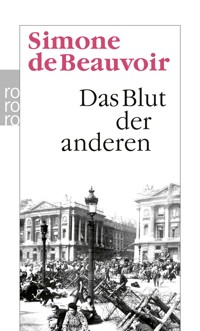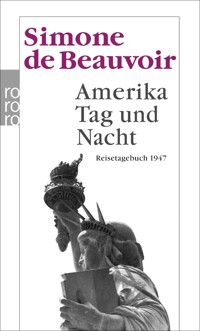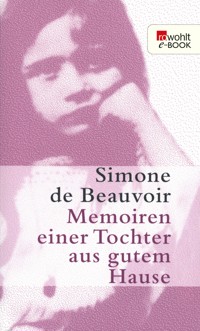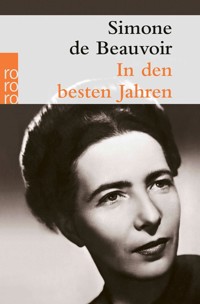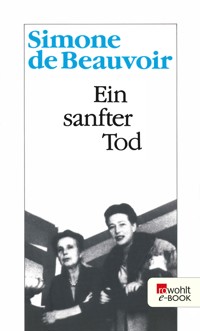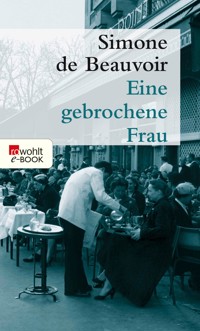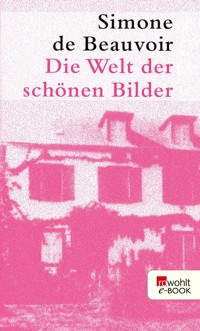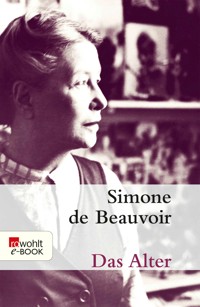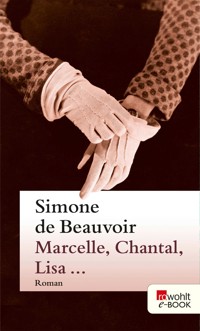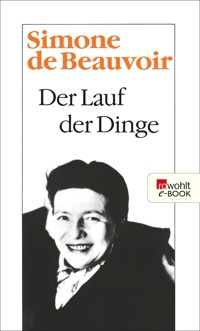
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Beauvoir: Memoiren
- Sprache: Deutsch
Die Lebensgefährtin Jean-Paul Sartres schildert in diesen Aufzeichnungen ihre Beziehungen und ihre zahlreichen Reisen mit Sartre, die Wandlungen und Wendungen von Sartres Verhältnis zum Kommunismus, ihre Liebesaffären, vor allem ihre Liaison mit dem amerikanischen Romancier Nelson Algren, und ihre Freundschaften und Zerwürfnisse mit berühmten Zeitgenossen wie Camus, Koestler, Giacometti, Merleau-Ponty und Raymond Aron. Ein faszinierendes Zeitdokument über das Leben europäischer Intellektueller des 20. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1348
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Simone de Beauvoir
Der Lauf der Dinge
Über dieses Buch
Die Lebensgefährtin Jean-Paul Sartres schildert in diesen Aufzeichnungen ihre Beziehungen und ihre zahlreichen Reisen mit Sartre, die Wandlungen und Wendungen von Sartres Verhältnis zum Kommunismus, ihre Liebesaffären, vor allem ihre Liaison mit dem amerikanischen Romancier Nelson Algren, und ihre Freundschaften und Zerwürfnisse mit berühmten Zeitgenossen wie Camus, Koestler, Giacometti, Merleau-Ponty und Raymond Aron. Ein faszinierendes Zeitdokument über das Leben europäischer Intellektueller des 20. Jahrhunderts.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1963 unter dem Titel «La Force des choses» bei Éditions Gallimard, Paris.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2015
Copyright © 1966 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«La Force des choses» Copyright © 1963 by Éditions Gallimard, Paris
Umschlaggestaltung Werner Rebhuhn, unter Verwendung eines Fotos der Autorin
ISBN 978-3-644-03141-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Ich habe bereits ...
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Zwischenspiel
Zweiter Teil
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Die Reise dauerte ...
11. Kapitel
Epilog
Hinweise
Ich habe bereits erwähnt, warum ich mich entschlossen hatte, nach dem ersten Band – Mémoires d’une jeune fille rangée [Memoiren einer Tochter aus gutem Hause] – meine Autobiographie fortzusetzen. Als ich bei der Befreiung von Paris angelangt war, hielt ich atemlos inne. Ich musste wissen, ob mein Unternehmen andere interessiere. Allem Anschein nach war das der Fall. Aber bevor ich die Arbeit wiederaufnahm, zögerte ich von neuem. Freunde und Leser hörten nicht auf zu fragen: «Und dann? Und nachher? Wie weit sind Sie jetzt? Schreiben Sie doch weiter. Sie sind uns die Fortsetzung schuldig.» Aber es hat auch an inneren und äußeren Einwänden nicht gefehlt: «Es ist zu früh. Ihr Gesamtwerk ist doch noch gar nicht umfangreich.» Oder: «Warten Sie doch, bis Sie alles sagen können. Auslassungen verfälschen die Wahrheit.» Und dann: «Es fehlt Ihnen der nötige Abstand.» Und auch: «Schließlich lernt man Sie besser in Ihren Romanen kennen.» Das alles hat etwas für sich. Aber mir blieb keine andere Wahl. Die Gleichgültigkeit des Alters, ob sie nun heiter oder trist war, würde mir nicht erlauben, das zu erfassen, was ich einfangen möchte: den Augenblick, da am Rande einer noch lebendigen Vergangenheit der Abstieg beginnt. In diesem Bericht soll mein Blut kreisen. Ich wollte ihn schreiben, solange ich noch ein lebendiger Mensch bin, wollte Rede und Antwort stehen, solange noch nicht alle Fragen sinnlos geworden sind. Vielleicht ist es zu früh. Morgen aber wird es bestimmt zu spät sein.
«Man kennt die Geschichte Ihres Lebens, weil es sich vom Jahre 1944 an in der Öffentlichkeit abgespielt hat.» Auch das hat man mir entgegengehalten. Diese Publizität aber war ja nur eine Dimension meines Privatlebens, und da es meine Absicht ist, Missverständnisse zu zerstreuen, halte ich es für wichtig, die wahren Zusammenhänge zu schildern. Da ich mehr als früher in die politischen Ereignisse verstrickt war, werde ich im Übrigen viel von ihnen reden müssen. Mein Bericht wird aber dadurch keineswegs unpersönlicher werden. Wenn die Politik die Kunst ist, ‹die Gegenwart vorauszusehen›, werde ich als Laie von einer unvorhergesehenen Gegenwart berichten müssen: Die Art, wie sich mir die Geschichte von Tag zu Tag dargeboten hat, ist ein ebenso eigenartiges Abenteuer wie meine persönliche Entwicklung.
In der Periode, von der nun die Rede sein wird, ging es eher um die Verwirklichung als um die Formung meines Charakters. Obwohl Gesichter, Bücher, Filme, Begegnungen im Einzelnen nicht wichtig waren, blieb das Ganze doch bedeutend. Wenn ich von ihnen erzähle, so haben oft die Launen der Erinnerung meine Wahl bestimmt, was nicht bedeutet, dass es sich dabei unbedingt auch um ein Werturteil handelt. Außerdem werde ich die Erlebnisse, von denen ich bereits berichtet habe – meine Reisen nach den USA und nach China –, weglassen, dafür aber meinen Besuch in Brasilien ausführlich beschreiben. Wenn dadurch das Gleichgewicht dieses Buches gestört sein sollte, tut es mir leid. Ich behaupte ja keineswegs, dass es sich um ein Kunstwerk handle (das gilt auch für die beiden ersten Teile): Dieses Wort erinnert mich an eine Statue, die sich im Garten einer Villa langweilt, es gehört zum Sprachgebrauch des Sammlers, des Genießers, aber nicht des schöpferischen Menschen. Es käme mir nicht in den Sinn, die Werke von Rabelais, Montaigne, Saint-Simon oder Rousseau als Kunstwerke zu bezeichnen, und es macht mir nichts aus, wenn man meinen Memoiren dieses Etikett verweigert. Denn es ist nicht ein Kunstwerk, sondern mein Leben mit seinen Glanzzeiten, seinen Nöten, seinen Zufälligkeiten, es ist mein Leben, das nach dem ihm gemäßen Ausdruck sucht, das aber nicht als Vorwand für zierliche Ornamente geeignet ist.
Auch diesmal werde ich möglichst wenig überspringen. Es wundert mich immer wieder, wenn man dem Verfasser einer Lebensbeschreibung Längen zum Vorwurf macht, denn wenn mich das Werk interessiert, dann werde ich gern viele Bände lesen, wenn es langweilig ist, dann sind zehn Seiten schon zu viel. Die Farbe des Himmels, der Geschmack einer Frucht – ich erwähne sie nicht aus Selbstgefälligkeit: Wenn es sich um das Leben eines anderen Menschen handelte, würde ich diese sogenannten trivialen Details, sofern sie mir bekannt wären, mit der gleichen Ausführlichkeit schildern. Man spürt in ihnen nicht nur eine Zeit und einen Menschen aus Fleisch und Blut: Gerade ihre Bedeutungslosigkeit verleiht einer wahren Geschichte erst den Anstrich der Wahrheit. Sie bestehen nur aus sich selbst. Man hebt sie nur aus dem einen Grund hervor – weil sie da sind: Das genügt.
Trotz meiner Zurückhaltung, die auch für diesen letzten Band gilt – da es unmöglich ist, alles zu sagen –, haben mich Kritiker der Indiskretion bezichtigt. Ich habe nicht damit angefangen. Ich will lieber selbst in meine Vergangenheit hinabsteigen, als dieses Geschäft anderen zu überlassen.
Im Allgemeinen gesteht man mir eine Eigenschaft zu, um die ich mich sehr bemüht habe: eine Aufrichtigkeit, die von Prahlerei ebenso weit entfernt ist wie von Selbstquälerei und die ich mir bewahrt zu haben hoffe. Seit mehr als dreißig Jahren pflege ich sie in meinen Gesprächen mit Sartre. Ohne falsche Scham, ohne Eitelkeit gebe ich mich Tag für Tag so, wie ich bin, äußere alles, was mich betrifft, ebenso offen, wie ich die Dinge meiner Umgebung wahrnehme. Sie ist mir nicht durch eine besondere Gnade des Himmels zur zweiten Natur geworden, sondern dank der Art und Weise, wie ich die Menschen, auch mich selbst, betrachte. Ich glaube an die Freiheit des Willens und an unsere Verantwortung, aber diese Dimensionen unseres Daseins, mögen sie noch so bedeutsam sein, entziehen sich jeglicher Beschreibung. Was man erfassen kann, sind nur die Voraussetzungen. Ich sehe mich selber als Objekt, als Resultat, ohne dass das Verdienst oder die Unwürdigkeit dabei eine Rolle spielten. Wenn mir eine bestimmte Handlung zufälligerweise allein schon durch den Abstand mehr oder weniger geglückt oder mehr oder weniger missglückt erscheint, dann kommt es mir in jedem Fall eher darauf an, sie zu begreifen, als ein Urteil darüber zu fällen. Mir selber nachzuspüren, macht mir mehr Vergnügen, als mir zu schmeicheln. Meine Wahrheitsliebe übertrifft bei weitem die Sorge um den guten Eindruck: Sie ist in meiner Vergangenheit verwurzelt, und ich rechne sie mir nicht zur Ehre an. Die Tatsache, dass ich über mich kein Urteil abgebe, hält mich nicht davon ab, mein Leben und mich selber ins helle Licht zu rücken, zumindest in dem Maße, wie dies für meine eigene Welt zutrifft. Vielleicht würde mir die Projektion meines Bildes in eine andere Welt – zum Beispiel die der Psychoanalytiker – bestürzend oder peinlich sein. Aber wenn ich selber die Feder in der Hand habe, schrecke ich vor nichts zurück.
Trotzdem müssen wir uns über die Grenzen meiner Unparteilichkeit verständigen. Ein Kommunist, ein Gaullist – ebenso wie ein Fabrikarbeiter, ein Bauer, ein Militär, ein Musiker – würde diese Jahre anders schildern. Aber meine Ansichten, Überzeugungen, Perspektiven, Interessen, Engagements liegen klar zutage: Sie gehören zu der Zeugenaussage, die von ihnen ausgeht. Selbstverständlich bin ich nur objektiv in dem Maße, wie meine Objektivität mich selber einbezieht.
Genauso wie die beiden früheren Bände verlangt auch dieses Buch von dem Leser eine gewisse Mitarbeit. Ich schildere der Reihenfolge nach sämtliche Etappen meiner Entwicklung, und er muss sich in Geduld fassen, um nicht voreilige Schlüsse zu ziehen. Es ist zum Beispiel nicht richtig, wenn ein Kritiker folgert, dass Sartre immer noch Guido Reni liebe, nur weil er ihn mit neunzehn Jahren geliebt hat. Eigentlich ist es nur der böse Wille, der diese Trugschlüsse diktiert, und dagegen kann ich mich nicht sichern. Dieses Buch besitzt im Gegenteil alle erforderlichen Eigenschaften, um ihn auf den Plan zu rufen, und ich wäre enttäuscht, wenn es niemandem gefiele. Deshalb möchte ich darauf hinweisen, dass sein wahrer Gehalt sich nicht auf der einzelnen Seite, sondern nur in der Gesamtheit äußert.
Man hat mir in dem zweiten Band meiner Memoiren – La Force de Vage [In den besten Jahren] – viele kleinere und auch zwei bis drei schwerer wiegende Irrtümer nachgewiesen. Trotz aller Sorgfalt werden mir sicher auch in diesem Buch Irrtümer unterlaufen sein. Aber ich kann nur abermals betonen, dass ich nie mit Absicht gemogelt habe.
Erster Teil
1
Wir sind befreit. Auf den Straßen singen die Kinder:
Nous ne les reverrons plus
C’est fini, ils sont foutus.
[Wir sehen sie nicht mehr, juchhei –
Es ist vorbei, und wir sind frei.]
Und ich wiederhole im Stillen: Es ist vorbei, vorbei … Es ist vorbei: Alles beginnt. Waldberg, der amerikanische Freund der Leiris, fuhr uns mit seinem Jeep in die Umgebung spazieren. Seit Jahren war es das erste Mal, dass ich wieder in einem Auto saß, dass ich nach Mitternacht durch die köstliche Milde des Septembers schlenderte. Die Lokale schlossen frühzeitig, aber nachdem wir die Terrasse der ‹Rhumerie› oder diese kleine rote und verräucherte Hölle, das ‹Montana›, verlassen hatten, standen die Trottoirs, die Bänke, die Straßen zu unserer Verfügung. Auf den Dächern hausten noch immer vereinzelte Scharfschützen, und der Gedanke machte mich traurig, wenn ich dort über meinem Kopf den Hass lauern fühlte. Eines Nachts ertönten die Sirenen wieder. Ein Bomber, dessen Herkunft ewig dunkel blieb, überflog Paris. Mehrere V-1 fielen in den Vororten nieder und zerstörten etliche Sommervillen. Waldberg, der im Allgemeinen sehr gut informiert war, behauptete, dass die Deutschen beängstigende Geheimwaffen zur Verfügung hätten. Die Angst fand in mir ein noch recht warmes Plätzchen wieder. Sie wurde aber schnell durch den Jubel aufgewogen. Tag und Nacht feierten wir zusammen mit unseren Freunden die Befreiung, plaudernd, trinkend, flanierend, lachend: Und alle, die nah und fern genauso feierten wie wir, wurden zu unseren Freunden. Was für eine Orgie der Brüderlichkeit! Die Finsternis, die auf Frankreich gelastet hatte, war verscheucht. Stämmige Soldaten in graugelben Uniformen, Kaugummi kauend, boten die Gewähr dafür, dass man wieder die Meere befahren konnte. Sie marschierten mit lässigen Schritten, und oft sah man sie torkeln. Torkelnd sangen und pfiffen sie auf den Bürgersteigen und auf den Bahnsteigen der Métro, torkelnd tanzten sie abends in den Bars und entblößten laut lachend ihre Kinderzähne. Genet, der keine Sympathie für die Deutschen gehabt hatte, das Idyll aber nicht liebte, erklärte auf der Terrasse der ‹Rhumerie› mit lauter Stimme, dass diese verkleideten Zivilisten keine Haltung aufwiesen. Die Okkupanten in ihren grünen und schwarzen Schalen hätten da anders ausgesehen! In meinen Augen war in dieser Ungezwungenheit junger Amerikaner die Freiheit selber verkörpert: unsere und auch die, welche sie – daran zweifelten wir nicht – über die ganze Welt verbreiten würden. Waren erst einmal Hitler und Mussolini hingerichtet, Franco und Salazar davongejagt, würde sich Europa endgültig von der Schande des Faschismus lossagen. Das Programm der Widerstandsbewegung würde Frankreich auf den Weg zum Sozialismus führen. Wir bildeten uns ein, das Land sei so gründlich aufgerüttelt worden, dass es möglich sein müsse, ohne neue Krämpfe sein Gefüge von Grund auf zu verändern. Der Combat formulierte unsere Hoffnungen in seiner Devise: Vom Widerstand zur Revolution.
Dieser Sieg ließ unsere früheren Niederlagen vergessen, es war unser Sieg, und uns gehörte die Zukunft, die er eröffnete. Die Regierung bestand aus Widerstandskämpfern, die uns, mehr oder weniger direkt, kannten. Mit vielen verantwortlichen Repräsentanten der Presse und des Rundfunks waren wir befreundet. Die Politik war zu einer Familienangelegenheit geworden, und wir hatten die Absicht, uns einzumischen. «Die Politik geht nicht mehr an dem Einzelnen vorbei», schrieb Camus Anfang September im Combat. «Sie ist der direkte Appell des Menschen an andere Menschen.» An Menschen zu appellieren, war unsere Aufgabe, die Aufgabe der Schriftsteller. Vor dem Krieg hatten nur wenige Intellektuelle versucht, ihre Zeit zu begreifen. Alle – oder fast alle – waren bei diesem Versuch gescheitert, und der Mann, den wir am höchsten schätzten, Alain, hatte sich unmöglich gemacht: Wir mussten für Ablösung sorgen.
Ich wusste jetzt, dass mein Schicksal mit dem aller anderen verknüpft war. Die Freiheit, die Unterdrückung, das Glück und Leid der Menschen berührten mich zutiefst. Aber wie schon gesagt, ich hatte keine philosophischen Ambitionen. Sartre hatte in seinem Buch L’Être et le Néant [Das Sein und das Nichts] eine umfassende Beschreibung der Existenz, deren Wert von ihrer eigenen Situation abhängt, skizziert und beabsichtigte, seine Bemühungen fortzusetzen. Er sah sich gezwungen, seine Stellungnahme nicht nur mit Hilfe theoretischer Überlegungen, sondern auch durch wirkliche Taten deutlich zu machen. Aus diesem Grund engagierte er sich viel stärker als ich. Nach wie vor diskutierten wir unter uns über seine Ansichten. Manchmal habe ich ihn beeinflusst. Aber in ihrer Dringlichkeit und ihren Nuancen wurde ich durch ihn mit den Problemen vertraut gemacht. Daher muss ich von ihm sprechen, wenn ich von uns sprechen will.
In unserer Jugend hatten wir uns zur KP hingezogen gefühlt, in dem Maße, wie ihr Negativismus sich mit unserem Anarchismus vertrug. Wir wollten das Ende des Kapitalismus herbeiführen, nicht aber die Geburt einer sozialistischen Gesellschaft, die uns, wie wir glaubten, unsere Freiheit rauben würde. In diesem Sinn notierte Sartre am 14. September 1939 in seinen Aufzeichnungen: «Jetzt bin ich vom Sozialismus geheilt, falls ich die Kur nötig hatte.» Im Jahre 1941, als er eine Widerstandsgruppe gründete, war er trotzdem mit den Losungsworten ‹Sozialismus und Freiheit› einverstanden. Der Krieg hatte einen entscheidenden Gesinnungsumschwung bewirkt.
Erstens hatte ihm der Krieg gezeigt, wie sehr auch er in der Geschichte verwurzelt war. Der schwere Schock machte ihm klar, dass er trotz aller Angriffe doch sehr an der bestehenden Ordnung hing. Jeder Abenteurer hat einen sehr konservativen Zug: Um seinen Ruf zu begründen, seine Legende in die Zukunft zu projizieren, braucht er eine dauerhafte Gesellschaft. Sartre, der bis ins innerste Knochenmark dem Abenteuer des Schreibens verschworen war und der von Kind an den heißen Wunsch gehegt hatte, ein großer Schriftsteller zu sein und unsterblichen Ruhm zu ernten, hoffte auf eine Zukunft, die in seinem Sinne ohne Unterbrechung das Erbe dieses Jahrhunderts wieder aufgreifen werde. Im Grunde blieb er der ‹oppositionellen Ästhetik› seiner zwanziger Jahre treu: Eifrig damit beschäftigt, die Mängel dieser Gesellschaft anzuprangern, wollte er sie doch nicht zerstören. Plötzlich war alles aus den Fugen geraten. Die Ewigkeit zerfiel. Er entdeckte, dass er zwischen einer Vergangenheit voller Illusionen und einer dunkel verschleierten Zukunft hilflos dahintrieb. Er wehrte sich mit Hilfe seines moralischen Postulats von der Aufrichtigkeit: Unter dem Gesichtspunkt der Freiheit wird man mit allen Situationen fertig, wenn man sie einem Vorhaben unterstellt. Diese Lösung grenzt eng an den Stoizismus, weil die Umstände oft keinen anderen Weg als den der Unterwerfung freilassen. Da Sartre die Schliche des Innenlebens verabscheute, konnte er nicht lange Gefallen daran finden, seine Untätigkeit durch wortreiche Proteste zu bemänteln. Er sah ein, dass man nicht im Absoluten, sondern im Vergänglichen lebt, dass man auf das Sein verzichten und sich zum Handeln entschließen müsse. Dieser Übergang wurde ihm durch seine frühere Entwicklung erleichtert. Im Denken und Schreiben war es sein anfängliches Bestreben gewesen, Bedeutungen zu erfassen. Nach Heidegger hatte ihn Saint-Exupéry, den er 1940 las, davon überzeugt, dass Bedeutungen durch die Taten der Menschen zustande kommen. Die Praxis sei wichtiger als die Reflexion. Während des ‹närrischen Krieges› hatte er zu mir gesagt – und es sogar in einen Brief an Brice Parain geschrieben –, dass er nach dem Friedensschluss Politik zu machen gedenke.
Das Erlebnis der Gefangenschaft hatte tiefe Spuren hinterlassen. Es hatte ihn Solidarität gelehrt. Weit davon entfernt, sich erniedrigt zu fühlen, nahm er eifrig am Gemeinschaftsleben teil. Er verabscheute alle Privilegien. Da er stolz war, wollte er sich aus eigener Kraft seinen Platz auf der Erde erobern. In der Masse untertauchend, eine Nummer unter Nummern, fand er eine ungeheuere Befriedigung darin, seine Unternehmungen zum Erfolg zu führen. Er schloss Freundschaften, warb für seine Ideen, organisierte, mobilisierte das gesamte Lager, um zu Weihnachten sein gegen die Deutschen gerichtetes Stück Bariona unter großem Beifall aufführen zu lassen. Die Strenge und die Wärme der Kameradschaft lösten die Widersprüche in seinem Antihumanismus: Im Grunde rebellierte er gegen den bürgerlichen Humanismus, der im Menschen eine Natur verehrt. Wenn es aber galt, den Menschen zu schaffen, dann hätte nichts ihn mehr begeistern können. Statt Individualismus und Kollektivität gegeneinanderzustellen, betrachtete er sie von nun an nur noch als ein Ganzes. Er wollte seine Freiheit nicht mehr durch eine subjektive Hinnahme der gegebenen Situation verwirklichen, sondern dadurch, dass er die Situation objektiv veränderte durch den Aufbau einer seinen Wünschen entsprechenden Zukunft. Diese Zukunft war, gerade im Namen der demokratischen Grundsätze, zu denen er sich bekannte, der Sozialismus, von dem ihn nur die Befürchtung getrennt hatte, sich in ihm zu verlieren: Jetzt sah er in ihm gleichzeitig die einzige Chance der Menschheit und die Vorbedingung seiner eigenen Verwirklichung.
Der Zusammenbruch von ‹Sozialismus und Freiheit› war für Sartre eine Lehre, realistischer an die Dinge heranzugehen. Erst später wurde er im Schoß der FN, in Zusammenarbeit mit den Kommunisten, ernsthaft tätig.
1941 misstrauten sie, wie ich bereits in La Force de l’âge erwähnt habe, den kleinbürgerlichen Intellektuellen. Sie verbreiteten das Gerücht, Sartre habe sich seine Freiheit damit erkauft, dass er sich verpflichtete, den Deutschen als Spitzel zu dienen. 1943 forderten sie die Einheitsfront. Es existierte eine den Kommunisten zugeschriebene und in Südfrankreich gedruckte Broschüre, in der Sartre zusammen mit Châteaubriant und Montherlant auf einer Schwarzen Liste figurierte; als er sie Claude Morgan zeigte, rief dieser aus: «Das ist empörend!» Damit war der Zwischenfall beigelegt. Die Beziehungen zwischen Sartre und den kommunistischen Widerstandskämpfern waren durchaus freundschaftlicher Art. Nach dem Abmarsch der Deutschen beabsichtigte er, dieses Einvernehmen aufrechtzuerhalten. Die Ideologen der Rechten haben sein Bündnis mit der KP psychoanalytisch gedeutet und ihm allerlei Komplexe angedichtet: Preisgabe oder Minderwertigkeit, Ressentiment, Infantilismus, Sehnsucht nach einer Kirche. Lauter Dummheiten. Die Massen standen hinter der KP. Nur mit ihrer Hilfe konnte der Sozialismus siegen. Andererseits wusste Sartre jetzt ganz genau, dass seine Beziehungen zum Proletariat ihn selber in Frage stellten. Er hatte das Proletariat stets als die universelle Klasse betrachtet, aber solange er das Absolute durch literarische Tätigkeit zu erreichen hoffte, war ihm der Dienst am Nächsten nur von sekundärer Bedeutung gewesen. Als er seine Verwurzlung in der Geschichte entdeckte, war ihm auch seine Abhängigkeit klargeworden. Es gab keine Ewigkeit, kein Absolutes mehr. Die Universalität, die er als bürgerlicher Intellektueller anstrebte, konnten ihm nur die Menschen vermitteln, in denen sie sich hier auf Erden verkörpert. Er beschäftigte sich bereits mit dem Gedanken, den er später (1952 in Les Communistes et la paix) formuliert hat: Die wahre Perspektive ist die des Enterbten. Der Henker kann sein Tun ignorieren – das Opfer erleidet unausweichlich seine Qualen, seinen Tod. Die Wahrheit der Unterdrückung ist der Unterdrückte. Nur mit den Augen der Ausgebeuteten würde Sartre sich selber erkennen. Stießen sie ihn zurück, dann würde er der Gefangene seiner kleinbürgerlichen Sonderexistenz sein.
Unsere freundschaftlichen Gefühle für die Sowjetunion waren durch keine Vorbehalte gestört. Die Opfer, die das russische Volk gebracht hatte, nahmen wir als Beweis dafür, dass die Machthaber seinen Willen verkörperten. Es fiel uns also nicht schwer, mit der KP zusammenzuarbeiten. Sartre hatte aber nicht die Absicht, in die Partei einzutreten. Einmal war sein Unabhängigkeitsdrang viel zu stark. Vor allem aber bestanden zwischen ihm und den Marxisten ernste ideologische Meinungsverschiedenheiten. Die Dialektik, so, wie er sie damals auffasste, hätte ihn als Individuum beseitigt. Er glaubte an die phänomenologische Intuition, die das Ding als unmittelbar und ‹leibhaftig› auffasst. Obwohl er den Begriff der Praxis als solchen guthieß, hatte er doch keineswegs auf seinen alten Plan verzichtet, eine Morallehre zu schreiben: Seine Bemühungen galten immer noch dem Sein. Moralisch leben hieß in seinen Augen eine wirklich bedeutende Daseinsweise erreichen. Er wollte nicht die Begriffe der Verneinung, der Innerlichkeit, der Existenz, der Freiheit, wie er sie in L’Être et le Néant herausgearbeitet hatte, preisgeben – und er hat sie auch nie preisgegeben. Im Gegensatz zu einem Marxismus, wie ihn die KP vertrat, lag ihm daran, die menschliche Dimension des Menschen zu bewahren. Er hoffte, dass die Kommunisten die Werte des Humanismus zur Geltung bringen würden; mit Hilfe der Werkzeuge, die er von ihnen lieh, würde er versuchen, den Humanismus der Bourgeoisie zu entreißen. Indem er den Humanismus aus der Sicht der bürgerlichen Kultur betrachtete, sah er diese Kultur wiederum aus einer marxistischen Perspektive. «Selbst den Mittelklassen entstammend, versuchten wir, die Verbindung zwischen dem intellektuellen Kleinbürgertum und den intellektuellen Kommunisten herzustellen.» (Merleau-Ponty vivant [Freundschaft und Ereignis. Begegnung mit Merleau-Ponty]) Auf politischer Ebene hatten seiner Meinung nach die mit der KP Sympathisierenden die Rolle zu spielen, die bei anderen Parteien die innere Opposition übernimmt: unterstützen, aber gleichzeitig kritisieren.
Diese liebenswürdigen Träume waren der Widerstandsbewegung entsprungen; wenn sie uns auch die geschichtlichen Zusammenhänge enthüllte, verschleierte sie doch den Klassenkampf. Es sah so aus, als seien zugleich mit dem Nazismus auch die reaktionären Kreise politisch liquidiert worden; von der Bourgeoisie nahm nur die der Widerstandsbewegung angeschlossene Fraktion am öffentlichen Leben teil, die das Programm der CNR akzeptierte. Die Kommunisten unterstützten ihrerseits die Regierung der ‹Nationalen Eintracht›. Als Thorez aus der Sowjetunion zurückkehrte, gab er der Arbeiterklasse den Rat, die Industrie wiederaufzubauen, zu arbeiten, sich zu gedulden und vorläufig auf alle Forderungen zu verzichten. Niemand sprach von einer Rückkehr zum Alten, und auf ihrem Vormarsch gingen Reformisten und Revolutionäre die gleichen Wege. In diesem Klima verwischten sich alle oppositionellen Strömungen. Dass Camus die Kommunisten ablehnte, war ein nur wenig bedeutsamer subjektiver Zug, da seine Zeitung im Kampf für die Durchführung des Programms der CNR den gleichen Standpunkt vertrat. Sartre, der der KP nahestand, sympathisierte indessen mit der Linie des Combat in solchem Maße, dass er für diese Zeitung sogar Leitartikel schrieb. Gaullisten, Kommunisten, Katholiken, Marxisten verbrüderten sich. In allen Zeitungen wurden gemeinsame Gedankengänge formuliert. Sartre gab dem Carrefour ein Interview. Mauriac schrieb in Les Lettres françaises. Wir alle sangen im Chor das Lied von den kommenden Tagen.
Sehr bald verfielen Les Lettres françaises dem Sektierertum. Die Action zeigte bessere Ansätze; man schien sich mit den jungen Leuten in der Redaktion verständigen zu können. Hervé und Courtade forderten Sartre sogar zur Mitarbeit auf. Er lehnte ab, weil die Action Malraux in einer Weise schlechtgemacht hatte, die wir für ungerecht hielten. Wir waren sehr erstaunt, als Ponge, der den Kulturteil redigierte, uns mitteilte, dass sich auf seinem Schreibtisch die gegen Sartre gerichteten Artikel häuften. Er, Sartre, veröffentlichte einige davon, antwortete mit einer Richtigstellung. Man warf ihm vor, viele Ideen von Heidegger übernommen zu haben. Die politische Haltung Heideggers hatte aber schließlich nicht rückwirkend alle seine Gedanken zunichtegemacht. Andererseits hatte der Existenzialismus, weit entfernt von jeglichem Quietismus und Nihilismus, den Menschen aufgrund seines Handelns definiert. Wenn er ihn der Angst überantwortet, dann nur in dem Maße, wie er ihn zur Verantwortung heranzieht. Die Hoffnung, die er ihm verweigert, ist das träge Vertrauen, das man nicht sich selber, sondern anderen Dingen entgegenbringt: Er fordert ihn auf, von seinem freien Willen Gebrauch zu machen. Sartre war überzeugt, dass ihn die Marxisten von nun an nicht mehr für einen Gegner halten würden. Es waren so viele Hindernisse bezwungen worden, dass uns keines mehr unüberwindlich schien. Von den anderen und von uns selbst erwarteten wir alles.
Unsere Umgebung teilte diese Hochstimmung, vor allem die Familie und die alte Garde der Fiestas. Junge Leute hatten sich unserer Gruppe angeschlossen. Rolland, der mit zwanzig Jahren im Maquis Kommunist geworden war, durchdrungen von den Vorzügen der Partei, sah trotzdem großzügig über unsere Abweichungen hinweg. Scipion lachte so laut, dass man ihn für einen lustigen Menschen halten konnte: Er war unübertrefflich in der Parodie, im Kalauer, im Wortspiel, in der pikaresken Anekdote. Astruc, mit seinem breiten, lebhaften Lächeln, schrieb pausenlos in sämtlichen Zeitungen, und wenn er gerade nicht schrieb, dann redete er – vor allem über sich selbst. Mit rührender Eigenliebe beichtete er naive und derbe Einzelheiten aus seinem Privatleben. Im September 1944 zwanzig oder fünfundzwanzig Jahre alt zu sein, war offenbar eine enorme Chance: Alle Wege standen offen. Journalisten, Schriftsteller, angehende Filmtheoretiker diskutierten, schmiedeten Pläne, fassten leidenschaftliche Entschlüsse, als ob ihre Zukunft nur von ihnen selber abhinge. Ihre Heiterkeit bestärkte mich in meiner guten Laune. In ihrem Kreis fühlte ich mich gleichaltrig, ohne etwas von jener Reife einzubüßen, die so teuer erkauft war, dass ich fast in Versuchung geriet, sie für Weisheit zu halten. So vereinte ich – in einer flüchtigen Illusion – die widersprüchlichen Privilegien der Jugend und des Alters. Ich glaubte viel zu wissen und beinahe alles zu können.
Bald darauf kehrten die Emigranten zurück. Bianca hatte sich zusammen mit ihren Eltern und ihrem Mann, einem Studienkollegen, ein Jahr lang in den von der Résistance beherrschten nördlichen Voralpen versteckt gehalten. Raymond Aron war 1940 nach London geflohen und hatte dort, zusammen mit André Labarthe, eine bei den Gaullisten nicht sehr beliebte Zeitschrift, La France libre, herausgegeben. Obwohl er seine Gefühle nicht gern zeigte, fielen wir einander in die Arme, als er eines Morgens im ‹Café de Flore› erschien. Etwas später war auch Albert Palle nach England gegangen und war dann mit dem Fallschirm über Frankreich abgesprungen, um im Maquis mitzukämpfen. Tief bewegt sah ich die vertrauten Gesichter wieder. Es war auch ein neues darunter. Camus machte uns mit Pater Bruckberger, dem Feldgeistlichen der FFI, bekannt, der soeben mit Bresson Das Hohelied der Liebe gedreht hatte. Er spielte den Bonvivant, saß in weißer Kutte auf der Terrasse der ‹Rhumerie›, rauchte Pfeife, trank Punsch und schwatzte drauflos. Aron nahm uns zum Essen in die Wohnung von Corniglion-Molinier mit, den Vichy zum Tode verurteilt hatte. Man hatte seine Möbel beschlagnahmt, und er kampierte in der Avenue Gabriel, in einem leeren Luxusappartement. Geschäftig und charmant berichtete er eine Fülle von Anekdoten über die Franzosen in England. Auch Romain Gary erzählte uns eines Abends auf der Terrasse der ‹Rhumerie› allerlei Geschichten. Auf einer von Les Lettres françaises veranstalteten Cocktailparty traf ich Elsa Triolet und Aragon. Ponge war der kommunistische Schriftsteller, mit dem wir am liebsten zusammen waren. Er sprach, wie er schrieb, leicht hingetuscht, mit viel Bosheit und einiger Selbstgefälligkeit. In Versailles, anlässlich einer von dem Verlag Éditions de Minuit veranstalteten Festlichkeit, in deren Verlauf ein Stück von La Fontaine aufgeführt wurde, plauderte ich mit Lise Deharme. Ich erinnere mich nicht mehr an die unzähligen Male, da ein Händedruck, ein Lächeln getauscht wurde, aber ich weiß, welche Freude mir diese Fülle der Begegnungen gemacht hat. Durch diese Zusammenkünfte lernte ich eine historische Zeit kennen, die ich selbst zwar miterlebt hatte, die mir aber unbekannt geblieben war. Aron schilderte uns ausführlich die Bombardements Londons, die Kaltblütigkeit der Engländer und ihre Ausdauer. Die V-1, die ich in Neuilly-sous-Clermont rot am schwarzen Himmel hatte vorbeiziehen sehen, waren in England unsichtbar geblieben: ein Pfiff, eine Explosion, Tote. «Es war Vorschrift, sich platt aufs Pflaster zu werfen, sowie man sie hörte», erzählte Aron. «Einmal, als ich mich erhob, erblickte ich eine alte Dame, die stehen geblieben war und mich von oben bis unten ansah. Ich war so ärgerlich, dass ich ihr einen Verweis erteilte: ‹Madame, in solchen Fällen legt man sich hin!›» Er lieh mir sein Sammelexemplar von La France libre, und ich lernte die Geschichte des Krieges, nicht von Paris, sondern von London aus gesehen, kennen. Ich war sozusagen eingesperrt gewesen – jetzt wurde mir die Welt zurückgegeben.
Eine verwüstete Welt. Nach der Befreiung entdeckte man die Folterkammern der Gestapo, grub die Gebeine aus. Bianca berichtete vom Vercors, schilderte die Wochen, die ihr Vater und ihr Mann in einer Grotte zugebracht hatten. Die Zeitungen veröffentlichten Einzelheiten über die Metzeleien, die Geiselhinrichtungen und Berichte über die Zerstörung Warschaus. Diese brutal entlarvte Vergangenheit erfüllte mich mit Grauen. Die Lebensfreude wich der Scham, es überlebt zu haben. Manche konnten sich nicht damit abfinden. Jausion, den der Franc-Tireur als Kriegsberichterstatter an die Front entsandt hatte, kehrte nicht zurück, und sein Tod war zweifellos kein Zufall. (Seine Verlobte war, wie ich schon erwähnt habe, deportiert worden. Er war während des Aufstandes auf der Place de la Concorde verhaftet und kurz vor dem Einmarsch der Alliierten gegen einen deutschen Offizier ausgetauscht worden. Er hat einen Roman hinterlassen: Un homme marche dans la ville.) Der Sieg kam teuer zu stehen. Im September verwandelten die Luftstreitkräfte der Alliierten Le Havre in einen Schutthaufen. Menschen starben zu Tausenden. Die Deutschen verschanzten sich im Elsass und bei Saint-Nazaire. Im Sommer stürzten sich lautlose schwere Raketen auf London, die V-2, viel wirksamer als die V-1. Waren das die Geheimwaffen, von denen Waldberg gesprochen hatte, oder existierten andere, noch fürchterlichere? Rundstedts Truppen überschwemmten Holland und ließen die Bevölkerung verhungern. In Belgien eroberten sie einen Teil des verlorenen Terrains zurück und töteten die Bewohner. Blitzschnell malte ich mir aus, dass sie siegreich nach Paris zurückkehren würden. Man wagte nicht daran zu denken, was sich jetzt, wo die Deutschen das Spiel verlorengaben, in den Lagern ereignen würde.
In materieller Hinsicht hatte sich die Lage seit dem vorigen Jahr verschlechtert. Das Transportwesen funktionierte nicht mehr. Es fehlte an Lebensmitteln und Kohle, es gab nicht genügend Gas und Elektrizität. Als die Kälte kam, lief Sartre in einer alten Pelzjacke herum, die bereits die Haare verlor. Bei einem seiner ehemaligen Lagerkameraden, einem Kürschner, kaufte ich einen Kaninchenfellmantel, der mich vor der Kälte schützte. Aber bis auf ein schwarzes Kostüm, das ich für wichtige Gelegenheiten aufsparte, hatte ich darunter nur alte Sachen anzuziehen, und die Sohlen meiner Schuhe waren immer noch aus Holz. Das war mir im Übrigen völlig egal. Seit ich mit dem Fahrrad gestürzt war, fehlte mir ein Zahn, die Lücke war zu sehen, aber ich dachte nicht an einen Ersatz: wozu auch? Auf jeden Fall war ich nicht mehr jung, sechsunddreißig Jahre alt. Diese Feststellung war von keiner Bitterkeit getrübt. Durch die Sturzflut der Ereignisse und meine Tätigkeit weit über mich hinausgetragen, war ich jünger als meine Sorgen.
Angesichts dieses Notstandes ereignete sich wenig auf dem Gebiet der Literatur, der Künste und des Theaters. Der Salon d’Automne wurde jedoch zu einer großen kulturellen Kundgebung, einem Rückblick auf die Vorkriegsmalerei: Nachdem die Deutschen die Bilder ins Zwielicht der Ateliers oder die Keller der Händler verbannt hatten, war es ein Ereignis, sie ans Licht kommen zu sehen. Eine ganze Abteilung war Picasso gewidmet. Wir waren oft bei ihm zu Besuch gewesen und kannten seine neuesten Gemälde. Aber hier war das Gesamtwerk dieser letzten Jahre zusammengetragen worden. Es gab schöne Gemälde von Braque, Marquet, Matisse, Dufy, Gromaire, Villon und den erstaunlichen Hiob des Francis Guber. Auch die Surrealisten stellten aus: Dominguez, Masson, Miró, Max Ernst. Der Tradition des Salon d’Automne getreu, kamen die Spießbürger herbeigeströmt. Diesmal wurde ihnen aber nicht die gewohnte Nahrung geboten: Vor den Picassos fingen sie an zu grinsen.
Es erschienen nur wenige Bücher. Ich ärgerte mich über Aragons Aurélien und nicht weniger über Die Nussbäume der Altenburg, das ein Jahr zuvor in der Schweiz erschienen war und den alten Groethuysen zu dem Ausspruch bewogen hatte: «Malraux ist im vollen Besitz seiner Mängel.» L’Arbalète brachte die zumeist vom Marcel Duhamel übersetzten Arbeiten unbekannter amerikanischer Autoren – Henry Miller, McCoy, Nathanael West, Damon Runyon, Dorothy Baker –, aber auch die Werke bekannter Verfasser: Hemingway, Richard Wright, Thomas Wolfe, Thornton Wilder, Caldwell und selbstverständlich Saroyan; man konnte keine Zeitschrift öffnen, ohne seinem Namen zu begegnen. In dieser Zeitschrift fand sich außerdem auch ein Engländer, Peter Cheyney. Man sprach von mehreren neuen englischen Schriftstellern: Auden, Spender, Graham Greene, kannte aber ihre Bücher noch nicht. Jemand lieh mir Hillarys Der letzte Feind. Der junge Flieger, der über dem Ärmelkanal abgeschossen worden war, einer der letzten langhaarigen Oxforder, schildert mit einem etwas misstönigen Lachen die Operationen und Transplantationen, mit deren Hilfe man ihm die Augen, ein Gesicht, Hände wiedergegeben hatte. Durch die Absage an jeglichen Humanismus und Heroismus geht der Bericht weit über die Episode hinaus, die ihm als Vorwurf dient. Ich las auch eine große Anzahl von Kriegsbüchern – geringerer Qualität –, die in den USA eigens für die überseeischen Länder gedruckt worden waren. Auf dem weißen, rot gestreiften Umschlag war die Freiheitsstatue mit ihrer Fackel zu sehen. In seinem Buch G.I. Joe entwarf Ernie Pyle das Bild eines amerikanischen Frontkämpfers. Die Amerikaner vergötterten «diesen kleinen Mann in der zerknitterten Uniform, der den Krieg hasst, aber die Soldaten liebt und versteht» (Steinbeck). Er schilderte den Alltag des Krieges: «Den Krieg der Männer, die ihre Socken in ihrem Stahlhelm waschen.» (Steinbeck)
Huis clos [Bei geschlossenen Türen] erschien wieder auf dem Spielplan. Dullin inszenierte Das Leben ein Traum. Das Spectacle des Alliés am Pigalle diente vor allem patriotischen Zwecken. Die Stücke, die dort gespielt wurden, fanden wenig Beifall. In einer Privatvorstellung sah ich Die Hoffnung von Malraux. Die Dramatisierung gefiel mir ebenso gut wie der Roman. Bis auf Capras Montagen Why We Fight und ab und zu einen alten Mack Sennett hatte der Film nichts Annehmbares zu bieten. Es hieß jedoch geduldig warten. Man berichtete Wunderdinge aus Hollywood. Ein junges, siebenundzwanzigjähriges Genie namens Orson Welles habe die Filmtechnik revolutioniert. Es sei ihm geglückt, den Hintergrund mit der gleichen Schärfe wiederzugeben wie den Vordergrund, und bei den Innenaufnahmen sei die Zimmerdecke zu sehen. Es hieß, dass die technische Umwälzung so weit gehe, dass man besondere Projektionsapparate brauche, um die neuesten amerikanischen Filme zu zeigen.
Ich übergab Gallimard Le Sang des autres [Das Blut der anderen], Sartre brachte ihm die beiden ersten Bände von Les Chemins de la liberté [Die Wege der Freiheit]. Pyrrhus et Cinéas erschien. Es war das eine der ersten Arbeiten, die nach der Befreiung das Licht der Welt erblickten. In der allgemeinen Euphorie – und wohl auch, weil man vier Jahre lang von ideologischen und literarischen Interessen abgeschnitten gewesen war – wurde dieser kleine Essay sehr günstig aufgenommen. Ich fing wieder an zu schreiben. Ich konnte frei über meine Zeit verfügen, denn durch den Film und das Theater verdiente Sartre, der sich vom Staatsdienst hatte beurlauben lassen, etwas Geld. Wir hatten schon immer unsere Einkünfte in einen gemeinsamen Topf getan. Dabei blieb es, und ich hatte keine Nahrungssorgen mehr. Ich habe den Frauen oft zur Selbständigkeit geraten und erklärt, sie beginne beim Portemonnaie, sodass ich eine Haltung rechtfertigen muss, die mir im Augenblick selbstverständlich war. Meine materielle Unabhängigkeit war gesichert, weil ich im Notfall jederzeit meine Tätigkeit als Lehrerin fortsetzen konnte. Nachdem ich wieder in den Staatsdienst aufgenommen worden war, ließ ich mich beurlauben. Es wäre mir dumm und sogar tadelnswert erschienen, wenn ich kostbare Stunden geopfert hätte, nur um mir täglich zu beweisen, dass ich im Grunde unabhängig sei. Ich habe mich nie nach Prinzipien, immer nur nach dem Zweck gerichtet. Nun, ich hatte zu tun. Die Schriftstellerei war für mich zu einem anspruchsvollen Metier geworden. Sie sicherte meine moralische Unabhängigkeit. In der Einsamkeit der übernommenen Risiken, der zu treffenden Entscheidungen verwirklichte ich meine Willensfreiheit viel konsequenter, als wenn ich mich einträglichem Trott gebeugt hätte. Meine eigentliche Leistung waren meine Bücher, und sie ersparten mir jede andere Form der Selbstbehauptung. Ich widmete mich also restlos und ohne Bedenken meinem Werk: Tous les hommes sont mortels [Alle Menschen sind sterblich]. Jeden Morgen ging ich in die Bibliothèque Mazarine, um Berichte aus alten Zeiten zu lesen. Es war dort eiskalt, aber die Geschichte Karls V., das Abenteuer der Wiedertäufer ließen mich meine körperliche Schwäche vergessen, und ich hörte auf zu schlottern.
Im Jahre zuvor hatten wir uns, wie ich schon erwähnt habe, mit zwei Projekten beschäftigt: einer Enzyklopädie und einer Zeitschrift. Das erste gab Sartre auf, an dem zweiten hielt er fest. Wegen Papiermangels durften nur die Publikationen erscheinen, die schon vor dem Kriege existiert hatten oder während der Besatzungszeit in der freien Zone gegründet worden waren. Esprit, Confluences, Poésie 44 waren zwar interessant, vertraten aber das Anliegen unserer Zeit nur recht unzulänglich. Man musste sich etwas anderes einfallen lassen. Sartre äußerte sich über seine Absichten wie folgt: «Wenn es nur eine Wahrheit gibt, so dachte ich, dann darf man sie, wie Gide es von Gott gesagt hat, nirgendwo anders suchen als überall. Jedes gesellschaftliche Produkt und jede Haltung – sei es die intimste oder die öffentlichste – sind deren anspielungsreiche Verkörperungen. Eine Anekdote spiegelt ebenso die ganze Epoche wider wie eine politische Verfassung. Wir würden dem Sinn nachjagen, wir würden das Wahre über die Welt und über unser Leben sagen.» (Merleau-Ponty vivant) Im September hatten wir die Redaktion beisammen. Camus war zu sehr durch den Combat in Anspruch genommen, um mitzumachen. Malraux lehnte ab. Der Redaktion gehörten Raymond Aron, Leiris, Merleau-Ponty, Albert Ollivier, Paulhan, Sartre und ich an. Damals vertrugen sich diese Namen noch miteinander.
Wir suchten einen Titel. Leiris, der sich aus seiner surrealistischen Jugend die Vorliebe für den Skandal bewahrt hatte, schlug einen knalligen Titel vor: «Grabuge» [Krach]. Er wurde nicht genehmigt, weil wir zwar kritisieren, aber zugleich auch konstruktiv sein wollten. Der Titel sollte andeuten, dass wir uns tatsächlich für aktuelle Fragen interessierten: Seit vielen Jahren hatten so viele Zeitschriften den gleichen Vorsatz gefasst, dass keine große Auswahl mehr vorhanden war. Man einigte sich auf Temps Modernes. Das war zwar nicht brillant, aber die Verbindung mit Chaplins Film Moderne Zeiten gefiel uns. (Als die Zeitschrift gegründet war, passierte es öfters, dass uns Argus Zeitungsausschnitte zusandte, die den Film betrafen.) Außerdem sei es, sagte Paulhan in seinem gespielt ernsten Ton, aus dem der Ernst nicht völlig verbannt war, von Wichtigkeit, dass eine Zeitschrift sich durch ihre Initialen bezeichnen lasse, wie das mit NRF[Nouvelle Revue Française] der Fall war. TM klinge fast genauso gut. Das zweite Problem war der Umschlag. Picasso machte einen recht hübschen Entwurf, der aber besser für eine Kunstrevue als für Les Temps Modernes geeignet gewesen wäre. Man hätte auf dem Umschlag keine Inhaltsangabe unterbringen können. Trotzdem hatte er seine Fürsprecher, und innerhalb der Redaktion entspannen sich lebhafte, wenn auch keineswegs bissige Debatten. Schließlich legte uns ein Graphiker des Verlages Gallimard eine Skizze vor, die einmütigen Beifall fand. Unsere Diskussionen gingen vorläufig nur um Lappalien, aber sie machten mir sehr viel Spaß. Diese Gemeinsamkeit im Handeln erschien mir als die vollkommenste Form der Freundschaft. Da Sartre verreist war, sollte ich im Januar in seinem Namen den damaligen Informationsminister Soustelle um eine Papierzuteilung bitten. Leiris, der ihn durch das Musée de l’Homme kennengelernt hatte, begleitete mich. Soustelle war sehr liebenswürdig, aber die Zusammensetzung der Redaktion ging ihm gegen den Strich. «Aron? Warum Aron?» Er warf ihm seine de Gaulle-feindliche Haltung vor. Schließlich entließ er uns mit Versprechungen, die einige Monate später erfüllt wurden.
Sowie die Züge wieder verkehrten, fuhren wir für drei Wochen zu Mme Lemaire. In einem überfüllten Abteil waren wir von acht Uhr früh bis acht Uhr abends unterwegs. Der Zug hielt sich nicht an den üblichen Fahrplan. Wir ließen unser Gepäck in Lion d’Angers und legten ohne Pause zu Fuß die siebzehn Kilometer bis La Pouèze zurück. Auch diesmal verlief der Aufenthalt angenehm und ohne Zwischenfälle.
Nach der Rückkehr bemühte ich mich in Paris um eine Aufführung von Les Bouches inutiles [Unnütze Mäuler]. Sartre hatte Raymond Rouleau eine Abschrift gegeben, der mir aber erklärte, dass ich mich «zu kurz gefasst» hätte. Die Knappheit des Dialogs grenze an Trockenheit. Ich gab mein Stück Vitold, der mir sagte, dass er es gern inszenieren wolle. Badel, der Direktor des Vieux Colombier, nahm es zur Aufführung an. Vitold begann die Rollen zu besetzen: Die der Clarice hatte ich Olga zugedacht. Es war davon die Rede, dass Douking die Dekorationen machen sollte, und so unterhielt ich mich mit ihm darüber. Aus diesem Grund war ich mehrmals mit Sartre bei Badel zum Essen eingeladen worden. Eines Abends machte man das ‹Mörderspiel›, und ich war sehr stolz, dass ich der einzige Detektiv war, der den Mörder entdeckte. Ich hatte viel für Gaby Sylvia übrig, die sich nicht mit ihrer Schönheit und ihrer Begabung zufriedengab und etwas lernen wollte. Ihr Lehrer war Robert Kanters, der sie tatsächlich auf das Abitur vorbereitete. Aber ich fühlte mich nicht wohl in diesem allzu großartigen Salon, wo die Menschen nicht meine Sprache sprachen. Gaby Sylvias Kleider waren aus dem Hause Rochas und von einer ausgeklügelten und betörenden Einfachheit, sodass mein schlechthin einfaches schwarzes Kostüm, das ich mir in La Pouèze hatte anfertigen lassen, fast unhöflich wirkte. Ich liebte damals die Geselligkeit, aber das mondäne Leben langweilte mich.
«Würde es Ihnen und Sartre Spaß machen, Hemingway kennenzulernen?», fragte mich Lise eines Abends. «Natürlich!», erwiderte ich. Solche Vorschläge gefielen mir, und dieser kam nicht allzu überraschend. Lises Hauptvergnügen seit der Befreiung war die – wie sie sich ausdrückte – «Jagd auf Amerikaner». Diese verteilten mit leichter Hand ihre Zigaretten und ‹Rationen›, und die ewig hungrige Lise beabsichtigte, von dieser Freigebigkeit zu profitieren. Sie saß allein – anfangs auch zuweilen in Begleitung Scipions – abends auf der Terrasse des ‹Café de la Paix› oder an den Champs-Élysées und wartete darauf, dass ein G.I. sie anredete; gewöhnlich fehlte es nicht an Bewerbern. Wenn sie einen fand, der ihr gleichzeitig diskret und unterhaltsam schien, ließ sie sich zu einem Glas Wein, einer Jeep-Fahrt, einem Abendessen einladen. Als Handgeld für das versprochene Rendezvous, das sie im Allgemeinen nicht einhielt, brachte sie Tee, Camels, Pulverkaffee und Fleischkonserven mit nach Hause. Das Spiel war nicht ungefährlich. Auf den Boulevards riefen die Soldaten ihr nach: «Zig-Zig Blondie!», worauf sie lachend weiterging. Wenn sie zudringlich wurden, warf sie ihnen Schimpfworte an den Kopf, die einen alten Haudegen zum Erröten gebracht hätten. Ihr englischer Wortschatz war ebenso reichhaltig wie ihr französischer. Auf der Place de l’Opéra begann ihr einer auf die Nerven zu gehen. Sie stieß seinen Kopf kurzerhand gegen einen Laternenpfahl und ließ ihn bewusstlos auf dem Pflaster liegen. Aber sie machte auch erfreulichere Bekanntschaften. Sie hatte sich mit einem jungen, blonden und lustigen Riesen eingelassen, dem jüngeren Bruder Hemingways. Er zeigte ihr die Fotos seiner Frau und seiner Kinder, er brachte ihr Rationskisten, er erzählte ihr von dem «Bestseller», den er schreiben wollte. «Das Rezept kenne ich», sagte er.
An diesem Abend hatte sich Hemingway, der als Kriegsberichterstatter arbeitete und der gerade in Paris eingetroffen war, mit seinem Bruder im ‹Ritz›, wo er wohnte, verabredet. Der Bruder hatte Lise vorgeschlagen, ihn zu begleiten und Sartre und mich mitzunehmen. Das Zimmer, in das wir kamen, entsprach keineswegs der Vorstellung, die ich mir vom ‹Ritz› gemacht hatte. Es war groß, aber hässlich mit den beiden Kupferbetten. In dem einen lag Hemingway im Pyjama, die Augen durch einen grünen Schirm geschützt. In Reichweite standen auf einem Tisch eine beträchtliche Menge halbgeleerter oder ganz leerer Whiskyflaschen. Er stand auf, drückte Sartre die Hand und schloss ihn in die Arme. «Sie sind ein General!», sagte er. «Ich bin nur ein Captain: Sie aber sind ein General!» (Wenn er getrunken hatte, spielte er immer den Bescheidenen.) Das von zahlreichen Gläsern Whisky unterbrochene Gespräch war hinreißend. Trotz seiner Grippe war Hemingway von überschäumender Vitalität. Schlaftrunken wankte Sartre gegen drei Uhr morgens davon. Ich blieb bis zum Morgengrauen.
Bost wollte gern Journalist werden. Camus las das Manuskript des Buches, das er während des Krieges geschrieben und in dem er seine Erlebnisse als Infanterist geschildert hatte – Le Dernier des métiers. Er behielt es für die Reihe Espoir, die er bei Gallimard herausgab, und schickte Bost als Kriegsberichterstatter an die Front. Wenn man ihn um eine Gefälligkeit bat, erwies er sie mit einer so schlichten Selbstverständlichkeit, dass man nicht zögerte, gleich um die nächste zu bitten: Es war niemals vergeblich. Als mehrere junge Leute aus unserer Umgebung Mitarbeiter des Combat werden wollten, nahm er sie alle bei sich auf. Wenn wir morgens die Zeitung aufschlugen, kam es uns fast so vor, als öffneten wir unsere Privatpost. Gegen Ende November wollten die USA Frankreich mit ihrer Kriegsrüstung vertraut machen und luden ein Dutzend Reporter ein. Nie hat sich Sartre so gefreut wie an dem Tag, als Camus ihm anbot, den Combat zu vertreten. Um sich die nötigen Papiere, eine Reiseerlaubnis und Dollars zu besorgen, musste er eine Menge beschwerlicher Gänge machen. Er erledigte sie in der Dezemberkälte mit einer Munterkeit, die fast ein wenig beunruhigend wirkte: Denn damals war nichts sicher. Es sah auch wirklich zwei bis drei Tage lang so aus, als sei das Projekt zum Scheitern verurteilt. An Sartres Bestürzung konnte ich seinen Eifer ermessen.
Amerika bedeutete ihm so viel! Vor allem: das Unerreichbare: Jazz, Film, Literatur hatten uns in unserer Jugend interessiert, waren aber auch ein großer Mythos gewesen: Und ein Mythos ist eben unerreichbar. Die Reise sollte mit dem Flugzeug gemacht werden. Es erschien uns unglaublich, dass auch für uns die Leistung eines Lindbergh heutzutage möglich sein sollte. Amerika war außerdem der Erdteil, der die Befreier geschickt hatte. Die Zukunft war auf dem Marsch. Der Überfluss und die grenzenlosen Horizonte; ein Tohuwabohu legendärer Bilder: Wenn man sich überlegte, dass man das alles nun mit eigenen Augen sehen sollte, wurde einem schwindlig. Ich freute mich nicht nur für Sartre, sondern auch meinetwegen, da ich überzeugt war, dass, wenn der Weg erst einmal offenstand, ich ihm eines Tages folgen könnte.
Ich hatte gehofft, dass die Weihnachtsferien den Frohsinn unserer früheren Fiestas heraufbeschwören würden, aber am 24. Dezember war die Offensive der Deutschen eben erst aufgefangen worden. Die Angst war noch zu spüren. Bost war an der Front, Olga machte sich Sorgen um ihn. Wir verbrachten einige recht trübe Stunden bei Camille und Dullin. Gegen ein Uhr morgens gingen wir mit Olga und einer kleinen Schar zu Fuß nach Saint-Germain-des-Prés und beendeten die Nacht bei der schönen Evelyne Carrai, wo wir Pute zu essen bekamen und Mouloudji seine gewohnten Erfolgschansons sang und Marcel Duhamel, der damals noch nicht Direktor der Série Noire war, mit viel Charme amerikanische Songs vortrug. Silvester feierten wir bei Camus, der die Wohnung von Gide in der Rue Vaneau übernommen hatte. Dort gab es ein Trapez und ein Klavier. Gleich nach der Befreiung war Francine Camus aus Afrika gekommen, sehr blond, sehr frisch, sehr schön in ihrem schieferblauen Tailleur. Aber wir waren noch nicht oft mit ihr zusammen gewesen. Mehrere Gäste waren uns unbekannt. Camus machte uns auf einen Herrn aufmerksam, der den ganzen Abend hindurch nicht ein Wort von sich gegeben hatte: «Das ist der Mann», sagte er, «den ich als Vorbild für Der Fremde genommen habe.» In unseren Augen war die Zusammenkunft nicht intim genug. Eine junge Frau hatte mich in eine Ecke gedrängt und mich in rachsüchtigem Ton beschuldigt: «Sie glauben ja nicht an die Liebe!» Gegen zwei Uhr früh spielte Francine Bach. Niemand trank viel, bis auf Sartre, der sich einredete, dass der Abend nicht anders sei als die früheren, und der sehr bald so angeheitert war, dass er den Unterschied nicht mehr bemerkte.
Am 12. Januar flog Sartre mit einer Militärmaschine ab. Zwischen den USA und Frankreich gab es keinen privaten Postverkehr: Wie es ihm ging, erfuhr ich nur aus seinen Artikeln. Seine Journalistenlaufbahn leitete er mit einem Schnitzer ein, der Aron schaudern ließ: Er schilderte den Antigaullismus der führenden Kreise Amerikas während des Krieges mit solchem Wohlgefallen, dass man ihn beinahe nach Frankreich zurückgeschickt hätte.
Aufgrund einer Abmachung zwischen Camus und Brisson musste er auch dem Letzteren einige Artikel geben. Er schickte ihm Impressionen, Betrachtungen, flüchtig hingeworfene Notizen und reservierte für den Combat die Sachen, die ihn Zeit und Mühe kosteten. Camus, der am Tage zuvor im Figaro eine ungezwungene lustige Beschreibung amerikanischer Städte gelesen hatte, erhielt zu seiner Verblüffung eine gewissenhafte Studie über die Wirtschaftsprobleme des Tennessee Valley.
Aber auch ich hatte Glück. Meine Schwester hatte Lionel geheiratet, der jetzt am Institut Français in Lissabon beschäftigt war. Er gab eine französisch-portugiesische Zeitschrift, Affinidades, heraus und lud mich im Namen des Instituts ein, nach Portugal zu kommen und Vorträge über die Besatzungszeit zu halten. Ich stürzte in die Büros der Kulturabteilung und bat um eine Reiseerlaubnis. Ich musste mit vielen Leuten verhandeln, aber alle machten mir Versprechungen, und so verzehrte ich mich in stiller Hoffnung.
Man begann im Vieux Colombier mit den Proben zum 3. und 4. Bild von Les Bouches inutiles. Ich sammelte Beiträge für Les Temps Modernes, knüpfte Beziehungen an. In den ‹Deux Magots› lernte ich Connolly kennen, den Direktor der englischen Zeitschrift Horizon, in der während des Krieges Arbeiten der in der Résistance tätigen Schriftsteller erschienen waren, unter anderem auch Aragons Le Crève-cœur. Er erzählte mir von den Neuerscheinungen auf dem englischen Büchermarkt und von Koestler, der in London lebte. Ein spanisches Testament hatte mir sehr gut gefallen. Am Weihnachtsabend hatte mir Camus Sonnenfinsternis geliehen, und ich hatte das Buch in der darauffolgenden Nacht in einem Zug ausgelesen. Mit Befriedigung hörte ich, dass Koestler die Bücher Sartres schätze. Das Mittag- wie das Abendessen nahm ich immer zusammen mit Freunden ein. Wir gingen zu ‹Chéramy›, in das ‹Vieux Paris›, in das ‹Armagnac›, in das ‹Petit Saint-Benoît›. Meine Abende verbrachte ich mit dem einen oder anderen im ‹Montana›, im ‹Méphisto›, in den ‹Deux Magots›. Bost nahm mich einmal zum Mittagessen ins ‹Scribe› mit, wo die Kriegskorrespondenten Zutritt hatten. Es war eine amerikanische Enklave mitten in Paris: Weißbrot, frische Eier, Konfitüren, Zucker, Dosenfleisch.
Ich schloss neue Freundschaften. Vor dem Krieg hatte eine Unbekannte Sartre ein kleines Buch zugeschickt, Tropismen, das unbemerkt geblieben war und von dessen Vorzügen wir sehr angetan waren. Es handelte sich um Nathalie Sarraute. Er hatte ihr geschrieben und sie kennengelernt. 1941 war sie zusammen mit Alfred Péron in einer Widerstandsgruppe tätig gewesen. Sartre hatte sie wiedergesehen, und auch ich hatte ihre Bekanntschaft gemacht. In diesem Winter ging ich recht oft mit ihr aus. Als Tochter russischer Juden, welche die zaristischen Verfolgungen zu Beginn des Jahrhunderts aus dem Land getrieben hatten, verdankte sie, wie ich annehme, diesen Umständen ihren nervösen Scharfblick. Ihre Art, die Dinge zu sehen, deckte sich genau mit den Gedanken Sartres. Sie lehnte alles Absolute ab, sie glaubte weder an klar umrissene Charaktere noch an genau bestimmbare Gefühle, noch auch an fix und fertige Anschauungen. In dem Buch, an dem sie momentan arbeitete, Porträt eines Unbekannten, bemühte sie sich, im vertrauten Milieu die schillernde Wahrheit des Lebens zu erfassen. Sie war nicht sehr mitteilsam, diskutierte aber leidenschaftlich gern über literarische Fragen.
Im Herbst begegnete ich beim Anstehen vor einem Kino an den Champs-Élysées in Gesellschaft einer gemeinsamen Bekannten einer eleganten, großen, blonden Frau mit außerordentlich hässlichen Zügen, aber strahlender Vitalität: Violette Leduc. Einige Tage später gab sie mir im ‹Flore› ein Manuskript. Ich glaube, es hieß: ‹Bekenntnisse einer Dame von Welt›. Ich schlug das Heft auf. «Meine Mutter hat mir nie die Hand gereicht.» Ich las in einem Zug die Hälfte der Erzählung, die plötzlich zu Ende war. Der Schluss war eine Verlegenheitslösung. Das sagte ich auch Violette Leduc: Sie strich daraufhin die letzten Kapitel und ersetzte sie durch andere, die den ersten gleichwertig waren. Sie war nicht nur begabt, sie konnte auch fleißig sein. Ich legte die Arbeit Camus vor, der sie sofort annahm. Als sie unter dem Titel L’Asphyxie einige Monate später erschien, erreichte sie zwar nicht das breite Publikum, erntete aber den Beifall anspruchsvoller Kritiker. Unter anderem trug sie der Verfasserin die Freundschaft von Jean Genet und Jouhandeau ein. Eigentlich hatte Violette Leduc gar nichts von einer Weltdame. Als ich sie kennenlernte, verdiente sie sich ihren Lebensunterhalt damit, dass sie Fleisch und Butter kiloweise aus den Bauernhöfen der Normandie heranschleppte. Mehrmals lud sie mich zum Essen in die Schwarzmarktlokale ein, die sie versorgte. Sie war lustig und zuweilen drollig, hatte aber unter der scheinbaren Glätte etwas Heftiges und Misstrauisches. Stolz erzählte sie mir von ihren Geschäften, von den anstrengenden Märschen quer über Land, von den Dorfwirtshäusern, den Lastautos, den rußigen Zügen. Natürlich war sie ein Herz und eine Seele mit den Bauern, den Chauffeuren, den Händlern. Maurice Sachs, mit dem sie gut befreundet gewesen war, hatte sie zum Schreiben ermuntert. Sie lebte in großer Einsamkeit. Ich machte sie mit Colette Audry bekannt, die ich recht oft traf, und auch mit Nathalie Sarraute. Zwischen ihnen entspann sich eine Freundschaft, die aber recht bald an den unterschiedlichen Temperamenten gescheitert ist.
Die Säuberung führte bald zu Meinungsverschiedenheiten in den Reihen der früheren Widerstandskämpfer. Alle Welt war sich darin einig, dass die Art der Durchführung unmöglich sei. Aber während Mauriac Verzeihung predigte, forderten die Kommunisten Strenge. Im Combat versuchte Camus einen gerechten Mittelweg zu finden. Sartre und ich teilten seinen Standpunkt: Rache ist eitel – aber gewisse Menschen hatten in der Welt, die wir aufbauen wollten, keinen Platz. Praktisch hielt ich mich von allem fern. Ich war Mitglied des Schriftstellerverbandes (CNE) geworden, nahm jedoch nie an einer der Zusammenkünfte teil. Meiner Meinung nach machte Sartres Anwesenheit die meine überflüssig. Ich war aber einverstanden, als ich durch Sartre von den Beschlüssen des Komitees erfuhr, dass seine Mitglieder sich verpflichteten, nicht in den Zeitschriften und Zeitungen mitzuarbeiten, die Beiträge aus der Feder früherer Kollaborateure veröffentlichten. Die Stimme von Menschen, die der Ermordung von Millionen Juden und Widerstandskämpfern zugestimmt hatten, wollte ich nicht mehr hören. Ich wollte ihren Namen nicht neben dem meinen gedruckt sehen. Wir hatten gesagt: «Wir werden es nicht vergessen.» Ich vergaß es nicht.
Ich fiel auch aus allen Wolken, als mich jemand – ich weiß nicht, wer – wenige Tage vor dem Prozess gegen Brasillach bat, meinen Namen unter ein Schriftstück zu setzen, das seine Anwälte zirkulieren ließen: Die Unterzeichner sollten erklären, dass sie sich als Schriftsteller mit ihm solidarisch fühlten und das Gericht um Milde bäten. (Ich kann mich nicht mehr an den genauen Wortlaut dieser Bittschrift erinnern, aber das war ihr Sinn.) In keiner Weise, auf keinem Gebiet fühlte ich mich mit Brasillach solidarisch. Wie oft hatte ich beim Lesen seiner Artikel vor Zorn geweint! «Kein Mitleid mit den Meuchelmördern des Vaterlandes», hatte er geschrieben. Er hatte das Recht gefordert, «die Verräter anzuzeigen», und reichlich von ihm Gebrauch gemacht. Unter seiner Leitung war die Redaktion des Je suis partouteifrig damit beschäftigt, zu denunzieren, Köpfe zu fordern, Vichy in den Ohren zu liegen, man möge in der freien Zone das Tragen des gelben Sterns einführen. Sie hatten mehr getan, als ja und amen zu sagen. Sie hatten den Tod von Feldman, Cavaillès, Politzer und Bourla, die Deportation von Yvonne Picard, Péron, Kaan und Desnos gefordert. Es waren diese toten oder todgeweihten Freunde, mit denen ich mich solidarisch fühlte. Wenn ich auch nur einen Finger zugunsten Brasillachs gerührt hätte, hätte ich verdient, dass sie mir ins Gesicht spuckten. Ich zögerte keinen Moment, es kam überhaupt nicht in Frage. Camus reagierte ebenso. «Mit diesen Leuten haben wir nichts gemeinsam», sagte er zu mir. «Das Gericht wird entscheiden: Uns geht es nichts an.»
Ich wollte aber den Prozess miterleben; meine Unterschrift hatte zwar kein Gewicht, und meine Weigerung war rein symbolisch gewesen. Doch selbst durch eine Geste übernimmt man eine gewisse Verantwortung, und es erschien mir allzu bequem, mich der meinen durch Gleichgültigkeit zu entziehen. Ich verschaffte mir einen Platz auf der Pressetribüne. Es war kein erfreuliches Erlebnis. Die Journalisten machten sich nonchalant ihre Notizen, malten Männchen aufs Papier und gähnten. Die Anwälte deklamierten, die Richter saßen zu Gericht, der Vorsitzende führte den Vorsitz – es war eine Komödie, eine Zeremonie: Für den Angeklagten aber war es der «Augenblick der Wahrheit», in dem es um sein Leben ging. Angesichts des sinnlosen Justizapparats existierte nur er, dessen Schicksal sich plötzlich vollendete, als Mensch von Fleisch und Blut. Gelassen bot er seinen Anklägern die Stirn, und als das Urteil verlesen wurde, zuckte er mit keiner Wimper. In meinen Augen wurde durch diesen Mut nichts wiedergutgemacht. Gerade die Faschisten legen auf die Art des Sterbens mehr Gewicht als auf die Taten. Ich finde mich auch nicht mit dem Gedanken ab, dass der Ablauf der Zeit genügen müsse, um meinen Zorn in Resignation zu verwandeln: Er lässt die Toten nicht wiederauferstehen, er wäscht ihre Mörder nicht rein. Aber wie so vielen anderen war mir ein Apparat unangenehm, der den Henker in das Opfer verwandelt und dadurch einer Verurteilung den Anschein der Unmenschlichkeit verleiht. Als ich den Justizpalast verließ, traf ich kommunistische Freunde und schilderte ihnen mein Unbehagen. «Wären Sie doch zu Hause geblieben», antworteten sie trocken.
Einige Tage später vertraute mir Camus etwas verlegen an, dass er, einem gewissen Druck ausgesetzt und aus Gründen, die er mir nur unzulänglich erklärte, doch ein Schriftstück zugunsten einer Begnadigung unterzeichnet habe. Ich für meine Person habe meine Enthaltung nie bereut – obwohl an dem Morgen, an dem die Hinrichtung stattfand, meine Gedanken sich unablässig damit beschäftigten. Man hat der Säuberungsaktion vorgeworfen, sie habe diejenigen, welche den Bau des Atlantikwalls befürworteten, härter bestraft als seine Erbauer. Ich finde es sehr ungerecht, dass man wirtschaftliche Zusammenarbeit entschuldigt, aber es war richtig, gegen Hitlers Propagandisten streng vorzugehen. Durch mein Handwerk, meinen Beruf messe ich den Worten eine ungeheure Bedeutung bei. Simone Weil hat vorgeschlagen, alle, die sich des Wortes bedienen, um die Menschen zu belügen, vor Gericht zu stellen, und ich verstehe es. Es gibt Worte, die so mörderisch sind wie eine Gaskammer. Es waren Worte, die den Mörder Jaurès’ bewaffnet, Worte, die Salengro zum Selbstmord getrieben haben. Im Falle Brasillachs handelte es sich nicht um ein ‹Gesinnungsdelikt›. Durch seine Denunziationen, durch seine Aufrufe zum Töten und Völkermord hat er der Gestapo direkt in die Hände gearbeitet.
Die Deutschen hatten das Spiel verloren, aber sie gaben nicht nach. Hungersnot: Sie hatten die uralte Geißel nach Europa zurückgebracht. In der Erde scharrend, an Baumrinde nagend, wehrten sich Tausende von Holländern vergebens gegen diesen mittelalterlichen Tod. Bost brachte Fotos aus Holland mit, die Camus mir zeigte. «Das kann man nicht veröffentlichen!», sagte er und breitete auf seinem Schreibtisch die Bilder kleiner Kinder aus, die keinen Körper und kein Gesicht mehr hatten, nur noch Augen, riesige und irre Augen. Die Zeitungen brachten nur die harmlosesten, und doch fiel es einem schwer, sie anzuschauen.
Am 27. Februar bestieg ich am Abend den Zug nach Hendaye, mit Escudos und einer Reiseerlaubnis versehen – einem dreifarbigen Stück Papier, das in meinen Augen so kostbar war wie ein altes, mit dickem Wachs versiegeltes Pergament. Mein Nachbar las eifrig in einer Lebensbeschreibung Stalins. «Sehr trocken», sagte er. Die ganze Nacht hindurch unterhielt er sich mit zwei jungen Frauen über den Bolschewismus: Ihre Einstellung dazu war im Großen und Ganzen positiv. Ich las Peter Cheyneys Buch Hiebe auf den ersten Blick zu Ende, begann Graham Greenes Am Abgrund des Lebens und schlief gegen Morgen ein. Plötzlich war der Himmel blau: Hendaye. Außer für mich und einen kleinen alten Mann, der ebenfalls nach Madrid fuhr, war das die Endstation. Eine Grenze überschreiten zu dürfen, war damals noch ein seltenes Privileg. Sechs Jahre lang war das nicht möglich gewesen, und fünfzehn Jahre waren vergangen, seit ich von Spanien Abschied genommen hatte. Ich musste eine Stunde lang beim Militärkommandanten warten. Endlich hob sich der Schlagbaum, und ich sah die zweispitzigen Lacklederhüte der Guardia Civil wieder. Am Straßenrand verkaufte eine Frau Orangen, Bananen und Schokolade. Mir schnürte es vor Gier und Empörung die Kehle zusammen: Warum wurde uns dieser Überfluss, zehn Meter von zu Hause entfernt, vorenthalten? Plötzlich erschien mir unsere Not nicht mehr so schicksalhaft; ich hatte den Eindruck, dass man uns bestrafen wollte. Wer? Mit welchem Recht? Im Zoll wechselte man mir die Escudos, lehnte aber die Francs ab. Den Koffer in der Hand, legte ich zu Fuß die zwei Kilometer bis Irun zurück, das im Bürgerkrieg in einen Trümmerhaufen