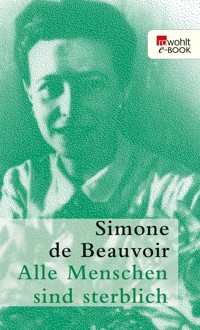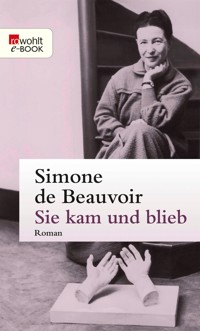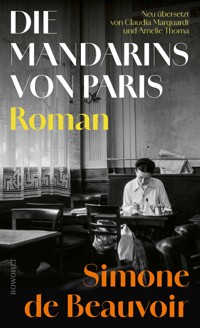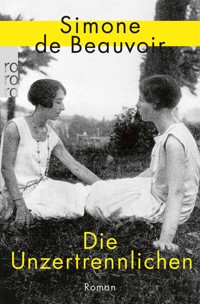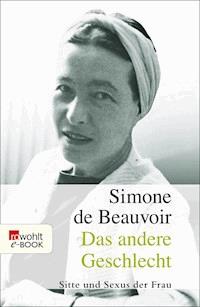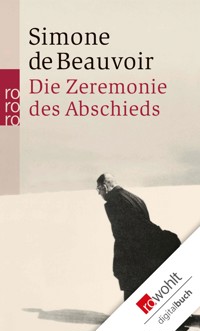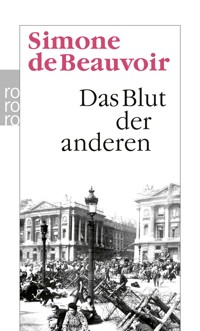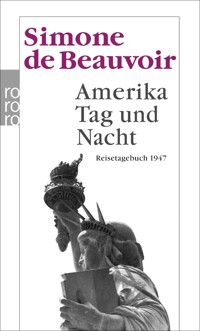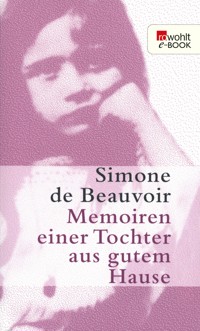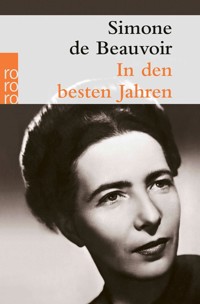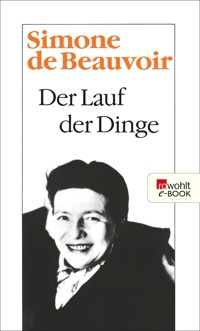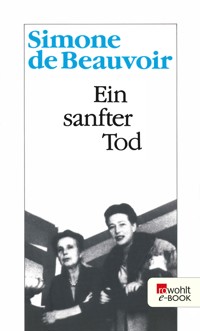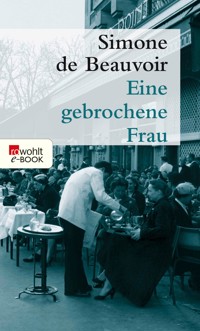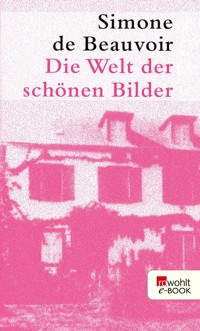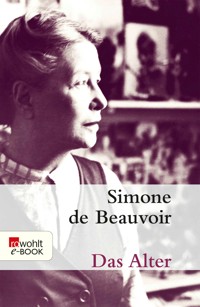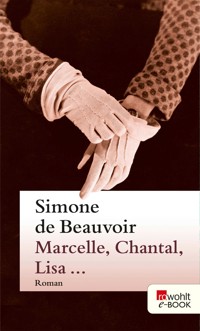7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Simone de Beauvoir ist nicht nur eine eigenwillige und geistreiche Schriftstellerin, sondern auch eine glänzende Vertreterin des Existenzialismus Sartre'scher Prägung. Sie beschränkt sich keineswegs darauf, die Gedanken des großen französischen Philosophen und Schriftstellers zu popularisieren, sondern versteht es, aufgrund ihrer Vertrautheit mit Sartres Denken und ihrer Kenntnis vor allem der Kant'schen und Hegel'schen Philosophie wesentliche Aspekte des menschlichen Seins unter einem neuen Blickwinkel darzustellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Simone de Beauvoir
Soll man de Sade verbrennen?
Drei Essays zur Moral des Existenzialismus
Aus dem Französischen von Alfred Zeller
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Soll man de Sade verbrennen?
«Gebieterisch, jähzornig, ohne Maß und Ziel, in den Sitten von einer wirren Phantasie, die nicht ihresgleichen hat, Atheist bis zum Fanatismus, kurz gesagt, so bin ich, und noch einmal, tötet mich oder nehmt mich so, wie ich bin, denn ich werde mich nicht ändern.»
Man hat sich dafür entschieden, ihn zu töten, zuerst langsam, durch die Langeweile in den Verliesen, und dann, indem man ihn verleumdet und vergessen hat. Einen solchen Tod hatte er sich selber gewünscht: «Sobald das Grab aufgefüllt ist, wird man Eicheln darauf säen, damit dann … die Spuren meiner Grabstätte ebenso von der Oberfläche der Erde verschwinden, wie ich mir schmeichle, dass die Erinnerung an mich aus dem Gedächtnis der Menschen ausgelöscht sein wird …» Von seinen letzten Willensäußerungen wurde einzig und allein diese eine respektiert, dafür aber umso gründlicher: Die Erinnerung an Sade ist durch törichte Legenden entstellt worden[1]; sogar sein Name wurde zu gewichtigen Wörtern (Sadismus, sadistisch) verwässert; seine intimen Tagebücher sind verloren, seine Manuskripte wurden verbrannt – die zehn Bände der «Journées de Florabelle» auf Veranlassung seines eigenen Sohnes –, seine Bücher verboten. Zwar interessierten sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts Swinburne und einige andere Neugierige für seinen Fall, aber erst Apollinaire hat dem Marquis einen Platz in der französischen Literatur gegeben, einen Platz, der ihm offiziell noch keineswegs zugebilligt wird. Man kann in umfassenden, ausführlichen Arbeiten über «die Ideen des 18. Jahrhunderts» oder gar über «die Empfindsamkeit im 18. Jahrhundert» blättern, ohne auch nur ein einziges Mal auf seinen Namen zu stoßen. Angesichts dieses skandalösen Schweigens kann man verstehen, dass die eifrigen Anhänger Sades ins andere Extrem verfielen und den Marquis als genialen Propheten feierten: Man behauptete, in seinen Schriften kündeten sich gleichzeitig Nietzsche, Stirner, Freud und die Surrealisten an. Aber dieser Kult, der wie jeder Kult auf einem Missverständnis beruhte, übte wiederum Verrat an ihm, indem der «göttliche Marquis» zum Gott erhoben wurde; wir möchten gerne verstehen, und man verlangt von uns, anzubeten. Jene Kritiker und Historiker, die in Sade weder einen Schurken noch einen Abgott, sondern einen Menschen, einen Schriftsteller sehen, lassen sich an den Fingern einer Hand abzählen. Ihnen ist es zu verdanken, dass Sade endlich wieder zu uns auf die Erde zurückgekehrt ist.
Aber wo steht er nun eigentlich? Womit verdient er unser Interesse? Selbst seine Bewunderer geben freimütig zu, dass seine Schriften größtenteils unlesbar sind; zwar sind sie, philosophisch gesehen, nicht eben banal, doch dafür ohne jeden Zusammenhang. Auch seine Laster setzen keineswegs durch ihre Originalität in Erstaunen; in dieser Hinsicht hat Sade nichts erfunden, und in psychiatrischen Abhandlungen begegnet man zahlreichen mindestens ebenso merkwürdigen Fällen wie dem seinen. Sade verdient also besondere Beachtung weder als Schriftsteller noch als sexuell Pervertierter. Aufmerksamkeit verdient vielmehr die Beziehung, die er zwischen diesen beiden Aspekten seiner Person geschaffen hat. Die Anomalien Sades sind von dem Augenblick an interessant, da er, anstatt sie als etwas von der Natur Gegebenes hinzunehmen, ein umfassendes System ausarbeitet, um sie zu rechtfertigen; und umgekehrt fesseln uns seine Bücher, sobald wir erkennen, dass er mittels seiner ermüdenden Wiederholungen, klischeehaften Formulierungen und stilistischen Ungeschicklichkeiten eine Erfahrung mitzuteilen versucht, deren Eigenart es gerade ist, nicht mitteilbar zu sein. Sade hat sich bemüht, sein leibseelisches Schicksal in eine ethische Wahl zu verwandeln, und damit nahm er seine menschliche Vereinzelung auf sich, wollte Beispiel und Anruf sein. Darin liegt die allgemein menschliche Bedeutung seines Lebens. Können wir unser Streben nach Universalität befriedigen, ohne auf unsere Individualität zu verzichten? Oder müssen wir aufgeben, was uns unterscheidet, wenn wir uns in die Gemeinschaft einordnen wollen? Dieses Problem geht uns alle an. Was ihn von seiner Umwelt unterscheidet, ist bei Sade zum Skandal gesteigert; andererseits beweist uns der gewaltige Umfang seines literarischen Œuvres, dass er sehnlichst danach verlangte, in die menschliche Gemeinschaft aufgenommen zu werden: Der Konflikt, dem kein aufrichtiger Mensch ausweichen kann, findet sich bei ihm in seiner extremsten Form. Es ist das Paradoxe und, in gewisser Hinsicht, der Sieg Sades, dass er, weil er hartnäckig an seinen Besonderheiten festhielt, uns dazu verhelfen kann, das menschliche Drama allgemein zu definieren.
Um Sades Entwicklung verstehen, um erfassen zu können, welche Rolle seine Freiheit in dieser Lebensgeschichte spielte, um ermessen zu können, was ihm gelang und worin er scheiterte, wäre es wünschenswert, die Gegebenheiten seiner Situation genau zu kennen. Leider bleiben trotz des Eifers seiner Biographen Person und Lebensgeschichte in vielem dunkel. Wir besitzen von ihm kein einziges authentisches Bildnis, und die Beschreibungen, die Zeitgenossen hinterlassen haben, sind dürftig. Nach dem Protokoll des Marseiller Prozesses war der Zweiunddreißigjährige «von angenehmer Gestalt und vollem Gesicht», von mittlerer Größe, in einen grauen Frack und Hosen aus quittengelber Seide gekleidet, hatte eine Feder am Hut, einen Degen an der Seite und einen Stock in der Hand. Nach einer Aufenthaltsbestätigung vom 7. Mai 1793 sah er mit dreiundfünfzig Jahren folgendermaßen aus: «Fünf Fuß zwei Zoll groß, Haare fast weiß, rundes Gesicht, hohe Stirn, blaue Augen, normale Nase, rundes Kinn.» Die Personenbeschreibung vom 23. März 1794 weicht davon ein wenig ab: «Fünf Fuß zwei ein Zwölftel Zoll groß, mittlere Nase, kleiner Mund, rundes Kinn, graublonde Haare, ovales Gesicht, hohe, freie Stirn, hellblaue Augen.» Seine «angenehme Gestalt» hatte er inzwischen verloren; wenige Jahre vorher schrieb er in der Bastille: «Mangels körperlicher Betätigung bin ich so korpulent geworden, dass ich mich kaum noch rühren kann.» Diese Korpulenz fiel Charles Nodier als Erstes auf, als er Sade 1807 in Sainte-Pélagie kennenlernte: «… eine gewaltige Fettleibigkeit, die seine Bewegungen so sehr störte, dass es ihm nicht möglich war, einen Rest der Anmut und Eleganz zu entfalten, deren Spuren noch in seinem ganzen Benehmen zu erkennen waren. Dennoch bewahrten seine müden Augen etwas Glänzendes, Fieberhaftes, das von Zeit zu Zeit in ihnen aufleuchtete, wie ein Funke, der in einer ausgebrannten Kohle erlischt.» Diese Zeugnisse, die einzigen, die wir besitzen, machen es kaum möglich, sich ein ganz bestimmtes Gesicht vorzustellen. Man[2] hat behauptet, dass Nodiers Beschreibung an den alternden Oscar Wilde erinnere; sie lässt aber auch an Montesquieu oder Maurice Sachs denken, und man könnte sich gut vorstellen, dass Sade auch etwas von Charlus gehabt haben mag, doch dieser Hinweis ist sehr fraglich. Noch mehr zu bedauern ist, dass wir über seine Kindheit kaum etwas wissen. Wenn Valcours Erzählung (in Sades ‹Aline und Valcour›) tatsächlich eine autobiographische Skizze wäre, dann hätte Sade früh schon Hass und Gewalt kennengelernt: Mit dem genau gleichaltrigen Joseph-Louis de Bourbon gemeinsam aufgezogen, scheint er sich gegen die egoistische Arroganz des kleinen Prinzen durch Zornanfälle und Schläge so heftig gewehrt zu haben, dass man ihn vom Hof entfernen musste. Nicht zu bezweifeln ist, dass seine Aufenthalte im düsteren Schloss Saumane und im zerfallenden Kloster Ebreuil seine Phantasie stark beeinflusst haben. Über seine kurze Studienzeit, seinen Eintritt in die Armee und über sein Leben als mondäner, ausschweifender agréable (heute würde man dazu Playboy sagen) weiß man hingegen nichts Genaues. Man kann versuchen, aus Sades Schriften auf sein Leben zu schließen, wie es Klossowski getan hat: Dieser sah in Sades Hass auf seine Mutter den Schlüssel zu seinem Leben und Schaffen; aber diese Hypothese leitet er ausschließlich aus der Rolle ab, die die Mutter in Sades Schriften spielt, das heißt, er beschränkt sich darauf, unter einem bestimmten Blickwinkel die Phantasiewelt Sades zu beschreiben, ohne uns deren Wurzeln in der realen Welt aufzuzeigen. Wir hingegen wollen a priori nach allgemeinen Schemata annehmen, dass Sades Beziehungen zu seinen Eltern bedeutungsvoll waren, auch wenn wir über sie im Einzelnen nichts aussagen können. Zu dem Zeitpunkt, da uns Sades Persönlichkeit zugänglich wird, ist sie schon voll ausgebildet, und wir wissen nicht, wie er zu dem geworden ist, was er ist. Dieses Nichtwissen macht es uns unmöglich, auf seine Strebungen und sein spontanes Verhalten zu schließen; sein Gefühlsleben, die spezifischen Eigenheiten seiner Sexualität erscheinen uns als Gegebenheiten, die wir lediglich zur Kenntnis nehmen können. Diese bedauernswerte Wissenslücke hat zur Folge, dass uns das innerste Wesen Sades stets verborgen bleiben wird; jeder Deutungsversuch lässt einen ungeklärten Rest zurück, den allein die Kindheitsgeschichte Sades aufhellen könnte. Dennoch dürfen wir uns durch diese unserem Verständnis aufgezwungenen Begrenzungen nicht entmutigen lassen, denn Sade hat sich, wie bereits angedeutet wurde, nicht darauf beschränkt, die Folgen seiner ursprünglichen Entscheidungen passiv hinzunehmen; stärker als seine Anomalien interessiert uns an ihm die Art und Weise, wie er diese Folgen auf sich genommen hat. Aus seiner Sexualität hat er eine Ethik gemacht, und diese Ethik hat er in einem literarischen Œuvre dargelegt. Durch diese wohlüberlegte Maßnahme als Erwachsener hat Sade seine eigentliche Originalität gewonnen. Wohl bleiben uns die Ursachen seiner Neigungen unbekannt, aber wir können genau verfolgen, wie er diese Neigungen zu Prinzipien erhoben und warum er diese «bis zum Fanatismus» getrieben hat.
Oberflächlich gesehen ähnelt Sade mit dreiundzwanzig Jahren allen Söhnen aus guten Familien seiner Zeit: Er ist gebildet, liebt das Theater, die Künste, das Leben. Er ist vergnügungssüchtig: Er unterhält eine Mätresse, die Beauvoisin, und besucht die Bordelle. Ohne große Begeisterung beugt er sich dem väterlichen Willen und heiratet ein dem niederen Adel angehörendes, aber sehr reiches Mädchen, Renée-Pélagie de Montreuil. Nun beginnt das Drama, das sich auf sein ganzes Leben auswirken und sich stets aufs Neue wiederholen wird: Im Mai verheiratet, wird Sade im Oktober wegen Ausschweifungen in einem Haus verhaftet, in das er sich bereits im Juni begeben hatte. Die Gründe für die Verhaftung sind so schwerwiegend, dass Sade an den Gefängnisdirektor wirre Briefe schreibt, in denen er darum bittet, diese Gründe geheim zu halten, da er sonst unrettbar verloren wäre. Die Episode lässt vermuten, dass Sades Geschlechtsleben bereits besorgniserregende Formen angenommen hatte; bestätigt wird diese Annahme durch die Tatsache, dass ein Jahr später ein Inspektor Marais die Zuhälterinnen anwies, dem Marquis keine Mädchen mehr zur Verfügung zu stellen. Aber die eigentliche Bedeutung dieser Episode liegt weniger in den Aufschlüssen, die sie uns vermittelt, als in der Erkenntnis, die Sade selber dadurch zuteil wurde: Am Beginn seines Lebens als Erwachsener muss er plötzlich feststellen, dass sich sein gesellschaftliches Dasein und seine persönlichen Vergnügungen nicht auf einen Nenner bringen lassen.
Der junge Sade ist alles andere als ein Revolutionär, ja, er empört sich nicht einmal: Er ist ganz und gar bereit, die Gesellschaft so hinzunehmen, wie sie nun einmal ist. Er gehorcht seinem Vater[3] so sehr, dass er mit dreiundzwanzig Jahren sich von ihm eine Gattin geben lässt, die ihm missfällt, und für sich keine andere Zukunft ins Auge fasst als jene, die ihm auf Grund seiner Herkunft zukommt: Er wird Gatte, Vater, Marquis, Hauptmann, Schlossherr, Generalleutnant sein; auf keinen Fall möchte er auf die Privilegien verzichten, die ihm seine Stellung und das Vermögen seiner Frau sichern. Indessen vermag ihn all das doch nicht zu befriedigen; man bietet ihm Beschäftigungen, Aufgaben, Ehren an, aber keine Unternehmung, nichts interessiert, amüsiert oder beschäftigt ihn. Er will nicht nur eine im öffentlichen Leben stehende Persönlichkeit sein, deren ganzes Verhalten durch Konventionen und Routine bestimmt wird, sondern will auch Mensch sein, ein lebensvoller Mensch. Nur einen Ort gibt es, an dem sich diese Individualität bestätigen kann, und das ist nicht das Bett, in dem er allzu züchtig von einer prüden Gattin erwartet wird, sondern das Bordell, in dem er sich das Recht erkaufen kann, seinen Träumen freien Lauf zu lassen. Einer dieser Träume ist den meisten jungen Adeligen jener Zeit gemeinsam: Als späte Vertreter einer im Abstieg begriffenen Gesellschaftsschicht, die einst eine konkrete Macht in Händen hatte, nun aber keinerlei wirklichen Einfluss auf die Welt mehr auszuüben vermag, versuchen sie, symbolisch in der Abgeschiedenheit von Nebengemächern jenen früheren Zustand wiederherzustellen, dessen sie sich sehnsüchtig erinnern: den des selbstherrlichen, einsamen Feudaldespoten. So waren beispielsweise die Orgien des Herzogs von Charolais ebenso berüchtigt wie blutig. Nach dieser illusionären Selbstherrlichkeit dürstet auch Sade. «Was wünscht man, wenn man genießt? Dass sich alles ringsum nur um einen kümmert, nur an einen denkt, sich nur mit einem beschäftigt … Es gibt keinen Menschen, der nicht ein Despot sein will, wenn er f…» Der Rausch der Tyrannei führt unmittelbar zur Grausamkeit, denn der Libertin empfindet, wenn er das ihm dienende Objekt quält, «alle Reize, die ein nervöser Mensch fühlt, wenn er sein Kräfte gebraucht; er beherrscht, er ist Tyrann».
Genau besehen ist es eigentlich eine recht bedeutungslose «Heldentat», gegen ein im Voraus vereinbartes Entgelt einige Mädchen auszupeitschen; dass Sade so großen Wert darauf gelegt hat, ist eine Tatsache, die ihn ganz und gar in Frage stellt. Auffallend ist, dass er außerhalb der Mauern seines «kleinen Hauses» nicht im mindesten daran denkt, «seine Kräfte zu gebrauchen»; man entdeckt an ihm keinerlei Ehrgeiz, keine Unternehmungslust, keinen Machtwillen, und ich möchte sogar annehmen, dass er ein regelrechter Feigling war. Zweifelsohne verlieh er ganz systematisch den Helden seiner Schriften alle jene Züge, die in den Augen der Gesellschaft einen Makel darstellen; gleichwohl hat er Blangis mit einem solchen Wohlgefallen gezeichnet, dass die Annahme, er habe sich selber in ihn hineinprojiziert, durchaus berechtigt ist, und die folgenden Worte sind von der Unmittelbarkeit eines persönlichen Geständnisses: «Ein entschlossenes Kind hätte diesen Koloss in Schrecken versetzt … Er wurde furchtsam und feige, und der Gedanke an einen noch so ungefährlichen, aber mit gleichen Kräften ausgetragenen Kampf hätte ihn ans andere Ende der Welt fliehen lassen.» Dass Sade, teils aus Leichtsinn, teils aus Großzügigkeit, außerordentlicher Kühnheit fähig war, widerspricht nicht der Annahme, dass er Gleichgestellten und, allgemeiner, der Wirklichkeit der Welt gegenüber furchtsam, ja ängstlich war. Von Seelenstärke spricht er nicht deshalb so viel, weil er sie besitzt, sondern weil er sie begehrt; in Widerwärtigkeiten stöhnt er, ängstigt sich, weiß nicht mehr aus noch ein. Die Furcht, unter Geldnot leiden zu müssen, die ihn unaufhörlich verfolgt hat, verrät eine unbestimmtere Besorgnis: Er misstraut allem und allen, weil er sich ihnen nicht gewachsen fühlt. Und er ist ihnen auch nicht gewachsen: Er führt sich unordentlich auf, macht Schulden, gerät in unmäßige Erregung, flieht oder liefert sich zur falschen Zeit aus; er gerät in jede Falle. Diese gleichzeitig langweilige und bedrohliche Welt, die ihm nichts Gültiges zu bieten vermag und bei der er nicht recht weiß, was er von ihr fordern soll, interessiert ihn nicht; er sucht sich seine Wahrheit anderswo. Wenn er schreibt, dass die Genusssucht alle anderen Leidenschaften «gleichzeitig unterordnet und vereint», so gibt er uns damit eine genaue Beschreibung seiner eigenen Erfahrung: Er hat sein Dasein seiner Erotik untergeordnet, weil in seinen Augen die Erotik der einzig mögliche Vollzug seines Daseins war. Er gab sich ihr deshalb mit solcher Heftigkeit, Unvorsichtigkeit und Hartnäckigkeit hin, weil er den Geschichten, die er sich durch den Akt der Wollust selbst erzählt, mehr Bedeutung beimaß als den zufälligen Geschehnissen: Er entschied sich für die Welt der Phantasie.
Zweifellos wiegte sich Sade zunächst in Sicherheit in seinem trügerischen Paradies, das eine dichte Wand von der Welt der Ernsthaftigkeit zu trennen schien. Und wenn es zu keinem Skandal gekommen wäre, dann wäre er vielleicht nur ein ganz alltäglicher Wüstling gewesen, den man an bestimmten Orten seiner etwas sonderbaren Neigungen wegen gekannt hätte. Zu jener Zeit gab es zahlreiche Libertins, die sich ungestraft noch ärgeren Ausschweifungen hingaben. Ich glaube jedoch, dass im Falle Sades der Skandal schicksalhaft war. Es gibt abartig veranlagte Menschen, auf die der Mythus von Mister Hyde und Doktor Jekyll genau zutrifft: Sie hoffen zunächst, ihre «Laster» befriedigen zu können, ohne ihre «offizielle» Persönlichkeit zu kompromittieren; wenn ihre Einbildungskraft jedoch ausreicht, über sich selbst nachzudenken, dann reißen sie sich in einem Taumel, in dem sich Scham und Stolz mischen, selbst die Maske vom Gesicht: Dies tat Charlus, trotz seiner Listen und gerade durch seine Listen. Inwieweit war Sades Unvorsichtigkeit Herausforderung? Diese Frage zu beantworten, ist unmöglich. Sicherlich wollte er die vollkommene Trennung seines Familienlebens von seinen privaten Vergnügungen betonen, und ebenso steht fest, dass ihn dieser heimliche Triumph nur dadurch befriedigen konnte, dass er ihn bis zu einem Grad steigerte, da er aus der Heimlichkeit heraustrat. Seine Überraschung, wenn er gestellt wurde, gleicht der eines Kindes, das so lange auf ein Gefäß einschlägt, bis es zerbricht. Im Glauben an seine Selbstherrlichkeit spielte er mit der Gefahr; aber die Gesellschaft lauerte ihm auf; sie verweigert jede Teilung, fordert jeden Einzelnen ganz und gar für sich; rasch bemächtigte sie sich Sades Geheimnis und nahm es in sich auf – als Verbrechen.
Darauf reagiert Sade zunächst mit Bittgesuchen, Demut und Scham; er bittet flehentlich, man möge ihm gestatten, seine Frau wiederzusehen, und bezichtigt sich, sie schwer beleidigt zu haben; er verlangt nach einem Beichtvater und öffnet diesem sein Herz. Das ist keineswegs bloße Heuchelei; von einem Tag auf den anderen hat sich ein schrecklicher Wandel vollzogen: Natürliche, unschuldige Handlungen, die für Sade bis dahin nur Lustquellen waren, sind zu strafwürdigen Taten geworden, und der junge agréable hat sich in ein räudiges Schaf verwandelt. Wahrscheinlich hat er schon seit seiner Kindheit – möglicherweise durch seine Beziehungen zur Mutter – die grausame Zerrissenheit der Gewissensbisse gekannt, aber durch den Skandal des Jahres 1763 leben sie in dramatischer Weise wieder auf: Sade ahnt, dass er von nun an zeit seines Lebens schuldig sein wird. Auf seine Vergnügungen legt er zu großen Wert, als dass er auch nur einen Augenblick daran dächte, auf sie zu verzichten; eher will er durch Trotz gegen die Scham ankämpfen. Es ist bemerkenswert, dass die erste seiner bewusst anstößigen Handlungen unmittelbar nach seiner Haftentlassung erfolgt: Die Beauvoisin begleitet ihn in das Schloss La Coste, wo sie als «Madame de Sade» den ganzen provenzalischen Adel zum Narren hält, während sich Sades Abbé zu stummer Komplizität gezwungen sieht. Die Gesellschaft hat Sade jede heimliche Freiheit verweigert, hat versucht, seine Erotik zu «vergesellschaften»: Umgekehrt wird sich von nun an das gesamte gesellschaftliche Leben des Marquis auf der Ebene der Erotik abspielen. Da man nicht in aller Ruhe das Gute vom Bösen trennen kann, um sich nacheinander beidem hinzugeben, muss man angesichts des Guten und sogar von diesem abhängig das Böse fordern. Wiederholt hat Sade eingestanden, dass seine spätere Haltung dem Ressentiment entsprungen ist: «Es gibt Seelen, die hart erscheinen, weil sie für Empfindungen empfänglich sind, und diese gehen manchmal sehr weit: Was man bei ihnen für Sorglosigkeit und Grausamkeit hält, ist lediglich eine ihnen allein bekannte Art und Weise, lebhafter zu empfinden als die anderen» (‹Aline und Valcour›). Und Dolmancé (in ‹Die Philosophie im Boudoir›) schreibt seine Laster der Bosheit der Menschen zu: «Es war ihre Undankbarkeit, die mein Herz austrocknete, ihre Falschheit, die in mir jene unglücklichen Tugenden zerstörte, für die ich vielleicht ebenso geboren war wie ihr.» Die dämonische Moral, die Sade später zu einer Theorie ausarbeitete, war für ihn zuerst eine erlebte Erfahrung.
Durch Renée-Pélagie, seine Frau, lernte Sade die ganze Schalheit der Tugend und die Langeweile kennen; dadurch entstand in ihm ein Widerwille, wie ihn nur ein Wesen aus Fleisch und Blut wecken kann. Aber durch Renée gewinnt er auch die für ihn köstliche Erkenntnis, dass in ihrer konkreten, fleischlichen, individuellen Gestalt das Gute im Zweikampf besiegt werden kann. Seine Frau ist für ihn keine Feindin, sondern wie alle Gattinnengestalten in seinen Schriften, zu denen er durch sie angeregt wurde, ein auserwähltes Opfer: ein Opfer, das mitschuldig sein will. Die Beziehungen Blamonts zu seiner Frau widerspiegeln zweifellos ziemlich genau das Verhältnis zwischen Sade und der Marquise; Blamont findet seine Freude daran, seine Frau in dem Augenblick zu kosen, da er die finstersten Machenschaften gegen sie ausheckt. Jemandem einen Genuss verschaffen kann tyrannische Gewalttätigkeit sein, wie Sade schon hundertfünfzig Jahre vor den Psychoanalytikern erkannt hat; in seinen Schriften finden sich zahlreiche Opfer, denen man zuerst ein Lustgefühl gewährt, ehe man sie martert. Dem als Liebender verkleideten Folterknecht gefällt es zu sehen, wie die Liebende gutgläubig vor Wollust und Dankbarkeit außer sich ist und seine Schlechtigkeit für Zärtlichkeit hält. Derartig raffinierte Freuden mit der Erfüllung einer gesellschaftlichen Pflicht zu vereinen, hat sicherlich Sade veranlasst, mit seiner Frau drei Kinder zu zeugen. Aber er hat dadurch noch weit mehr erreicht: Die Tugend machte sich zur Verbündeten des Lasters und zu seiner Sklavin. Jahrelang hat Mme de Sade die Verfehlungen ihres Mannes gedeckt, hat ihm mutig die Flucht aus Miolans ermöglicht, hat die Liebschaft ihrer eigenen Schwester mit dem Marquis und später die Orgien im Schloss La Coste begünstigt. Sie hat sich sogar selbst strafbar gemacht, als sie, um die Beschuldigungen Nanons zu widerlegen, Silbergeschirr in deren Gepäck versteckte. Sade hat sich ihr gegenüber niemals dankbar gezeigt, ja, die Idee der Dankbarkeit gehört zu jenen, die er am heftigsten ablehnt; aber offenbar empfand er ihr gegenüber jene zweideutige Freundschaft, die jeder Despot dem erweist, was unbestreitbar sein ist. Ihr verdankte er nicht nur, dass er seine Rolle als Gatte, Vater und Edelmann mit seinen Vergnügungen in Einklang bringen konnte, sondern auch, dass er die Überlegenheit des Lasters über die Güte, die Ergebenheit, die Treue, die Anständigkeit ganz offensichtlich zu machen vermochte; indem er die Institution der Ehe und alle ehelichen Tugenden den Launen seiner Phantasie und seiner Sinne unterwarf, verhöhnte er die ganze Gesellschaft.
Renée-Pélagie ist Sades glänzendster Erfolg; Mme de Montreuil hingegen, seine Schwiegermutter, ist der Inbegriff seines Scheiterns. Sie verkörpert die abstrakte, allgemeine Gerechtigkeit, an der der Einzelne zerbricht. Ihr gegenüber fordert er am nachdrücklichsten von seiner Frau, zu ihm zu stehen: Wenn er in den Augen der Tugend seinen Prozess gewinnt, dann büßt das Gesetz viel von seiner Macht ein; denn die schrecklichsten Waffen des Gesetzes sind nicht das Gefängnis oder das Schafott, sondern jenes Gift, das es in leicht verwundbare Herzen versenkt. Unter dem Einfluss ihrer Mutter wird Renée unsicher; die junge Nonne bekommt es mit der Angst zu tun; die feindselige Gesellschaft schleicht sich in Sades Haus ein, macht seine Vergnügungen zunichte, und er gerät selbst unter ihren Einfluss: Getadelt, beschämt, beginnt er an sich zu zweifeln. Das schlimmste Verbrechen, das Mme de Montreuil an ihm verübt hat, ist, dass sie ihn durch ihre Anklage zum Schuldigen und schließlich zum Verbrecher gemacht hat. Daher wurde Sade niemals müde, sie in seinen Schriften lächerlich zu machen, zu beschmutzen, zu quälen: Er will mit ihr seine eigenen Sünden beseitigen. Möglich, dass Klossowskis Hypothese begründet und Sade tatsächlich seine Mutter verabscheut hat; die Eigenart seiner Sexualität lässt diesen Schluss zu. Sicherlich aber wäre diese Feindschaft nicht so lebendig geblieben, wenn nicht Renées Mutter ihm die Mutterschaft so hassenswert gemacht hätte. Eigentlich hat sie im Leben ihres Schwiegersohns eine so bedeutsame und so abscheuliche Rolle gespielt, dass die Vermutung naheliegt, er habe ausschließlich sie angegriffen. Jedenfalls ist sie es, die er auf den letzten Seiten seiner ‹Philosophie im Boudoir› durch die eigene Tochter wild verhöhnen lässt.
Zwar ist Sade schließlich von seiner Schwiegermutter und dem Gesetz besiegt worden, aber nur, weil er selbst zu dieser Niederlage beigetragen hat. Ob nun der Zufall oder seine eigene Unvorsichtigkeit beim Skandal des Jahres 1763 eine größere Rolle gespielt hat, sicher ist, dass er in der Folgezeit durch die Gefahr seine Vergnügungen zu steigern gesucht hat. In diesem Sinn kann man sagen, dass er die Verfolgungen eigentlich selber gewollt hat, auch wenn er sich dann stets entrüstet zeigte. Es war ein Spiel mit dem Feuer, dass er ausgerechnet den Ostersonntag wählte, um die Bettlerin Rose Keller in sein Haus in Arcueil zu locken; nachdem man sie, ausgepeitscht und völlig verschreckt, nicht sicher genug eingeschlossen hatte, konnte sie fliehen und entfesselte einen Skandal, der zu zwei kürzeren Inhaftierungen Sades führte.
Während der drei Jahre seines Exils, die er auf seinen Ländereien in der Provence verbrachte und die von kurzen Dienstzeiten beim Militär unterbrochen waren, scheint er vernünftig geworden zu sein. Gewissenhaft spielt er seine Rolle als Schlossherr und Gatte: Er zeugt mit seiner Frau zwei Kinder, lässt sich von der Gemeinde Saumane huldigen, richtet seinen Park her, liest Bücher, lässt auf der Schlossbühne Komödien aufführen, von denen er eine selbst verfasst hat. Aber für dieses erbauliche Leben wird er übel belohnt: 1771 wird er wegen Schulden eingesperrt. Nach seiner Freilassung ist sein Tugendeifer erkaltet; er verführt seine junge Schwägerin, der er indessen für kurze Zeit aufrichtig geneigt gewesen zu sein scheint: Immerhin war sie Nonne, Jungfrau und die Schwester seiner Frau, was das Abenteuer recht reizvoll machte. Allerdings sucht er in Marseille auch noch andere Zerstreuungen, und 1772 nimmt die «Affäre mit den Kanthariden-Bonbons» unerwartete und erschreckende Ausmaße an: Während Sade mit seiner Schwägerin nach Italien flieht, werden er und sein Diener Latour in Abwesenheit zum Tode verurteilt und beide in effigie auf dem Hauptplatz von Aix verbrannt. Die Nonne sucht in einem französischen Kloster Zuflucht, wo sie bis an ihr Lebensende bleibt; Sade verbirgt sich in Savoyen, wird ergriffen und im Schloss Miolans festgesetzt, aus dem ihm seine Frau zur Flucht verhilft; doch von nun an ist er ein gehetzter Mensch. Bald in Italien unterwegs, bald in seinem Schloss versteckt, weiß er, dass er nie mehr ein normales Leben wird führen können. Gelegentlich nimmt er seine Rolle als Seigneur ernst: Als sich auf seinen Ländereien eine Komödiantengruppe niederlässt, um das Stück ‹Der gehörnte, geschlagene und zufriedene Gatte› aufzuführen, ordnete Sade, vielleicht über diesen Titel aufgebracht, an, dass die Plakate, auf denen die Vorstellung angekündigt wird, von den Stadtdienern als «anstößig und die Freiheiten der Kirche verletzend» zerrissen werden. Einen Mann namens Saint-Denis, dem er feindlich gesinnt ist, verjagt er aus seinem Gebiet mit den Worten: «Ich habe das Recht, hergelaufene Menschen, die sich auf meinen Ländereien herumtreiben, zu verjagen.» Aber eine derartige Machtausübung bereitet ihm wenig Vergnügen; er versucht einen Traum zu verwirklichen, der immer wieder durch seine Bücher geistern sollte: In der Einsamkeit des Schlosses La Coste stellt er einen seinen Launen gefügigen Harem zusammen; im Bunde mit der Marquise versammelt er mehrere schöne Diener, einen völlig ungebildeten, aber hübschen Sekretär, eine reizende Köchin und ein ebensolches Zimmermädchen und dazu zwei Mädchen, die von Zuhälterinnen zur Verfügung gestellt werden. Aber das Schloss La Coste ist nicht die unzugängliche Festung der ‹Hundertzwanzig Tage›; die Gesellschaft kommt ihm auf die Schliche. Die beiden leichten Mädchen fliehen, das Zimmermädchen verlässt das Schloss und gebiert ein Kind, als dessen Vater sie den Marquis bezeichnet, der Vater der Köchin schießt mit einem Revolver auf Sade, der hübsche Sekretär wird von seinen Eltern zurückverlangt. Lediglich Renée-Pélagie passt sich genau der Rolle an, die ihr von ihrem Mann zugewiesen wird; alle anderen fordern ihr Eigenleben zurück, und Sade muss einmal mehr erkennen, dass er diese nur allzu wirkliche Welt nicht zu seinem privaten Theater machen kann.
Indessen begnügt sich die Welt nicht damit, seine Träume in Schach zu halten, sondern sie verstößt ihn. Sade flieht nach Italien, aber dort spürt ihn Mme de Montreuil auf, die ihm nicht verzeihen kann, dass er ihre jüngste Tochter verführt hat. Der Marquis kehrt nach Frankreich zurück und wagt sich nach Paris, doch seine Schwiegermutter benützt die Gelegenheit, um ihn am 13. Februar 1777 im Schloss von Vincennes festsetzen zu lassen. Nach Aix zurückgebracht und verurteilt, flieht er nach La Coste, wo er vor den Augen seiner geduldigen Frau mit Mlle Rousset, ihrer Gouvernante, ein Idyll zu beginnen versucht. Aber am 7. November 1778 ist er wieder in Vincennes, «wie ein wildes Tier hinter neunzehn eisernen Toren eingesperrt».
Nun hebt eine neue Geschichte an: Während der elfjährigen Gefangenschaft – zuerst in Vincennes, dann in der Bastille – liegt ein Mann im Sterben, und ein Schriftsteller wird geboren. Der Mann ist rasch zerbrochen: Zur Ohnmacht verdammt, ohne zu wissen, wie lange er eingesperrt sein wird, verfällt sein Geist in wirre Träumereien. Durch gewissenhafte Berechnungen, die auf keiner faktischen Gegebenheit beruhen, sucht er herauszubekommen, wann seine Einkerkerung ein Ende haben wird. Geistig hat er sich ziemlich rasch wieder gefangen, wie sein Briefwechsel mit Mme de Sade und Mlle Rousset beweist. Sein Fleisch jedoch entsagt: In Tafelfreuden sucht er nach einem Ausgleich für seine sexuelle Enthaltsamkeit. Sein Diener Carteron berichtet, dass er «im Gefängnis wie ein Seeräuber Pfeife rauchte» und «für vier aß». Nach eigenem Eingeständnis «in allem maßlos», wird er zum Vielfraß: Von seiner Frau lässt er sich riesige Körbe mit Lebensmitteln schicken und wird regelrecht feist. Aber in all seinen Klagen, Beschuldigungen, Verteidigungsschriften, Bittgesuchen macht es ihm immer noch ein wenig Vergnügen, die Marquise zu quälen: Er stellt sich eifersüchtig, schreibt ihr finstere Machenschaften zu, und wenn sie ihn besucht, macht er ihr wegen ihrer Kleidung Vorwürfe und verlangt von ihr ein feierlich-strenges Gehabe. Diese Zerstreuungen sind jedoch selten und reichlich fade. Ab 1782 verlangt er nur noch von der Literatur das, was ihm das Leben nicht mehr gewährt: die Aufregung, den Trotz, die Aufrichtigkeit und alle Freuden der Phantasie. Auch in dieser Hinsicht ist er «maßlos»: Wie er isst, so schreibt er auch, nämlich wie ein Rasender. Auf das ‹Zwiegespräch zwischen einem Priester und einem Sterbenden› folgen die ‹Hundertzwanzig Tage von Sodom›, ‹Die Unglücke der Tugend› und ‹Aline und Valcour›. Nach dem Werkverzeichnis von 1788 soll er damals schon fünfunddreißig Theaterakte, ein halbes Dutzend Erzählungen und fast das ganze ‹Tagebuch eines Literaten› geschrieben haben; überdies ist diese Liste sicherlich unvollständig.
Als Sade am Karfreitag des Jahres 1790 wieder die Freiheit erhält, kann er hoffen und hofft auch, dass für ihn ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Seine Frau will sich von ihm trennen; seine Söhne, von denen der eine kurz vor der Auswanderung steht, während der zweite Malteserritter ist, sind ihm ebenso fremd wie «die gute dicke Bäuerin», die er zur Tochter hat. Nicht mehr an seine Familie gebunden, versucht er, den die Gesellschaft des Ancien Régime als Unberührbaren behandelt hatte, sich in die neue Gesellschaft einzuordnen, die ihm die Würde eines Bürgers gegeben hat. Man führt seine Stücke öffentlich auf, ‹Oxtiern› wird sogar zu einem beachtlichen Erfolg. Er wird in die «Section des Piques» auf genommen und zu deren Vorsitzendem ernannt; als solcher verfasst er eifrig Ansprachen und Petitionen. Aber sein Idyll mit der Revolution ist nur von kurzer Dauer. Sade ist nun fünfzig Jahre alt, hat eine Vergangenheit, die ihn verdächtig erscheinen lässt, und ein aristokratisches Temperament, das auch sein Hass auf den Adel nicht auszulöschen vermochte: Wiederum befindet er sich im Zwiespalt. Er ist Republikaner, tritt theoretisch sogar für einen radikalen Sozialismus und die Abschaffung des Privateigentums ein, aber er legt Wert darauf, sein Schloss und seine Ländereien behalten zu können. Die Welt, der er sich anzupassen versucht, ist immer noch zu real und setzt ihm einen heftigen Widerstand entgegen, der ihn verletzt; es ist eine von allgemeingültigen Gesetzen regierte Welt, und diese Gesetze sind in seinen Augen abstrakt, falsch und ungerecht. Als sich die Gesellschaft auf diese Gesetze beruft, um ihre Morde zu rechtfertigen, zieht sich Sade entsetzt zurück. Man kennt ihn sehr schlecht, wenn man sich darüber verwundert, dass er, anstatt sich um den Posten eines Volkskommissars in der Provinz zu bemühen, der ihm die Möglichkeit gegeben hätte, zu quälen und zu töten, sich durch Menschlichkeit bei den neuen Machthabern unmöglich machte. Es wäre völlig falsch, wollte man annehmen, dass er «das Blut liebte», wie man das Gebirge oder das Meer liebt. «Blut fließen lassen» war eine Handlung, die unter bestimmten Umständen auf ihn eine fast berauschende Wirkung ausüben konnte, aber was ihn zur Grausamkeit trieb, war eigentlich das Verlangen, durch sie ganz bestimmte Menschen und sein eigenes Dasein als Bewusstsein und Freiheit und gleichzeitig als Fleischlichkeit zu erfahren. Er weigert sich, über anonyme Menschen zu Gericht zu sitzen, sie zu verurteilen, sie aus der Ferne sterben zu sehen. Nichts hat er an der Gesellschaft des Ancien Régime so sehr gehasst wie deren Anmaßung, zu richten und zu bestrafen, eine Anmaßung, deren Opfer er selbst gewesen war; die Schreckensherrschaft der Revolution vermag er nicht zu entschuldigen. Wenn der Mord durch die Verfassung erlaubt wird, ist er nur noch der abscheuliche Ausdruck abstrakter Prinzipien: Er wird unmenschlich. Als Sade zum Staatsanwalt ernannt wird, ordnet er deshalb fast immer die Niederschlagung der Prozesse an; er weigert sich, im Namen des Gesetzes Mme de Montreuil und ihrer Familie zu schaden, als er deren Schicksal in der Hand hat. Er sieht sich sogar veranlasst, seinen Posten als Vorsitzender der «Section des Piques» niederzulegen, und schreibt an Gaufridy: «Ich habe mich gezwungen gesehen, meinen Sessel dem Vizepräsidenten zu überlassen; sie wollten mich dazu bringen, Abscheulichkeit, Unmenschlichkeit ins Werk zu setzen: Ich habe das niemals gewollt.» Im Dezember 1793 wurde er als «Gemäßigter» eingesperrt; dreihundertfünfundsiebzig Tage später wieder freigelassen, schrieb er niedergeschlagen: «Meine ‹nationale› Haft, die Guillotine vor Augen, hat mir hundertmal mehr geschadet als alle nur denkbaren Bastillen.» Und zwar deshalb, weil die Politik durch diese summarischen Blutopfer nur allzu deutlich zeigte, dass für sie die Menschen eine einfache Anhäufung von Objekten waren, während Sade eine Welt von individuellen Lebewesen um sich haben wollte; das «Böse», bei dem er Zuflucht gesucht hatte, verschwindet, wenn die Tugend sich das Recht zum Verbrechen herausnimmt. Eine mit gutem Gewissen ausgeübte Schreckensherrschaft ist die radikalste Verneinung der dämonischen Welt Sades.
«Das Übermaß des Schreckens hat das Verbrechen abgestumpft», schreibt Saint-Just. Sades Sexualität ist nicht nur deshalb eingeschlafen, weil er alt und verbraucht ist, sondern weil die Guillotine die düstere Poesie der Erotik ausgelöscht hat. Um sich darin zu gefallen, das Fleisch zu demütigen, sich an ihm zu begeistern, muss man ihm zuerst einen Wert verleihen; wenn man jedoch die Menschen ruhigen Gewissens als Sachen behandeln kann, hat das Fleisch weder Sinn noch Wert. Wohl konnte Sade in seinen Büchern seine vergangenen Erfahrungen zu neuem Leben erwecken, seine alte Welt neu erstehen lassen, aber im wirklichen Leben hat er den Glauben daran verloren. In seinem Verhältnis zu jener Frau, die er «Sensible» nennt, ist nichts Körperliches mehr von Bedeutung. Sein einziges erotisches Vergnügen besteht darin, von ‹Justine› inspirierte obszöne Gemälde zu betrachten, die er in seinem Geheimkabinett aufhängen lässt: Er schwelgt in Erinnerungen, ist aber keines Schwunges mehr fähig, ja, schon das Leben an sich ist für ihn eine kaum noch erträgliche Bürde. Wohl ist er des gesellschaftlichen und familiären Rahmens ledig, in dem er erstickte, aber dessen festes Gefüge war für ihn eine Notwendigkeit, und so schleppt er sich elend und krank dahin. Die zu La Coste gehörenden Güter muss er mit Verlust verkaufen und vergeudet in kurzer Zeit das dafür eingenommene Geld; er sucht bei einem Gutsbesitzer Zuflucht, dann zusammen mit dem Sohn Sensibles in einer Scheune; vierzig Sous täglich verdient er als Angestellter beim Versailler Theater. Das Dekret vom 28. Juni 1799, in dem das Verbot ausgesprochen wird, ihn aus der Liste der Emigranten zu streichen, in die er als Adliger aufgenommen worden war, veranlasst ihn zu den verzweifelten Worten: «Tod und Elend sind die Belohnung, die mir für meine treue Anhänglichkeit an die Republik zuteil wird.» Dennoch erhält er eine Aufenthaltsgenehmigung und einen Bürgerschein, und im Dezember 1799 tritt er in seinem ‹Oxtiern› in der Rolle des Fabrice auf; aber zu Beginn des Jahres 1800 ist er im Versailler Krankenhaus, «vor Hunger und Kälte sterbend» und seiner Schulden wegen von Einkerkerung bedroht. In der feindseligen Welt der sogenannten freien Menschen fühlt er sich so unglücklich, dass man sich fragen kann, ob er nicht ganz absichtlich darauf hingearbeitet hat, wieder in die Einsamkeit und Sicherheit des Gefängnisses zurückzukommen; zumindest ist er ganz sicherlich dem Gedanken an eine neue Inhaftierung nicht sehr abgeneigt, ist er doch so unvorsichtig, ‹Justine› in Umlauf zu bringen, und so unklug, ‹Zoloé› zu veröffentlichen, ein Buch, in dem er Joséphine, Mme Tallien, M. Tallien, Barras und Bonaparte angreift. Ob er sich nun diesen Wunsch eingesteht oder ihn bloß insgeheim hegt, auf jeden Fall wird er erfüllt: Am 5. April 1801 finden wir ihn in Sainte-Pélagie eingesperrt; später wird er nach Charenton überführt, wohin ihm Mme Quesnet folgt, die sich als seine Tochter ausgibt und ein Zimmer in der Nähe des seinen erhält, und dort beendet er seine Tage.
Wohlgemerkt, sobald Sade wieder eingesperrt ist, regt er sich auf und erhebt jahrelang wütende Proteste; aber zumindest kann er sich von neuem ohne Sorgen der Leidenschaft hingeben, die bei ihm den Sinnengenuss ersetzt hat: dem Schreiben. Damit hat er niemals aufgehört. Als er aus der Bastille entlassen wurde, ging der größte Teil seiner Aufzeichnungen verloren. Er glaubt, dass auch das Manuskript der ‹Hundertzwanzig Tage von Sodom› vernichtet worden sei, eine zwölf Meter lange Papierrolle, die er sorgfältig verborgen hatte, doch diese wurde ohne sein Wissen gerettet. Nach der 1795 geschriebenen ‹Philosophie im Boudoir› verfasst er eine neue «Summa»: eine vollkommen ausgearbeitete, abgeänderte Fassung der ‹Justine›, 1797 gefolgt von ‹Juliette›, deren Autorschaft er jedoch ableugnet; ‹Die Verbrechen der Liebe› hingegen erscheinen unverhohlen unter seinem Namen. In Sainte-Pélagie beschäftigt er sich intensiv mit einem gewaltigen zehnbändigen Werk: ‹Die Tage Florabelles oder Die enthüllte Natur›, und auch die beiden Bände ‹La Marquise de Ganges› sind ihm zuzuschreiben, obwohl sie nicht unter seinem Namen erschienen sind.
Die Tatsache, dass Sade von nun an in der schriftstellerischen Arbeit den Sinn seines Lebens sieht, ist zweifellos die Ursache seines Wunsches, ein friedliches Alltagsleben zu führen. Er geht mit Sensible im Garten der Irrenanstalt spazieren, schreibt und lässt für die Kranken Komödien aufführen; er übernimmt es, ein Stegreifstück zu verfassen, das anlässlich des Besuchs des Erzbischofs von Paris aufgeführt wird. An Ostern reicht er das geweihte Brot und sammelt in der Pfarrkirche Almosen. Wohl beweist sein Testament, dass er seinen Überzeugungen niemals abgeschworen hat, aber er war des Kampfes müde. «Er war höflich bis zur Unterwürfigkeit», schreibt Nodier, «so liebenswürdig, dass es schon salbungsvoll wirkte, und sprach achtungsvoll von allem, was Achtung genießt.» Ange Pitou berichtet, dass ihm der Gedanke an das Alter und den Tod Entsetzen einflößte. «Dieser Mann erbleichte beim Gedanken an den Tod und fiel beim Anblick seiner weißen Haare in Ohnmacht.» Und doch starb er ruhig; am 2. Dezember 1814 raffte ihn «eine Lungenkongestion in Form von Asthma» dahin.
Das Auffallendste an der schmerzlichen Erfahrung, die sein Leben darstellte, ist die Tatsache, dass sie ihm keinerlei Solidarität zwischen seinen Mitmenschen und ihm zeigte. Keine gemeinsame Unternehmung band die letzten Nachkommen eines dekadenten Adels aneinander. Die Einsamkeit, zu der Sade durch seine Geburt verurteilt war, erfüllte er mit derart extremen erotischen Spielereien, dass sich die Angehörigen seines Standes gegen ihn wandten; als eine neue Welt auftauchte, schleppte er bereits eine allzu schwere Vergangenheit mit sich: Von seiner Umwelt verdächtigt, mit sich selbst im Zwiespalt, war es diesem von despotischen Träumen geplagten Aristokraten unmöglich, sich ehrlichen Sinnes dem aufsteigenden Bürgertum anzuschließen. Zwar entrüstete er sich über das Bürgertum, von dem das Volk unterdrückt wurde, aber auch dieses Volk blieb ihm fremd: Er gehörte keiner der Klassen an, deren Gegensätzlichkeit er anprangert; er hat nicht seinesgleichen. Vielleicht hätte er gegen dieses Schicksal ankämpfen können, wenn sein Gemüt anders gebildet worden wäre, aber zeitlebens erscheint er als rasender Egozentriker. Seine Gleichgültigkeit gegenüber äußeren Ereignissen, seine wahnartigen Geldsorgen, die manische Sorgfalt, mit der er sich seinen Ausschweifungen widmet, die in Vincennes einsetzende delirierende Deutungssucht und die schizophrenen Züge seiner Träume beweisen, dass er ein vollkommen introvertierter Mensch war. Diese leidenschaftliche Übereinstimmung mit sich selbst hat ihm einerseits seine Grenzen gesetzt, aber andererseits seinem Leben jenen beispielhaften Charakter verliehen, der die Ursache ist, warum wir uns heute mit ihm befassen.
Sade hat seine Erotik zum Sinn und Ausdruck seines ganzen Daseins gemacht: Es ist also keine müßige Neugierde, wenn wir versuchen wollen, das Wesen dieser Erotik zu bestimmen. Wenn man sich wie Maurice Heine auf die Aussage beschränken würde, dass Sade alles versucht, alles geliebt habe, würde man das Problem aufheben, ohne seiner Lösung um einen Schritt nähergekommen zu sein. Auch der Ausdruck «Algolagnie» bringt uns dem Verständnis Sades kaum näher; zwar besaß Sade offenbar eine ausgeprägte sexuelle Eigenart, aber diese genau zu bestimmen, ist nicht einfach. Seine Helfershelfer und seine Opfer haben geschwiegen, und nur zwei aufsehenerregende Skandale haben für kurze Zeit den Vorhang gehoben, hinter dem sich die Ausschweifung zu verbergen pflegt. Seine Tagebücher und Lebenserinnerungen sind verlorengegangen, in seinen Briefen hat er sich vorsichtig zurückgehalten, und in seinen Büchern hat er mehr über sich erfunden als von sich enthüllt. «Ich habe mir alles ausgedacht, was sich in dieser Richtung ausdenken lässt, aber ich habe sicherlich nicht alles getan, was ich ausgedacht habe, und ich werde es bestimmt auch niemals tun», schreibt er. Nicht ohne Grund hat man seine Schriften mit der ‹Psychopathologia Sexualis› Krafft-Ebbings verglichen, und bei diesem käme wohl niemand auf den Gedanken, ihm alle sexuellen Perversionen zuzuschreiben, die er aufgezeichnet hat. In ähnlicher Weise hat Sade nach den Regeln einer Art Kombinatorik ein Repertoire der sexuellen Möglichkeiten des Menschen zusammengestellt: Ganz sicherlich hat er sie nicht alle selbst ausprobiert oder auch nur für seinen eigenen Leib erträumt. Darauf weist die Tatsache hin, dass er nicht nur zu viel davon erzählt, sondern meist auch ausgesprochen schlecht erzählt. Seine Schilderungen gleichen den Stichen, mit denen ‹Justine› und ‹Juliette› in den Ausgaben von 1797 illustriert sind: Die Anatomie und die Positionen sind mit allen Details sehr realistisch dargestellt, aber die langweilige, unpassende Ruhe der Gesichter macht die schrecklichen Bacchanalien ganz und gar unglaubhaft. Es fällt schwer, in den von Sade zusammengestellten nüchternen Orgien ein lebendiges Geständnis zu entdecken. Dennoch gibt es in seinen Romanen Situationen, die er mit besonderem Wohlgefallen schildert, und für manche seiner Helden bezeugt er eine besondere Sympathie: Noirceuil, Blangis, Gernande und vor allem Dolmancé hat er viel von seinen Neigungen und Gedanken verliehen. Manchmal taucht auch, in einem Brief, in einem Nebensatz, in einem Dialog verborgen, überraschend ein lebensvoller Gedanke auf, der einen tieferen Einblick vermittelt. Diese Szenen, diese Helden, diese privilegierten Textstellen muss man befragen.
Gewöhnlich versteht man unter Sadismus Grausamkeit. Auspeitschungen, Gemetzel, Folterungen, Morde, die in Sades Schriften als Erstes ins Auge springen, scheinen zu bestätigen, was die Tradition mit seinem Namen in Verbindung gebracht hat. Die Episode mit Rose Keller zeigt ihn, wie er sein Opfer mit einer Gerte und einem verknoteten Seil auspeitscht, ihm sicherlich[4] auch mit einem Messer die Haut aufritzt und Wachs in die Wunden gießt; in Marseille zieht er eine aus Pergament geflochtene und mit krummen Nadeln versehene Peitsche aus der Tasche und lässt sich Ruten aus Heidekraut bringen. Sein ganzes Verhalten seiner Frau gegenüber bezeugt eine offensichtliche seelische Grausamkeit. Ausführlich hat er über die Lust geschrieben, die das Zufügen von Schmerzen bereitet; seine Ausführungen sind allerdings wenig aufschlussreich, da er sich damit begnügt, die klassische Lehre vom animalischen Nervenleben neu vorzubringen: «Es handelt sich lediglich darum, die Masse unserer Nerven durch einen möglichst heftigen Schock zu erschüttern; da nicht zu bezweifeln ist, dass der Schmerz weit intensiver wirkt als die Lust, sind die Schocks, die sich ergeben, wenn man anderen diese Empfindung zufügt, dementsprechend weit stärker.» Das Geheimnis, wie die Heftigkeit eines solchen Schocks als Wollust bewusst wird, lüftet Sade nicht. Glücklicherweise finden sich an anderen Stellen aufrichtigere Erklärungen. Die grundlegende Einsicht, auf der Sade seine ganze Sexualität und dementsprechend seine ganze Ethik aufbaute, ist die Erkenntnis, dass der Koitus und die Grausamkeit im Grunde identisch sind. «Wäre wohl der Höhepunkt der Wollust eine Art Raserei, wenn es nicht in der Absicht dieser Mutter des Menschengeschlechts (der Natur) gelegen hätte, dass die Ausübung des Koitus gleich sein sollte der der Wut? Welcher kraftvolle Mann … wünscht nicht … das Opfer seines Genusses zu quälen?» In der Beschreibung, die Sade vom Herzog von Blangis auf dem Höhepunkt der Lust gibt, muss man sicherlich eine Übertragung der sexuellen Gewohnheiten des Autors in die Welt der Dichtung sehen: «Schreckliche Schreie, lästerliche Flüche entflohen seiner geschwellten Brust, Flammen schienen ihm aus den Augen zu lodern, er schäumte und wieherte …» und ging sogar so weit, sein Opfer zu würgen. Nach der Aussage von Rose Keller hat auch Sade «sehr schrille und sehr entsetzliche Schreie ausgestoßen», ehe er die Fesseln seines Opfers durchschnitt. Der Brief «Vanille und Manille» beweist, dass er den Orgasmus wie einen epileptischen Anfall erlebte, aggressiv und mörderisch wie die Raserei eines Wutanfalls.
Wie erklärt sich diese eigenartige Heftigkeit? Man hat sich gefragt, ob Sade nicht unter sexueller Schwäche litt; viele seiner Helden – unter anderen der ihm teure Gernande – sind nicht sehr potent, haben große Schwierigkeiten, zur Erektion und Ejakulation zu gelangen. Sicherlich hat auch Sade diese Nöte gekannt, aber bei ihm scheinen sie eine Folge übermäßiger Ausschweifungen gewesen zu sein, was auch bei zahlreichen von ihm geschilderten Wüstlingen der Fall ist. Übrigens ist eine ganze Reihe dieser Helden mit enormen sexuellen Kräften begabt, und Sade spielt oft auf die Stärke seiner eigenen Sexualität an. Ich glaube jedoch, dass der Schlüssel zu seiner Erotik vielmehr in der Verbindung von heftiger sexueller Triebhaftigkeit mit einem vollkommenen «Isolationismus» des Gefühls zu suchen ist.
Von seiner Jünglingszeit bis zur Einkerkerung hat Sade seine sexuelle Triebhaftigkeit sicherlich als drängendes, ja manisches Begehren erfahren. Eine andere Erfahrung hingegen scheint ihm völlig unbekannt geblieben zu sein: das Erlebnis echter Erschütterung. Nie erscheint in seinen Romanen die Wollust als Selbstvergessenheit, Ohnmacht, Hingabe; man vergleiche nur etwa die Ergüsse eines Rousseau mit den frenetischen Lästerungen eines Noirceuil oder Dolmancé oder die Erregungen der Superiorin in Diderots ‹Nonne› mit den grobschlächtigen Vergnügungen von Sades Lesbierinnen. Beim Helden Sades wird die männliche Aggressivität nicht durch die im Geschlechtsakt übliche Umwandlung des Leibes in reine Fleischlichkeit gemildert; nicht für einen Augenblick verliert er sich in seiner Animalität: Sein Denken bleibt so klar, sein Verstand so rege, dass selbst philosophische Gespräche seine Lust nicht stören, sondern seine Erregung noch steigern können. Man versteht, dass in einem derart kalten, angespannten, sich gegen jedes Mitgerissenwerden anstemmenden Körper Begierde und Lust in einer Art von wütender Krise zum Ausbruch kommen: Sie führen nicht zu einem Erleben der leibseelischen Einheit des Subjekts, sondern zerschmettern den Leib, einem organischen Zusammenbruch vergleichbar. Infolge dieser Maßlosigkeit erzeugt der Geschlechtsakt die Illusion eines höchsten Genusses, der in Sades Augen seinen einzigartigen Wert darstellt, aber es fehlt ihm eine wesentliche Dimension, für die Sade mit allen Kräften einen Ausgleich zu schaffen suchte. Durch die Erschütterung wird das Dasein in sich und im anderen gleichzeitig als Subjektivität und als Objektivität erfasst; in dieser mehrschichtigen Einheit verschmelzen die beiden Partner, jeder wird von seiner eigenen Gegenwart befreit und gelangt zu einer unmittelbaren Kommunikation mit dem anderen. Der auf Sade lastende Fluch, der sich nur aus seiner Kindheit erklären lassen könnte, ist diese ausschließliche Ichbezogenheit, die es ihm unmöglich macht, sich je zu vergessen und sich der Gegenwart anderer wirklich bewusst zu werden. Wenn er kalt veranlagt gewesen wäre, hätte sich daraus keinerlei Problem ergeben; aber er war von Trieben bestimmt, die ihn zwangsläufig zu jenen fremden Objekten hinführten, mit denen sich zu vereinen er unfähig war. Um ihrer habhaft zu werden, musste er ganz besondere Methoden erfinden. Auch später noch, als seine Begierden erloschen sind, lebt er weiterhin in dieser erotischen Welt, die er aus Sinnlichkeit, Langeweile, Trotz und Groll zur einzigen Welt gemacht hat, die in seinen Augen Wert besitzt; jetzt verfolgt er mit seinen Machenschaften das Ziel, zu Erektion und Orgasmus zu gelangen. Aber sogar zu einer Zeit, da er beides ohne Schwierigkeit zu erreichen vermochte, waren für Sade Umwege nötig, damit seine Sexualität jene Bedeutung erhielt, die sich in ihr abzeichnete, ohne je ganz verwirklicht zu werden: Er wollte seinen Geist in sein Fleisch ausbrechen lassen, wollte den anderen durch das Fleisch als Bewusstsein erfassen.
Gewöhnlich erfasst jeder Mensch seine eigene Fleischlichkeit im Taumel, in dem er den anderen fleischlich erlebt. Wer sich in die Einsamkeit seines Bewusstseins einschließt, dem wird diese Erschütterung nicht zuteil, und nur in der Vorstellung vermag er dem anderen zu begegnen. Gierig belauert ein verstandesbestimmter, kalter Liebhaber den Genuss der Geliebten und muss sich als Urheber dieses Genusses bestätigen, denn für ihn gibt es keine andere Möglichkeit, selbst zu Fleisch zu werden: Dieses Verhalten, das die menschliche Vereinzelung durch eine bewusste Tyrannei aufzuheben trachtet, kann man als sadistisch bezeichnen. Sade weiß, dass es ein aggressiver Akt sein kann, im anderen Lust zu erzeugen, und manchmal hat seine Herrschsucht diese Gestalt angenommen; aber sie vermag ihn nicht zu befriedigen. Zunächst einmal lehnt er jene Gleichheit ab, die durch gemeinsame Wollust geschaffen wird: «Wenn die uns zu Diensten stehenden Objekte genießen, sind sie von da an viel häufiger mit sich selbst als mit uns beschäftigt, und infolgedessen ist unser Genuss getrübt. Die Vorstellung, einen anderen wie man selbst genießen zu sehen, führt zu einer Art von Gleichheit, die den unaussprechlichen Reizen, die der Despotismus verschafft, Abbruch tut.» Noch deutlicher sagt er: «Jeder geteilte Genuss ist geminderter Genuss.» Zudem sind lustvolle Empfindungen für seinen Geschmack allzu mild: Am dramatischsten enthüllt sich das Fleisch als Fleisch, wenn es geschunden, gequält wird. «Es gibt keine Empfindung, die kräftiger wäre und tiefer ginge als der Schmerz: Er beeindruckt nachhaltig.» Damit aber durch die zugefügten Qualen auch ich zu Fleisch und Blut werde, muss ich in der Passivität des anderen meine eigene Lage erkennen, muss also erkennen, dass in ihm eine Freiheit und ein Bewusstsein vorhanden sind. Der Libertin «wäre zu beklagen, wenn er auf ein lebloses Objekt einwirkte, das nichts empfindet». Deshalb braucht der Henker zu seinem Glück die Windungen und Klagen des Opfers, was Verneuil veranlasste, seiner Frau, wenn er sie quälte, eine Haube aufzusetzen, die ihre Schreie verstärkte. Indem sich das geschundene Objekt auflehnt, bestätigt es sich als meinesgleichen, und damit gelange ich durch seine Vermittlung zu jener Verschmelzung von Geist und Fleisch, die mir zuerst unmöglich gewesen war.
Wenn das Ziel verfolgt wird, gleichzeitig sich selbst zu entfliehen und die Realität der Fremdexistenz zu entdecken, steht noch ein anderer Weg offen: Man muss sich durch andere quälen lassen. Das weiß natürlich auch Sade; in Marseille dienen seine Peitschen und Ruten nicht nur der Auspeitschung seiner Opfer, sondern er lässt sich damit auch selbst peitschen. Sicherlich war das bei ihm etwas durchaus Übliches; alle die Helden in seinen Schriften lassen sich mit Freuden auspeitschen: «Heute weiß jedermann, dass die Auspeitschung äußerst wirkungsvoll ist, um die durch übermäßigen Sinnengenuss erloschene Kraft der Lenden neu zu wecken.» Noch eine andere Möglichkeit gibt es, seine Passivität zu verwirklichen: In Marseille veranlasst Sade seinen Diener Latour zu homosexuellen Handlungen an sich; Latour scheint es durchaus gewöhnt gewesen zu sein, ihm diesen Dienst zu erweisen. Sades Helden eifern ihm hierin unermüdlich nach, und er erklärt ganz eindeutig, dass der Gipfel der Wollust durch Verbindung von aktiven und passiven homosexuellen Handlungen erreicht werde. Von keiner anderen Perversion spricht er so häufig und mit solchem Wohlgefallen, ja sogar mit leidenschaftlicher Begeisterung.
Wer die Menschen nach starren Schablonen einzuordnen liebt, wird sich alsbald zwei Fragen stellen: War Sade homosexuell? War er letzten Endes Masochist? Was die Homosexualität angeht, so beweisen die von seinen Dienern gespielte Rolle, die Anwesenheit des hübschen ungebildeten Sekretärs im Schloss La Coste, die große Bedeutung, die Sade in seinen Schriften diesem «Einfall» zumisst, und die Heftigkeit seiner Verteidigungen, dass sie tatsächlich einer der wesentlichsten physischen Aspekte seiner Sexualität war. Sicherlich haben auch die Frauen in seinem Leben wie in seinen Schriften eine große Rolle gespielt: Er hat zu vielen Frauen Beziehungen gehabt, hat die Beauvoisin und andere, weniger bedeutende Mätressen unterhalten, seine Schwägerin verführt, in seinem Schloss junge Frauen und Freudenmädchen in Dienst genommen, mit Mlle Rousset geflirtet und seine letzten Lebensjahre in der Nähe von Mme Quesnet verbracht, ohne von seinem Verhältnis zu seiner Frau zu sprechen, ein Verhältnis, das ihm von der Gesellschaft aufgezwungen worden war, das er jedoch nach seiner Eigenart neu gestaltete. Aber in welcher Beziehung stand er zu allen diesen Frauen? Es ist bemerkenswert, dass aus den beiden einzigen Zeugnissen über seine sexuelle Aktivität nicht zu ersehen ist, ob Sade seine Geschlechtspartner auf «normale» Weise «erkannt» hat: Im Falle von Rose Keller kommt er, ohne sie zu berühren, allein dadurch zum Orgasmus, dass er sie auspeitscht; dem Mädchen in Marseille macht er den Vorschlag, sie solle sich «von hinten erkennen lassen», und zwar durch seinen Diener Latour oder allenfalls auch durch ihn, Sade, selbst; als sie sich weigert, begnügt er sich mit einigen Berührungen, während er sich von Latour von hinten «erkennen» lässt. Seine Helden machen sich ein Vergnügen daraus, junge Mädchen zu entjungfern – diese mit Blut und Entweihung verbundene Gewalttätigkeit reizt Sades Phantasie –, aber sogar in diesem Fall ziehen sie es oft vor, die Jungfrau als Knaben zu behandeln. Mehrere der Gestalten in Sades Romanen hegen für das «Vordere» der Frauen tiefen Abscheu; andere äußern sich nicht so entschieden, aber ihre Vorliebe ist deutlich zu erkennen. Niemals hat Sade jenen Teil des weiblichen Körpers gerühmt, der in ‹Tausendundeiner Nacht› so fröhlich gefeiert wird. Für die armseligen «Weichlinge», die ihre Frauen auf die gewöhnliche Weise besitzen, hat er nur Verachtung übrig. Zwar hat er mit Mme de Sade Kinder gezeugt, aber man hat ja gesehen, unter welchen Umständen dies geschah, und in Anbetracht der merkwürdigen Ausschweifungen, denen man sich in La Coste hingab, steht keineswegs fest, dass er Nanon geschwängert hat. Natürlich darf man nicht glauben, dass Sade alle Praktiken und Auffassungen vertreten hat, die er in seinen Romanen den eindeutigen Päderasten in den Mund legt, aber das, was er in den ‹Hundertzwanzig Tagen von Sodom› den Bischof äußern lässt, steht seinen eigenen Ansichten doch so nahe, dass man darin durchaus ein Geständnis sehen darf. Für die Lust, so sagt er, «taugt der Knabe mehr als das Mädchen; betrachten Sie das einmal vom Standpunkt des Bösen aus, das fast immer der eigentliche Reiz der Sinnenlust ist: Mit einem ganz und gar der eigenen Spezies angehörigen Wesen erscheint einem das Verbrechen stets größer als mit einem Wesen, das anders ist, und in diesem Augenblick ist die Wollust verdoppelt». Wohl hat Sade an seine Frau geschrieben, seine einzige Verfehlung habe darin bestanden, dass er «die Frauen zu sehr geliebt» habe; hier handelt es sich aber um einen offiziellen, heuchlerischen Brief. Dass er in seinen Romanen den Frauen Hauptrollen gegeben hat, beruht auf einer dem Roman innewohnenden Dialektik: Bei ihnen bildet die Verworfenheit einen ergreifenden Gegensatz zu der ihrem Geschlecht traditionell eigenen Sanftmut; wenn sie durch das Verbrechen ihre natürliche Niedrigkeit überwinden, zeigen sie deutlicher als jeder Mann, dass der Aufschwung eines kühnen Herzens durch keine Situation gehemmt zu werden vermag. Sie geben in seiner Phantasie deshalb die großartigsten Henker ab, weil sie in Wirklichkeit die geborenen Opfer sind: passiv, servil, zu Tränen neigend, verführt und betrogen. Dass Sade die Frauen verachtet hat, ihnen gegenüber Ekel empfand, spricht aus allen seinen Schriften. Hat er in ihnen vielleicht seine Mutter verachtet? Man kann sich auch fragen, ob Sade das weibliche Geschlecht vielleicht deshalb hasste, weil er in der Frau nicht seine Ergänzung, sondern sein Double sah und nichts von ihr erhalten konnte: Seine großen Schurkinnen sind lebendiger, wärmer als seine Helden, nicht nur aus rein ästhetischen Gründen, sondern weil sie ihm innerlich näherstehen. Man hat behauptet, er habe sich in der weinerlichen Justine dargestellt; ich glaube jedoch, dass ihm Juliette viel ähnlicher ist, die die gleiche Behandlung erfährt wie ihre Schwester, sie aber stolz und lustvoll annimmt. Sade fühlt sich als Frau und wendet sich gegen die Frauen, weil sie nicht das von ihm ersehnte Maskuline sind: Die außergewöhnlichste aller seiner Frauengestalten, die Durand, versieht er in seiner Phantasie mit einem riesigen Kitzler, der es ihr ermöglicht, sich geschlechtlich wie ein Mann zu verhalten.
Es ist unmöglich, genau festzustellen, wieweit die Frauen für Sade mehr waren als ein Ersatz und ein Spielzeug; fest steht immerhin, dass seine Sexualität anal organisiert war. Bestätigt wird dies durch seine Liebe zum Geld; Erbschleichereien haben in seinem Leben eine sehr große Rolle gespielt, der Diebstahl ist in seinen Schriften eng mit der Sexualität verknüpft, sodass schon die Erinnerung an einen begangenen Diebstahl ausreicht, um einen Orgasmus auszulösen. Aber selbst wenn man die Freud’sche Deutung der Geldgier ablehnt, gibt es dennoch einen eindeutigen Beweis für seine anale Sexualorganisation, eine Tatsache, die Sade selbst ganz offen eingestanden hat: seine Koprophilie. In Marseille gibt er einem Mädchen Zuckerwerk mit dem Hinweis, dass «das sie veranlassen wird, Wind zu machen», und er zeigt sich enttäuscht, als es nicht die gewünschte Wirkung hat. Bezeichnenderweise sind die beiden «Einfälle», die zu erklären er die meisten Anstrengungen gemacht hat, Grausamkeit und Koprophilie. Inwieweit hat er beides praktiziert? Ganz sicher war ein großer Unterschied zwischen den Ausschweifungen Sades in Marseille und den Exkrement-Orgien in den ‹Hundert zwanzig Tagen von Sodom›; aber die Bedeutung, die er ihnen beimisst, die Sorgfalt, mit der er die Riten dieser Orgien und vor allem die Vorbereitungen beschreibt, beweisen, dass es sich hier nicht um nüchterne, theoretische Erfindungen handelt, sondern um gefühlsbetonte Phantasien. Andererseits lässt sich der außergewöhnliche Heißhunger Sades in der Gefangenschaft nicht ausschließlich durch seine erzwungene Untätigkeit erklären: Essen kann nur dann ein Ersatz für erotische Betätigung sein, wenn auf infantile Weise die Magen-Darm-Funktionen und die sexuellen Funktionen gleichgesetzt werden; so hat es sich sicherlich bei Sade verhalten. Für ihn besteht eine enge Verbindung zwischen der Schlemmerei und der sexuellen Ausschweifung. «Keine Leidenschaft passt besser zur Wollust als Trunkenheit und Fresslust», stellt er fest, und diese Vermischung führt schließlich zu anthropophagischen Wunschvorstellungen: Das Trinken von Blut, das Verschlucken von Samen und Exkrementen, das Verspeisen von Kindern bedeutet, das Verlangen nach vollkommener Zerstörung seines Objektes zu befriedigen. Im Genuss gibt es keine Wechselseitigkeit, kein Schenken, keine unbegründete Freigebigkeit; der Genießende ist ebenso despotisch wie der Geizige, der das, was er nicht aufnehmen kann, lieber vernichtet, als es einem anderen zukommen zu lassen.