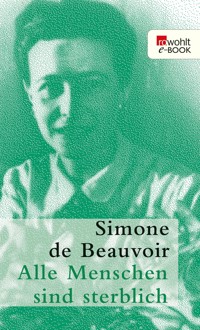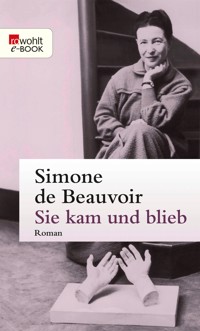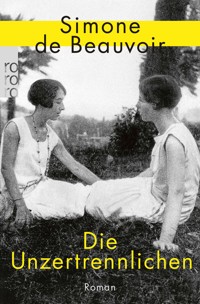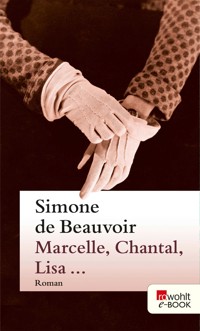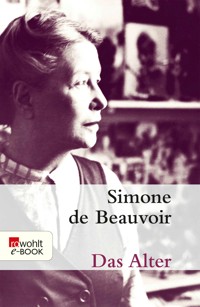
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Simone de Beauvoirs Buch über das Alter ragt durch die einzigartige Fülle des ausgebreiteten Materials wie durch die Vielfalt neuer Einsichten und Perspektiven unter allen wissenschaftlichen und philosophischen Abhandlungen dieses Themas heraus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1190
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Simone de Beauvoir
Das Alter
Aus dem Französischen von Anjuta Aigner-Dünnwald und Ruth Henry
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Vorwort
Erster Teil: Von außen betrachtet
1 . Alter und Biologie
2 . Die Gegebenheiten der Ethnologie
3 . Das Alter in den historischen Gesellschaften
4 . Das Alter in der heutigen Gesellschaft
Zweiter Teil: Das In-der-Welt-Sein
5 . Entdeckung und Bewältigung des Alters. Die körperlich erlebte Erfahrung
6 . Zeit – Aktivität – Geschichte
7 . Alter und Alltag
8 . Einige Beispiele
Schlussfolgerung
Anhang
I Die Hundertjährigen
II Robert E. Burger: Wer kümmert sich um die Alten?
III Die Lebensbedingungen der alten Arbeiter in den sozialistischen Ländern
IV Einige statistische Angaben über die Sexualität alter Menschen
Namenregister
Sachregister
Einführung
Zu der Zeit, da Buddha noch als Prinz Siddharta von seinem Vater in einem herrlichen Palast festgehalten wurde, entwischte er manchmal und fuhr im Wagen in der Umgebung spazieren. Bei seinem ersten Ausflug begegnete ihm ein gebrechlicher Mann, zahnlos, voller Falten, weißhaarig, gebeugt, auf einen Stock gestützt, zittrig und brabbelnd. Er staunte, und der Kutscher erklärte ihm, was ein Greis ist. «Was für ein Unglück», rief der Prinz aus, «dass die schwachen und unwissenden Menschen, berauscht vom Stolz der Jugend, das Alter nicht sehen. Lass uns schnell wieder nach Hause fahren. Wozu all die Spiele und Freuden, da ich doch die Wohnstatt des künftigen Alters bin.»
Buddha erkannte in einem Greis sein eigenes Schicksal, weil er, geboren, um die Menschen zu retten, ihr Los uneingeschränkt auf sich nehmen wollte. Darin unterschied er sich von ihnen: Die Menschen verdrängen, was ihnen missfällt. Und besonders das Alter. Amerika hat das Wort Tote aus seinem Vokabular gestrichen: Man spricht von lieben Dahingegangenen; ebenso vermeidet man jeden Hinweis auf hohes Alter. Auch im heutigen Frankreich ist dieses Thema geächtet. Als ich am Schluss meines Buches Der Lauf der Dinge gegen dieses Tabu verstieß, welch ein Zetergeschrei löste ich da aus! Zuzugeben, dass ich an der Schwelle des Alters stand, hieß, dass es allen Frauen auflauerte, dass es viele schon ereilt hatte. Freundlich oder erbost sagten mir viele Leute, vor allem ältere, bis zum Überdruss, es gäbe kein Alter. Es gäbe lediglich mehr oder weniger junge Leute, das sei alles. Für die Gesellschaft ist das Alter eine Art Geheimnis, dessen man sich schämt und über das zu sprechen sich nicht schickt. Über die Frau, das Kind, den Jugendlichen gibt es auf allen Gebieten eine reiche Literatur; doch Hinweise auf das Alter sind, außer in Spezialwerken, sehr selten. Der Verfasser eines Zeichentrickfilms musste eine ganze Serie noch einmal machen, weil unter seinen Personen ein Großelternpaar vorkam: «Streichen Sie die Alten!», befahl man ihm.1 Wenn ich sagte, dass ich an einem Essay über das Alter arbeite, riefen die meisten: «Was für eine Idee! … Aber Sie sind doch nicht alt! … So ein tristes Thema …»
Und das ist der Grund, weshalb ich dieses Buch schreibe: um die Verschwörung des Schweigens zu brechen. Die Konsumgesellschaft, so schreibt Marcuse, hat das unglückliche Bewusstsein durch ein glückliches Bewusstsein ersetzt und verwirft jedes Schuldgefühl. Sie muss aus ihrer Ruhe gerissen werden. Denn gegenüber den alten Menschen ist sie nicht nur schuldig, sondern kriminell. Verschanzt hinter den Mythen des Wirtschaftswachstums und des Überflusses, behandelt sie die Alten wie Parias. In Frankreich, das den höchsten Prozentsatz an Alten auf der Welt hat – 12% der Bevölkerung sind älter als 65 Jahre –, sind sie verurteilt zu Armut, Einsamkeit, Krankheit, Verzweiflung. In den USA ist ihr Los nicht besser. Um diese Barbarei mit der humanistischen Moral in Einklang zu bringen, die die herrschende Klasse im Munde führt, befleißigt sie sich der bequemen Haltung, die Alten nicht als Menschen anzusehen; wenn man ihre Stimme hörte, müsste man erkennen, dass es eine menschliche Stimme ist; ich werde meine Leser zwingen, sie zu hören. Ich werde beschreiben, in welcher Lage sie sich befinden und wie sie leben; ich werde sagen, was – entstellt von Lügen, Mythen, Klischees der bürgerlichen Kultur – wirklich in ihren Köpfen und Herzen vorgeht.
Übrigens verhält sich die Gesellschaft ihnen gegenüber sehr doppelzüngig. Im Allgemeinen sieht sie das Alter nicht als deutlich nach Jahren abgegrenzte Klasse. Die Pubertätskrise ermöglicht es, zwischen Jugendlichen und Erwachsenen eine Demarkationslinie zu ziehen, die nur in engen Grenzen willkürlich sein kann: Mit 18, mit 21 Jahren werden die Jungen in die Gesellschaft der Menschen aufgenommen. Fast immer begleiten ‹Übergangsriten› diesen Aufstieg. Hingegen ist der Zeitpunkt, wann das Alter beginnt, schlecht definiert, er wechselt je nach Zeit und Ort. Man findet nirgends ‹Übergangsriten›, die einen neuen Status herstellen. (Die Feste, die in einigen Gesellschaften anlässlich des 60. oder 80. Geburtstages gefeiert werden, haben nicht den Charakter einer Einweihung.) Im staatlichen Leben behält der Mensch bis an sein Ende die gleichen Rechte und Pflichten. Das Bürgerliche Gesetzbuch macht keinerlei Unterschied zwischen einem Hundertjährigen und einem Vierzigjährigen. Die Juristen gehen davon aus, dass die alten Menschen, abgesehen von pathologischen Fällen, strafrechtlich die gleiche Verantwortung tragen wie die jungen.2 Praktisch behandelt man sie nicht als eine eigene Kategorie, und im Übrigen würden sie es gar nicht wollen; es gibt Bücher, Veröffentlichungen, Filme, Fernseh- und Radiosendungen eigens für Kinder und Erwachsene: für Alte nicht.3 Auf allen diesen Gebieten setzt man sie den jüngeren Erwachsenen gleich. Urteilt man jedoch über ihren wirtschaftlichen Status, so scheint man anzunehmen, sie gehörten einer fremden Gattung an: Offenbar haben sie weder die gleichen Bedürfnisse noch die gleichen Gefühle wie die anderen Menschen, wenn es genügt, ihnen ein erbärmliches Almosen zu geben, um sich ihnen gegenüber quitt zu fühlen. Diese bequeme Selbsttäuschung sanktionieren die Wirtschaft und die Gesetzgebung, wenn sie darüber klagen, welche Last die Nicht-Aktiven für die Aktiven darstellen: Als ob diese nicht selber künftige Nicht-Aktive wären und als ob sie nicht ihre eigene Zukunft sicherten, indem sie die Sorge für die alten Menschen gesetzlich verankern. Die Gewerkschaften geben sich hier keinen Illusionen hin: Wenn sie ihre Forderungen erheben, weisen sie dem Problem der Altersversorgung stets breiten Raum zu.
Die Alten, die keinerlei wirtschaftliche Kraft darstellen, haben nicht die Mittel, ihre Rechte durchzusetzen: Das Interesse der Ausbeuter geht dahin, die Solidarität zwischen den Arbeitenden und den Unproduktiven zu brechen, sodass diese von niemand mehr vertreten werden. Die Mythen und Klischees, die das bürgerliche Denken in Umlauf setzt, zielen darauf ab, den Alten als einen anderen zu zeigen. «Aus Jugendlichen, die eine ausreichende Anzahl von Jahren überdauern, macht das Leben Greise», sagt Proust; sie behalten die Vorzüge und Fehler jenes Menschen, der sie ja weiterhin sind. Und das will die öffentliche Meinung nicht wahrhaben. Wenn die Alten die gleichen Wünsche, die gleichen Gefühle, die gleichen Rechtsforderungen wie in der Jugend bekunden, schockieren sie; bei ihnen wirken Liebe, Eifersucht widerwärtig oder lächerlich, Sexualität abstoßend, Gewalttätigkeit lachhaft. Sie müssen ein Beispiel für alle Tugenden geben. Vor allem fordert man von ihnen heitere Gelassenheit; man behauptet einfach, sie besäßen sie, was einem erlaubt, gleichgültig über ihr Unglück hinwegzusehen. Weichen sie von dem erhabenen Bild ab, das man ihnen aufnötigt, nämlich dem des Weisen mit einem Heiligenschein weißer Haare, reich an Erfahrung und verehrungswürdig, hoch über dem menschlichen Alltag stehend – so fallen sie tief darunter: Diesem Bild steht das des alten Narren gegenüber, der dummes Zeug faselt und den die Kinder verspotten. Auf jeden Fall stehen die Alten, sei es dank ihrer Tugend, sei es durch ihre Erniedrigung, außerhalb der Menschheit. Man kann ihnen also ohne Skrupel jenes Minimum verweigern, das man für ein menschenwürdiges Dasein als unerlässlich erachtet.
Wir gehen in dieser Verfemung so weit, dass wir sie sogar gegen uns selbst anwenden: Wir lehnen es ab, uns in dem Greis zu erkennen, der wir einmal sein werden: «Unter allen Realitäten ist es (das Alter) vielleicht diejenige, von der wir im Leben am längsten eine rein abstrakte Vorstellung bewahren», schrieb Proust ganz richtig. Alle Menschen sind sterblich: Daran denken sie. Viele von ihnen werden alt: Diese Veränderung zieht fast niemand im Voraus in Betracht. Nichts sollte erwartungsgemäßer eintreten, aber nichts kommt unvorhergesehener als das Alter. Wenn man die Jungen nach ihrer Zukunft fragt, dann lassen sie, vor allem die jungen Mädchen, ihr Leben spätestens mit 60 Jahren enden. Manche sagen: «Ich werde nicht so alt, ich sterbe vorher.» Und einige sogar: «Ich bringe mich vorher um.» Der Erwachsene verhält sich so, als ob er nie alt würde. Oft ist der Arbeitende verblüfft, wenn die Stunde der Pensionierung schlägt: Das Datum stand seit langem fest, er hätte sich darauf vorbereiten können. Doch in Wirklichkeit war ihm dieses Wissen bis zum letzten Augenblick fremd geblieben – es sei denn, das Thema ist ein ernstliches Politikum.
Zu gegebener Zeit, und schon wenn man sich ihm nähert, zieht man das Alter gewöhnlich dem Tod vor. Dennoch sehen wir diesen auf weite Sicht klarer vor uns. Der Tod ist eine unserer unmittelbaren Möglichkeiten, er bedroht uns in jedem Alter; gelegentlich streift er uns, oft haben wir Angst vor ihm. Dagegen wird man nicht von einem Augenblick zum anderen alt: Jung oder in der Blüte der Jahre, denken wir nicht wie Buddha daran, dass das künftige Alter schon in uns wohnt: Es ist durch eine so lange Zeitspanne von uns getrennt, dass es in unseren Augen mit der Ewigkeit verschmilzt; diese ferne Zukunft erscheint uns irreal. Und außerdem sind die Toten nichts; man mag einen metaphysischen Schauder vor diesem Nichts empfinden, aber in gewisser Weise beruhigt es, es stellt kein Problem dar. «Ich werde nicht mehr sein»: Ich bewahre meine Identität bei diesem Verschwinden. (Diese Identität ist jenen umso mehr garantiert, die eine unsterbliche Seele zu besitzen glauben.) Wenn ich mit 20, mit 40 Jahren an mein Alter denke, dann sehe ich mich als jemand anderen. In jeder Metamorphose liegt etwas Erschreckendes. Als Kind war ich bestürzt, ja sogar entsetzt, als mir klar wurde, dass ich mich eines Tages in einen Erwachsenen verwandeln würde. Aber der Wunsch, man selbst zu bleiben, wird in jungen Jahren im Allgemeinen kompensiert durch die erheblichen Vorteile, die das Erwachsensein mit sich bringt. Wohingegen das Alter wie ein Unglück erscheint: Selbst bei Leuten, die als «gesund und rüstig» gelten, springt der körperliche Verfall ins Auge. Denn beim Menschen sind die Veränderungen, die das Alter hervorruft, am auffallendsten. Tiere werden mager, schwach, aber sie machen keine Metamorphose durch. Wir hingegen schon. Es schnürt einem das Herz zusammen, wenn man neben einer schönen jungen Frau ihren Abglanz im Spiegel der Zukunft sieht: ihre Mutter. Die indischen Nambikwara, berichtet Lévi-Strauss, haben nur ein Wort, «um jung und schön» auszudrücken und auch nur eines für «alt und hässlich». Vor dem Bild, das die alten Leute uns von unserer eigenen Zukunft zeigen, stehen wir ungläubig; eine Stimme in uns flüstert uns widersinnigerweise zu, dass uns dies nicht widerfährt: Das sind nicht mehr wir, wenn es eintritt. Ehe es nicht über uns hereinbricht, ist das Alter etwas, das nur die anderen betrifft. So kann man auch verstehen, dass es der Gesellschaft gelingt, uns daran zu hindern, in den alten Menschen unseresgleichen zu sehen.
Hören wir auf, uns selbst zu belügen; der Sinn unseres Lebens ist in Frage gestellt durch die Zukunft, die uns erwartet; wir wissen nicht, wer wir sind, wenn wir nicht wissen, wer wir sein werden: Erkennen wir uns in diesem alten Mann, in jener alten Frau. Das ist unerlässlich, wenn wir unsere menschliche Situation als Ganzes akzeptieren wollen. Dann werden wir das Unglück des Alters nicht mehr gleichgültig hinnehmen, wir werden uns betroffen fühlen: Wir sind es. Eklatant liegt das System der Ausbeutung bloß, in dem wir leben. Der Greis, der unfähig ist, selbst für seine Bedürfnisse aufzukommen, stellt immer eine Bürde dar. Aber in Gesellschaften, in denen eine gewisse Gleichheit herrscht – in einer ländlichen Gemeinschaft, bei einigen primitiven Völkern –, weiß der reife Mensch, auch wenn er es nicht wahrhaben möchte, dass seine Stellung morgen jene sein wird, die er heute dem Alten zuweist. Das ist der Sinn des grimmschen Märchens, das in abgewandelter Form in fast allen Landstrichen vorkommt: Ein Bauer lässt seinen alten Vater abseits von der Familie aus einem kleinen Holznapf essen; er überrascht seinen Sohn, wie er Hölzchen zusammenträgt: «Das ist für dich, wenn du alt bist», sagt das Kind. Sofort hat der Großvater seinen Platz am gemeinsamen Tisch wieder. Die aktiven Mitglieder der Gemeinschaft erfinden Kompromisse zwischen ihrem langfristigen und ihrem unmittelbaren Interesse. So zwingt die Knappheit der Nahrung manche primitiven Völker, ihre alten Eltern zu töten, auch auf die Gefahr hin, später das gleiche Schicksal zu erleiden. In weniger extremen Fällen mildern Vorsorge und Kindesliebe den Egoismus. In der kapitalistischen Welt spielt das langfristige Interesse keine Rolle mehr: Die Privilegierten, die über das Schicksal der Masse entscheiden, fürchten nicht, es einmal teilen zu müssen. Was humanitäre Gefühle angeht, so treten sie, trotz scheinheiliger Lippenbekenntnisse, kaum noch auf. Die Wirtschaft beruht auf Profit, ihm ist praktisch die ganze Zivilisation untergeordnet: Für das Menschenmaterial interessiert man sich nur insofern, als es etwas einbringt. Danach wirft man es weg. «In einer sich wandelnden Welt, in der die Lebensdauer von Maschinen nur sehr kurz ist, dürfen die Menschen nicht allzu lange arbeiten. Alles, was 55 Jahre überschreitet, muss ausgeschaltet werden», sagte kürzlich Dr.Leach, Anthropologe aus Cambridge, auf einem Kongress.4
Das Wort ‹ausgeschaltet› macht deutlich, was das heißt. Man macht uns weis, der Ruhestand wäre die Zeit der Freiheit und Muße; Dichter priesen einst «die Wonnen des Hafens»5. Das sind schamlose Lügen. Die Gesellschaft zwingt der überwiegenden Mehrheit der Alten einen so erbärmlichen Lebensstandard auf, dass der Ausdruck «arm und alt» fast ein Pleonasmus ist; umgekehrt sind die meisten Bedürftigen Alte. Der Ruhestand eröffnet dem Pensionierten keine neuen Möglichkeiten; in dem Augenblick, da der Mensch endlich befreit ist von den Zwängen, nimmt man ihm die Mittel, seine Freiheit zu gebrauchen. Er ist dazu verurteilt, in Einsamkeit und Langeweile dahinzuvegetieren, ein purer Nichtsnutz. Dass ein Mensch während der letzten 15 oder 20 Jahre seines Lebens nur noch Ausschuss ist, offenbart das Scheitern unserer Zivilisation. Dieser Sachverhalt würde uns die Kehle zusammenschnüren, wenn wir die Alten als Menschen, die ein Leben als Mensch hinter sich haben, ansähen und nicht als wandelnde Leichname. Jene, die unser verstümmelndes System anprangern, müssten diesen Skandal aufdecken. Nur wenn man seine Anstrengungen auf das Schicksal der am meisten Benachteiligten konzentriert, vermag man eine Gesellschaft zu erschüttern. Gandhi hat die Stellung der Parias als Angriffspunkt genommen, um das Kastensystem zu zerschlagen; das kommunistische China hat die Frau emanzipiert, um die feudalistische Familienstruktur aufzubrechen. Die Forderung, dass Menschen im Alter Menschen bleiben müssen, würde eine radikale Umwälzung implizieren. Aber unmöglich ist dieses Ergebnis durch ein paar begrenzte Reformen zu erreichen, die das System unangetastet lassen: die Ausbeutung der Arbeiter, die Atomisierung der Gesellschaft, das Elend einer Kultur, die einem Mandarinat vorbehalten ist – das alles führt zu diesem entmenschlichten Alter. Und es zeigt, dass alles neu zu regeln ist, von Anfang an. Deshalb wird dieses Problem so beflissentlich mit Schweigen übergangen; deshalb ist es nötig, dieses Schweigen zu brechen: Ich bitte meine Leser, mir dabei zu helfen.
Vorwort
Bisher habe ich vom Alter gesprochen, als ob dieses Wort eine genau definierte Realität umfasste. In Wahrheit kann man es, wenn es um unsere Spezies geht, nicht leicht abgrenzen. Es ist ein biologisches Phänomen: Der Organismus des alten Menschen weist bestimmte Besonderheiten auf. Das Altwerden zieht psychologische Konsequenzen nach sich: Manche Verhaltensweisen werden zu Recht als charakteristisch für das hohe Alter angesehen. Wie alle menschlichen Situationen hat es eine existentielle Dimension: Es verändert die Beziehung des Einzelnen zur Zeit, also seine Beziehung zur Welt und zu seiner eigenen Geschichte. Andererseits lebt der Mensch niemals im Naturzustand; im Alter wird ihm, wie in jeder Lebensphase, sein Status von jener Gesellschaft aufgezwungen, zu der er gehört. Was das Problem kompliziert macht, ist die enge Wechselbeziehung dieser verschiedenen Gesichtspunkte. Wie wir heute wissen, ist es abstrakt, die physiologischen und die psychologischen Gegebenheiten getrennt zu betrachten: Sie bedingen sich gegenseitig. Wir werden sehen, dass diese Beziehung im Alter besonders deutlich zutage tritt: Sie ist das Gebiet der Psychosomatik schlechthin. Indessen lässt sich das, was man das psychische Leben eines Individuums nennt, nur im Licht seiner existentiellen Situation verstehen; diese hat also auch Auswirkungen auf den Organismus; und umgekehrt: Die Beziehung zur Zeit wird verschieden empfunden, je nachdem, ob der Körper mehr oder weniger verfallen ist.
Schließlich weist die Gesellschaft dem Greis seinen Platz und seine Rolle unter Berücksichtigung seiner individuellen Eigenarten zu; seiner körperlichen Behinderung, seiner Erfahrung; umgekehrt wird das Individuum geprägt von der praktischen und ideologischen Haltung der Gesellschaft ihm gegenüber. Es genügt also nicht, die verschiedenen Aspekte des Alters analytisch zu beschreiben: Jeder reagiert auf andere und wird von ihnen bestimmt; das Alter muss in der unbegrenzten Bewegung dieser Zirkularität erfasst werden.
Aus diesem Grund sollte eine Studie über das Alter versuchen, erschöpfend zu sein. Da mein Hauptziel darin besteht, aufzuzeigen, wie das Los der alten Leute heute in unserer Gesellschaft ist, wird der Leser sich vielleicht wundern, dass ich ihrer Stellung in so genannten primitiven Gemeinschaften wie auch innerhalb verschiedener Epochen der Menschheitsgeschichte so viele Seiten widme. Doch wenn das Alter als biologisches Schicksal eine transhistorische Realität ist, so gilt nicht weniger, dass dieses Schicksal je nach dem sozialen Zusammenhang verschieden erlebt wird; umgekehrt: Der Sinn oder Nicht-Sinn, den das Alter innerhalb einer Gesellschaft hat, stellt diese insgesamt in Frage, denn dadurch enthüllt sich der Sinn oder Nicht-Sinn des ganzen vorhergegangenen Lebens. Um das unsere zu beurteilen, müssen wir die Lösungen, die unsere Gesellschaft gewählt hat, jenen gegenüberstellen, für die sich andere Gemeinschaften an anderen Orten und zu anderen Zeiten entschieden haben. Dieser Vergleich ermöglicht uns, festzustellen, was an der Situation des alten Mannes unvermeidlich ist, in welchem Maß, zu welchem Preis man seine Schwierigkeiten beheben könnte und wie groß ihm gegenüber die Verantwortung des Systems ist, in dem wir leben.
Jede menschliche Situation kann von außen betrachtet werden – so wie sie sich anderen darstellt – und von innen her, so wie der Einzelne sie aufnimmt, indem er sie durchlebt. Für die anderen ist der alte Mensch Gegenstand eines Wissens; er selbst jedoch hat über seinen Zustand eine erlebte Erfahrung. Im ersten Teil dieses Buches werde ich den ersten Gesichtspunkt behandeln. Ich werde untersuchen, was die Biologie, die Anthropologie, die Geschichte, die heutige Soziologie uns über das Alter lehrt. Im zweiten Teil werde ich mich bemühen, zu beschreiben, auf welche Art und Weise der alte Mensch selbst seine Beziehung zu seinem Körper, zur Zeit (Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft), zu anderen sieht. Keine dieser beiden Untersuchungen ermöglicht uns, das Alter zu definieren; wir werden im Gegenteil feststellen, dass es eine Vielzahl von Gesichtern hat, die sich nicht aufeinander zurückführen lassen. In der Geschichte ebenso wie in der Gegenwart bedingt der Klassenkampf die Art, wie ein Mensch von seinem Alter befallen wird; ein Abgrund trennt den alten Sklaven vom alten Eupatriden, einen alten Arbeiter mit erbärmlicher Rente von einem Onassis. Die Verschiedenartigkeit der individuellen Altersformen hat noch andere Ursachen: Gesundheit, Familie usw. Aber es gibt zwei Kategorien von Alten – die eine außerordentlich groß, die andere auf eine kleine Minorität beschränkt –, die auf dem Gegensatz zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten beruhen. Jede Aussage, die behauptet, sich ganz allgemein auf das Alter zu beziehen, muss zurückgewiesen werden, weil sie dazu neigt, diese Kluft zu verschleiern.
Eine Frage erhebt sich gleich zu Anfang. Das Alter ist kein statisches Faktum; es ist Ende und Verlängerung eines Prozesses. Worin besteht er? Mit anderen Worten: Was ist altern? Dieser Gedanke ist mit dem der Veränderung verbunden. Aber das Leben des Embryos, des Neugeborenen, des Kindes ist eine fortgesetzte Veränderung. Muss man daraus schließen, wie manche es getan haben, dass unsere Existenz ein langsames Sterben ist? Sicher nicht. Ein solches Paradoxon verkennt die essentielle Wahrheit des Lebens; es ist ein labiles System, bei dem das Gleichgewicht in jedem Augenblick verloren geht und wieder gefunden wird: Nur Stillstand ist gleichbedeutend mit Tod. Das Gesetz des Lebens ist Veränderung. Und eine ganz bestimmte Art von Veränderung kennzeichnet das Altern: unumkehrbar und ungünstig, ein Verfall. Der amerikanische Gerontologe Lansing schlug folgende Definition vor: «Ein fortschreitender nachteiliger, gewöhnlich vom Ablauf der Zeit abhängiger Veränderungsprozess, der nach der Reife eintritt und stets zum Tode führt.»
Aber sogleich stoßen wir auf eine Schwierigkeit: Was bedeutet das Wort nachteilig? Es impliziert ein Werturteil. Fortschritt oder Rückschritt gibt es nur im Verhältnis zu einem angestrebten Ziel. Marielle Goitschel musste sich von dem Tag an, als sie weniger gut Ski lief als Jüngere, in sportlicher Hinsicht als alt betrachten. Die Rangordnung der Altersklassen wird in dem Unternehmen Leben festgelegt, und ihr Kriterium ist weitaus unbestimmter. Man müsste wissen, welches Ziel das menschliche Leben anstrebt, um entscheiden zu können, welche Veränderungen es davon entfernen oder ihm näher bringen.
Das Problem ist einfach, wenn man beim Menschen nur seinen Organismus betrachtet. Jeder Organismus zielt darauf ab, sich zu erhalten. Deshalb muss er sein Gleichgewicht jedes Mal, wenn es wankt, wiederherzustellen versuchen, muss sich gegen Aggressionen von außen verteidigen, auf der Welt den breitesten und festesten Stand suchen. Unter diesem Gesichtspunkt haben die Worte: vorteilhaft, gleichgültig, schädlich einen klaren Sinn. Von der Geburt bis zum Alter von 18 bis 20 Jahren strebt die Entwicklung des Organismus danach, seine Überlebenschancen zu erhöhen: Er stärkt sich, er wird widerstandsfähiger, seine Energiequellen wachsen, seine Möglichkeiten vermehren sich. Alle physischen Fähigkeiten des Menschen erreichen ihren höchsten Entwicklungspunkt um das 20. Lebensjahr. Während der ersten 20 Jahre ist die Mutation des Körpers, insgesamt gesehen, also vorteilhaft.
Gewisse Veränderungen ziehen weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung des organischen Lebens nach sich, sie sind unwesentlich: so die Rückbildung der Thymusdrüse, die in der frühen Kindheit eintritt; dann jene der Gehirnneuronen, deren Zahl um ein Vielfaches höher ist als der Bedarf des Menschen.
Nachteilige Veränderungen treten sehr bald ein. Die Weite der Akkomodationsspanne nimmt vom 10. Lebensjahr an ab. Die Obergrenze der hörbaren Laute sinkt bereits vor dem Jugendalter. Eine gewisse Form von Rohgedächtnis lässt vom 12. Lebensjahr an nach. Kinsey zufolge nimmt die sexuelle Potenz des Mannes nach dem 16. Lebensjahr ab. Diese sehr begrenzten Verluste verhindern nicht, dass die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen weiter einer aufsteigenden Linie folgt.
Nach dem 20. und vor allem nach dem 30. Lebensjahr beginnt eine Rückbildung der Organe. Muss man von diesem Augenblick an von Altern sprechen? Nein. Beim Menschen ist der Körper nicht nur reine Natur. Die Verluste, die Veränderungen, die Ausfälle können durch Montagen, Automatismen, ein praktisches und intellektuelles Wissen kompensiert werden. Solange die Mangelerscheinungen sporadisch bleiben und leicht behoben werden können, spricht man nicht von Altern. Erst wenn sie Bedeutung erlangen und irreparabel sind, wird der Körper gebrechlich und mehr oder weniger hinfällig: Dann kann man eindeutig sagen, dass er verfällt.
Das Problem wird sehr viel komplexer, wenn wir das Individuum als Ganzes betrachten. Man verfällt, nachdem man einen Höhepunkt erreicht hat: Wo ist dieser anzusetzen? Trotz ihrer gegenseitigen Abhängigkeit durchlaufen Physis und Geist keine streng parallele Entwicklung. Geistig kann ein Mensch erheblich verloren haben, ehe sein physischer Verfall beginnt; andererseits ist es auch möglich, dass er im Laufe dieses Verfalls intellektuell beträchtlich gewinnt. Welchem Vorgang messen wir höheren Wert bei? Jeder wird eine andere Antwort geben, je nachdem, ob er den körperlichen oder den geistigen Fähigkeiten oder einem glücklichen Gleichgewicht zwischen beiden größere Bedeutung beimisst. Nach solchen Gesichtspunkten stellen die Gesellschaften eine Rangordnung der Altersklassen auf: Doch es gibt keine, die allgemein anerkannt würde.
Das Kind ist dem Erwachsenen überlegen durch den Reichtum seiner Möglichkeiten, die Vielfalt der aufgenommenen Eindrücke, die Frische seiner Empfindungen: Genügt das, um zu behaupten, dass es mit zunehmendem Alter verfalle? Dies scheint bis zu einem gewissen Punkt Freuds Meinung gewesen zu sein: «Denken Sie an den traurigen Kontrast, der zwischen der strahlenden Intelligenz eines gesunden Kindes und der geistigen Schwäche eines durchschnittlichen Erwachsenen besteht», schrieb er. Diesen Gedanken hat auch Montherlant oft entwickelt: «Wenn das Genie der Kindheit erlischt, dann für alle Zeiten. Man sagt immer, aus der Raupe entschlüpfe der Schmetterling; beim Menschen ist es der Schmetterling, der zur Raupe wird», sagt Ferrante in Die tote Königin.
Beide hatten persönliche Gründe – sehr unterschiedlicher Natur –, die Kindheit aufzuwerten. Ihre Meinung wird nicht allgemein geteilt. Allein das Wort Reife zeigt schon, dass man dem fertigen Menschen Vorrang vor dem Kind und dem Jugendlichen gibt: Er hat Wissen, Erfahrung, Fähigkeiten erworben. Gelehrte, Philosophen, Schriftsteller setzen gewöhnlich den Höhepunkt des Menschen in der Mitte des Lebens an.1 Manche von ihnen halten das Alter sogar für die privilegierte Zeit des Daseins: Es bringt, so meinen sie, Erfahrung, Weisheit und Frieden. Das menschliche Leben kenne keinen Verfall.
Wenn man definieren will, was Fortschritt und was Rückschritt für den Menschen ist, so setzt das voraus, dass man sich auf ein bestimmtes Ziel bezieht; aber a priori, absolut ist keines gegeben. Jede Gesellschaft schafft ihre eigenen Werte: Nur im sozialen Kontext kann das Wort Verfall einen präzisen Sinn erhalten.
Diese Überlegungen bestätigen, was ich bereits anfangs sagte: Das Alter lässt sich nur in seiner Gesamtheit erfassen; es ist nicht nur eine biologische, sondern eine kulturelle Tatsache.
ERSTER TEIL
Von außen betrachtet
1. KAPITEL
Alter und Biologie
Wir haben gesehen: In biologischer Hinsicht hat der Begriff Verfall einen klaren Sinn. Der Organismus verfällt, wenn seine Lebenschancen sich verringern. Zu allen Zeiten waren sich die Menschen der Unvermeidlichkeit dieser Veränderung bewusst. Die Antwort hing jeweils von der Vorstellung ab, die sich die Medizin insgesamt vom Leben machte.
In Ägypten und bei allen alten Völkern verschmolz die Medizin mit der Magie. Im antiken Griechenland unterschied sie sich anfangs nicht von der religiösen Metaphysik oder der Philosophie. Erst mit Hippokrates gewann sie ihre Eigenständigkeit: Sie wurde eine Wissenschaft und eine Kunst; sie baute auf Erfahrung und Urteilskraft auf. Hippokrates übernahm seinerseits die pythagoreische Theorie der vier Körpersäfte: Blut, Schleim, Galle, schwarze Galle; die Krankheit beruht auf einer Störung ihres Gleichgewichts; das Alter ebenfalls. Er ließ es mit 56 Jahren beginnen. Er war der Erste, der die Etappen des menschlichen Lebens mit den vier Jahreszeiten der Natur verglich und das Alter mit dem Winter. In mehreren Büchern und vor allem in seinen Aphorismen vermittelte er exakte Beobachtungen über alte Menschen. (Sie brauchen weniger Nahrung als die Jungen. Sie leiden unter Atembeschwerden, Katarrhen mit Hustenanfällen, Harnzwang, Gliederschmerzen, Nierenkrankheiten, Ohnmachten, Schlaganfällen, Kräfteverfall, Juckreiz am ganzen Körper, gesteigertem Schlafbedürfnis; sie scheiden Wasser durch den Darm, durch Augen und Nasenlöcher aus; sie haben oft grauen Star, sind kurzsichtig, hören schlecht.) Auf allen Gebieten rät er ihnen zur Mäßigkeit, aber auch dazu, ihre Tätigkeiten nicht zu unterbrechen.
Hippokrates’ Nachfolge war weniger gut. Aristoteles zwang seine Meinungen auf, die sich auf Spekulation und nicht auf Erfahrung gründeten; er hielt die innere Wärme für die Grundbedingung des Lebens und setzte das Altern mit einem Erkalten gleich. Rom übernahm die Begriffe, mit denen die Griechen die organischen Phänomene erklärt hatten: Temperamente, Säfte, Mischung der Körpersäfte, Pneuma. Im Rom Marc Aurels waren die medizinischen Kenntnisse nicht weiter fortgeschritten als in Griechenland unter Perikles.
Im 2. Jahrhundert schuf Galenus eine allgemeine Synthese der antiken Medizin. Er betrachtete das Alter als ein Stadium zwischen Krankheit und Gesundheit. Es ist kein eigentlich pathologischer Zustand: Indessen sind alle physiologischen Funktionen des Greises reduziert und geschwächt. Dieses Phänomen erklärt er, indem er die Theorie der Körpersäfte und die der inneren Wärme kombiniert. Die Wärme nährt sich von den Säften: Sie erlischt, wenn der Körper seine Feuchtigkeit verliert und die Säfte verdunsten. In seiner Gerocomica gibt er Ratschläge über Gesundheitspflege, an die man sich in Europa bis ins 19. Jahrhundert hielt. Er ist der Meinung, dass nach dem Contraria-contrariis-Prinzipder Körper des alten Menschen erwärmt und befeuchtet werden muss: Er soll heiße Bäder nehmen, Wein trinken, aber auch aktiv bleiben. Er gibt ihm detaillierte Ernährungsvorschriften. Als Beispiel führt er den alten Arzt Antiochos an, der noch mit 80 Jahren seine Kranken besuchte und an politischen Versammlungen teilnahm, sowie den Grammatiker Telephos, der sich bis zu fast 100 Jahren guter Gesundheit erfreute.
Jahrhundertelang hat die Medizin nichts anderes getan, als sein Werk zu umschreiben. Autoritär, seiner Unfehlbarkeit gewiss, triumphierte er zu einem Zeitpunkt, als man es vorzog, zu glauben, anstatt zu erwägen. Vor allem lebte er in einer Epoche und in einem Milieu, wo der vom Orient kommende Monotheismus sich gegen das Heidentum durchsetzte. Seine Theorien sind von Religiosität durchtränkt. Er glaubt an die Existenz eines einzigen Gottes. Er betrachtet den Körper als materielles Instrument der Seele. Die Kirchenväter haben seine Gedanken übernommen, ebenso die Juden und die islamisierten Araber. Und deshalb entwickelte sich die Medizin während des ganzen Mittelalters kaum weiter: Folglich wusste man auch über das Alter sehr wenig. Indessen machte Avicenna – auch er ein Schüler von Galenus – im 11. Jahrhundert interessante Feststellungen über chronische Krankheiten und geistige Störungen der Alten.
Die Scholastiker verglichen das Leben mit einer Flamme, die das Öl der Lampe nährt: Das ist ein mystisches Bild, denn die Seele wird im Mittelalter oft als Flamme dargestellt. Auf weltlichem Gebiet gilt die Hauptsorge der Ärzte weniger dem Heilen als dem Vorbeugen. Die Schule von Salerno, in der die abendländische Medizin entstand und sich weiterentwickelte, arbeitete «Verordnungen für Gesundheit und Langlebigkeit» aus. Eine reichhaltige Literatur über dieses Thema kommt auf. Im 13. Jahrhundert schrieb Roger Bacon, der das Alter für eine Krankheit hielt – er stimmte darin mit Terenz überein, der dies schon in der Antike geäußert hatte –, für KlemensVI. eine Gesundheitslehre des Alters, in der er der Alchimie breiten Raum gab. Er ist der Erste, der auf die Idee kam, das Sehen durch vergrößernde Gläser zu verbessern. (In Italien wurden kurz nach seinem Tod im Jahre 1300 Brillen hergestellt. Die Verwendung falscher Zähne war schon bei den Etruskern bekannt. Im Mittelalter entnahm man sie Tierkadavern oder verstorbenen jungen Leuten.) Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts sind alle Werke über das Alter Abhandlungen über Gesundheitslehre. Die Schule von Montpellier verfasste ebenfalls «régimes de santé». Am Ende des 15. Jahrhunderts tritt in Italien eine Renaissance der Wissenschaft ein, parallel zu der der Kunst. Der Arzt Zerbi schrieb eine Gerontocomia, die erste Monographie, die der Pathologie des Alters gewidmet ist. Aber er erfindet nichts Neues.
Der Zweig der Medizin, der zu Beginn der Renaissance den größten Fortschritt verzeichnete, war die Anatomie. Tausend Jahre lang war es verboten gewesen, den menschlichen Körper zu sezieren. Das wurde nun, mehr oder weniger offiziell, Ende des 15. Jahrhunderts möglich. Bemerkenswert, aber nicht überraschend ist, dass der Schöpfer der modernen Anatomie Leonardo da Vinci war: Als Maler hatte er sich leidenschaftlich für die Darstellung des menschlichen Körpers interessiert und wollte ihn genau kennen lernen. «Ich habe, um ein vollständiges und wahres Wissen darüber zu erlangen, mehr als zehn menschliche Körper seziert», schrieb er. Tatsächlich hat er im Laufe seines Lebens mehr als dreißig Leichen seziert: darunter auch Leichen von Greisen. Er zeichnete viele Gesichter und Körper von alten Menschen; er stellte auch, nach eigenen Beobachtungen, ihre Eingeweide, ihre Adern dar. (Darüber hinaus hat er sich schriftlich über anatomische Veränderungen geäußert, die er beobachtete, aber diese Texte wurden erst sehr viel später bekannt.)
Die Anatomie macht weitere Fortschritte mit Vesalius, der ihr großer Meister ist. Doch die anderen Disziplinen stagnieren. Die Wissenschaft bleibt durchtränkt von Metaphysik. Der Humanismus versucht gegen die Tradition anzukämpfen, aber es gelingt ihm nicht, sich von ihr zu befreien. Paracelsus schreibt, um modern zu sein, im 16. Jahrhundert seine Bücher deutsch, nicht lateinisch. Er hat einige neue und bemerkenswerte Gedanken, die allerdings in verworrenen Theorien untergehen. Ihm zufolge ist der Mensch eine «chemische Verbindung», und das Alter beruht auf einer Selbstvergiftung.
Bis dahin befassten sich die dem Alter gewidmeten Werke nur mit der vorbeugenden Gesundheitspflege: Auf Diagnostik und Therapeutik findet man nur vereinzelte Hinweise. David Pomis, ein venezianischer Arzt, behandelte diese Fragen als Erster systematisch und klar. Einige seiner Beschreibungen von Alterskrankheiten sind sehr genau, insbesondere die des erhöhten Blutdrucks.
Im 17. Jahrhundert entstanden viele Werke über das Alter, die jedoch uninteressant sind. Im 18. Jahrhundert hat Galenus immer noch Jünger, darunter Gerard van Swieten. Dieser hält das Alter für eine Art unheilbarer Krankheit; er mokiert sich über die von der Alchimie oder Astrologie beeinflussten Heilmittel; er beschreibt sehr genau gewisse altersbedingte anatomische Veränderungen. Indessen führen der Aufstieg des Bürgertums, Rationalismus und Mechanismus, zu denen es sich bekennt, zur Gründung einer neuen Schule: der Iatrophysik. Borelli, Baglivi wenden die Ideen von La Mettrie in der Medizin an: Der Körper ist eine Maschine, ein Komplex von Zylindern, Spindeln, Rädern, die Lunge ein Blasebalg. Hinsichtlich des Alters greifen sie also die Theorien der Mechanisten aus der Antike auf1: Der Organismus nutzt sich ab wie eine Maschine, die lange Zeit in Gebrauch war.2 Diese These hatte bis ins 19. Jahrhundert Verfechter und erlebte damals sogar ihre größte Popularität. Aber der Begriff ‹Abnutzung› ist stets sehr unbestimmt geblieben. Andererseits leitet Stahl die unter dem Namen Vitalismus bekannte Theorie ein: Im Körper des Menschen soll ein Lebensprinzip existieren, dessen Nachlassen zum Altern und dessen Verschwinden zum Tod führe.
Die Anhänger der Tradition und die der modernen Systeme lieferten sich viele sinnlose Dispute. Die Medizin hatte ernste theoretische Schwierigkeiten. Sie gab sich nicht mehr mit der alten Pathologie der Körpersäfte zufrieden, hatte aber noch keine neuen Grundlagen entdeckt. Sie befand sich in einer Sackgasse. Indessen machte sie empirisch Fortschritte. Man widmete sich mehr der Autopsie und hatte in der Anatomie große Fortschritte gemacht. Das kam der Untersuchung des Alters zugute. In Russland brach Fischer, Direktor des Gesundheitsdienstes, mit Galenus und beschrieb systematisch die altersbedingte Rückbildung der Organe. Sein Buch machte Epoche, trotz mancher Mängel. Ebenfalls sehr bedeutend war das 1761 erschienene Werk des Italieners Morgagni. Er stellte erstmals eine Wechselbeziehung her zwischen den klinischen Symptomen und den bei Autopsien gemachten Beobachtungen. Dem Alter widmete er einen eigenen Abschnitt.
Im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts erschienen drei Bücher über dieses Thema, die die Entdeckungen des 19. und 20. Jahrhunderts vorwegnahmen. Der amerikanische Arzt Rush veröffentlichte eine auf seinen Beobachtungen beruhende physiologische und klinische Studie. Der Deutsche Hufeland trug ebenfalls viele interessante Beobachtungen in einer Abhandlung zusammen und erfreute sich großer Popularität. Er war Vitalist. Er glaubte, jeder Organismus sei mit einer bestimmten Lebensenergie ausgestattet, die sich mit der Zeit erschöpfe. Das bedeutendste Werk war das von Seiler, das 1799 erschien: Es befasste sich ausschließlich mit der Anatomie des alten Menschen und stützte sich auf Autopsien. Zwar ermangelte es der Originalität, dennoch war es jahrzehntelang eines der geschätztesten Arbeitsinstrumente. Man benutzte es bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts vertraten die Ärzte von Montpellier weiterhin den Vitalismus.3 Aber die Medizin begann vom Fortschritt der Physiologie und aller experimentellen Wissenschaften zu profitieren. Die Untersuchungen über das Alter wurden präzise und systematisch. Rostan studierte 1817 das Asthma der alten Leute: Er entdeckte eine Verbindung mit einer Gehirnstörung. Prus schrieb 1840 die erste systematische Abhandlung über die Alterskrankheiten.
Von der Mitte des 19. Jahrhunderts an gibt es eine regelrechte Geriatrie – ohne dass damals schon diese Bezeichnung auftauchte. In Frankreich wurde sie durch die Gründung großer Krankenhäuser begünstigt, die viele alte Menschen aufnahmen. Die Salpêtrière war das größte Krankenhaus Europas; sie beherbergte 8000 Kranke, von denen 2000 bis 3000 Alte waren. Auch Bicêtre beherbergte zahlreiche alte Menschen. Folglich wurde es leicht, klinische Daten über sie zu sammeln. Man kann die Salpêtrière als den Kern der ersten geriatrischen Einrichtung ansehen. Charcot hielt dort seine berühmten Vorlesungen über das Alter, die 1886 veröffentlicht wurden und ein riesiges Echo fanden. Damals erschienen viele Abhandlungen über Gesundheitspflege, durchweg stereotyp und uninteressant. Aber insgesamt gesehen wich die vorbeugende Medizin der therapeutischen: Von nun an bemühte man sich, die Alten zu heilen – zumal sie immer zahlreicher wurden, anfangs in Frankreich, dann auch in anderen Ländern: Die Ärzte hatten sich bei ihren Patienten immer mehr mit altersbedingten Degenerationskrankheiten zu befassen. Schon vor dem Buch von Charcot waren 1847 ein Werk von Pennock und 1852 eine Abhandlung von Réveillé-Parise erschienen, in denen diese die Pulsfrequenz und den Atmungsrhythmus bei alten Leuten untersuchten. Geist veröffentlichte zwischen 1857 und 1860 eine gute Synthese der in Deutschland, Frankreich und England erschienenen geriatrischen Literatur.
Ende des 19. und im 20. Jahrhundert wurden immer mehr Untersuchungen durchgeführt. In Frankreich veröffentlichten 1895 Boy-Tessier, 1908 Rauzier, 1912 Pic und Bamamour große zusammenfassende Werke. Sehr bedeutend waren auch in Deutschland die Arbeiten von Bürger, in Amerika die Abhandlungen von Minot und Metschnikoff, die beide 1908 erschienen, sowie das 1915 herausgekommene Buch des Zoologen Child. Wie in früherer Zeit hofften einige Gelehrte noch immer, den Prozess des Alterns durch eine einzige Ursache erklären zu können. Ende des 19. Jahrhunderts vertraten einige die Ansicht, er beruhe auf einer Rückbildung der Geschlechtsdrüsen. Charles Édouard Brown-Séquard, Professor am Collège de France, injizierte sich im Alter von 72 Jahren einen Extrakt aus den Hoden von Meerschweinchen und Hunden: ohne dauerhaftes Ergebnis. Serge Voronoff, ebenfalls Professor am Collège de France, erfand eine Methode, alten Männern Affendrüsen zu überpflanzen: ein Misserfolg. Bogomoletz wollte ein Verjüngungsserum auf Hormonbasis herstellen: ein Misserfolg. Metschnikoff seinerseits übernahm in modernisierter Form den Gedanken, dass die Vergreisung auf Selbstvergiftung beruhe. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts behauptete Cazalis in einer Formel, die Schlagzeilen machte: «Man ist so alt wie seine Arterien»; er sah in der Arteriosklerose den entscheidenden Faktor des Alterns. Am weitesten verbreitet war die Vorstellung, dass der Altersprozess auf einem Nachlassen des Stoffwechsels beruhe.
Als Vater der Geriatrie gilt der Amerikaner Nascher. Geboren in Wien – das ein wichtiges Zentrum für Studien über das Alter war –, kam er als Kind nach New York und studierte dort Medizin. Bei einem Altersheimbesuch mit einer Studentengruppe hörte er, wie sich eine alte Frau beim Professor über verschiedene Beschwerden beklagte. Dieser erklärte, ihre Krankheit sei nichts weiter als ihr hohes Alter. «Was kann man dagegen tun?», fragte Nascher. – «Nichts.» Nascher war über diese Antwort so verblüfft, dass er beschloss, sich dem Studium des Alters zu widmen. Nach Wien zurückgekehrt, besuchte er ein Altersheim; er wunderte sich über die Langlebigkeit und die gute Gesundheit seiner Insassen. «Das kommt daher, weil wir die alten Patienten so behandeln wie die Kinderärzte die Kinder», sagten ihm seine Kollegen. Dies bewog ihn, einen eigenen Zweig der Medizin zu schaffen, den er Geriatrie taufte. 1909 veröffentlichte er sein erstes Programm; 1912 gründete er die Gesellschaft für Geria von New York und 1914 veröffentlichte er ein neuartiges Buch über das Problem; er hatte Mühe, einen Verleger zu finden: Man fand das Thema nicht interessant.
Neben der Geriatrie entwickelte sich in neuerer Zeit eine Wissenschaft, die man heute Gerontologie nennt: Sie untersucht nicht die Pathologie des Alters, sondern den Prozess des Alterns selbst. Zu Anfang des Jahrhunderts waren die biologischen Forschungen über das Alter nur ein Nebenprodukt anderer Untersuchungen: Bei dem Studium vom Leben der Pflanzen und Tiere interessierte man sich nebenbei auch für die Veränderungen, die mit zunehmendem Alter eintreten. Während Kindheit und Jugend Gegenstand zahlreicher Spezialwerke waren, untersuchte man das Alter nicht um seiner selbst willen – und zwar hauptsächlich wegen der bereits erwähnten Tabus.4 Es galt als unangenehme Angelegenheit. Zwischen 1914 und 1930 gab es kaum etwas Nennenswertes außer den Arbeiten von Carrel, dessen Ansichten in Frankreich weite Verbreitung fanden; er kam wieder auf die Idee zurück, dass das Alter eine Selbstvergiftung infolge von Stoffwechselablagerungen in den Zellen sei.
In der Folge änderte sich die Situation. In den USA hatte sich zwischen 1900 und 1930 die Zahl alter Menschen verdoppelt, und sie verdoppelte sich zwischen 1930 und 1950 abermals; die Industrialisierung der Gesellschaft führte zur Konzentration vieler Alten in den Städten, woraus sich ernste Probleme ergaben. Zahlreiche Untersuchungen, die angestellt wurden, um eine Lösung zu finden, lenkten die Aufmerksamkeit auf die alten Menschen: Man wollte besser über sie Bescheid wissen. In der Biologie, Psychologie und Soziologie machte die Forschung von 1930 an Fortschritte. In gleicher Weise entwickelte sie sich in anderen Ländern. In Kiew fand 1938 ein nationaler Kongress über das Altern statt. Im selben Jahr erschien in Frankreich das umfassende Werk von Bastaï und Pogliatti und in Deutschland die erste Fachzeitschrift. 1939 beschloss eine Gruppe englischer Gelehrter und Medizinprofessoren, einen internationalen Klub für Altersforschung zu gründen. In den USA erschien das Monumentalwerk von Cowdry Problems of Ageing.
Während des Krieges ließen die Forschungen nach. Aber unmittelbar danach wurden sie wieder aufgenommen. 1945 entstand in den USA eine Gesellschaft für Gerontologie, und 1946 brachte man dort die zweite dem Alter gewidmete Zeitschrift heraus. In allen Ländern erschienen nun solche Veröffentlichungen. In England gründete Lord Nuffield die Nuffield Foundation, die über beträchtliche Mittel verfügt: Sie studiert die Geriatrie und auch die Stellung der alten Menschen in Großbritannien. In Frankreich erlebte die Altenforschung durch Léon Binet einen neuen Aufschwung. 1950 entstand in Lüttich eine internationale Vereinigung für Gerontologie; sie hielt noch im selben Jahr in Lüttich einen Kongress ab, dann 1951 einen in St. Louis am Missouri, 1954 einen in London und in der Folge noch viele weitere. In zahlreichen Ländern wurden Forschungsgesellschaften gegründet. 1954 enthielt ein in den USA zusammengestellter bibliographischer Index über die Gerontologie 19000 Angaben. Dr.Destrem zufolge ist diese Zahl heute doppelt so hoch anzusetzen. Was Frankreich betrifft, so konstituierte sich die französische Gesellschaft für Gerontologie im Jahre 1958. Im selben Jahre entstand das von Prof.Bourlière geleitete Centre d’études et de recherches gérontologiques. Bedeutende Abhandlungen erschienen in Frankreich: die von Grailly und Destrem 1953, die von Binet und Bourlière 1955. Die Revue française de gérontologie wurde 1954 gegründet. Schließlich wurde in Paris eine Sonderkommission für Sozialhygiene ins Leben gerufen, um die Probleme des Alters zu erforschen. In den USA veröffentlichte die Universität von Chicago 1959 und 1960 drei Abhandlungen, die sowohl aus individueller als auch sozialer Sicht regelrechte Gesamtwerke über das Alter in Amerika und Westeuropa darstellen.
Die Gerontologie entwickelte sich auf drei Gebieten: dem biologischen, psychologischen und sozialen. Auf allen dreien bleibt sie der gleichen positivistischen Einstellung treu; es geht nicht darum, zu erklären, warum die Phänomene auftreten, sondern zusammenfassend mit größtmöglicher Genauigkeit die Erscheinungen zu beschreiben.
Die moderne Medizin weist dem biologischen Altern keine spezifische Ursache mehr zu: Sie betrachtet es als zum Lebensprozess gehörend, ebenso wie Geburt, Wachstum, Fortpflanzung, Tod. Die Rattenversuche von McCay5 veranlassten Dr.Escoffier-Lambiotte zu einem interessanten Kommentar: «Das Altern und danach der Tod hängen also nicht mit einem bestimmten Grad der Energieverausgabung, einer bestimmten Zahl von Herzschlägen zusammen, sondern sie treten dann ein, wenn ein vorgegebenes Wachstums- und Reifeprogramm abgeschlossen ist.» Das heißt, das Alter ist kein mechanischer Zwischenfall; ebenso wie den Tod, den, so Rilke, jeder in sich trägt wie die Frucht ihren Kern, scheint jeder Organismus schon von Anfang an sein Alter in sich zu tragen, die unausweichliche Folge seiner Vollendung.6
Nach heutiger Auffassung ist das Altern ein allen Lebewesen gemeinsamer Prozess. Bis vor nicht allzu langer Zeit meinte man, die Zellen selbst seien unsterblich: Lediglich ihre Kombinationen lösten sich mit der Zeit auf. Carrel hatte diese These verteidigt und glaubte, sie bewiesen zu haben. Aber unsere Erfahrungen haben erhärtet, dass auch die Zellen sich mit der Zeit verändern. Gemäß dem amerikanischen Biologen Orgel führt das Alter zu Mängeln in dem System, das gewöhnlich die Produktion der Zellenproteine präzise bestimmt und plant. Jedoch sind diese biochemischen Forschungen noch nicht sehr weit gediehen. Was beim Menschen physiologisch den Alterungsprozess bestimmt, ist die von Destrem so benannte «pejorative Gewebeveränderung». Die Menge der stoffwechselaktiven Gewebe verringert sich, während die der inaktiven Gewebe sich vermehrt: Bindegewebe und verhärtetes Muskelgewebe; sie sind Gegenstand einer Dehydrierung und entarteten Verfettung. Die Fähigkeit der Zellerneuerung lässt merklich nach. Die Vermehrung des Bindegewebes gegenüber den edlen Geweben ist vor allem bei den Drüsen und beim Nervensystem frappierend. Sie führt zu einer Rückbildung der wichtigsten Organe und einer Schwächung gewisser Funktionen, die unaufhörlich weiter verfallen bis zum Tod. Biochemische Veränderungen treten ein: Zunahme von Natrium, Chlor, Kalzium; Abnahme von Kalium, Magnesium, Phosphor und der Weißkörpersynthesen.
Die Erscheinung des Menschen verändert sich und ermöglicht es, sein Alter bis auf wenige Jahre genau zu bestimmen. Die Haare werden weiß und schütter, warum, weiß man nicht: Der Mechanismus der Depigmentierung der Haarwurzel ist nicht bekannt; die Körperhaare werden ebenfalls weiß, während an manchen Stellen – zum Beispiel am Kinn alter Frauen – ein verstärktes Wachstum einsetzt. Infolge von Dehydrierung und nachlassender Elastizität des unteren Lederhautgewebes wird die Haut faltig. Die Zähne fallen aus. Im August 1957 zählte man in den USA 21,6 Millionen zahnlose Menschen, das heißt 13% der Bevölkerung. Der Verlust der Zähne führt zu einer Verkürzung der unteren Gesichtshälfte, sodass die Nase – die sich auf Grund der Atrophie ihrer elastischen Gewebe vertikal verlängert – dem Kinn näher kommt. Die Alterswucherung der Haut führt zu einer Verdickung der oberen Augenlider, während unter den Augen Tränensäcke entstehen. Die Oberlippe wird schmal; das Ohrläppchen wächst. Auch das Skelett verändert sich. Die Bandscheiben der Wirbelsäule werden zusammengedrückt und die Wirbelkörper senken sich: Zwischen 45 und 85 Jahren verkürzt sich der Oberkörper bei Männern um 10, bei Frauen um 15 Zentimeter. Die Schultern werden schmaler, das Becken verbreitert sich; der Brustkasten neigt dazu, eine Bogenform anzunehmen, vor allem bei Frauen. Muskelschwund, Sklerose der Gelenke führen zu Gehbeschwerden. Das Skelett leidet unter Osteoporose: Die kompakte Knochensubstanz wird schwammig und brüchig; deshalb ist der Bruch des Oberschenkelhalses, der das Gewicht des Körpers trägt, ein so häufiger Unfall.
Das Herz verändert sich nicht wesentlich, aber es arbeitet schlechter; es verliert nach und nach seine Anpassungsfähigkeit, der Mensch muss seine Tätigkeiten einschränken, um es zu schonen. Der Blutkreislauf wird in Mitleidenschaft gezogen; die Arterienverkalkung ist nicht Ursache des Alters, aber eines seiner deutlichsten Merkmale. Man weiß nicht genau, was sie auslöst: Hormonstörungen, sagen die einen; überhöhter Blutdruck sagen andere; im Allgemeinen glaubt man, dass ihre Hauptursache eine Stoffwechselstörung der Fette ist. Die Folgen sind verschieden. Manchmal greift sie das Gehirn an. Auf jeden Fall wird die Durchblutung des Gehirns schwächer. Die Adern verlieren ihre Elastizität, die Herzleistung nimmt ab, die Zirkulationsgeschwindigkeit verringert sich, der Blutdruck steigt. Übrigens sei darauf hingewiesen, dass der für den erwachsenen Menschen sehr gefährliche Bluthochdruck vom alten Menschen gut vertragen wird. Der Sauerstoffverbrauch des Gehirns verringert sich. Der Brustkorb wird starrer, und die Atmungskapazität, die mit 25 Jahren 5 Liter beträgt, fällt bei 85 Jahren auf 3 Liter. Die motorischen Nerven übertragen die Reize weniger rasch und die Reaktionen erfolgen langsamer. Nieren, Verdauungsdrüsen und die Leber bilden sich zurück. Auch die Sinnesorgane werden in Mitleidenschaft gezogen. Die Akkomodationsfähigkeit lässt nach. Bei fast allen alten Leuten tritt Weitsichtigkeit auf; die Sehkraft nimmt ab, die Unterscheidungsfähigkeit des Auges lässt nach. Ebenso das Gehör, oft bis zur Taubheit. Gefühl, Geschmack, Geruchssinn sind weniger ausgeprägt als früher.
Die Rückbildung der endokrinen Drüsen ist eine der verbreitetsten und offensichtlichsten Folgen des Alterns; gleichzeitig erfolgt eine Rückbildung der Geschlechtsorgane. Über diesen Punkt wurden kürzlich einige präzise Tatsachen ermittelt.7 Beim alten Mann stellt man keine besondere Anomalie der Samenzellen fest; theoretisch ist die Befruchtung des Eies durch das Sperma des alten Mannes unbegrenzt möglich. Es gibt kein allgemeines Gesetz über das Aufhören der Spermenbildung, sondern nur Einzelfälle. Indessen tritt die Erektion zwei- bis dreimal langsamer ein als in der Jugend. (Die Morgenerektionen, die selbst in hohem Alter noch vorkommen, haben keinen sexuellen Charakter.) Sie kann lange Zeit ohne Ejakulation aufrechterhalten werden, was zum Teil auf sexueller Erfahrung, zum Teil auf einem weniger intensiven Ansprechen auf sexuelle Reize beruht. Nach dem Orgasmus geht die Erektion außerordentlich schnell zurück, und es dauert beim alten Menschen viel länger, bis er wieder auf sexuelle Reize reagiert, als beim jungen.
Beim jungen Mann verläuft die Ejakulation in zwei Phasen: dem Ausstoßen der Samenflüssigkeit in die Ausführungsgänge der Prostata; ihrem Weg durch die Harnröhre nach außen; in der ersten Phase spürt er, dass die Ejakulation unweigerlich eintritt. Der alte Mann empfindet im Allgemeinen nichts dergleichen; die beiden Phasen verschmelzen zu einer einzigen und er hat oft mehr das Gefühl eines Heraussickerns als eines Ausstoßens. Mit zunehmendem Alter lassen die Möglichkeiten der Ejakulation und Erektion nach und verschwinden sogar ganz. Doch die Impotenz führt nicht immer zum Erlöschen der Libido.
Bei der Frau wird die Fortpflanzungsfähigkeit in relativ jungem Alter brutal abgebrochen. Einzigartig im Alterungsprozess, der auf allen anderen Gebieten kontinuierlich verläuft, kommt es mit etwa 50 Jahren zu einem abrupten Einschnitt: der Menopause. Die Eierstöcke stellen ihre Produktion ein, die Menstruation bleibt aus; die Frau kann nicht mehr befruchtet werden. Die Geschlechtssteroide8 verschwinden und die Geschlechtsorgane bilden sich zurück.
Ein verbreitetes Vorurteil ist, dass alte Menschen schlecht schlafen. Aus einer 1959 in französischen Krankenhäusern durchgeführten Untersuchung geht hervor, dass sie mehr als sieben Stunden pro Nacht schlafen. Allerdings stellt man bei vielen von ihnen Schlafstörungen fest. Entweder können sie schlecht einschlafen, oder sie wachen früh auf, oder ihr Schlaf wird von kurzen Wachperioden unterbrochen; die Gründe für diese Anomalien können physiologischer, biologischer oder psychologischer Natur sein. Nach 80 Jahren schlummern fast alle untertags.
Die gesamten organischen Rückbildungen führen beim alten Menschen zu einer Ermüdbarkeit, der niemand entgeht; körperliche Anstrengungen kann er sich nur noch in engen Grenzen erlauben. Er ist weniger anfällig für Infektionen als junge Menschen; aber sein reduzierter Organismus kann sich schlecht gegen die Angriffe von außen wehren: Die Rückbildung der Organe verringert den Sicherheitsspielraum, der es ermöglicht, ihnen standzuhalten. Manche Ärzte gehen so weit, das Alter mit einer Krankheit gleichzusetzen: Das tat kürzlich9 auch Dr.Aslan, die berühmte rumänische Spezialistin für Geriatrie, in einem Interview, das sie in Italien gab. Ich halte das nicht für gerechtfertigt; die Krankheit ist ein Zwischenfall; das Alter hingegen ein Gesetz des Lebens. Dennoch ist der Ausdruck «alt und gebrechlich» fast ein Pleonasmus. «Diese summarische Gebrechlichkeit, das Altern», schreibt Péguy. Samuel Johnson sagte: «Meine Krankheiten sind Asthma, Wassersucht und, was weniger leicht heilbar ist, 75 Jahre.» Ein Arzt fragte eine alte Frau nach ihrer Brille: «Was fehlt Ihnen? Sind Sie weitsichtig oder kurzsichtig?» – «Ich bin alt, Herr Doktor.»
Es besteht eine Wechselbeziehung zwischen Alter und Krankheit; diese beschleunigt das Altern, und hohes Alter macht anfällig für pathologische Störungen, insbesondere für entsprechende Degenerationsprozesse. Sehr selten kommt «das Alter im Reinzustand» vor, wie man es nennen könnte. Alte Menschen sind mit einer Vielzahl chronischer Krankheiten behaftet.
Wenn man 100 kranke Alte und 100 kranke Junge betrachtet, so ist der Anteil derer, die den Arzt aufsuchen oder Medikamente kaufen, bei den letzteren sehr viel höher. Andererseits stellen die Alten nur etwa 12% der Bevölkerung dar. Indessen machen sie in Frankreich in den Krankenhäusern ein Drittel der Eingänge aus und eines Tages sicher mehr als die Hälfte der Kranken, weil sie länger bleiben als die anderen. In den USA war 1955 ein Fünftel der Krankenhausbetten mit alten Menschen belegt, obgleich sie nur ein Zwölftel der Bevölkerung betrugen. Eine 1955 in Kalifornien angestellte Untersuchung erbrachte, dass die Zahl der Arztbesuche mit zunehmendem Alter stieg. Sie war bei den Alten um 50% höher als bei der Gesamtbevölkerung und bei alten Frauen doppelt so hoch wie bei Männern. Frauen überwiegen auch in den Krankenhäusern. Sie werden älter als Männer, sind aber im Ganzen genommen häufiger krank.10 Insgesamt ist in den USA die Zahl der chronisch Kranken bei alten Menschen im Durchschnitt viermal höher als bei den anderen. Untersuchungen in Australien und Holland haben ähnliche Ergebnisse erbracht.
Alte Leute leiden vor allem unter «schwer definierbarem Unwohlsein» und Rheumatismus. Eine amerikanische Statistik nennt als hauptsächlich vorkommende Alterskrankheiten: Arthritis, Rheumatismus, Herzkrankheiten. Eine andere: Herzkrankheiten, Arthritis, Rheumatismus, Nierenentzündung, hohen Blutdruck, Arteriosklerose. Wieder eine andere: Koordinationsstörungen, Rheumatismus, Erkrankungen der Atemwege, des Verdauungsapparats, der Nerven. Dr.Vignat, der in Lyon alte, im Krankenhaus liegende Menschen beobachtete, stellte fest, dass sie in sinkender Folge an Krankheiten der Herzkranzgefäße, der Atemwege, Geisteskrankheiten, biologischem Kräfteverfall, Gefäßkrankheiten, Neurosen, Krebs11, Störungen der Muskulatur und Verdauungsbeschwerden litten. Da das Alter schlechthin das Gebiet der Psychosomatik ist, hängen die organischen Krankheiten auch eng mit psychologischen Faktoren zusammen.
Tatsächlich kann man in zahlreichen Fällen die beiden Ursachenkomplexe nicht voneinander trennen. So zum Beispiel hinsichtlich der Unfälle, die bei alten Menschen relativ häufig vorkommen. Sie sind die Folge gewisser Verhaltensweisen, die den Einsatz intellektueller Fähigkeiten erfordern – Aufmerksamkeit, Wahrnehmung –, sowie affektiver Verhaltensweisen: Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit, Eigensinn. Aber andererseits erklären sie sich zum großen Teil durch Orientierungsstörungen, Schwindelanfälle, die Steifheit der Muskeln, Brüchigkeit des Skeletts. Sie müssen also hier angeführt werden. Bei der vom National Health Survey untersuchten Gruppe hatten 33% der Männer und 23% der Frauen im Laufe des Jahres einen Unfall erlitten, der die Betroffenen einen oder mehrere Tage lahm legte. Zwischen 45 und 55 Jahren zählt man bei 100000 Personen einen Durchschnitt von 52 Unfällen pro Jahr; über 75 Jahren erhöht sich der Durchschnitt auf 338 Unfälle. Es handelt sich vorwiegend um Stürze innerhalb des Hauses, die manchmal zum Tode führen. Alte Menschen werden auch leicht zu Verkehrsopfern, weil ihnen das Gehen Mühe macht und sie schlecht sehen. Viele verzichten darauf, ihr Heim zu verlassen.
Manche Untersuchungen äußern sich optimistisch über die Gesundheit der Alten: Aber man müsste wissen, welchen genauen Sinn die Untersuchenden ihren Worten beimessen. Dem Bericht zufolge, den Sheldon 1948 in den USA herausgab, fielen von 471 Personen über 60 Jahre nur 29,3% unter die Normalgrenze: Darunter befanden sich viele 80-Jährige: 2,5% waren bettlägerig, 8,5% blieben zu Hause, 22% bewegten sich nur in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, 46% waren völlig normal und 24,5% sogar bemerkenswert gesund. So weit gut. Aber auf welche Norm stützt sich Sheldon? Ist es die, die er auf einen 40-Jährigen angewandt hätte? Zweifellos nein. Eine präzisere Auskunft liefert eine 1955 in Sheffield angestellte Untersuchung: Von 476 Personen über 61 Jahre standen 54,9% Frauen und 71,2% Männer noch voll aktiv im Leben. Zu ähnlichen Ergebnissen kam man 1954 und 1957 in Holland. Die Aktivität setzt in der Tat ein gewisses Maß an Gesundheit voraus. Aber viele Gründe, psychologischer und sozialer Art, können dazu beitragen, sie zu verlängern, selbst bei physischem Verfall.
Was aus allen Beobachtungen hervorgeht, sind die erheblichen Unterschiede bei Angehörigen ein und derselben Altersgruppe. Das chronologische und das biologische Alter stimmen keineswegs immer überein: Die physische Erscheinung sagt mehr aus über die Zahl unserer Jahre als physiologische Untersuchungen. Die Jahre wiegen nicht auf allen Schultern gleich schwer. «Das Altern», sagt der amerikanische Gerontologe Howell, «ist nicht ein Abhang, den alle mit der gleichen Geschwindigkeit hinuntergehen. Es ist eine Folge von unregelmäßigen Stufen, die einige schneller hinunterpurzeln als andere.»12 Es gibt eine Krankheit, die «Progeria», die alle Organe des Patienten vorzeitig altern lässt.13 Am 12. Januar 1968 starb im Krankenhaus von Chatham in Kanada ein 10-jähriges Kind, das äußerlich die Erscheinung einer 90-jährigen Frau hatte. Ein Bruder war im Alter von 11 Jahren an derselben Krankheit gestorben. Dr.Dénard-Toulet erzählte mir von einer Frau, die mit 45 Jahren an den Folgen einer Altersrückbildung ihrer Organe gestorben war. Abgesehen von diesen sehr seltenen Fällen wird der Verfall von zahlreichen Faktoren beschleunigt oder verzögert: der Gesundheit, den Erbanlagen, der Umwelt, den Emotionen, den früheren Gewohnheiten, dem Lebensstandard. Er nimmt unterschiedliche Formen an, je nachdem, welche Funktionen als Erste nachlassen. Manchmal ist es ein kontinuierlicher Prozess; dann wieder bekommen Leute, die bis dahin knapp so alt wirkten, wie sie wirklich waren, oder sogar jünger, plötzlich «ein altes Aussehen». Im Fall einer Krankheit, Überanstrengung, Trauer, eines schweren Misserfolgs sind es nicht die Organe, die unvermittelt nachlassen, sondern der Bau, der ihre Mängel kaschierte, bricht zusammen. Der Betroffene hatte in Wahrheit in seinem Körper die Altersrückbildung durchgemacht, sie aber durch Automatismen oder überlegtes Verhalten ausgleichen können: Plötzlich ist er nicht mehr in der Lage, seine Abwehrmechanismen einzusetzen, und sein latentes Alter enthüllt sich. Dieser geistige Zusammenbruch wirkt auf die Organe zurück und kann zum Tod führen. Man hat mir die Geschichte einer sehr gut erhaltenen 63-jährigen Frau erzählt, die tapfer die qualvollen Schmerzen ertrug, derentwegen sie behandelt wurde. Nachdem ein unbesonnener Assistenzarzt ihr gesagt hatte, dass sie nie wieder gesund würde, alterte sie schlagartig um 20 Jahre, und ihre Schmerzen steigerten sich. Ein großer Ärger, zum Beispiel ein verlorener Prozess, kann einen Mann von 60 Jahren physisch wie auch geistig in einen Greis verwandeln.
Wenn keinerlei Schock dieser Art eintritt, wenn die Gesundheit gut bleibt, kann es dagegen vorkommen, dass der Mensch bis zu einem fortgeschrittenen Alter die verlorenen Fähigkeiten zu kompensieren vermag. Dank einer erprobten Technik, einer genauen Kenntnis ihres Körpers, bleiben manche Sportler lange Zeit «in Form». Ted Meredith, ein Fußballspieler von internationalem Format, wurde noch mit 52 Jahren aufgestellt. Eugène Lenormand gab noch mit 63 Jahren Schwimmvorstellungen; Borotra war mit 56 Jahren Tennisweltmeister.
In früheren Zeiten bestand oft ein krasser Gegensatz zwischen der geistigen und der physischen Entwicklung eines Menschen. Montesquieu beklagte diese Unterschiedlichkeit; «Unglückseliges Los der Menschen! Kaum hat der Geist den Punkt der Reife erlangt, beginnt der Körper schwächer zu werden!» Delacroix notierte in seinem Tagebuch: «Dieses seltsame Missverhältnis zwischen der Kraft des Geistes, die das Alter mit sich bringt, und der Schwächung des Körpers, die es ebenfalls zur Folge hat, verwundert mich immer wieder und erscheint mir wie ein Widerspruch in den Fügungen der Natur.»
Die Fortschritte der Medizin haben die Situation verändert. Gegen eine Vielzahl von Gebrechen und Krankheiten abgeschirmt, hält der Körper länger dem Verfall stand. So lange der Geist sein Gleichgewicht und seine Kraft bewahrt, gelingt es gewöhnlich, den Menschen bei guter physischer Gesundheit zu erhalten: Diese bricht erst zusammen, wenn der Geist nachlässt. Und umgekehrt: Wenn der physiologische Zustand sich ernstlich verschlechtert, trüben sich auch die geistigen Fähigkeiten. Auf alle Fälle leiden sie unter körperlichen Veränderungen. Die Botschaften werden weniger schnell übermittelt und durch die schlechte Qualität der Empfangsorgane deformiert. Die Funktionsweise des Gehirns ist weniger flexibel; wie wir bereits gesehen haben, verringert sich sein Sauerstoffverbrauch; die ungenügende Anreicherung des Blutes mit Sauerstoff führt zu einer Minderung des unmittelbaren Gedächtnisses und des Merkvermögens, einer Verlangsamung der Vorstellungsprozesse, zu Unregelmäßigkeiten in den leichten Denkvorgängen und zu heftigen Gefühlsreaktionen: Euphorie oder Depression. Man kann das Altern als Beispiel jener «diffusen Amputation» ansehen, von der Goldstein im Zusammenhang mit posttraumatischen Gehirnstörungen spricht. Hier kommt es auch zur Einbuße von Gehirnzellen. Da diese jedoch zahlreich sind, kann der Mensch relativ leicht damit fertig werden, sofern eine Situation nicht übermäßige Anstrengung erfordert. Wenn aber in seinem Leben das Gleichgewicht fehlt, besteht die Gefahr von Katastrophen. Auf jeden Fall ermüdet ihn geistige Anstrengung; Arbeitskraft und Konzentrationsfähigkeit lassen nach, zumindest vom 70. Lebensjahr an.
Bei ihren Untersuchungen über die Psychologie alter Menschen greifen die Gerontologen zu denselben Methoden wie bei der Erforschung ihrer Physiologie. Sie behandeln die Patienten äußerlich. Dabei stützen sie sich hauptsächlich auf die Psychometrie, eine Disziplin, die mir äußerst anfechtbar erscheint. Die einem Test unterworfene Person befindet sich in einer künstlich herbeigeführten Situation, und die erzielten Ergebnisse sind reine Abstraktionen, die sich erheblich von der praktischen und lebendigen Realität unterscheiden. In Wirklichkeit hängen die intellektuellen Reaktionen eines Menschen von seiner Gesamtsituation ab: Man weiß zur Genüge, dass ein bisher frühreifes Kind durch familiäre Konflikte plötzlich dumm wirken kann. Wenn ich später an anderer Stelle die Psychologie alter Menschen untersuchen werde, gehe ich von einer Gesamtperspektive aus, indem ich sie gemäß dem bereits erwähnten Zirkularitätsprinzip in einen biologischen, existentiellen und sozialen Zusammenhang stelle. Da ich meinen Lesern eine genaue Vorstellung von der bis heute geleisteten Arbeit der Gerontologen vermitteln möchte, begnüge ich mich hier damit, auf ihre Methoden hinzuweisen und auf die Resultate, die sie erzielt zu haben glauben.
1917 wollte man im amerikanischen Heer das geistige Niveau der Offiziersanwärter feststellen: Zu diesem Zweck wurden die ersten Intelligenztests erfunden. Danach vermehrten sich die Forschungen auf diesem Gebiet. 1927 übernahm Willoughby einzelne der im amerikanischen Heer verwendeten Tests und unterzog ihnen eine Gruppe von Familien, die in der Umgebung der Universität von Stanford lebte. Jones und Conrad stellten 1925 und 1926 die in New England erzielten Ergebnisse zusammen, nachdem sie 1191 Personen getestet hatten. Die Forschungen wurden dann in Amerika, Deutschland, England fortgesetzt. In Frankreich beobachtete Suzanne Pacaud 1955 die Reaktionen von 4000 Eisenbahnangestellten zwischen 20 und 55 Jahren und von Lehrlingen zwischen 12½ und 15½ Jahren. Kürzlich hat Prof.Bourlière in Sainte-Périne eine ‹Test-Batterie› zur Ermittlung der geistigen Fähigkeiten entwickelt. Da verlangt man zum Beispiel von der Testperson, die Irrtümer in einer Reihe von Zeichnungen festzustellen; in einem Labyrinth den Weg einzuzeichnen, auf dem man am schnellsten herausgelangt; unvollständige Zeichnungen zu vollenden; ähnliche und unähnliche Worte zusammenzustellen oder zu trennen; synonyme zu unterstreichen und die Nuancen anzugeben, die sie unterscheiden; Buchstaben und Zahlenverbindungen zu handhaben (Kodetest); aus dem Gedächtnis geometrische Figuren wiederzugeben; auf ein Signal zu reagieren; mit «Richtig» oder «Falsch» auf Behauptungen zu antworten, die das Verhalten und die Persönlichkeit betreffen; spiegelverkehrte Zeichnungen anzufertigen. Dabei stellte man fest, dass das unmittelbare Gedächtnis bei älteren Menschen kaum Einbußen erleidet; das konkrete Gedächtnis (das wohl bekannte Gegebenheiten betrifft) lässt zwischen 30 und 50 Jahren nach; ebenfalls das logische Gedächtnis. Am stärksten vermindert sich das Gedächtnis, das die Bildung neuer Assoziationen erfordert: zum Beispiel das Erlernen einer Sprache. Im Übrigen bestehen große Unterschiede je nach dem Bildungsgrad der Testperson. In Groeningen zeigten Gedächtnistests bei 3000 Personen, dass es bei allen Menschen im höheren Alter nachlässt, bei intellektuell Schaffenden aber weniger als bei manuell Tätigen, bei ehemaligen Facharbeitern weniger als bei Hilfsarbeitern, bei Erwerbstätigen weniger als bei Pensionierten.
Was die motorischen Reaktionen angeht, so sind sie bei 25-Jährigen