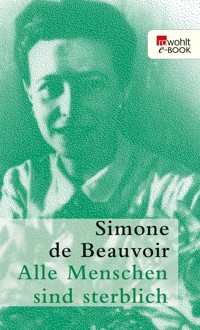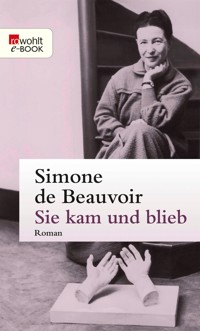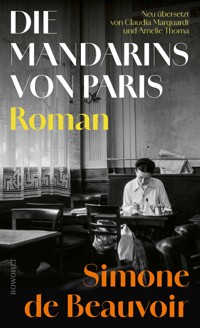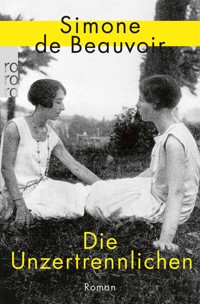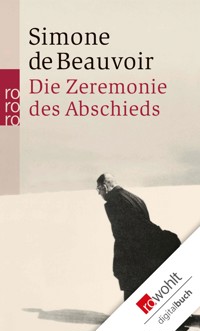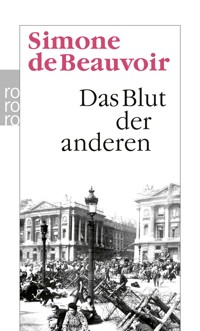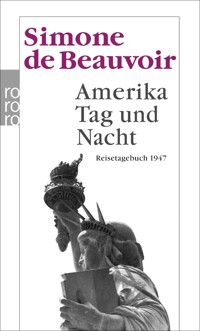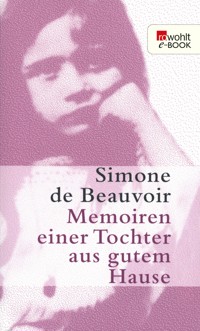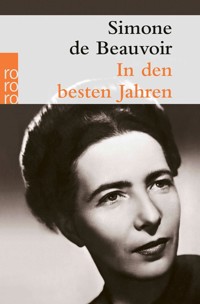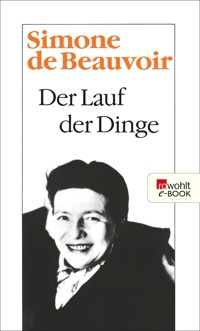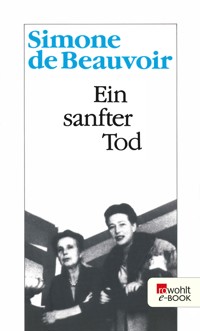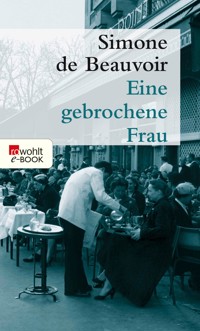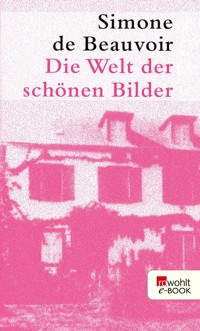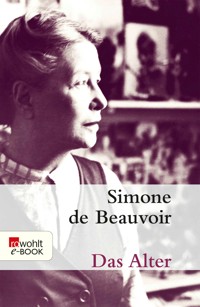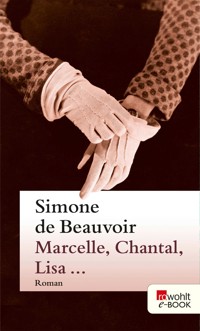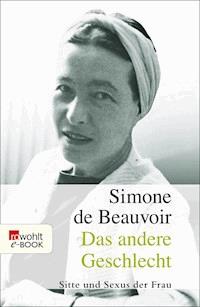
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das berühmte Standardwerk von Simone de Beauvoir! Die universelle Standortbestimmung der Frau, die aus jahrtausendealter Abhängigkeit von männlicher Vorherrschaft ausgebrochen ist, hat nichts an Gültigkeit eingebüßt. Die Scharfsichtigkeit der grundlegenden Analyse tritt in der Neuübersetzung noch deutlicher hervor. Simone de Beauvoir überprüft die subjektiven und objektiven Einschränkungen und Belastungen, denen Frauen ausgesetzt waren und sind. Aus souveränem Verständnis, profundem Wissen und umsichtig angeordnetem überreichem Quellenmaterial formt sie die Diagnose von Ängsten, Frustrationen, Unterlegenheitsgefühlen, Kompensation und ausweichenden Reaktionen, die der weiblichen Emanzipation noch immer entgegenstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Simone de Beauvoir
Das andere Geschlecht
Sitte und Sexus der Frau
Aus dem Französischen von Uli Aumüller und Grete Osterwald
Über dieses Buch
Das berühmte Standardwerk von Simone de Beauvoir!
Die universelle Standortbestimmung der Frau, die aus jahrtausendealter Abhängigkeit von männlicher Vorherrschaft ausgebrochen ist, hat nichts an Gültigkeit eingebüßt. Die Scharfsichtigkeit der grundlegenden Analyse tritt in der Neuübersetzung noch deutlicher hervor.
Simone de Beauvoir überprüft die subjektiven und objektiven Einschränkungen und Belastungen, denen Frauen ausgesetzt waren und sind. Aus souveränem Verständnis, profundem Wissen und umsichtig angeordnetem überreichem Quellenmaterial formt sie die Diagnose von Ängsten, Frustrationen, Unterlegenheitsgefühlen, Kompensation und ausweichenden Reaktionen, die der weiblichen Emanzipation noch immer entgegenstehen.
Vita
Geboren am 9.1.1908 in Paris. Ihre ursprünglich wohlhabenden Eltern lebten nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund von Fehlspekulationen unter wenig üppigen Verhältnissen in der Rue de Rennes. Mit fünfeinhalb Jahren kam Simone an das katholische Mädcheninstitut, den Cours Désir, Rue Jacob; als Musterschülerin legte sie dort den Baccalauréat, das französische Abitur, ab. 1925/26 studierte sie französische Philologie am Institut Sainte-Marie in Neuilly und Mathematik am Institut Catholique, bevor sie 1926/27 die Sorbonne bezog, um Philosophie zu studieren.
1928 erhielt sie die Licence, schrieb eine Diplomarbeit über Leibnitz, legte gemeinsam mit Merleau-Ponty und Lévi-Strauss ihre Probezeit als Lehramtskandidatin am Lycée Janson-de-Sailly ab und bereitete sich an der Sorbonne und der École Normale Supérieure auf die Agrégation in Philosophie vor. In ihrem letzten Studienjahr lernte sie dort eine Reihe später berühmt gewordener Schriftsteller kennen, darunter Jean-Paul Sartre, ihren Lebensgefährten seit jener Zeit. 1932-1936 unterrichtete sie zunächst in Rouen und bis 1943 dann am Lycée Molière und Camille Sée in Paris. Danach zog sie sich aus dem Schulleben zurück, um sich ganz der schriftstellerischen Arbeit zu widmen. Zusammen mit Sartre hat Simone de Beauvoir am politischen und gesellschaftlichen Geschehen ihrer Zeit stets aktiv teilgenommen. Sie hat sich, insbesondere seit Gründung des MLF (Mouvement de Libération des Femmes) 1970, stark in der französischen Frauenbewegung engagiert. 1971 unterzeichnete sie das französische Manifest zur Abtreibung. 1974 wurde sie Präsidentin der Partei für Frauenrechte, schlug allerdings die «Légion d'Honneur» aus, die ihr Mitterrand angetragen hatte. Am 14.4.1986 ist sie, 78-jährig, im Hospital Cochin gestorben. Sie wurde neben Sartre auf dem Friedhof Montparnasse beigesetzt.
Erstes BuchFakten und Mythen
Deutsch von Uli Aumüller
Für Jacques Bost
Es gibt ein gutes Prinzip, das die Ordnung, das Licht und den Mann geschaffen hat, und ein böses Prinzip, das das Chaos, die Finsternis und die Frau geschaffen hat.
Pythagoras
Alles, was von Männern über Frauen geschrieben wurde, muß verdächtig sein, da sie zugleich Richter und Partei sind.
Poulain de la Barre
Einleitung
Ich habe lange gezögert, ein Buch über die Frau zu schreiben. Das ist ein Reizthema, besonders für Frauen, und es ist nicht neu. In der Debatte über den Feminismus ist genug Tinte geflossen. Jetzt ist sie nahezu abgeschlossen: reden wir nicht mehr darüber. Es wird aber doch weiter darüber geredet, und es sieht nicht so aus, als hätte die in den letzten hundert Jahren produzierte Flut von Sottisen das Problem geklärt. Gibt es überhaupt ein Problem? Und worin besteht es? Gibt es überhaupt Frauen? Die Theorie vom Ewigweiblichen hat zwar noch Anhänger, die sich zuflüstern: «Sogar in Rußland bleiben sie Frauen», aber andere gutinformierte Leute – manchmal auch dieselben – seufzen: «Das Frauliche geht verloren, es gibt keine Frauen mehr.» Man weiß nicht mehr genau, ob es noch Frauen gibt, ob es sie immer geben wird, ob dies wünschenswert ist oder nicht, welchen Platz sie in dieser Welt einnehmen, welchen sie einnehmen sollten. «Wo sind die Frauen?» fragte kürzlich eine unregelmäßig erscheinende Zeitschrift namens Franchise, die inzwischen eingestellt wurde. Doch zunächst einmal: was ist eine Frau? «Tota mulier in utero: eine Gebärmutter», sagt der eine. Über manche Frauen urteilen Kenner jedoch: «Das sind keine Frauen», obwohl sie einen Uterus haben wie alle anderen. Von allen wird einmütig anerkannt, daß es innerhalb der menschlichen Spezies «Weibchen» gibt. Sie stellen heute wie ehedem etwa die Hälfte der Menschheit. Und doch sagt man uns, die Weiblichkeit sei «in Gefahr», man ermahnt uns: «Seid Frauen, bleibt Frauen, werdet Frauen.» Nicht jeder weibliche Mensch ist also zwangsläufig eine Frau; er muß an jener geheimnisvollen, bedrohten Realität, der Weiblichkeit, teilhaben. Wird diese von den Eierstöcken produziert? Oder ist sie eine abgehobene platonische Idee? Genügt ein aufreizender Unterrock, um sie auf die Erde herunterzuholen? Obwohl manche Frauen sich eifrig bemühen, sie zu verkörpern, wurde ein Gebrauchsmuster nie festgelegt. Das Weibliche wird gern in unbestimmten, schillernden Ausdrücken beschrieben, die dem Wortschatz von Seherinnen zu entstammen scheinen. Zur Zeit des Thomas von Aquin galt es als ebenso eindeutig definierte Essenz wie etwa die einschläfernde Wirkung des Mohns. Aber der Konzeptualismus hat an Boden verloren: die Biologie und die Sozialwissenschaften glauben nicht mehr an die Existenz unwandelbarer Anlagen, die gegebene Charaktertypen wie die Frau, den Juden oder den Schwarzen hervorbringen; sie betrachten den Charakter als Sekundärreaktion auf eine Situation. Wenn es heute keine Weiblichkeit mehr gibt, so, weil es nie eine gegeben hat. Bedeutet das etwa, daß das Wort «Frau» keinerlei Inhalt hat? Das jedenfalls behaupten die Anhänger der Aufklärung, des Rationalismus und des Nominalismus, indem sie nachdrücklich erklären, die Frauen seien unter den Menschen nur jene, die willkürlich mit dem Wort «Frau» bezeichnet werden. Vor allem die Amerikanerinnen hängen an dem Gedanken, die Frau als solche komme nicht mehr vor. Und wenn eine Rückständige sich immer noch für eine Frau hält, raten ihr die Freundinnen zu einer Psychoanalyse, um diese Zwangsvorstellung loszuwerden. Dorothy Parker schreibt über ein – nebenbei gesagt höchst ärgerliches – Werk mit dem Titel Modern woman: the lost sex: «Ich kann Büchern, die die Frau als Frau behandeln, nicht gerecht werden … Nach meiner Auffassung müssen wir alle, Männer wie Frauen, als Menschen betrachtet werden.» Aber der Nominalismus ist eine Doktrin, die etwas kurz greift, und die Gegner des Feminismus haben leichtes Spiel nachzuweisen, daß Frauen keine Männer sind. Mit Sicherheit ist die Frau wie der Mann ein Mensch: aber eine solche Behauptung ist abstrakt. Tatsächlich befindet sich jeder konkrete Mensch immer in einer einzigartigen Situation. Die Begriffe vom Ewigweiblichen, von der schwarzen Seele, vom jüdischen Charakter abzulehnen, bedeutet ja nicht zu verneinen, daß es heute Juden, Schwarze, Frauen gibt: diese Verneinung wäre für die Betroffenen keine Befreiung, sondern eine Flucht ins Unauthentische. Selbstverständlich kann keine Frau, ohne unaufrichtig zu sein, behaupten, sie stünde jenseits ihres Geschlechts. Vor einigen Jahren lehnte eine bekannte Schriftstellerin es ab, ihr Porträt für eine Fotoserie mit ausschließlich weiblichen Autoren zur Verfügung zu stellen: sie wollte den Männern zugeordnet werden. Um dieses Privileg zu erlangen, ließ sie den Einfluß ihres Mannes spielen. Frauen, die Männer zu sein behaupten, verlangen deshalb nicht weniger Rücksichten und Huldigungen von Seiten der Männer. Hier muß ich auch an eine junge Trotzkistin denken, die bei einer stürmischen Versammlung auf dem Podium stand und trotz ihrer offensichtlichen Zartheit zu einem Faustschlag ausholte: sie verleugnete ihre weibliche Schwäche, doch sie tat es aus Liebe zu einem Genossen, dem sie ebenbürtig sein wollte. Die herausfordernde Haltung, in der die Amerikanerinnen sich verkrampfen, zeigt, wie sehr sie sich vom Gefühl ihrer Weiblichkeit verfolgt fühlen. Dabei braucht man nur mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, um festzustellen, daß die Menschheit sich in zwei Kategorien von Individuen teilt, deren Kleidung, Gesichter, Körper, Lächeln, Gang, Interessen und Betätigungen sichtlich verschieden sind: vielleicht sind diese Unterschiede oberflächlich, vielleicht sind sie dazu bestimmt zu verschwinden. Sicher ist, daß sie derzeit unübersehbar existieren.
Wenn die Funktion des «Weibchens» nicht ausreicht, um die Frau zu definieren, wenn wir es auch ablehnen, sie mit dem Ewigweiblichen zu erklären, aber gelten lassen, daß es, zumindest vorläufig, Frauen auf der Erde gibt, müssen wir uns wohl die Frage stellen: was ist eine Frau?
Schon beim Formulieren der Frage kommt mir eine erste Antwort. Es ist bezeichnend, daß ich sie überhaupt stelle. Ein Mann käme gar nicht auf die Idee, ein Buch über die einzigartige Situation der Männer innerhalb der Menschheit zu schreiben. Der Kinsey-Report zum Beispiel beschränkt sich darauf, das Sexualverhalten des amerikanischen Mannes zu beschreiben, was etwas ganz anderes ist. Wenn ich mich definieren will, muß ich zuerst einmal klarstellen: «Ich bin eine Frau.» Diese Wahrheit ist der Hintergrund, von dem sich jede weitere Behauptung abheben wird. Ein Mann beginnt nie damit, sich als Individuum eines bestimmten Geschlechts darzustellen: daß er ein Mann ist, versteht sich von selbst. In Amtsregistern und auf Personalbögen sind die Rubriken «männlich» und «weiblich» nur der Form halber symmetrisch. Das Verhältnis der beiden Geschlechter ist nicht das zweier elektrischer Ströme, zweier Pole: der Mann vertritt so sehr zugleich das Positive und das Neutrale, daß im Französischen les hommes (die Männer) die Menschen schlechthin bezeichnen, da die spezielle Bedeutung des Wortes vir in der allgemeinen von homo aufgegangen ist. Die Frau dagegen erscheint als das Negative, so daß jede Bestimmung ihr zur Einschränkung gereicht, ohne daß die Sache umkehrbar wäre. Bei theoretischen Diskussionen hat es mich manchmal geärgert, von Männern gesagt zu bekommen: «Sie denken das und das, weil Sie eine Frau sind.» Mir war aber klar, daß ich mich nur mit der Antwort verteidigen konnte: «Ich denke es, weil es stimmt», das heißt unter Ausklammerung meiner Subjektivität. Keinesfalls hätte ich entgegnen dürfen: «Und Sie denken das Gegenteil, weil Sie ein Mann sind», denn es steht fest, daß ein Mann zu sein keine Besonderheit darstellt. Ein Mann ist im Recht, weil er ein Mann ist, die Frau dagegen ist im Unrecht. Wie es für die Menschen der Antike eine absolute Vertikale gab, von der die Definition des Schrägen abgeleitet wurde, gibt es einen absoluten Menschentyp, nämlich den männlichen. Die Frau hat Ovarien und einen Uterus. Das sind Sonderbedingungen, die sie zur Subjektivität verurteilen. Man sagt gern, sie denke mit ihren Drüsen. Der Mann sieht großzügig darüber hinweg, daß zu seiner Anatomie auch Hormone und Testikel gehören. Er begreift seinen Körper als direkte, normale Verbindung zur Welt, die er in ihrer Objektivität zu erfassen glaubt, während er den Körper der Frau durch alles, was diesem eigentümlich ist, belastet sieht und ihn als Behinderung, als Gefängnis betrachtet. «Das Weib ist Weib dadurch, daß ihm bestimmte Eigenschaften fehlen», sagt Aristoteles. «Wir müssen das Wesen der Frauen als etwas natürlich Mangelhaftes sehen.» Und Thomas von Aquin schließt sich ihm in der Auffassung an, die Frau sei ein «verfehlter Mann», ein «zufälliges Wesen». Das gleiche symbolisiert auch die Geschichte der Genesis, in der Eva nach den Worten Bossuets aus einem «überzähligen Knochen» Adams hervorgezaubert wird. Die Menschheit ist männlich, und der Mann definiert die Frau nicht als solche, sondern im Vergleich zu sich selbst: sie wird nicht als autonomes Wesen angesehen. «Die Frau, das relative Wesen …» schreibt Michelet. Das gleiche sagt Julien Benda im Rapport d’Uriel: «Der Körper des Mannes ist sinnhaft durch sich selbst, auch ohne den der Frau, während der ihre sinnentblößt scheint, wenn man den männlichen nicht einbezieht … Der Mann denkt sich ohne die Frau. Sie denkt sich nicht ohne den Mann.» Und sie ist nichts anderes als das, was der Mann bestimmt. In Frankreich zum Beispiel nennt man sie einfach le sexe, womit gemeint ist, daß sie für den Mann in erster Linie ein geschlechtliches Wesen ist: für ihn ist sie sexuell, das heißt, sie ist es absolut. Sie wird mit Bezug auf den Mann determiniert und differenziert, er aber nicht mit Bezug auf sie. Sie ist das Unwesentliche gegenüber dem Wesentlichen. Er ist das Subjekt, er ist das Absolute: sie ist das Andere.[*]
Die Kategorie des Anderen ist so ursprünglich wie das Bewußtsein selbst. In den primitivsten Gesellschaften, in den ältesten Mythologien findet sich immer eine Dualität: die des Gleichen und des Anderen. Diese Zweiteilung stand zunächst nicht im Zeichen der Geschlechtertrennung, sie ist durch keine empirische Gegebenheit bedingt: das geht u.a. aus den Arbeiten von Granet über das chinesische Denken und von Dumézil über Indien und Rom hervor. In den Begriffspaaren Varuna-Mitra, Uranos-Zeus, Sonne-Mond, Tag-Nacht ist zunächst kein weibliches Element enthalten, ebensowenig wie in der Gegenüberstellung von Gut und Böse, der heil- und unheilbringenden Prinzipien, der Rechten und der Linken, Gottes und Luzifers. Die Alterität ist eine grundlegende Kategorie des menschlichen Denkens. Keine Gemeinschaft definiert sich jemals als die Eine, ohne sich sofort die Andere entgegenzusetzen. Es genügt, daß drei Reisende zufällig im selben Zugabteil sitzen, damit alle übrigen Reisenden irgendwie feindliche «andere» werden. Für den Dorfbewohner sind alle Leute, die nicht zu seinem Dorf gehören, verdächtige «andere». Dem Einheimischen eines Landes erscheinen die Bewohner anderer Länder als «Fremde». Für den Antisemiten sind die Juden «andere», für die amerikanischen Rassisten sind es die Schwarzen, für die Kolonialherren die Eingeborenen und für die besitzenden Klassen die Proletarier. Als abschließendes Ergebnis einer eingehenden Studie über die verschiedenen Gestalten primitiver Gesellschaften konnte Lévi-Strauss feststellen: «Der Übergang vom Naturzustand zum Kulturzustand wird nach der Befähigung der Menschen bestimmt, biologische Beziehungen in Gegensatzsystemen zu denken: Dualität, Wechselfolge, Gegensatz und Symmetrie, ob sie nun in eindeutiger oder verschwommener Form vorkommen, stellen nicht so sehr erklärungsbedürftige Phänomene dar, als daß sie die grundlegenden, unmittelbaren Gegebenheiten der sozialen Wirklichkeit bilden.»[*] Diese Phänomene blieben unverständlich, wenn die menschliche Realität ausschließlich ein auf Solidarität und Freundschaft beruhendes Mitsein wäre. Sie werden erst begreiflich, wenn man wie Hegel im Bewußtsein selbst eine grundlegende Feindseligkeit gegenüber jedem anderen Bewußtsein entdeckt. Das Subjekt setzt sich nur, indem es sich entgegensetzt: es hat den Anspruch, sich als das Wesentliche zu behaupten und das Andere als das Unwesentliche, als Objekt zu konstituieren.
Nur setzt ihm das andere Bewußtsein seinerseits den gleichen Anspruch entgegen: auf Reisen stellt der Einheimische entrüstet fest, daß es in den Nachbarländern Einheimische gibt, die ihn als Fremden betrachten. Zwischen Dörfern, Stämmen, Nationen, Klassen gibt es Kriege, Potlatchs, Handelsbeziehungen, Verträge und Fehden, die der Idee des Anderen ihren absoluten Sinn nehmen und ihre Relativität offenbaren; Individuen und Gruppen sind wohl oder übel gezwungen, die Wechselseitigkeit ihrer Beziehung anzuerkennen. Wie aber kommt es dann, daß zwischen den Geschlechtern diese Wechselseitigkeit nicht hergestellt worden ist, daß der eine der beiden Begriffe sich als der einzig wesentliche behauptet hat und jede Relativität in Bezug auf sein Korrelat verleugnet, indem er dieses als die Alterität schlechthin definiert? Wieso fechten die Frauen die männliche Selbstherrlichkeit nicht an? Kein Subjekt versteht sich ohne weiteres spontan als das Unwesentliche. Nicht das Andere definiert das Eine, indem es sich selbst als das Andere definiert: es wird von dem Einen, das sich als das Eine versteht, als das Andere gesetzt. Damit aber die Umkehrung vom Anderen zum Einen nicht vollzogen wird, muß das Andere sich diesem fremden Standpunkt unterwerfen. Woher kommt diese Unterwerfung bei der Frau?
Es gibt auch sonst Fälle, in denen es einer Kategorie für kürzere oder längere Zeit gelungen ist, eine andere vollständig zu beherrschen. Oft entsteht dieses Vorrecht aufgrund einer zahlenmäßigen Ungleichheit: die Mehrheit zwingt der Minderheit ihr Gesetz auf oder verfolgt sie. Aber die Frauen sind keine Minderheit wie die Schwarzen in Amerika oder die Juden: es gibt ebenso viele Frauen wie Männer auf der Erde. Oft waren die beiden vorhandenen Gruppen auch zunächst unabhängig: sie wußten nichts voneinander, oder jede ließ die Autonomie der anderen zu; erst ein historisches Ereignis hat die schwächere der stärkeren untergeordnet: die jüdische Diaspora, die Einführung der Sklaverei in Amerika, die kolonialen Eroberungen sind datierbare Fakten. Hier hat es für die Unterdrückten ein Vorher gegeben: sie haben eine Vergangenheit, eine Tradition, manchmal eine Religion, eine Kultur gemeinsam. In diesem Sinne wäre Bebels Vergleich zwischen den Frauen und dem Proletariat bestens begründet: auch die Proletarier sind zahlenmäßig nicht unterlegen und haben nie eine Gemeinschaft für sich gebildet. Doch nicht ein Ereignis, sondern eine historische Entwicklung erklärt ihre Existenz als Klasse und das Vorkommen dieser Individuen in dieser Klasse. Proletarier hat es nicht immer gegeben: Frauen hat es immer gegeben. Sie sind Frauen aufgrund ihrer physiologischen Struktur. So weit die Geschichte zurückreicht, sind sie dem Mann immer untergeordnet gewesen: ihre Abhängigkeit ist nicht die Folge eines Ereignisses oder einer Entwicklung, sie ist nicht geschehen. Zum Teil erscheint die Alterität, eben weil sie nicht der Zufälligkeit des historischen Geschehens unterliegt, hier als ein Absolutes. Eine Situation, die im Laufe der Zeit entstanden ist, kann sich in einer anderen Zeit wieder auflösen: die Schwarzen von Haiti zum Beispiel haben es ja bewiesen. Natürliche Verhältnisse dagegen scheinen jeder Veränderung zu trotzen. In Wirklichkeit ist die Natur ebensowenig eine unwandelbare Gegebenheit wie die historische Realität. Wenn die Frau sich als das Unwesentliche erkennt, das sich nie ins Wesentliche umkehrt, so weil sie selbst diese Umkehrung nicht vollzieht. Die Proletarier sagen «wir». Die Schwarzen auch. Indem sie sich als Subjekte setzen, verwandeln sie die Bürger, die Weißen in «andere». Die Frauen sagen nicht «wir», außer auf bestimmten Kongressen, die theoretische Kundgebungen bleiben. Die Männer sagen «die Frauen», und diese übernehmen das Wort, um sich selbst zu bezeichnen. Aber sie setzen sich nicht authentisch als Subjekt. Die Proletarier haben in Rußland Revolution gemacht, die Schwarzen in Haiti, die Indochinesen in Indochina: das Handeln der Frauen ist immer nur symbolisches Agieren gewesen. Sie haben nur das erreicht, was die Männer ihnen zugestehen wollten. Sie haben nichts genommen: sie haben angenommen. Es fehlen ihnen nämlich konkrete Mittel, um sich zu einer Einheit zusammenzuschließen, die sich selbst setzt, indem sie sich entgegensetzt. Sie haben keine eigene Vergangenheit, Geschichte oder Religion. Sie bilden im Gegensatz zu den Proletariern keine Arbeits- und Interessengemeinschaft. Zwischen ihnen gibt es nicht einmal das räumliche Miteinander, das die amerikanischen Schwarzen, die Juden in den Gettos, die Arbeiter von Saint-Denis oder die der Renault-Werke zu einer Gemeinschaft macht. Sie leben verstreut unter den Männern, sind durch Wohnung, Arbeit, ökonomische Interessen und die soziale Stellung enger mit bestimmten Männern – sei es der Vater oder der Ehemann – verbunden als mit den anderen Frauen. Als bürgerliche Frauen sind sie solidarisch mit den bürgerlichen Männern und nicht mit den Frauen des Proletariats, als Weiße mit den weißen Männern und nicht mit den schwarzen Frauen. Das Proletariat könnte sich vornehmen, die herrschende Klasse niederzumetzeln; ein fanatischer Jude oder Schwarzer könnte davon träumen, sich das Geheimnis der Atombombe zu verschaffen und so eine ausschließlich jüdische oder schwarze Menschheit herbeizuführen: eine Frau kann die Männer nicht einmal im Traum ausrotten. Das Band, das sie mit ihren Unterdrückern verbindet, ist mit keinem anderen vergleichbar. Die Geschlechtertrennung ist nämlich eine biologische Gegebenheit, kein Merkmal der Menschheitsgeschichte. Aus einem ursprünglichen Mitsein hat die Gegensätzlichkeit sich allmählich herausgebildet, und die Frau hat sie nicht durchbrochen. Das Paar ist eine Grundeinheit, deren Hälften aneinander gefesselt sind: eine Spaltung der Gesellschaft nach Geschlechtern ist nicht möglich. Das ist das wesentliche Charakteristikum der Frau: sie ist das Andere in einem Ganzen, dessen Elemente einander brauchen.
Man könnte sich vorstellen, daß diese Gegenseitigkeit die Befreiung der Frau erleichtert hätte. Wenn Herkules zu Omphales Füßen Wolle spinnt, fesselt ihn sein Begehren: warum ist es Omphale nicht gelungen, dauerhafte Macht über ihn zu gewinnen? Um sich an Jason zu rächen, tötet Medea ihre Kinder: diese grausige Legende deutet an, daß die Frau aus ihrer Bindung an das Kind einen furchterregenden Einfluß hätte entwickeln können. In Lysistrata hat Aristophanes sich humoristisch eine Versammlung von Frauen ausgedacht, die versuchen, ihre Unentbehrlichkeit für die Männer gleichsam zu sozialen Zwecken auszubeuten: aber es ist nur eine Komödie. Die Legende von den geraubten Sabinerinnen, die sich ihren Entführern mit hartnäckiger Unfruchtbarkeit widersetzt haben sollen, erzählt auch, daß die Männer den Widerstand der Frauen durch Auspeitschen mit Lederriemen auf magische Weise gebrochen haben. Das biologische Bedürfnis, das das männliche Wesen vom weiblichen abhängig macht – der Sexualtrieb und der Wunsch nach Nachkommen –, hat nicht zur sozialen Befreiung der Frau geführt. Auch Herr und Sklave sind durch ein gegenseitiges wirtschaftliches Bedürfnis miteinander verbunden, das den Sklaven nicht befreit, weil der Herr in seiner Beziehung zum Sklaven das Bedürfnis nach dem anderen nicht setzt. Er hat die Macht, dieses Bedürfnis zu befriedigen; er vermittelt es nicht. Der Sklave in seiner Abhängigkeit, Hoffnung oder Angst dagegen verinnerlicht, daß er seines Herrn bedarf. Die Dringlichkeit des Bedürfnisses wirkt sich, selbst wenn sie bei beiden gleich stark ist, immer zugunsten des Unterdrückers gegen den Unterdrückten aus: das erklärt zum Beispiel, warum die Befreiung der Arbeiterklasse so langsam vonstatten ging. Nun war die Frau wenn schon nicht die Sklavin des Mannes, so doch immer seine Vasallin; beide Geschlechter haben sich die Welt nie gleichmäßig geteilt, und noch heute ist die Frau, obwohl ihre Lage sich allmählich ändert, stark zurückgesetzt. In fast keinem Land ist sie dem Mann rechtlich gleichgestellt, oft sogar erheblich benachteiligt. Selbst wenn ihr bestimmte Rechte theoretisch zuerkannt worden sind, verhindert eine lange Gewohnheit, daß diese im alltäglichen Umgang konkret zum Ausdruck kommen. Wirtschaftlich bilden Männer und Frauen fast zwei Kasten: bei gleichen Voraussetzungen haben die Männer vorteilhaftere Stellungen, höhere Löhne, mehr Aufstiegschancen als ihre neuen Konkurrentinnen. Sie haben in der Industrie, in der Politik usw. viel mehr Stellen inne und besetzen die wichtigsten Posten. Außer ihrer konkreten Macht besitzen sie ein Prestige, dessen Tradierung durch die gesamte Kindererziehung gewährleistet wird: die Gegenwart umschließt die Vergangenheit, und in der Vergangenheit ist alle Geschichte von den Männern gemacht worden. In dem Augenblick, in dem die Frauen anfangen, sich an der Gestaltung der Welt zu beteiligen, gehört diese Welt noch den Männern: sie, die Männer, zweifeln nicht, die Frauen zweifeln kaum daran. Eine Weigerung, das Andere zu sein, eine Ablehnung der Komplizenschaft mit dem Mann hieße für die Frau, auf alle Vorteile zu verzichten, die das Bündnis mit der höheren Kaste ihr bringen kann. Der Mann als Herrscher wird die Frau als Hörige materiell beschützen und es übernehmen, ihre Existenz zu rechtfertigen: mit dem ökonomischen umgeht sie auch das metaphysische Risiko einer Freiheit, die ihre Ziele ohne Hilfe erfinden muß. Neben dem ethischen Anspruch jedes Individuums, sich als Subjekt zu behaupten, gibt es in ihm die Versuchung, seine Freiheit zu fliehen und sich als Ding zu konstituieren: ein unheilvoller Weg, denn passiv, entfremdet, verloren, ist es fremden Willen ausgeliefert, von seiner Transzendenz abgeschnitten, jedes Wertes beraubt. Aber es ist ein bequemer Weg: man vermeidet so die Angst und Spannung einer selbstverantwortlichen Existenz. Der Mann, der die Frau als eine Andere konstituiert, trifft bei ihr also auf weitgehendes Einverständnis. Die Frau erhebt nicht den Anspruch, Subjekt zu sein, weil ihr die konkreten Möglichkeiten dazu fehlen, weil sie ihre Bindung an den Mann als notwendig empfindet, ohne deren Reziprozität zu setzen, und weil sie sich oft in ihrer Rolle als Andere gefällt.
Doch sogleich taucht eine Frage auf: wie hat diese ganze Geschichte angefangen? Verständlich ist, daß die Dualität der Geschlechter wie jede Dualität in einem Konflikt zum Ausdruck gekommen ist. Verständlich ist, daß, wenn es einem der beiden gelungen ist, seine Überlegenheit durchzusetzen, diese sich als absolut einbürgern mußte. Zu erklären bleibt, wieso es der Mann war, der am Anfang gewonnen hat. Es scheint, daß die Frauen hätten siegen oder daß der Kampf unentschieden hätte bleiben können. Wie kommt es, daß diese Welt immer den Männern gehört hat und daß die Dinge erst heute anfangen, sich zu verändern? Ist diese Veränderung etwas Gutes? Wird sie eine gleichmäßige Aufteilung der Welt zwischen Männern und Frauen bringen?
Diese Fragen sind keineswegs neu; es hat schon viele Antworten darauf gegeben. Aber die bloße Tatsache, daß die Frau anders ist, macht alle Rechtfertigungen, die je von Männern vorgebracht wurden, anfechtbar: zu offenkundig waren sie von deren Eigennutz diktiert. «Alles, was von Männern über Frauen geschrieben wurde, muß verdächtig sein, da sie zugleich Richter und Partei sind», sagte im 17. Jahrhundert Poulain de la Barre, ein kaum bekannter Feminist. Überall und zu allen Zeiten haben Männer ihre Genugtuung darüber bekundet, die Krönung der Schöpfung zu sein. «Gelobt seist Du, Gott, unser Herr und Herr der Welt, der mich nicht zu einem Weibe hat gemacht», sprechen die Juden in ihrem Morgengebet, während ihre Ehefrauen resigniert murmeln: «Gelobt seist Du, Gott, der mich nach seinem Willen hat geschaffen.» Unter den Wohltaten, für die Platon den Göttern dankte, war die erste, daß sie ihn frei und nicht als Sklaven erschaffen hatten, die zweite, daß er ein Mann und keine Frau geworden war. Doch die Männer hätten dieses Privileg nicht in vollem Umfang genießen können, wenn sie es nicht als im Absoluten und im Ewigen begründet angesehen hätten: aus ihrer faktischen Suprematie haben sie ein Recht zu machen versucht. «Da es Männer waren, die die Gesetze gemacht und zusammengestellt haben, begünstigten sie ihr Geschlecht, und die Rechtsgelehrten verkehrten die Gesetze in Privilegien», sagte Poulain de la Barre weiter. Gesetzgeber, Priester, Philosophen, Schriftsteller und Gelehrte haben alles eingesetzt, um zu beweisen, daß die Unterordnung der Frau im Himmel gewollt und für die Erde nützlich sei. Die von den Männern geschaffenen Religionen spiegeln denselben Herrschaftswillen wider: aus den Legenden von Eva und Pandora haben sie Waffen geschmiedet. Sie haben sich die Philosophie und die Theologie dienstbar gemacht, wie aus den zitierten Sätzen von Aristoteles und Thomas von Aquin zu ersehen ist. Seit der Antike hat es Satirikern und Moralisten gefallen, ein Bild der weiblichen Schwäche zu zeichnen. Man kennt die heftigen Anklagen, die sich quer durch die ganze französische Literatur ziehen: etwas weniger ungestüm greift Montherlant die Tradition eines Jean de Meung wieder auf. Diese Feindseligkeit erscheint manchmal begründet, oft völlig willkürlich; in Wahrheit verbirgt sich dahinter ein mehr oder weniger geschickt getarnter Wunsch nach Selbstrechtfertigung. «Es ist leichter, ein Geschlecht anzuklagen, als das andere zu entschuldigen», sagt Montaigne. In manchen Fällen ist offenkundig, wie die Sache läuft. So fällt zum Beispiel auf, daß das römische Recht, um die Rechte der Frau einzuschränken, ausgerechnet dann auf die «Dummheit und Gebrechlichkeit des weiblichen Geschlechts» hinweist, wenn dieses bei einer Schwächung der Familie zu einer Gefahr für die männlichen Erben wird. Ebenso fällt auf, daß man im 16. Jahrhundert, um die verheiratete Frau unter Vormundschaft zu halten, sich auf die Autorität des Augustinus beruft und erklärt, «die Frau ist eine Kreatur ohne Festigkeit und ohne Halt», wohingegen der unverheirateten die Befähigung, ihren Besitz zu verwalten, zuerkannt wird. Montaigne hat das Willkürliche und Ungerechte an dem der Frau zugewiesenen Los sehr richtig gesehen: «Die Frauen haben durchaus nicht unrecht, wenn sie die Regeln dieser Welt ablehnen, zumal die Männer sie ohne ihre Mitwirkung gemacht haben. Zwischen ihnen und uns gibt es naturgemäß Zwist und Streit.» Er geht jedoch nicht so weit, sich zu ihrem Vorkämpfer zu machen. Erst im 18. Jahrhundert nehmen sich überzeugt demokratisch denkende Männer dieser Frage objektiv an. Als einer von ihnen versucht Diderot beharrlich aufzuzeigen, daß die Frau genau wie der Mann ein menschliches Wesen ist. Etwas später ist es Stuart Mill, der sie leidenschaftlich verteidigt. Aber diese Philosophen sind außergewöhnlich unparteiisch. Im 19. Jahrhundert wird der Feminismusstreit wieder zum Parteienstreit. Eine Folge der industriellen Revolution ist die Teilnahme der Frau an der produktiven Arbeit: damit treten die feministischen Forderungen aus der Theorie heraus und gewinnen ökonomische Grundlagen. Ihre Gegner werden um so aggressiver. Obwohl der Grundbesitz an Bedeutung verloren hat, klammert sich das Bürgertum an die alte Moral, die in der Intaktheit der Familie den Garanten für den Privatbesitz sieht: es fordert das Verbleiben der Frau am häuslichen Herd um so schärfer, als ihre Emanzipation eine echte Bedrohung wird. Selbst innerhalb der Arbeiterklasse haben die Männer versucht, den Befreiungsprozeß zu bremsen, weil die Frauen ihnen als gefährliche Konkurrentinnen erschienen und es obendrein gewohnt waren, zu niedrigen Löhnen zu arbeiten. Um die Unterlegenheit der Frau zu beweisen, haben die Antifeministen damals nicht nur wie vordem die Religion, die Philosophie und die Theologie herangezogen, sondern auch die Naturwissenschaften – die Biologie, die Experimentalpsychologie usw. Man war allenfalls bereit, dem anderen Geschlecht «Gleichheit in der Unterschiedlichkeit» zuzugestehen. Diese Formel, die großen Anklang gefunden hat, ist sehr bezeichnend: genau dieselbe wird in den Jim-Crow-Gesetzen auf die amerikanischen Schwarzen angewandt: diese angeblich egalitäre Segregation hat nur zur schlimmsten Diskriminierung geführt. Die Übereinstimmung ist keineswegs zufällig: ob die untergeordnete Position einer Rasse, einer Kaste, einer Klasse oder einem Geschlecht zugewiesen wird, die Rechtfertigungsmechanismen sind immer gleich. Dem «Ewigweiblichen» entspricht die «schwarze Seele» und der «jüdische Charakter». Insgesamt ist das jüdische Problem allerdings sehr verschieden von den beiden anderen: der Jude ist für den Antisemiten weniger ein Unterlegener als vielmehr ein Feind, und ihm wird in dieser Welt kein eigener Platz zugebilligt – eher möchte man ihn vernichten. Doch zwischen der Situation der Frauen und der der Schwarzen gibt es tiefgreifende Analogien: die einen wie die anderen emanzipieren sich heute von derselben Bevormundung, und die bisherige Herrenkaste will sie dort festhalten, «wo sie hingehören», d.h. auf dem Platz, den sie ihnen zugedacht hat. In beiden Fällen ergeht sie sich in mehr oder weniger aufrichtigen Elogen über die Tugenden des «guten Schwarzen» mit der naiven, kindlichen, heiteren Seele, des Schwarzen, der sich in sein Schicksal ergeben hat, und der «wirklich weiblichen Frau», d.h. der frivolen, kindischen und verantwortungslosen, die sich dem Mann unterordnet. In beiden Fällen bezieht sie ihre Argumente aus einem Tatbestand, den sie selbst geschaffen hat. Man kennt ja den Ausspruch von George Bernard Shaw, der sinngemäß besagt: «Der weiße Amerikaner verweist den Schwarzen auf die Stufe eines Schuhputzers und schließt daraus, daß er nur zum Schuhputzen taugt.» Diesen circulus vitiosus findet man unter allen analogen Umständen wieder: wenn ein Individuum oder eine Gruppe von Individuen in Unterlegenheit gehalten wird, so ist sie eben unterlegen, doch müßte man sich zuerst einmal über die Bedeutung des Wortes sein verständigen. Die Unaufrichtigkeit besteht darin, ihm einen substantiellen Charakter zu geben, während es den dynamischen Sinn hat, den Hegel ihm verleiht: sein heißt geworden sein, heißt zu dem gemacht worden sein, als was man in Erscheinung tritt. Ja, die Frauen insgesamt sind den Männern heute unterlegen, d.h. ihre Situation eröffnet ihnen geringere Möglichkeiten: die Frage ist nur, ob es ewig bei diesem Stand der Dinge bleiben soll.
Viele Männer wünschen es: noch haben nicht alle die Waffen gestreckt. Das konservative Bürgertum sieht in der Emanzipation der Frau weiterhin eine Gefahr, die seine Moral und seine Interessen bedroht. Manche Männer fürchten die weibliche Konkurrenz. In Hebdo-Latin erklärte kürzlich ein Student: «Jede Studentin, die Ärztin oder Anwältin wird, stiehlt uns einen Arbeitsplatz.» Dieser junge Mann stellte sein Anrecht auf diese Welt nicht in Frage. Es geht aber nicht allein um wirtschaftliche Interessen. Ein Vorteil, den die Unterdrückung den Unterdrückern verschafft, besteht darin, daß noch der Geringste von ihnen sich überlegen fühlt: ein «armer Weißer» im Süden der USA kann sich damit trösten, daß er kein «dreckiger Neger» ist, und die wohlhabenderen Weißen beuten diesen Dünkel geschickt aus. Ebenso hält sich auch das minderwertigste männliche Wesen den Frauen gegenüber für einen Halbgott. Für Henry de Montherlant war es sehr viel leichter, sich als Helden zu sehen, wenn er sich (überdies eigens hierfür ausgewählten) Frauen gegenüberstellte, als wenn er unter Männern seine Männerrolle einnehmen mußte: eine Rolle, in der viele Frauen besser abgeschnitten haben als er. So konnte Claude Mauriac – dessen ungeheure Originalität allseits bewundert wird – denn auch im September 1948 in einem seiner Artikel im Figaro littéraire über die Frauen schreiben, oder er meinte, schreiben zu können: «Wir lauschen im Ton (sic!) höflicher Gleichgültigkeit … der brillantesten von ihnen, wohlwissend, daß ihr Geist mehr oder weniger glänzende Ideen wiedergibt, die von uns stammen.» Es sind dies natürlich nicht die Ideen des Herrn Mauriac persönlich, denn man weiß ja, daß er gar keine hat. Daß die Frau Ideen wiedergibt, die von Männern stammen, mag durchaus sein: auch unter den Angehörigen des männlichen Geschlechts gibt es mehr als einen, der Meinungen für seine eigenen hält, die er nicht erfunden hat. Man muß sich fragen, ob Claude Mauriac sich nicht besser mit einem guten Spiegelbild von Descartes, Marx oder Gide unterhalten sollte als mit sich selbst. Bemerkenswert ist, daß er sich durch das zweideutige Wir mit Paulus, Hegel, Lenin und Nietzsche identifiziert und, von deren Größe erhöht, verächtlich auf die Herde Frauen herabblickt, die es wagen, von gleich zu gleich mit ihm zu sprechen. Ehrlich gesagt kenne ich mehr als eine, die nicht die Geduld hätte, für Herrn Mauriac einen «Ton höflicher Gleichgültigkeit» aufzubringen.
Ich bin auf dieses Beispiel so ausführlich eingegangen, weil es die männliche Naivität in entwaffnender Weise zeigt. Es gibt viele andere und subtilere Arten, wie die Männer sich die Alterität der Frau zunutze machen. Für alle, die unter Minderwertigkeitskomplexen leiden, gibt sie einen wunderbaren Balsam ab: niemand ist den Frauen gegenüber arroganter, aggressiver oder verächtlicher als ein in seiner Männlichkeit verunsicherter Mann. Die Männer, die sich von ihresgleichen nicht eingeschüchtert fühlen, sind auch viel eher bereit, die Frau als ihresgleichen anzuerkennen. Doch selbst ihnen ist der Mythos Frau, der Mythos vom Anderen, aus vielen Gründen teuer[*]; man kann es ihnen nicht verübeln, daß sie all die Annehmlichkeiten, die sie daraus beziehen, nicht leichten Herzens opfern; sie wissen, was sie verlieren, wenn sie auf die Frau ihrer Träume verzichten; sie wissen aber nicht, was die Frau von morgen ihnen bringen wird. Viel Selbstverleugnung ist nötig, um sich nicht länger als einziges und absolutes Subjekt zu setzen.
Dieser Anspruch wird von der großen Mehrheit der Männer übrigens gar nicht ausdrücklich erhoben. Die meisten setzen die Frau nicht als Unterlegene, sie sind heute zu sehr vom demokratischen Gedankengut durchdrungen, um nicht alle Menschen als gleich zu betrachten. Das Kind, der junge Mann hat die Frau innerhalb der Familie als Person mit der gleichen sozialen Würde wie die männlichen Erwachsenen erlebt. Später hat er im Begehren und in der Liebe den Widerstand, die Unabhängigkeit der begehrten und geliebten Frau erfahren. Einmal verheiratet, respektiert er seine Frau als Ehefrau und Mutter, und sie behauptet sich in der konkreten Erfahrung des Ehelebens ihm gegenüber als Freiheit. Er kann sich also einreden, es gebe unter den Geschlechtern keine soziale Rangordnung mehr und die Frau sei im großen und ganzen über die Unterschiede hinweg gleich. Da er jedoch bestimmte Unterlegenheiten feststellt – vor allem die fehlende berufliche Qualifikation –, schreibt er diese der Natur zu. Wenn er der Frau gegenüber eine kooperative, wohlwollende Haltung einnimmt, diskutiert er über das theoretische Gleichheitsprinzip, ohne die praktische Ungleichheit, die er beobachtet, zu setzen. Doch sobald er in Konflikt mit der Frau gerät, kehrt sich die Situation um: er diskutiert die praktische Ungleichheit und leugnet unter Berufung darauf sogar die theoretische. So erklärt er beispielsweise, daß er seine Frau durch den fehlenden Beruf in keiner Weise herabgesetzt sieht: die Aufgaben im Haushalt seien ebenso wertvoll usw. Doch schon beim ersten Streit ruft er: «Du wärst ja gar nicht in der Lage, ohne mich für deinen Lebensunterhalt zu sorgen.» Viele Männer behaupten scheinbar aufrichtig, daß die Frauen ihnen gleich sind, daß sie nichts zu fordern brauchen; und gleichzeitig sagen sie, die Frauen könnten den Männern nie gleich werden, ihre Forderungen wären vergeblich. Ein Mann kann schwer ermessen, wie außerordentlich groß die Bedeutung sozialer Diskriminierungen ist, die von außen unerheblich erscheinen, deren moralische und intellektuelle Auswirkungen auf die Frau aber so tief gehen, daß es den Anschein haben kann, sie entsprängen einer Urnatur. Selbst bei den größten Sympathien für die Frau weiß der Mann nie richtig über ihre konkrete Situation Bescheid. Daher gibt es keinen Grund, den Männern zu glauben, die sich der Tragweite der Privilegien, die sie zu verteidigen suchen, nicht einmal bewußt sind. Wir werden uns also von der Vielzahl und Heftigkeit der Angriffe gegen die Frauen nicht einschüchtern lassen, auch werden wir uns nicht von den eigennützigen Lobreden auf die «wahre Frau» einwickeln oder uns von der Begeisterung anstecken lassen, die das weibliche Schicksal bei Männern wachruft, welche es um nichts in der Welt teilen möchten.
Den Argumenten der Feministinnen sollten wir allerdings nicht weniger mißtrauisch begegnen: oft macht das polemische Anliegen sie ganz wertlos. Daß die Frauenfrage so ergebnislos geblieben ist, liegt an der männlichen Arroganz, die einen «Streit» daraus gemacht hat; wenn man sich streitet, argumentiert man nicht mehr gut. Man hat unablässig zu beweisen versucht, daß die Frau dem Mann überlegen, unterlegen oder gleich sei: nach Adam erschaffen, ist sie offenkundig ein zweitrangiges Wesen, sagten die einen; im Gegenteil, sagten die anderen, Adam war nur ein Rohentwurf, und der vollkommene Mensch ist Gott erst gelungen, als er Eva schuf. Ihr Gehirn ist kleiner als seines: relativ gesehen ist es aber größer. Christus kam als Mann auf die Welt: vielleicht tat er es aus Demut. Jedes Argument ruft sofort das gegenteilige hervor, und oft gehen beide daneben. Um klarzusehen, muß man diese eingefahrenen Gleise verlassen; man muß den verschwommenen Begriffen Überlegenheit, Unterlegenheit und Gleichheit, die alle Diskussionen entstellt haben, eine Absage erteilen und ganz von vorn beginnen.
Wie aber sollen wir dann die Frage stellen? Und zunächst einmal, wer sind wir, daß wir sie stellen? Die Männer sind Richter und Partei: die Frauen ebenfalls. Wo soll man einen Engel finden? Aber auch ein Engel wäre schlecht geeignet, etwas dazu zu sagen; alle Grundlagen des Problems wären ihm unbekannt. Der Hermaphrodit ist ein Sonderfall: er ist nicht sowohl Mann wie Frau, sondern weder Mann noch Frau. Ich glaube, die besten Voraussetzungen zur Klärung der Situation der Frau haben immer noch bestimmte Frauen. Es wäre ein Trugschluß, Epimenides auf den Begriff Kreter und die Kreter auf den des Lügners festlegen zu wollen: es ist keine geheimnisvolle Essenz, die Männern und Frauen Aufrichtigkeit oder Unaufrichtigkeit diktiert; es ist vielmehr ihre Situation, die sie mehr oder weniger zur Wahrheitssuche befähigt. Viele Frauen von heute, die das Glück hatten, daß ihnen alle Privilegien des Menschen zurückgegeben wurden, können sich den Luxus der Unparteilichkeit leisten: wir haben sogar ein Bedürfnis danach. Wir sind nicht mehr so im Kampf wie unsere Vorläuferinnen, wir haben die Partie im großen und ganzen gewonnen. Bei den letzten Diskussionen über den Status der Frau hat die UNO nachdrücklich gefordert, daß die Gleichberechtigung der Geschlechter vollständig verwirklicht werden muß, und viele von uns haben ihre Weiblichkeit schon nicht mehr als Behinderung oder Einschränkung zu empfinden brauchen. Uns erscheinen zahlreiche Probleme wesentlicher als die, die speziell uns betreffen: eben diese Distanziertheit läßt uns hoffen, daß unsere Haltung objektiv sein wird. Außerdem sind wir mit der weiblichen Welt vertrauter als die Männer, weil wir in ihr unsere Wurzeln haben; wir begreifen unmittelbarer, was es für einen Menschen bedeutet, weiblich zu sein, und uns liegt mehr daran, es zu erfahren. Ich habe gesagt, daß es wesentlichere Probleme gibt, doch bleibt es meiner Ansicht nach von erheblicher Bedeutung, inwieweit die Tatsache, daß wir Frauen sind, unser Leben beeinflußt hat. Welche Chancen wurden uns im einzelnen gegeben und welche wurden uns vorenthalten? Welches Los können unsere jüngeren Schwestern erwarten, und welche Richtung soll man ihnen empfehlen? Auffällig ist, daß es der gesamten Frauenliteratur heutzutage viel weniger um Forderungen geht als um ein Streben nach Klarheit. Am Ende einer Zeit wirrer Polemiken soll dieses Buch ein Versuch unter anderen sein, die Dinge auf den Punkt zu bringen.
Aber es ist wohl unmöglich, irgendein menschliches Problem ohne Voreingenommenheit zu behandeln: schon die Art der Fragestellung, der Blickwinkel, den man einnimmt, setzt eine Interessenhierarchie voraus: jede Position schließt Werte ein; es gibt keine «objektive» Beschreibung, die nicht einen ethischen Hintergrund hätte. Statt die Prinzipien, von denen man mehr oder weniger stillschweigend ausgeht, zu verschleiern, sollte man sie lieber vorher nennen. Dann braucht man nicht auf jeder Buchseite zu erläutern, welchen Sinn man Wörtern wie überlegen, unterlegen, besser, schlechter, Fortschritt, Regression usw. verleiht. Wenn wir uns einige der Werke, die sich mit der Frau beschäftigen, in Erinnerung rufen, entdecken wir, daß der häufigste Standpunkt der des Gemeinwohls, des öffentlichen Interesses ist: in Wirklichkeit versteht jeder darunter das Interesse der Gesellschaft, die so ist, wie er sie erhalten oder errichten möchte. Wir dagegen meinen, daß es kein anderes Gemeinwohl gibt als das, welches das private Wohl der Bürger sichert. Wir beurteilen die Institutionen nach den konkreten Möglichkeiten, die sie den Individuen bieten. Aber deshalb verwechseln wir die Idee des Privatinteresses noch lange nicht mit der des Glücks: auch dies ist ein Standpunkt, dem man oft begegnet. Sind die Frauen im Harem nicht glücklicher als eine Wahlberechtigte? Ist die Hausfrau nicht glücklicher als die Arbeiterin? Dabei weiß man nicht so recht, was das Wort glücklich bedeutet, und noch weniger, welche authentischen Werte es abdeckt. Es gibt keine Möglichkeit, das Glück eines anderen zu messen, und es ist leichter, die Situation für glücklich zu erklären, die man ihm aufzwingen will: besonders diejenigen, die man zur Stagnation verurteilt, werden unter dem Vorwand, Glück sei Unbeweglichkeit, für glücklich erklärt. Glück ist also ein Begriff, auf den wir uns nicht beziehen. Unsere Perspektive ist die der existentialistischen Ethik. Jedes Subjekt setzt sich durch Entwürfe konkret als eine Transzendenz. Es verwirklicht seine Freiheit nur durch deren ständiges Überschreiten auf andere Freiheiten hin. Es gibt keine andere Rechtfertigung der gegenwärtigen Existenz als ihre Ausdehnung in eine unendlich offene Zukunft. Jedes Mal wenn die Transzendenz in Immanenz zurückfällt, findet eine Herabminderung der Existenz in ein «An-sich» und der Freiheit in Faktizität statt. Dieses Zurückfallen ist, wenn das Subjekt es bejaht, eine moralische Verfehlung; wird es ihm auferlegt, führt es zu Frustration und Bedrückung; in beiden Fällen ist es ein absolutes Übel. Jedes Individuum, dem daran liegt, seine Existenz zu rechtfertigen, empfindet sie als ein unendliches Bedürfnis, sich zu transzendieren. Was nun die Situation der Frau in einzigartiger Weise definiert, ist, daß sie sich – obwohl wie jeder Mensch eine autonome Freiheit – in einer Welt entdeckt und wählt, in der die Männer ihr vorschreiben, die Rolle des Anderen zu übernehmen; sie soll zum Objekt erstarren und zur Immanenz verurteilt sein, da ihre Transzendenz fortwährend von einem essentiellen, souveränen anderen Bewußtsein transzendiert wird. Das Drama der Frau besteht in diesem Konflikt zwischen dem fundamentalen Anspruch jedes Subjekts, das sich immer als das Wesentliche setzt, und den Anforderungen einer Situation, die sie als unwesentlich konstituiert. Wie kann ein Mensch sich im Frau-Sein verwirklichen? Welche Wege stehen ihm offen? Welche enden in Sackgassen? Wie kann man in der Abhängigkeit wieder Unabhängigkeit erlangen? Was schränkt die Freiheit der Frau ein, und kann sie diese Umstände überwinden? Das sind die grundlegenden Fragen, die ich klären möchte. Wenn ich also an den Möglichkeiten des Individuums interessiert bin, so nicht in Begriffen des Glücks, sondern in Begriffen der Freiheit.
Selbstverständlich wäre die ganze Sache sinnlos, wenn wir davon ausgingen, die Frau unterläge einer schicksalhaften physiologischen, psychologischen oder ökonomischen Bestimmung. Deshalb wollen wir zunächst die Einstellungen der Biologie, der Psychoanalyse und des historischen Materialismus zum Thema Frau erörtern. Anschließend werden wir anhand von Beispielen zu zeigen versuchen, wie die «weibliche Realität» sich konstituiert hat, warum die Frau als das Andere definiert wurde und welche Konsequenzen dies aus der Sicht der Männer hatte. Im Zweiten Buch werden wir die Welt aus der Sicht der Frauen beschreiben: wir werden die Schwierigkeiten verstehen können, auf die sie bei ihrem Versuch stoßen, aus der ihnen bisher zugewiesenen Sphäre auszubrechen und am menschlichen Mitsein teilzunehmen.
Erster TeilSchicksal
IDie biologischen Gegebenheiten
Was ist eine Frau? Ganz einfach, sagen die Freunde einfacher Formeln: sie ist ein Uterus mit Ovarien; sie ist ein Weibchen: mit diesem Wort ist sie ausreichend definiert. Aus dem Mund des Mannes klingt die Benennung «Weibchen» wie eine Beleidigung. Er dagegen schämt sich seiner Animalität nicht, er ist sogar stolz, wenn man von ihm sagt: «Er ist ungeheuer männlich!» Der Ausdruck «Weibchen» ist nicht deshalb abwertend, weil er die Frau in der Natur verankert, sondern weil er sie in ihr Geschlecht einsperrt. Und daß der Mann dieses Geschlecht selbst bei unschuldigen Tieren als verächtlich und feindlich empfindet, liegt offenbar an der ängstlichen Feindseligkeit, die die Frau in ihm wachruft. Eine Rechtfertigung für dieses Gefühl will er in der Biologie finden. Das Wort «Weibchen» löst in ihm einen wilden Reigen von Bildern aus: ein gewaltiges rundes Ovulum schnappt nach dem beweglichen Spermatozoon und kastriert es. Monströs und vollgefressen herrscht die Termitenkönigin über die unterworfenen Männchen. Die Gottesanbeterinnen, die liebessatten Spinnen zermalmen ihren Partner und fressen ihn auf. Die läufige Hündin rennt durch die Gassen und hinterläßt eine Fährte perverser Gerüche. Die Äffin exhibiert sich schamlos und entzieht sich mit heuchlerischer Koketterie, und die majestätischsten Raubkatzen, die Tigerin, die Löwin, die Leopardin, kuschen unterwürfig, wenn das Männchen herrisch Besitz von ihnen ergreift. Indem der Mann die Frau als träge, ungeduldig, listig, dumm, unsensibel, geil, wild, gedemütigt sieht, projiziert er die Eigenschaften sämtlicher Tierweibchen auf sie. Sie ist tatsächlich ein Weibchen. Will man aber aufhören, in Gemeinplätzen zu denken, tauchen sofort zwei Fragen auf: Was stellt das Weibchen im Tierreich dar? Und welche besondere Art von Weibchen ist die Frau?
Männchen und Weibchen sind zwei Typen von Individuen, die sich innerhalb einer Art in Bezug auf die Fortpflanzung unterscheiden. Man kann sie nur aufeinander bezogen definieren. Zunächst aber muß darauf hingewiesen werden, daß der eigentliche Sinn der Unterteilung der Arten in zwei Geschlechter nicht klar ist.
In der Natur ist sie nicht allgemein verbreitet. Um nur die Tiere zu erwähnen, so weiß man ja, daß bei den Einzellern, wie Infusorien, Amöben, Bakterien usw., die Vermehrung etwas grundlegend anderes ist als Sexualität, da die Zellen zur selbständigen Teilung fähig sind. Bei manchen Metazoen vollzieht sich die Fortpflanzung durch Schizogonie, d.h. durch Zerfallen des Lebewesens, dessen Ursprung ebenfalls ungeschlechtlich ist, oder durch Blastogonie, d.h. durch Zerfallen des Lebewesens, das seinerseits auf einem sexuellen Phänomen beruht: die bei der Süßwasserhydra, den Zölenteraten, Schwämmen, Würmern und Manteltieren vorkommenden Phänomene des Knospens und der Furchung sind wohlbekannte Beispiele dafür. Bei der Parthenogenese entwickelt sich das unbefruchtete Ei ohne Mitwirkung des Männchens zum Embryo; dieses spielt keine oder nur eine zweitrangige Rolle: die nicht befruchteten Bieneneier unterteilen sich und bringen Drohnen hervor. Bei den Blattläusen gibt es über mehrere Generationen keine Männchen, und aus den nicht befruchteten Eiern werden Weibchen. Man hat beim Seeigel, Seestern und beim Frosch eine künstliche Parthenogenese herbeigeführt. Doch kommt es bei Protozoen vor, daß zwei Zellen verschmelzen und eine sogenannte Zygote bilden. Befruchtung ist nötig, damit aus den Eiern der Biene Weibchen, aus denen der Blattläuse Männchen entstehen. Manche Biologen haben daraus geschlossen, sogar bei den Arten, die imstande sind, sich asexuell fortzupflanzen, diene die Erneuerung des Keimplasmas durch eine Vermischung mit fremden Chromosomen der Verjüngung und Kräftigung des Stammes; man verstehe so, daß bei den komplexesten Lebensformen die Sexualität eine unerläßliche Funktion sei; nur die primitiven Organismen könnten sich ungeschlechtlich vermehren, wobei sie allerdings ihre Vitalität erschöpften. Diese Hypothese gilt heute jedoch als völlig unhaltbar. Beobachtungen haben gezeigt, daß die ungeschlechtliche Vermehrung sich unbegrenzt fortsetzen kann, ohne daß irgendeine Form von Degeneration auftritt. Besonders auffallend ist dies bei den Bakterien. Es sind immer zahlreichere, immer kühnere Experimente mit Parthenogenese durchgeführt worden, und bei vielen Arten hat das Männchen sich als vollständig unnütz erwiesen. Würde sich übrigens die Nützlichkeit eines interzellularen Austauschs nachweisen lassen, so stünde sie selbst doch als unbegründete bloße Tatsache da. Die Biologie stellt die Geschlechtertrennung zwar fest, aber wie sehr sie auch von zweckgerichtetem Denken durchdrungen sein mag, gelingt es ihr doch nicht, diese Trennung aus der Zellstruktur oder aus den Gesetzen der Zellvermehrung oder aus irgendeinem Urphänomen abzuleiten.
Das Vorkommen von verschiedenartigen Gameten, d.h. von Keimzellen, aus deren Verschmelzung das Ei entsteht, genügt nicht, um zwei unterschiedliche Geschlechter zu definieren. Tatsächlich kommt es häufig vor, daß die Differenzierung der Keimzellen nicht zu einer Aufspaltung der Spezies in zwei Typen führt: sie können beide von ein und demselben Lebewesen stammen. Dies gilt für die in der Pflanzenwelt so häufigen zwittrigen Arten, wie man sie auch bei vielen niederen Tieren, u.a. den Ringelwürmern und den Mollusken, findet. Die Fortpflanzung erfolgt entweder durch Selbstbefruchtung oder gegenseitige Befruchtung. Auch in diesem Punkt haben manche Biologen die bestehende Ordnung rechtfertigen wollen. Sie betrachten den Gonochorismus, d.h. das System, in dem die verschiedenen, Gonaden genannten Keimdrüsen unterschiedlichen Individuen angehören, als eine Weiterentwicklung der Zweigeschlechtlichkeit. Andere dagegen halten den Gonochorismus für ursprünglich und den Hermaphroditismus für dessen degenerierte Form. In jedem Fall enthalten diese Vorstellungen von der Überlegenheit eines Systems über das andere höchst anfechtbare Theorien. Was mit Sicherheit behauptet werden kann, ist, daß beide Fortpflanzungsmodi in der Natur nebeneinander vorkommen, daß einer wie der andere die Arterhaltung sichert und daß die Verschiedenartigkeit der gonadentragenden Organismen ebenso wie die der Gameten akzidentell zu sein scheint. Die Trennung der Individuen in Männchen und Weibchen stellt sich also als eine unreduzierbare und kontingente Tatsache dar.
Die meisten Philosophen haben diese Trennung als selbstverständlich hingenommen, ohne sie erklären zu wollen. Der platonische Mythos ist allgemein bekannt: am Anfang gab es Männer, Frauen und Androgyne; jedes Individuum hatte zwei Gesichter, vier Arme, vier Beine und zwei miteinander verbundene Körper. Sie wurden eines Tages entzweigeteilt, «wie man Eier teilt», und seither sucht jede Hälfte sich wieder mit ihrer Ergänzung zu vereinen: die Götter beschlossen daraufhin, daß durch die Paarung zweier ungleicher Hälften neue Menschen entstehen sollten. Aber diese Geschichte will nur die Liebe erklären: die Geschlechtertrennung wird als gegeben vorausgesetzt. Aristoteles rechtfertigt sie ebensowenig: wenn nämlich bei jeder Handlung das Zusammenwirken von Stoff und Form erforderlich ist, so müssen das aktive und das passive Prinzip nicht notwendigerweise auf zwei Kategorien verschiedenartiger Individuen verteilt sein. Thomas von Aquin erklärt die Frau zu einem «zufälligen» Wesen: eine Art und Weise, aus männlicher Perspektive das Akzidentelle der Sexualität zu behaupten. Hegel dagegen wäre seinem rationalistischen Furor untreu gewesen, hätte er nicht versucht, sie logisch zu begründen. Die Sexualität stellt ihm zufolge die Vermittlung dar, durch die das Subjekt sich konkret in seiner Gattung verwirklicht: «Die Gattung in ihm ist daher, als Spannung gegen die Unangemessenheit ihrer einzelnen Wirklichkeit, der Trieb, im Andern seiner Gattung sein Selbstgefühl zu erlangen, sich durch die Einung mit ihm zu integrieren, und durch diese Vermittlung die Gattung mit sich zusammenzuschließen und zur Existenz zu bringen – die Begattung.»[*] Und etwas weiter: «Der Prozeß ist, daß sie das, was sie an sich sind, eine Gattung, dieselbe subjektive Lebendigkeit, als solche setzen.» Darauf erklärt Hegel, daß es, damit der Prozeß der Annäherung statthaben kann, zuvor eine Differenzierung der beiden Geschlechter geben muß. Aber seine Beweisführung ist nicht überzeugend: man spürt darin zu deutlich die vorgefaßte Absicht, in jedem Vorgang die drei Prämissen des Syllogismus zu finden. Die Überschreitung des Individuums auf die Spezies hin, wodurch Individuum und Spezies sich in ihrer Wahrheit erfüllen, könnte sich ohne eine dritte Größe in der bloßen Beziehung des Erzeugers zum Kind vollziehen: die Fortpflanzung könnte ungeschlechtlich sein. Oder die Beziehung zwischen beiden könnte die zwischen zwei Gleichartigen sein, wobei die Differenzierung in jedem einzelnen Lebewesen desselben Typs läge, wie es bei den zweigeschlechtlichen Arten der Fall ist. Hegels Beschreibung hebt zwar eine sehr wichtige Bedeutung der Sexualität hervor, aber sein Irrtum ist wieder einmal, aus der Bedeutung eine Begründung zu machen. Indem die Menschen sexuell aktiv sind, definieren sie die Geschlechter und ihre Beziehung zueinander, wie sie den Sinn und Wert aller Funktionen erschaffen, die sie erfüllen: aber diese Aktivität ist nicht notwendigerweise in der Natur des Menschen enthalten. In seiner Phénoménologie de la perception (dt.: Phänomenologie der Wahrnehmung) weist Merleau-Ponty darauf hin, daß die menschliche Existenz uns zwingt, die Begriffe Notwendigkeit und Kontingenz zu revidieren. «Die Existenz», sagt er, «hat keine zufälligen Attribute, keinen Inhalt, der nicht dazu beiträgt, ihr Form zu geben, sie läßt in sich kein reines Faktum zu, weil sie die Bewegung ist, durch die die Fakten angenommen werden.» Das ist wahr. Wahr ist aber auch, daß es Bedingungen gibt, ohne die das Faktum der Existenz selbst unmöglich erschiene. Das In-der-Welt-sein impliziert unwiderlegbar das Vorhandensein eines Körpers, der sowohl ein Ding der Welt als auch eine Anschauung dieser Welt ist: doch es ist nicht erforderlich, daß dieser Körper diese oder jene besondere Struktur hat. In L’être et le néant (dt.: Das Sein und das Nichts) diskutiert Sartre die Behauptung Heideggers, wonach die menschliche Realität aufgrund ihrer Endlichkeit dem Tod gewidmet ist. Er legt dar, daß eine endliche und zeitlich unbegrenzte Existenz denkbar wäre; wenn dem menschlichen Leben indes nicht der Tod innewohnte, wäre die Beziehung des Menschen zur Welt und zu sich selbst so tief erschüttert, daß die Definition «der Mensch ist sterblich» sich als etwas ganz anderes erweist denn als eine empirische Wahrheit: wäre ein Existierendes unsterblich, so wäre es nicht mehr das, was wir einen Menschen nennen. Eines der wesentlichen Charakteristika seines Schicksals besteht darin, daß die Bewegung seines zeitlichen Lebens hinter und vor ihm die Unendlichkeit der Vergangenheit und der Zukunft schafft: die Erhaltung der Art scheint demnach das Korrelat der individuellen Begrenztheit zu sein. Man kann das Phänomen der Fortpflanzung also als ontologisch begründet ansehen. Weiter darf man aber nicht gehen: die Erhaltung der Art zieht nicht die Differenzierung der Geschlechter nach sich. Daß diese von den Existierenden in der Weise angenommen wird, daß sie rückwirkend in die konkrete Definition der Existenz eingeht, mag sein. Nichtsdestoweniger sind ein Bewußtsein ohne Körper, ein unsterblicher Mensch absolut undenkbar, wohingegen eine Gesellschaft, die sich durch Parthenogenese fortpflanzt oder aus Hermaphroditen besteht, vorstellbar ist.
Die Ansichten über die jeweilige Rolle der Geschlechter haben sich sehr gewandelt. Zunächst spiegelten sie ohne jede wissenschaftliche Grundlage lediglich soziale Mythen wider. Man hat lange geglaubt, und in manchen matrilinearen primitiven Gesellschaften glaubt man noch, der Vater habe keinen Anteil an der Empfängnis des Kindes: man meint, die Lemuren der Ahnen würden in Form von lebendigen Keimen in den Mutterleib eindringen. Beim Aufkommen des Patriarchats erhob der Mann energisch Anspruch auf seine Nachkommenschaft. Notgedrungen billigte man der Mutter zwar noch eine Rolle bei der Fortpflanzung zu, aber man räumte lediglich ein, daß sie den lebendigen Samen austrägt und nährt: Schöpfer war allein der Vater. Aristoteles stellte sich vor, der Fötus entstehe beim Zusammentreffen von Sperma und Menstruationsblut: bei dieser Symbiose liefert die Frau nur einen passiven Stoff, das männliche Prinzip ist Kraft, Aktivität, Bewegung, Leben. Das ist auch die Lehre des Hippokrates, der zwei Arten von Samen erkennt, einen schwachen oder weiblichen und einen starken, der männlich ist. Die aristotelische Theorie hat sich das ganze Mittelalter hindurch bis in die heutige Zeit erhalten.
Ende des 17. Jahrhunderts sezierte Harvey Hirschkühe kurz nach der Paarung und fand in den Falten des Uterus Bläschen, die er für die Eier hielt, die in Wirklichkeit aber Embryonen waren. Der Däne Steno gab den weiblichen Geschlechtsdrüsen, die man bis dahin «weibliche Testikel» nannte, die Bezeichnung Ovarien und stellte auf ihrer Oberfläche Bläschen fest, die Graaf 1677 fälschlich als Eier identifizierte und denen er seinen Namen gab. Die Ovarien wurden weiterhin als Entsprechungen der männlichen Drüsen angesehen. Im gleichen Jahr wurden die «Spermatierchen» entdeckt, und es wurde festgestellt, daß sie in den weiblichen Uterus eindringen. Man glaubte jedoch, sie würden sich dort nur ernähren, und das Individuum sei in ihnen schon vorgebildet. 1694 zeichnete der Holländer Hartsaker den im Spermatozoon verborgenen Homunkulus, und 1699 erklärte ein anderer Gelehrter, er habe gesehen, wie das Spermatozoon sich gewissermaßen häutete, und darunter sei ein kleiner Mensch sichtbar geworden, den er ebenfalls zeichnete. Die Funktion der Frau war in diesen Hypothesen darauf beschränkt, ein bereits vollständig ausgebildetes lebendiges, aktives Prinzip zu nähren.
Diese Theorien waren nicht allgemeingültig, und die Diskussionen darüber gingen bis ins 19. Jahrhundert weiter. Erst die Erfindung des Mikroskops machte es möglich, das tierische Ei zu untersuchen. 1827 identifizierte Baer das Ei der Säugetiere als ein Element in den Graafschen Follikeln. Bald darauf konnte eine Furchung beobachtet werden. 1835 wurde die Sarkode, das heißt das Protoplasma, entdeckt, dann die Zelle. Und 1877 konnte eine Beobachtung gemacht werden, die das Eindringen des Spermatozoons in das Ei des Seesterns bewies. Von da an wurde die Symmetrie der Keime beider Gameten als erwiesen angesehen. Ihre Verschmelzung wurde im einzelnen erstmals 1883 von einem belgischen Zoologen untersucht.
Die Ideen des Aristoteles hatten indes nicht jedes Ansehen verloren. Hegel meinte, die beiden Geschlechter müßten verschieden sein: das eine aktiv, das andere passiv, und es versteht sich von selbst, daß die Passivität das weibliche Los war. «Der Mann ist also durch diesen Unterschied das Tätige; das Weib aber ist das Empfangende, weil sie in ihrer unentwickelten Einheit bleibt. »[*] Auch nachdem das Ei als aktives Prinzip erkannt war, haben die Männer versucht, seiner Trägheit die Beweglichkeit des Samenfadens entgegenzuhalten. Heute zeichnet sich eine gegenläufige Tendenz ab: die Entdeckungen der Parthenogenese haben manche Wissenschaftler dazu verleitet, die Rolle des Männchens auf die eines bloßen physikochemischen Agens zu reduzieren. Es hat sich gezeigt, daß bei manchen Arten die Einwirkung einer Säure oder eine mechanische Reizung ausreichen kann, um die Eifurchung und die Entwicklung des Embryos auszulösen. Davon ausgehend wurde kühn vermutet, der männliche Gamet sei für die Zeugung nicht notwendig, er sei höchstens ein Ferment. Vielleicht wird die Mitwirkung des Mannes an der Fortpflanzung eines Tages überflüssig: das ist anscheinend der Wunsch zahlreicher Frauen. Nichts aber berechtigt zu einer so gewagten Vorwegnahme, denn nichts berechtigt zu einer Verallgemeinerung spezifischer Lebensprozesse. Die Phänomene der ungeschlechtlichen Vermehrung und der Parthenogenese sind ebenso ursprünglich wie die geschlechtliche Fortpflanzung. Diese ist, wie gesagt, nicht a priori bevorzugt, doch weist keine Tatsache darauf hin, daß sie auf einen elementareren Mechanismus zurückzuführen ist.
Wenn man also jede apriorische Doktrin, jede gewagte Theorie ablehnt, steht man einer Tatsache gegenüber, für die es weder eine ontologische Begründung noch eine empirische Rechtfertigung gibt und deren Tragweite nicht von vornherein erfaßbar ist. Erst wenn wir sie in ihrer konkreten Realität untersuchen, können wir hoffen, ihre Bedeutung aufzudecken: dann vielleicht wird sich der Inhalt des Wortes «Weibchen» herauskristallisieren.
Ich habe nicht vor, hier eine Lebensphilosophie anzubieten, auch will ich in dem Streit zwischen teleologischer und mechanistischer Auffassung nicht voreilig Partei ergreifen. Beachtenswert ist jedoch, daß alle Physiologen und Biologen, schon indem sie den vitalen Phänomenen einen Sinn unterstellen, eine mehr oder weniger finalistische Sprache gebrauchen. Ich werde ihre Terminologie übernehmen. Ohne Entscheidendes zu der Beziehung zwischen Leben und Bewußtsein zu sagen, kann man behaupten, daß jedes lebende Faktum auf eine Transzendenz hindeutet, daß sich in jeder Funktion ein Entwurf verfestigt: vor diesem Hintergrund sind meine Darstellungen zu verstehen.
Bei den allermeisten Arten wirken Männchen und Weibchen bei der Fortpflanzung zusammen. Sie sind grundlegend durch die von ihnen produzierten Gameten bestimmt. Bei einigen Algen und Pilzen sind die Zellen, die verschmelzen, um das Ei zu bilden, identisch; diese Fälle von Isogamie sind insofern bedeutsam, als sie die grundsätzliche Gleichwertigkeit der Gameten belegen. Im allgemeinen sind diese differenziert, aber ihre Analogie bleibt auffällig. Samen- und Eizellen sind das Ergebnis einer Evolution ursprünglich identischer Zellen: die Entwicklung der weiblichen Urzellen zu Oozyten weicht protoplasmatisch von der der Spermatozyten ab, die Phänomene des Zellkerns aber sind deutlich dieselben. Der 1903 von dem Biologen Ancel aufgestellte Satz ist noch heute gültig: «Eine noch nicht differenzierte, nicht keimfähige Zelle wird je nach den Bedingungen, die sie bei ihrem Auftreten in der Keimdrüse antrifft, männlich oder weiblich – Bedingungen, die durch die Umwandlung einer bestimmten Zahl von Epithelzellen in nährende, einen speziellen Stoff ausbildende Elemente hergestellt werden.» Diese ursprüngliche Verwandtschaft drückt sich in der Struktur der beiden Gameten aus, die innerhalb jeder Spezies dieselbe Zahl von Chromosomen enthalten. Bei der Befruchtung vereinigen die beiden Kerne ihre Substanz, und in jedem verringert sich die Zahl der Chromosomen um die Hälfte: diese Reduktion erfolgt in beiden auf analoge Weise; die beiden letzten Teilungen der Eizelle, die zur Bildung der Polarkörperchen führen, entsprechen den letzten Teilungen des Spermatozoons. Heute weiß man, daß je nach Art entweder der männliche oder der weibliche Gamet das Geschlecht bestimmt: bei den Säugetieren ist es das Spermatozoon, das ein grundsätzlich verschiedenes Chromosom aufweist, das potentiell männlich oder weiblich ist. Die Erbanlagen dagegen werden den Mendelschen Gesetzen entsprechend sowohl vom Vater wie von der Mutter weitergegeben. Wichtig ist die Feststellung, daß bei dieser Vereinigung keiner der Gameten dem anderen überlegen ist: beide geben ihre Individualität auf, das Ei absorbiert ihre gesamte Substanz. Demnach erweisen sich zwei landläufige Vorurteile – zumindest auf dieser grundlegenden biologischen Ebene – als falsch: zum einen das von der Passivität des Weibchens. Der Lebensfunke ist in keinem der beiden Gameten enthalten, er entspringt ihrer Vereinigung; die Eizelle ist ein vitales Prinzip, das dem der Samenzelle genau entspricht. Das zweite Vorurteil widerspricht dem ersten, was nichts daran ändert, daß sie häufig zusammen vorkommen, nämlich daß die Arterhaltung vom Weibchen gesichert wird, da das männliche Prinzip eine explosive, flüchtige Funktion hat. In Wirklichkeit setzt der Embryo gleichermaßen das Protoplasma des Vaters wie das der Mutter fort und überträgt es in bald männlicher, bald weiblicher Gestalt auf seine Nachkommen. Es ist sozusagen ein androgynes Protoplasma, das die individuellen Erscheinungsformen des Somas von Generation zu Generation überdauert.