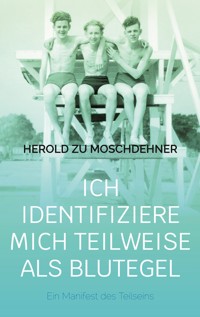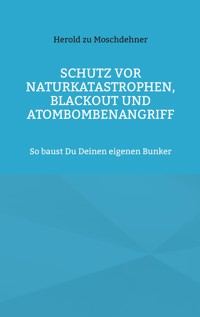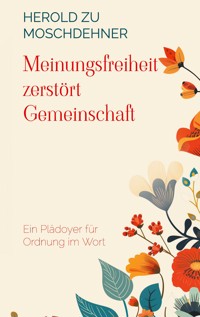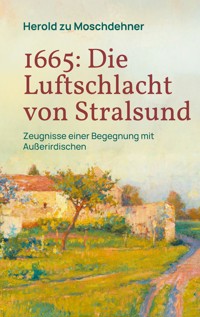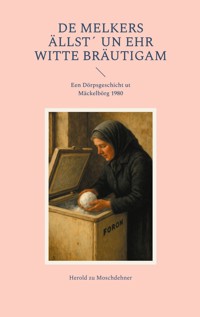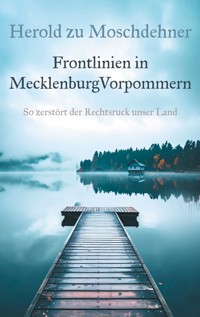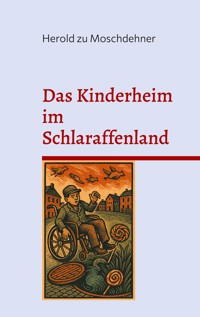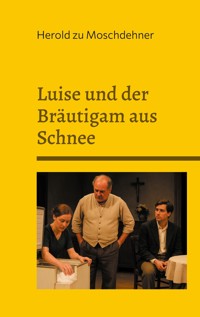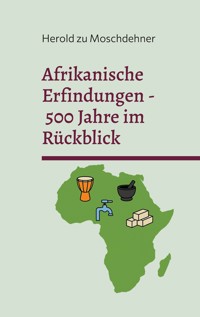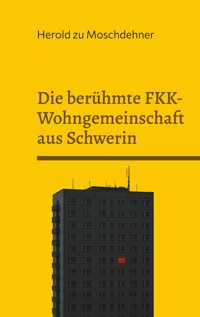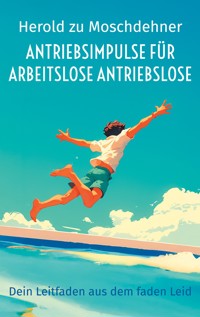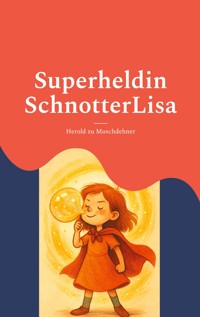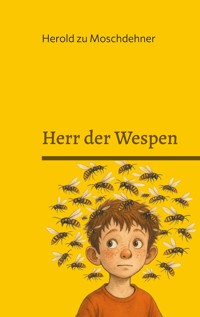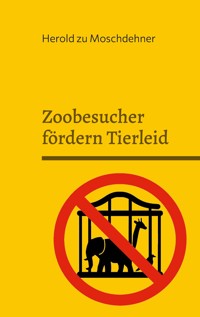Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1919 steht die kleine Stadt Schwaan vor dem Nichts. Inflation, Hunger und Misstrauen bedrohen den Alltag, als die Bürger ein außergewöhnliches Symbol wählen, um Vertrauen zurückzugewinnen: ein Bleßhuhn mit weißer Stirn. Was als Notlösung beginnt, wächst zu einer Bewegung, die den Spott der Nachbarn übersteht und die Gemeinschaft von innen stärkt. Der Roman erzählt von Friederike Lenz, der Stadtschreiberin, die das Amt des Vogels mit Worten trägt, von den Zweiflern und Spöttern, die am Markt lärmen, von den Alten, die mahnen, und den Jungen, die hoffen. Es ist die Chronik einer Stadt, die sich in absurden Zeiten nicht verliert, sondern eine Wahrheit entdeckt: manchmal kann das Kleinste am meisten zusammenhalten. Mit großer erzählerischer Kraft und poetischer Bildsprache entsteht ein Roman über Vertrauen, Ordnung und das Wunder, das selbst in den dunklen Jahren des Umbruchs leuchten konnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Wahl am Fluss
Kapitel 1 – Die Stadtschreiberin
Kapitel 2 – Eisgang
Kapitel 3 – Die Spötter
Kapitel 4 – Das Notgeld
Kapitel 5 – Stimmen im Nebel
Kapitel 6 – Der erste Angriff
Kapitel 7 – Sommer der Inflation
Kapitel 8 – Herbst der Zweifel
Kapitel 9 – Winter der Entscheidung
Kapitel 10 – Der Abgesang der Weißen Stirn
Prolog: Wahl am Fluss
Der Morgen, an dem Schwaan ein Bleßhuhn zum Bürgermeister wählte, begann mit Nebel. Nicht dem sachten, der sich in Fäden über die Wiesen legt, sondern mit jenem dichten, der das Bekannte anrührt und neu sortiert. Die Warnow stand hoch in ihrem Bett, trug Schilf, lose Äste, die Schalen von Rüben, und alles strich mit leisem Rauschen am Pfeiler des Rathausstegs vorbei. Auf dem nassen Geländer saß ein Bleßhuhn, aufgeplustert, als wäre es sein Amtssitz.
Friederike Lenz stand einen Schritt abseits und hielt das Protokollbuch unter ihrem Mantel trocken. Der Schlüssel zum Ratszimmer war verschwunden, seit Tagen schon, und die Männer aus dem Übergangsrat hatten beschlossen, dort zu tagen, wo die Stadt sie sehen konnte. Nicht hinter Türen, sondern am Fluss, der niemandem gehörte und allen. Ein Dutzend Bürger stand schweigend, Schirme, Mützen, Schals. In den Gesichtern lag Wachsamkeit und Müdigkeit, die der Winter ihnen aufgetragen hatte.
„Zur Ordnung“, sagte Pfarrer Keding, er hatte die Stimme, die man für Ordnung benutzte. „Die Tagespunkte sind bekannt: Suppenküche, Deich, der Streit um die Ziegel. Und die Vakanz im Bürgermeisteramt.“ Er sah kurz zu Friederike, die den Stift hob. Ein Tropfen Tinte löste sich wie eine schwere Beere und platzte auf dem Papier. Sie blies sacht, damit er sich nicht in die Zeilen fraß.
Das Bleßhuhn drehte den Kopf. Die weiße Stirnplatte leuchtete matt im Nebel. Ein paar Kinder hielten die Luft an. Es gab Leute, die sagten, Tiere merkten, wenn Menschen beschlossen, wichtig zu sein. Hannes Borgwardt stand am Rand, die Hände in den Taschen, der Blick auf den Fluss gerichtet. Er kannte die Strömungen, die heimlichen Wege unter dem Spiegel; er wusste, wo das Wasser mit einem redet, wenn man nur still bleibt.
„Die Frage des Bürgermeisters“, sagte Keding, „ist keine Frage der Eitelkeit, sondern der Verwaltung. Wir brauchen Unterschriften, wir brauchen Stempel, wir brauchen Verantwortung.“ Er wartete. Niemand trat vor. In Schwaan wartete man gern, bis das Schweigen das Gewicht der Dinge zeigte.
„Dann“, sagte Friederike, und ihre Stimme war heller, als sie wollte, „dann nehmen wir, was wir haben.“ Sie sah das Tier an. „Wir nehmen, was da ist und bleibt, wenn wir wieder fort sind. Der Fluss. Das Huhn.“
Ein Murmeln. Einer lachte, kurz, erschrocken über den eigenen Ton. Hannes hob den Kopf. Er sah, wie sie das Huhn nicht anlächelte, sondern betrachtete wie ein Zeichen, das man lesen kann, wenn niemand vorgibt, es schon zu kennen.
„Ich werde protokollieren, was beschlossen wird“, sagte Friederike. „Und ich werde protokollieren, wie es beschlossen wird. Wenn das Huhn den Kopf neigt, ist das Ja. Wenn es abtaucht, ist das Nein.“ Sie legte die Feder an. „Niemand soll später sagen, es sei Willkür gewesen.“
„Eine Farce“, zischte Mertens, der Mann aus dem Kreis, der seit gestern mit einem grauen Mantel und einer Mappe im Ort war. „Eine Kinderei.“
„Kindereien retten die Welt öfter als Mappen“, sagte Hannes, ohne ihn anzusehen. „Fragen Sie den Fluss, wenn Sie mir nicht glauben.“
Keding hob die Hand. „Anträge?“ Er sah in die Runde, und der Nebel tropfte als kleine Perlen von den Schirmkanten.
„Erster Antrag“, sagte Friederike. „Suppenküche im Kirchsaal, täglich, bis die Ernte kommt. Wer ist dafür?“
Sie sah das Huhn an. Es neigte den Kopf, schnell, entschieden, als wäre ein unsichtbarer Faden gezogen worden. Ein Atem ging durch die Menge, jene Art von Atem, die man in kalten Kirchen hört, wenn man beim Amen zu spät kommt.
„Ja“, sagte Friederike, und der Stift kratzte.
„Beschlossen.“
„Zweiter Antrag“, rief einer vom Feldweg, „der Deich am Westufer. Die Fuhren sinken ein. Wir verlieren Holz.“
Das Huhn schwieg. Es wippte auf den Füßen, sah in das Wasser, das unter ihm zog wie ein dunkles Tuch. Dann ließ es sich fallen, ein dunkler Tropfen, der den Spiegel zerschnitt, und war weg. Der Nebel nahm den kleinen Kreis an, den es hinterließ.
„Nein“, sagte Friederike, ohne zu zögern. „Kein Holz mehr über den Deich, bis wir ihn verstärkt haben. Wir nehmen die Fähre.“ Sie sah auf. „Nächster Antrag.“ Die Farce, dachte Mertens, ist eine Ordnung eigener Art. Er fror an den Händen, weil er seine Handschuhe in der Mappe vergessen hatte. Er begriff im selben Augenblick, dass er hier nicht begriff.
„Dritter Antrag“, sagte Friederike, und ihre Stimme war jetzt ruhig wie ein Messer, das man auf den Tisch legt.
„Die Vakanz im Amt. Bis zur regulären Wahl führt das Bleßhuhn von der Warnow die Geschäfte der Stadt. Ich protokolliere. Der Pfarrer bezeugt. Der Fischer wacht über die Brücke. Wer ist dafür?“
Sie wartete nicht auf Menschenarme. Das Huhn tauchte auf, schüttelte Wasser ab, schlug einmal mit den Flügeln, nicht zum Flug, sondern zur Betonung. Es neigte den Kopf. Es klang wie ein kleines Ja, das nirgends geschrieben stand und doch in viele Jahre fallen würde.
Keding atmete aus. „So sei es“, sagte er. Er machte ein Kreuzzeichen, obwohl niemand ihn darum gebeten hatte.
Friederike schrieb einen Titel über die Seite: Amtsblatt des Bleßhuhns, Nummer Eins. Dann setzte sie den Stift einen Moment lang ab und sah auf den Fluss. Im Nebel standen die Häuser wie Gedanken, die noch keine Worte gefunden hatten. Schwaan, dachte sie, ist klein genug, um zu hören, wenn ein Tier entscheidet, und groß genug, um daraus eine Stadt zu machen.
Hannes trat an das Geländer. Das Huhn sah ihn an, als erkenne es etwas, das nicht neu war. „Wir bringen dich durch den Winter“, sagte er leise. „Und du bringst uns durch das Jahr.“
Der Nebel hob sich einen Finger breit. Man sah das gegenüberliegende Ufer, die feuchten Stämme, den Pfad, der in die Weiden führte. Jemand begann zu klatschen, zögerlich, als lerne man das Klatschen neu.
Dann klatschten alle, und der Fluss nahm den Lärm auf und trug ihn davon, zu den Stellen, an denen man, wenn man sehr früh aufsteht, glauben kann, dass Wasser stempeln kann wie eine Hand auf nassem Papier.
Kapitel 1 – Die Stadtschreiberin
Der Winter in Schwaan hatte sich wie eine zweite Haut über die Stadt gelegt, rau und unnachgiebig, und jeder Schritt auf den gefrorenen Wegen klang, als würde man auf alten Knochen laufen. Friederike Lenz zog den Mantel enger um sich, doch die Kälte kroch durch jeden Stoff, sie kannte keine Scham, kein Halten.
Der Atem der Menschen stand in weißen Wolken über den Gassen, so dicht, dass man manchmal meinte, die Stadt selbst atme müde aus. Es war das Jahr 1919, und nichts war, wie es gewesen war. Männer waren verschwunden in den Schützengräben, einige in Erde, andere in Fremde, und jene, die zurückkamen, hatten Blicke, die nicht mehr ganz hier waren.
Friederike war dreiundzwanzig, Tochter eines verstorbenen Lehrers, und hatte das Glück – oder das Schicksal – eine saubere Schrift zu besitzen. In Zeiten, in denen es kaum Papier gab, war eine ordentliche Hand kostbarer als Silber. So hatte man sie, ganz ohne Wahl, zur Protokollführerin gemacht, zur Stadtschreiberin, wie die Leute bald sagten. Niemand hatte sie gefragt, ob sie das Amt wollte, aber sie hatte auch nicht widersprochen. Denn Schweigen war in Schwaan nicht nur Zustimmung, sondern auch Schutz.
Jeden Morgen ging sie die schmale Treppe zum Ratszimmer hinauf, dem kleinen, zugigen Raum über dem Rathausbogen. Die Balken knarrten, als trügen sie nicht nur das Dach, sondern auch die Last der Jahre. Ein großer Eichentisch stand darin, ein paar wacklige Stühle, und ein eiserner Ofen, der mehr Qualm als Wärme spendete. Oft musste sie die Tintenfässer nah an ihre Brust halten, damit die Flüssigkeit nicht zu Eis erstarrte. Und während draußen die Händler auf dem Marktplatz knurrend über Preise stritten – Rüben gegen Kohle, Ziegel gegen Stroh –, kratzte sie ihre Feder über das Papier und hielt fest, was die Männer des Rates in den Nebel hinein beschlossen.
Doch in Wahrheit, und das spürte sie schon nach den ersten Sitzungen, waren es keine Beschlüsse, die sie schrieb, sondern ein Geflecht aus Hoffnungen, Misstrauen und Müdigkeit. Jeder Satz im Protokoll war mehr Wunsch als Tatsache. „Es sei angeregt, die Suppenküche zu erweitern“, stand da, oder „Es sei beschlossen, den Deich zu verstärken“. Doch sobald die Feder trocken war, zerfielen die Worte oft zu Staub.
Niemand hatte die Kraft, sie wirklich zu tragen.
Am meisten störte sie der Kreisbeamte Mertens, der seit Dezember in der Stadt weilte. Ein Mann mit schmalem Gesicht und einem Mantel, der immer zu ordentlich hing, als dass er wirklich gebraucht würde. Er sprach leise, aber mit der Gewissheit eines, der Akten gewohnt war. Für ihn waren die Menschen von Schwaan nicht viel mehr als Zeilen in einem Register. Wenn Friederike schrieb, sah er ihr manchmal über die Schulter, und sie spürte seinen Atem wie einen kalten Finger im Nacken.
„Sie haben eine hübsche Schrift, Fräulein Lenz“, hatte er einmal gesagt. „Man wird sie brauchen können, wenn Ordnung einkehrt.“ Sie hatte nicht geantwortet, nur das Datum unterstrichen. Es war ihr lieber, ihre Schrift sprach für sie, nicht ihre Stimme.
An diesem Januarvormittag jedoch, wenige Tage nach der eigentümlichen Wahl am Fluss, war etwas anders. Friederike saß nicht am Tisch des Ratszimmers, sondern auf der Fensterbank, die Knie dicht beieinander, das Protokollbuch auf den Schenkeln. Der Nebel vom Fluss war bis hinauf in die Dachgauben gestiegen, und man hätte glauben können, die Stadt sei nur noch ein schwimmendes Floß. Unten auf dem Platz drängten sich Leute, die Köpfe hochgereckt, und riefen nach Beschlüssen, nach Brot, nach einem Funken Sicherheit. Sie schrien nicht laut, aber das gleichmäßige Murmeln ihrer Stimmen hatte die Macht, jede Mauer zu durchdringen.
Und wieder, wie schon am Steg, war da dieses Tier.
Das Bleßhuhn, mit seiner weißen Stirnplatte, stolzierte am Rand des Marktes, ganz nah beim Brunnen, als gehöre ihm der Platz. Die Kinder warfen ihm Krümel zu, und die Frauen zogen die Schürzen enger, wenn es unter ihren Röcken hindurchhuschte. Niemand wagte, es zu verjagen. Es war, als habe man seit jenem Tag akzeptiert, dass es ein Amt trug, auch wenn keiner wusste, wie lange oder wie ernsthaft.
Friederike schlug eine neue Seite auf und schrieb mit zitternder Hand:
„Amtsblatt des Bleßhuhns, Nummer Zwei. Eröffnet am 14. Januar 1919.“
Sie hielt inne. Die Feder tropfte, ein schwarzer Punkt wie ein Loch in der Welt. Dann setzte sie fort:
„Anwesend: Pfarrer Keding, H. Borgwardt, Kreisbeamter Mertens, diverse Bürger. Vorsitz: das Bleßhuhn von der Warnow.“
Das letzte Wort schrieb sie besonders klar, als müsste sie sich selbst davon überzeugen, dass es ernst gemeint war. Sie hatte gespürt, wie die Menschen am Steg plötzlich leichter geatmet hatten, als das Huhn genickt hatte. Als ob die Last der Entscheidung nicht mehr ganz auf ihnen lag. Ein Tier hatte ihnen etwas abgenommen, was sie selbst nicht tragen konnten.
War das nicht in Wahrheit die Essenz von Herrschaft?
Lasten verteilen, Verantwortung verschieben?
Die Sitzung begann stockend. Keding sprach vom Hunger. „Wir brauchen Getreide aus Rostock. Doch die Züge fahren nicht.“ Mertens schlug vor, eine Eingabe an die Bezirksregierung zu richten. Doch niemand glaubte, dass aus Schwerin Brot fallen würde wie Manna. Hannes Borgwardt, der Fischer, saß schweigend, die Hände verschränkt, und sah zum Fenster hinaus, wo das Huhn gerade den Kopf ins Wasser tauchte.
„Wir sollten hören, was es sagt“, murmelte er. Ein paar lachten, doch niemand widersprach.
„Dann stellen wir die Frage“, sagte Friederike, überraschend laut. „Soll eine Delegation zu Fuß nach Rostock gehen, um Korn zu holen?“ Sie beugte sich vor, sah das Huhn an. Das Tier hob den Kopf, schüttelte Wassertropfen ab und neigte sich langsam, als nicke es einem unsichtbaren Takt.
„Beschlossen“, sagte sie und schrieb es nieder.
So ging es Stunde um Stunde. Anträge, Blicke zum Tier, Kopfneigen, Tintenstriche. Manche sagten, das Huhn verstehe die Fragen. Andere, es sei Zufall. Wieder andere, es sei Gottes Werkzeug. Doch je länger die Sitzung dauerte, desto fester wurde die Überzeugung, dass ein Beschluss nur galt, wenn er mit dem Huhn abgestimmt war. Und Friederike, die mit ihrer Schrift das unsichtbare Band zwischen Tier und Mensch knüpfte, wusste: Sie war der Knoten, der alles hielt.
Als die Sitzung endete, trat sie hinaus in den Nebel. Die Bürger standen noch, als warteten sie auf ein Zeichen. Da flatterte das Huhn auf den Brunnenrand, breitete die Flügel aus und stieß einen Laut aus, scharf und hell wie eine gebrochene Geige. Die Leute verstummten, dann nickten sie, als hätten sie verstanden. Friederike spürte, wie ihr Herz gegen das Protokollbuch schlug.
Vielleicht, dachte sie, braucht eine Stadt in Zeiten des Chaos keine Helden, sondern ein Tier, das nicken kann.
Doch Friederikes Rolle endete nicht an den Sitzungen.
Abends, wenn die Laternen flackerten und der Frost die Scheiben mit Blumen überzog, saß sie an ihrem kleinen Schreibtisch in der Kammer ihrer Mutter und kopierte die Protokolle noch einmal in ein zweites, geheimes Buch. Nicht weil sie misstraute, sondern weil sie spürte, dass hier etwas geschah, das größer war als die Tagesordnung.
„Wenn einmal jemand fragt, wie wir durchkamen“, schrieb sie am Rand, „soll er wissen: Wir hatten einen Bürgermeister mit Federn. Und wir hatten Mut, es zu glauben.“
Ihre Mutter, eine blasse Frau mit schwachem Atem, lag im Nebenraum und hustete leise. Manchmal kam sie herein, legte die Hand auf die Schulter der Tochter und fragte: „Schreibst du wieder für das Huhn?“ Dann lächelte sie müde, als sei es ein Märchen, das man einem Kind erzählt.
Doch für Friederike war es kein Märchen. Es war eine Ordnung, die sich neu formte, leise, jenseits von Akten und Stempeln. Sie fühlte, dass Schwaan anders atmete, seit man die Verantwortung geteilt hatte. Die Menschen stritten weniger. Sie wussten, dass am Ende ein Tier entschied, und das nahm den Eifer aus ihren Zungen.
Nur Mertens blieb ein Stachel. „Kindereien“, knurrte er eines Abends, als sie allein die Tinte nachfüllte. „Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass man Geschichte mit Gekrächz schreibt?“
Friederike legte die Feder nieder. „Man schreibt Geschichte nicht mit dem, was man glaubt“, sagte sie ruhig. „Man schreibt sie mit dem, was man tut.“
Er sah sie an, lange, als erkenne er in ihr eine Gegnerin, die er nicht erwartet hatte. Dann ging er, sein Mantel flatterte wie ein schwarzer Vogel durch den Flur.
So vergingen die Wochen. Aus einem Scherz war ein Ritual geworden, aus einem Ritual eine Ordnung, aus Ordnung eine kleine, stille Hoffnung. Und Friederike, die Stadtschreiberin, war das Herzstück dieser Hoffnung.
Ihre Schrift machte die Stimmen hörbar, ihre Feder gab dem Nicken des Tieres Gewicht.