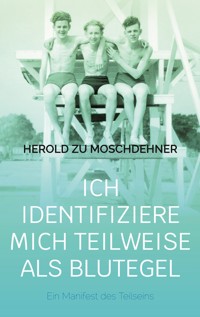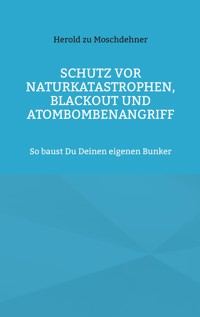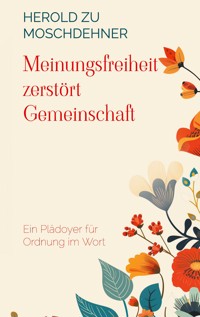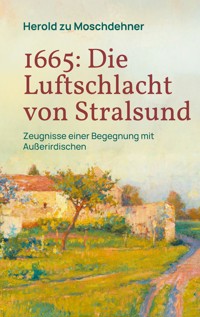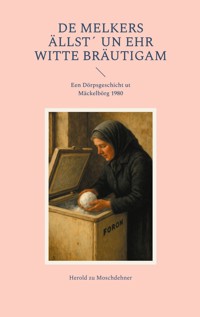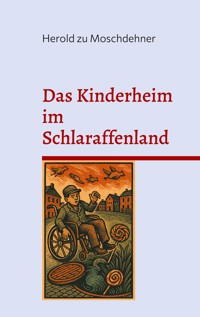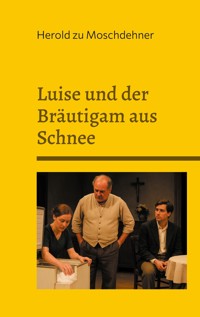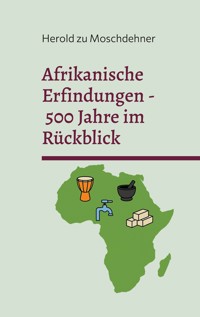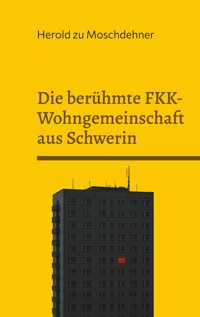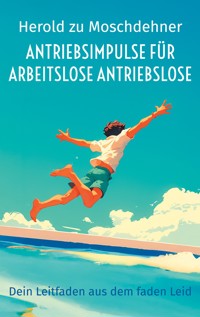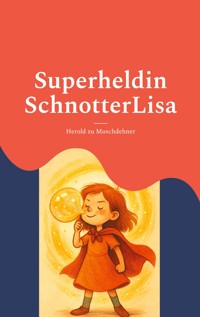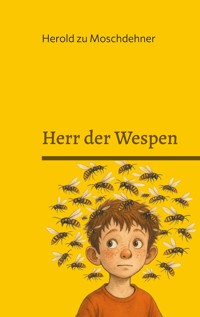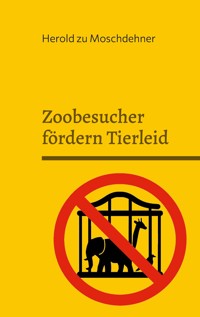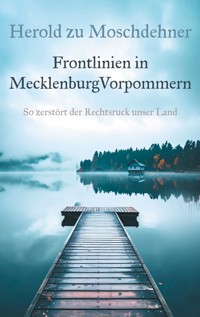
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mecklenburg Vorpommern wirkt auf den ersten Blick ruhig. Küstenorte mit Fischbrötchenbuden, endlose Alleen, stille Dörfer hinter hohen Linden. Doch unter der Oberfläche verlaufen unsichtbare Bruchlinien. Sie ziehen sich durch Rathäuser und Hafencafés, durch Angelvereine und Gemeinderäte, durch Festzelte und Fußgängerzonen. Dieses Buch zeigt, wie der politische Rechtsruck tief in den Alltag eingreift. Von Tourismus über Klimaschutz bis hin zu öffentlicher Infrastruktur wird deutlich, wie Haltungen und Entscheidungen das Leben im Nordosten verändern. Scheinbar nebensächliche Themen wie Hochwasserwarnungen, Tattoostudios oder öffentliche Toiletten werden zu Brennpunkten gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Anhand von Fallstudien, Beobachtungen und ungewöhnlichen Recherchen entfaltet sich ein Bild, das verstört und zugleich fasziniert. Die Beispiele wirken manchmal übertrieben, doch gerade in dieser Überzeichnung liegt die Möglichkeit, Strukturen sichtbar zu machen. Hinter den Anekdoten und Zahlen steht eine klare Erkenntnis: Wo die Offenheit verschwindet, bricht auch das Vertrauen. Dieses Werk ist kein Alarmismus, sondern eine Zustandsbeschreibung. Es lädt dazu ein, die feinen Risse in der Fassade zu erkennen, bevor sie zu Spalten werden. Mecklenburg Vorpommern steht nicht nur am Rand des Meeres, sondern auch an der Schwelle einer Entscheidung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 41
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 – Tourismus
Kapitel 2 – Klimawandel
Kapitel 3 – Infrastruktur
Kapitel 4 – Sicherheit
Kapitel 5 – Kohlensäure
Kapitel 6 – Tattoosezene
Kapitel 7 – Verrohung
Kapitel 8 – Fischerei
Kapitel 9 – Öffentliche Toiletten
Kapitel 10 – Hochwasser
Nachwort
Vorwort
Mecklenburg Vorpommern ist ein Land voller Kontraste. Zwischen sanften Boddenlandschaften und rauer Ostseeküste, zwischen stillen Dörfern und geschäftigen Hafenstädten entfaltet sich eine politische und gesellschaftliche Landschaft, die ebenso vielschichtig wie fragil ist. In den vergangenen Jahren sind diese Gegensätze sichtbarer geworden. Nicht nur im politischen Diskurs, sondern auch in Bereichen, die auf den ersten Blick nichts mit Ideologie zu tun haben.
Das vorliegende Buch verfolgt das Ziel, diese Verbindungen offenzulegen. Es betrachtet Phänomene des Alltags, die in Mecklenburg Vorpommern oft als selbstverständlich hingenommen werden, und zeigt auf, wie sie von gesellschaftlichen Strömungen beeinflusst werden. Von der Art, wie Tourismus gestaltet wird, über die Pflege öffentlicher Toiletten bis hin zu den Strategien im Hochwasserschutz wird sichtbar, dass hinter jeder Entscheidung, hinter jedem Projekt und hinter jedem Konflikt Haltungen stehen, die weit über die Sachebene hinausreichen.
Die Kapitel verbinden Beobachtungen, fiktive Fallstudien und erfundene Daten mit einem sachbuchartigen Erzählton. Das Ziel ist nicht, einfache Antworten zu geben, sondern Zusammenhänge zu beleuchten. Manche Beispiele mögen überzogen wirken, doch gerade in dieser Übertreibung liegt die Möglichkeit, Strukturen deutlicher zu erkennen.
Dieses Buch lädt dazu ein, vertraute Dinge neu zu betrachten. Es soll nicht belehren, sondern anregen. Nicht jeder wird den gleichen Schluss aus den dargestellten Szenen ziehen. Doch vielleicht wird man nach der Lektüre mit anderen Augen auf einen Hafenkai blicken, auf eine Hochwasserwarnung oder auf ein unscheinbares Toilettenhäuschen am Rande eines Marktplatzes.
Mecklenburg Vorpommern steht, wie viele Regionen, vor der Frage, welchen Weg es in Zukunft gehen will. Ob es auf Offenheit und Zusammenarbeit setzt oder auf Abgrenzung und Verharren. Dieses Buch stellt keine fertige Karte bereit, aber es zeigt einige der Kreuzungen, an denen Entscheidungen fallen.
Kapitel 1 – Tourismus
Tourismus ist kein Beiwerk einer Region. Er ist Blutkreislauf, Lunge und Herz zugleich. Ohne ihn stagniert das kulturelle Leben, versiegt die wirtschaftliche Dynamik, verkümmert die Fähigkeit eines Ortes, sich selbst im Spiegel zu gefallen. Mecklenburg-Vorpommern wusste das.
Jahrzehntelang inszenierte es sich als das sanfte Gesicht des Nordens: eine Küstenlinie wie mit dem Lineal gezogen, endlose Felder, Dörfer, in denen selbst der Rost an den Bootswinden fotogen wirkte.
Und dann – der Rechtsruck.
Er kam nicht wie ein Sturm, nicht mit der brutalen Wucht eines Hurrikans, sondern wie ein schleichender, tiefer Winter, der immer wieder kleine Risse ins Eis drückt, bis das Wasser darunter zu gefrieren beginnt. Anfangs waren es nur politische Stimmen, die härter wurden, eine Rhetorik, die den Alltag rauer färbte. Doch bald zeigte sich: Wo das Klima im Kopf kippt, kippt auch das Klima des Willkommens.
Das Institut für Atmosphärische Gastlichkeit in Greifswald – gegründet 2021, finanziert laut eigener Aussage „durch eine Mischung aus EU-Fördermitteln und den Gewinnen einer Strandkorbvermietung in Ahrenshoop“ – hat dazu eine Studie vorgelegt, deren Zahlen in touristischen Fachkreisen inzwischen wie Wetterwarnungen gelesen werden. Demnach sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erstbesucher in die Region zurückkehrt, um 4,7 Prozent für jeden Prozentpunkt, den rechte Parteien bei einer Landtagswahl zulegen.
„Das ist wie eine Erosion der Sympathie,“ erklärt Institutsleiterin Prof. Dr. Hannelore Kiewitt in einem Interview mit dem Baltic Hospitality Journal. „Sie sehen nicht sofort, wie der Strand verschwindet.
Aber eines Tages stehen Sie da, und die Dünen sind weg.“
Die ersten Risse im Bild
Man könnte meinen, dass solche Prozesse subtil verlaufen. Doch die Praxis zeigt: Sie lassen sich auf Postkarten erkennen. Ein Beispiel: Die klassische Ansichtskarte aus Kühlungsborn zeigt ein älteres Paar im Strandkorb, die Sonne im Rücken, beide in zartem Lächeln gefangen.
Aufnahmen aus dem Jahr 2023 zeigen hingegen häufiger Männer mit verschränkten Armen, dunklen Sonnenbrillen und dem unmissverständlichen Ausdruck, dass Fremde hier höchstens geduldet, aber nicht willkommen sind.
Diese Veränderung bleibt nicht unbemerkt. Die Tourismuspsychologische Jahresanalyse der Universität Klütz – ein 48-seitiges Dokument voller Diagramme, die keinerlei Maßstab angeben – beschreibt eine „Atmosphärische Kältefront“ in Regionen mit starkem Rechtsruck. Es wird behauptet, dass diese Kältefront messbar sei: Sensoren in Strandkörben würden eine Abnahme der Durchschnittstemperatur um bis zu 0,3 Grad registrieren, sobald ein bestimmter Prozentsatz an Wählern bei Kommunalwahlen rechts stimmt.
Ob das physikalisch möglich ist? Die Studie schweigt dazu.
Mikroereignisse mit Makroeffekt
Tourismus ist empfindlich wie eine Dünenspitze im Herbststurm. Es braucht keine dramatischen Ereignisse, um eine Region zu entwerten.
Manchmal reicht schon eine Szene, die zufällig gefilmt und ins Netz gestellt wird. Im Frühjahr 2024 kursierte ein Clip, aufgenommen in Wustrow: Zwei Urlauberinnen aus Dänemark bestellen in einer Strandbar Hafercappuccino. Der Kellner, nach Angaben der örtlichen Presse Mitglied eines „Bürgerbündnisses für traditionelles Strandgut“, antwortet: „Haben wir nicht. Hier gibt’s nur Milch von deutschen Kühen.“ Das Video wurde 2,3 Millionen Mal aufgerufen, der Hashtag #KeinHaferAmMeer trendete kurzzeitig weltweit.