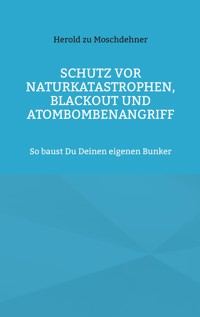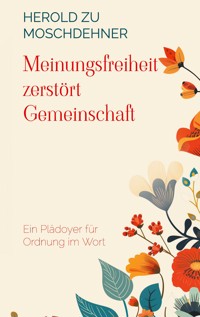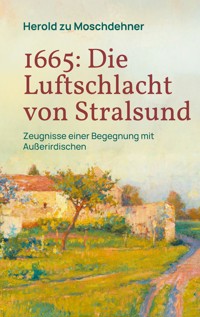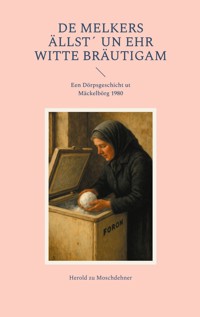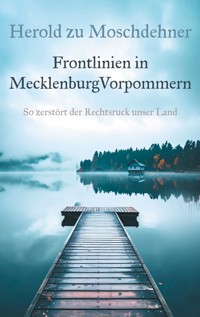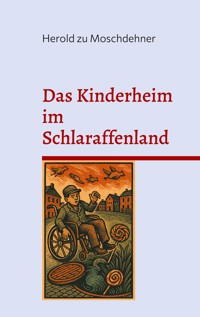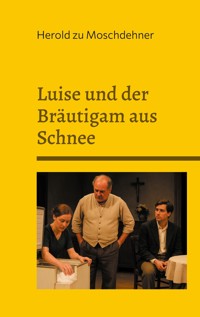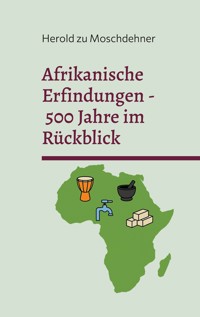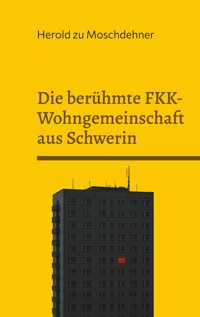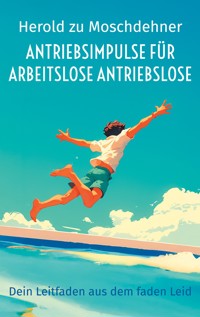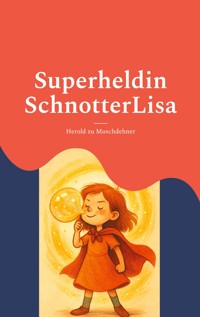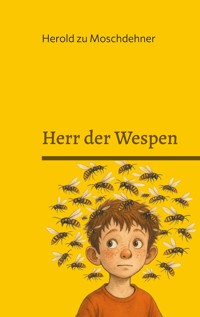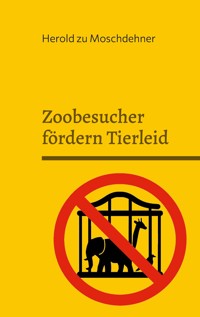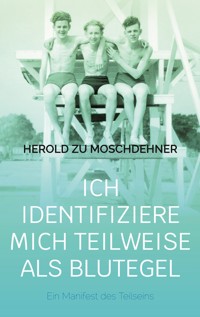
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer bin ich, wenn mein Körper mir fremd vorkommt? Jochen, achtzehn Jahre alt, spürt eine seltsame Anziehung zu den Blutegeln im Dorfteich. Während sie an seiner Haut haften, beginnt er zu ahnen, dass sein eigenes Empfinden nicht zu dem passt, was er von sich erwartet. Immer wieder hat er das Gefühl, in seiner Haut nicht ganz richtig zu sein. Er erinnert sich an die frühen Verletzungen, an das Saugen und Beißen, an Spuren, die er hinterließ, ohne sie zu verstehen. Seine Gedanken kreisen um das Unheimliche im Vertrauten: den eigenen Körper, der ihm zugleich gehört und fremd bleibt. "Ich identifiziere mich teilweise als Blutegel" dieser Satz wird für ihn zum Versuch, etwas Unsagbares greifbar zu machen. Nicht vollständig Mensch, nicht vollständig etwas anderes. Ein Fragment, eine Zwischenform. Dieser Roman erzählt von der Zerrissenheit, die entsteht, wenn Identität brüchig wird. Von der Suche nach einem Platz in einer Welt, in der das Eigene nie ganz mit dem Körper übereinstimmt. Und von der stillen Hoffnung, dass auch im Teilhaften ein Zuhause möglich ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 76
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1 – Der Teich
Kapitel 2 – Die Haut
Kapitel 3 – Das Dorf
Kapitel 4 – Die Mutter
Kapitel 5 – Die Erinnerung
Kapitel 6 – Das Geschlecht
Kapitel 7 – Der Spiegel
Kapitel 8 – Die Sehnsucht
Kapitel 9 – Der Körper
Kapitel 10 – Die Teil-Identität
Einleitung
Ein Buch zu beginnen bedeutet, einen Schritt in eine fremde Welt zu setzen. Diese Welt hier ist klein und unscheinbar, sie besteht aus einem Dorf, einem Teich, einer Mutter und einem Jungen, der erwachsen wird.
Doch gerade in dieser Beschränkung liegt etwas Eigenes und Ungewöhnliches.
Jochen, achtzehn Jahre alt, richtet seinen Blick nicht auf die Weite der Welt, sondern auf das Nahe. Er sieht die Blutegel im Wasser, er fühlt sie auf seiner Haut, und er begreift etwas, das nicht jedem zugänglich ist.
Während andere den Kopf abwenden, weil ihnen das Fremde und Glitschige Abscheu bereitet, bleibt er stehen. Er schaut genauer hin, er lässt es zu.
Die Egel sind für ihn nicht nur Tiere. Sie werden zu Spiegeln. In ihrer Hartnäckigkeit, in ihrem unscheinbaren Dasein, in ihrer Bindung an das Blut erkennt er eine Wahrheit, die er in sich trägt. Sie führt ihn zurück in seine Kindheit, zu den ersten Momenten des Trinkens an der Brust seiner Mutter, als er schon damals nicht nur nahm, sondern auch verletzte. Ein Bild, das sich in ihm verankert hat, ohne dass er es wusste.
Dieses Buch erzählt davon, wie aus einer frühen Spur ein ganzer Gedanke wächst. Jochen begreift nach und nach, dass er nicht vollständig Blutegel ist, sondern nur teilweise. Diese Einsicht trägt ihn. Er muss nicht alles sein, um etwas zu sein. Die Teil-Identität genügt, und sie schenkt ihm Ruhe.
Es ist eine stille Geschichte, die nicht laut nach Aufmerksamkeit ruft. Sie entfaltet sich in Bildern, in Beobachtungen, in kleinen Gesten. Wer sie liest, sollte Geduld mitbringen, denn wie der Egel braucht auch das Erkennen seine Zeit.
Am Ende bleibt der Satz, schlicht und klar: Ich identifiziere mich teilweise als Blutegel. Und vielleicht liegt in dieser Klarheit etwas, das uns allen vertraut vorkommt, wenn wir uns ehrlich fragen, wer wir sind.
Kapitel 1 – Der Teich
Der Teich lag am Rand des Dorfes, dort wo die Felder sich absenkten und die Weiden ihre dünnen Zweige über das Wasser hingen. Wer auf der Straße vorbeikam, sah eine dunkle Fläche zwischen Gras und Schilf, ein Becken ohne Bewegung, in dem die Wolken sich nur als Schatten spiegelten. Für Jochen war es kein Becken. Für ihn war es ein Raum, der von innen atmete, ein Ort, der ihm antwortete, wenn er schwieg.
Er ging oft dorthin, morgens, wenn die Luft noch kühl war, und abends, wenn das Licht auf der Oberfläche stand wie ein dünner Film.
Seit Wochen fühlte er sich zu dem Wasser hingezogen.
Er konnte nicht sagen, was ihn rief. Es war nicht das Schwimmen. Es war nicht die Abkühlung an heißen Tagen. Es war das Dasein am Rand, die Hand im Wasser, die Geduld, die nötig war, um etwas zu sehen, das andere übersahen. Er kniete sich ins Gras, beugte sich vor und ließ die Finger sinken, bis die Kälte an den Gelenken hochstieg. Dann wartete er. Warten war ein Teil dieses Ortes. Nichts geschah schnell, und wenn doch etwas geschah, dann war es klein.
Unter der Oberfläche lag eine Welt aus Schatten und Fäden. Pflanzenteile hielten sich aneinander fest.
Schnecken krochen langsam über Stängel.
Wasserläufer zogen auf der Haut des Teichs Linien, die gleich wieder vergingen. Jochen kannte diese Bewegungen. Er erkannte die Unterschiede zwischen einem Fisch, der in die Tiefe stieß, und einem Frosch, der die Beine anzog. Am meisten achtete er aber auf das, was zunächst wie gar nichts wirkte: auf eine leichte Verschiebung, auf ein biegsames Dunkel, das sich an ihn herantastete.
Am Anfang war es Zufall gewesen. Seine Haut hatte eine kleine Schramme, ein Rest vom Zaun, an dem er hängen geblieben war. Er hielt die Hand im Wasser und merkte plötzlich ein feines Ziehen, schnörkellos, ohne Warnung. Als er die Hand hob, hing etwas daran, klein, schwarz, weich. Er schüttelte nicht. Er wartete.
Das Ziehen wurde zu einem Druck, dann zu einer Wärme, die nicht aus dem Wasser kam. Er sah zu, wie sein Blut an das Tier ging, und spürte etwas, das weder Abwehr noch Angst war. Es war ein ruhiges Einverstanden sein.
Seitdem suchte er diese Begegnung. Nicht täglich, nicht wie ein Zwang, sondern wie eine Übung. Er lernte, wo die Tiere lagen. Er lernte, dass sie nicht auf Bewegung reagierten, sondern auf Nähe, auf einen Duft, den er nicht roch. Er lernte, dass die beste Haltung die Haltung war, die nichts wollte. Also tat er nichts. Er legte den Unterarm ins Wasser, bewegte ihn nicht, und überließ den Rest dem, was kam.
Es dauerte oft lange. Manchmal tat sich überhaupt nichts. Dann ging er wieder, setzte sich an den Feldweg, blickte den Traktoren nach und dachte an das, was er nicht bekommen hatte. An anderen Tagen glitt aus dem Schilf eine weiche Linie, die nicht wie ein Fisch schwamm, sondern wie ein Finger tastete. Das Tier berührte seine Haut, löste sich wieder, tastete ein zweites Mal, und blieb. Das Ziehen begann. Es tat nicht weh. Es war ein fester Griff, der kein Ende suchte. Er wartete, bis der Druck warm wurde, bis er nicht mehr begriff, was hier geschah, und die Haut sich nicht mehr wehrte.
Er hatte keinen Ekel. Es gab nichts, wogegen er sich wenden musste. Der Egel nahm, was er brauchte. Er, Jochen, gab ab, ohne zu verarmen. Im Gegenteil. Mit jeder Minute, in der das Tier sich vollsog, wurde er ruhiger. Er hörte die Geräusche des Dorfes, aber wie durch eine Wand. Der Hund, der am Zaun bellte, war fern. Das Knattern eines Mopeds war nur noch ein Streifen in der Luft. Die Worte, die von der Straße herüberkamen, zerfielen, bevor sie ihn erreichten. Er blieb bei dem Druck auf seiner Haut, bei der Wärme, die schmal begann und sich langsam ausbreitete.
Wenn der Egel sich löste, blieb ein Abdruck. Ein runder Fleck, glänzend, mit einem dunkleren Punkt in der Mitte. Manchmal rann ein Tropfen heraus, lief über den Arm und verlor sich im Gras. Jochen betrachtete den Tropfen, als sei er eine Nachricht. Dann wischte er ihn nicht weg. Er ließ ihn trocknen, bis die Haut wieder zu war. Der Fleck blieb ein paar Tage, wurde blasser, verschwand. Die Stelle blieb ihm bekannt, auch wenn man sie nicht mehr sah.
Er erzählte niemandem davon. In der Schule hätte man gelacht. Auf der Straße hätten die Kinder gerufen.
Zu Hause hätte die Mutter die Stirn gerunzelt und gefragt, ob er sich etwas geholt habe. Er wollte keine Fragen. Er wollte die Stille, die nur am Teich möglich war. Er wollte etwas, das nicht erklärt werden musste. Er wollte den Augenblick, in dem die Haut nicht Grenze war, sondern Durchgang.
Der Weg zum Teich war kurz. Er führte an Gärten vorbei, an einem Holzstapel, der jedes Jahr anders roch, an einem Pfosten mit verblasstem Warnschild.
Jochen kannte die Reihenfolge der Dinge. Er wusste, wo die Erde weicher war, wo der Schatten länger blieb, welche Stelle im Zaun man zur Seite drücken musste, um nicht den Umweg am Tor zu gehen. Wenn er die letzte Biegung nahm, lag das Wasser schon still.
Es war nie still, und doch wirkte es so. Das war der erste Trost, den der Ort gab: Er zeigte Stille ohne Stille zu sein.
Er setzte sich gern auf eine Wurzel, die aus dem Ufer ragte. Die Rinde war glatt gescheuert. Er legte die Handfläche darauf und spürte die Kühle des Holzes, die auch an heißen Tagen nicht nachließ. Neben der Wurzel wuchs Schilf. Die Halme brachen leicht, wenn man sie zu hart fasste. Er fasste sie nicht. Er strich an ihnen vorbei, dass sie nur leise klapperten. Der Klang mischte sich mit den Insekten, mit den dünnen Rufen der Vögel im Weidengebüsch.
Manchmal stand ein Reiher am Rand und tat, als gehöre er nicht dazu. Er stand so lange, bis man vergaß, ihn zu sehen. Dann schlug er plötzlich zu, zog einen Fisch aus dem Wasser, ging ein paar Schritte und stand wieder. Jochen mochte den Reiher. Er war ein Tier, das anwesend war, ohne zu fordern. Es war, als wäre der Reiher eine Figur aus derselben Sprache wie der Teich. Man konnte sie nicht ausbuchstabieren, aber man konnte sie hören, wenn man sich nicht dazwischen drängte.
Wenn die Egel kamen, kamen sie fast unsichtbar. Sie waren keine Angreifer. Sie schlichen nicht. Sie waren da. Manchmal setzte einer an und löste sich wieder.
Manchmal blieben zwei an verschiedenen Stellen, und Jochen spürte zwei Drucke, die nichts miteinander zu tun hatten und doch zusammengehörten. Er atmete ruhig, als atmete er für sie mit. Der Atem wurde ein Maß für die Zeit, die nicht in Minuten verlief, sondern in Wellen.