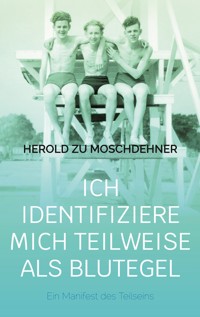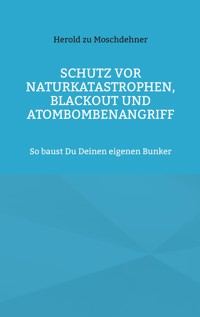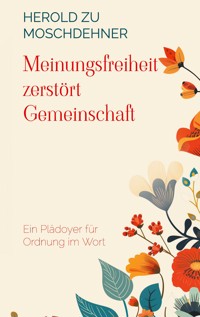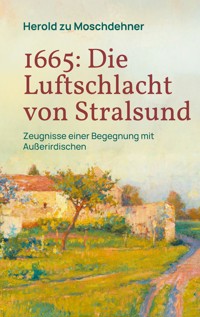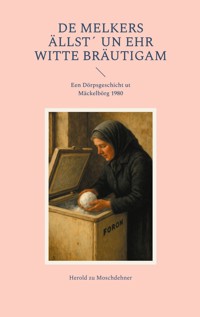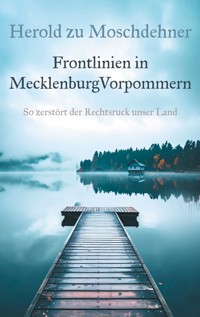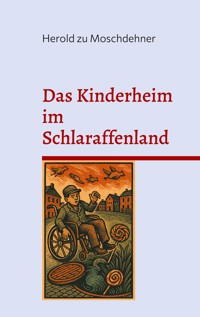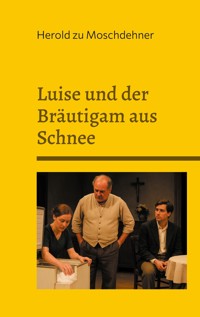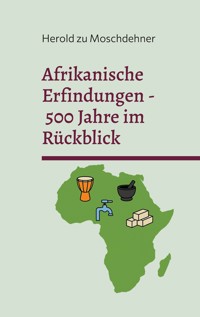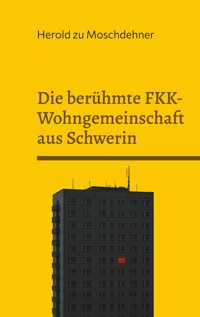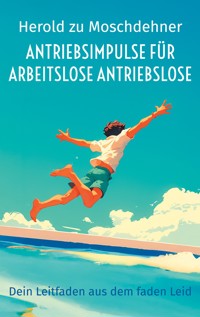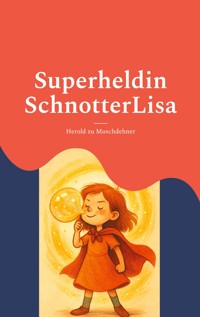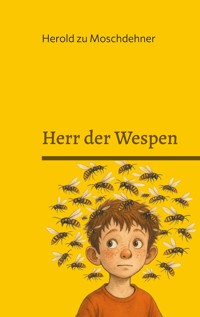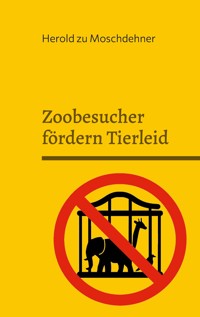
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Gehen Sie noch in den Zoo? Streifen Sie an freien Tagen durch Tierparks und staunen über Löwen, Eisbären oder Elefanten? Was, wenn dieser scheinbar harmlose Ausflug auf Kosten derer geht, die Sie bewundern? Dieses Buch richtet sich direkt an Sie. "Zoobesucher fördern Tierleid" enthüllt die andere Seite der Tierparks: winzige Gehege, Verhaltensstörungen, das routinemäßige Töten überzähliger Tiere und die Mythen vom Artenschutz. Herold zu Moschdehner zeigt, wie das System Zoo funktioniert und welche Rolle jeder Besucher dabei spielt. Er führt durch die Geschichte der Menagerien, schildert das Leid der Gefangenschaft, deckt die Geschäftspraktiken auf und präsentiert Alternativen, die ohne Tierleid auskommen. Wenn Ihnen Tiere am Herzen liegen, lesen Sie dieses Buch. Es fordert dazu auf, Traditionen zu hinterfragen, informiert über die Realität hinter den Kulissen und zeigt, wie Sie durch Ihre Entscheidungen einen Unterschied machen können. Verzichten Sie auf den nächsten Zoobesuch: Für die Freiheit der Tiere.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 56
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1: Überblick und historische Einordnung
Kapitel 2: Überproduktion und das Töten „überschüssiger“ Tiere
Kapitel 3: Gefangenschaft und ihre Folgen
Kapitel 4: Artenschutz – Mythos und Realität
Kapitel 5: Bildung oder Unterhaltung?
Kapitel 6: Alternativen zum Zoo
Kapitel 7: Moralische Argumente und Ausblick
Nachwort
Einleitung
Zoos und Tierparks sind in Deutschland fester Bestandteil der Freizeitkultur. Familien flanieren an sonnigen Wochenenden zwischen Käfigen und Gehegen und betrachten Tiere, die aus allen Teilen der Welt zusammengetragen wurden. Für viele Besucher gilt der Zoobesuch als pädagogisch wertvoll: Man kann den Kindern Tiere zeigen, die sie sonst nie sehen würden, und damit angeblich das Bewusstsein für Artenschutz fördern. Doch was passiert hinter den Kulissen? Welche Realität verbirgt sich hinter der bunten Fassade der Gehege und den putzigen Jungtieren?
Dieses Buch mit dem Titel „Zoobesucher fördern Tierleid“ ist ein Plädoyer für den Tierschutz und eine klare Absage an Zoos und Tierparks. Der Autor, Herold zu Moschdehner, lässt keinen Zweifel daran, dass die Haltung wilder Tiere in Gefangenschaft ein ethisches Problem ist. Er hinterfragt kritisch, ob Zoos ihrem selbst gesteckten Anspruch gerecht werden und ob sie überhaupt legitimiert sind, fühlende Lebewesen einzusperren. Schon der Begriff „Zoo“ ist gesetzlich definiert: In Deutschland handelt es sich um Einrichtungen, in denen mehr als zwanzig Wildtiere gehalten und an mehr als sieben Tagen im Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Laut Gesetz sollen Zoos das Bewusstsein für biologische Vielfalt fördern und zur Arterhaltung beitragen. Doch die folgenden Seiten zeigen, wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen.
Die Realität ist ernüchternd. Viele Tiere leben ihr ganzes Leben in Gefangenschaft, weit entfernt von ihren natürlichen Lebensräumen. Ein Eisbär streift in freier Wildbahn durch ein Revier von etwa 150 000 Quadratkilometern. Im Zoo werden zwei Tiere auf 400 Quadratmetern gehalten.
Elefanten, die normalerweise täglich weite Strecken wandern, werden in Gehegen eingesperrt, die nur einen Bruchteil eines Fußballfeldes groß sind. Sie können ihre natürlichen Bedürfnisse nicht ausleben und entwickeln häufig Verhaltensstörungen wie stereotype Bewegungen oder Selbstverletzung.
Hinzu kommt, dass in europäischen Zoos jährlich Tausende gesunde Tiere getötet werden, weil sie als „überschüssig“ gelten, eine Praxis, die Tierschützer und viele Bürger empört.
Der Autor hält es für an der Zeit, die Rolle der Zoobesucher zu reflektieren. Jede Eintrittskarte ist eine Abstimmung für das System Zoo und gegen den Tierschutz. Wer bezahlt, akzeptiert, dass Tiere in Käfigen leiden, getötet oder verstümmelt werden, nur damit wir sie betrachten können.
Diese Erkenntnis bildet den moralischen Kern des Buches: Es geht nicht um Reformen, sondern um die Überwindung des Zookonzepts. Mit modernen Technologien wie Virtual Reality (VR) können Menschen heute Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen erleben, ohne sie einzusperren.
Zugleich bleibt echter Artenschutz am wirkungsvollsten vor Ort, also dort, wo die Tiere leben. Das bedeutet den Schutz ihrer Habitate und die konsequente Bekämpfung von Wilderei und Lebensraumzerstörung.
In den folgenden Kapiteln wird gezeigt, wie systematisch Tiere in Zoos getötet werden, warum die Haltungsbedingungen nicht artgemäß sind, wie der Artenschutzbegriff missbraucht wird und weshalb Bildung häufig zugunsten von Unterhaltung vernachlässigt wird. Das Buch zeigt deutlich, dass die Praxis der Zoos mit echtem Tierschutz unvereinbar ist und ruft dazu auf, diese Einrichtungen zu meiden. Gleichzeitig werden Alternativen zum Zoobesuch vorgestellt, darunter virtuelle Safaris und nachhaltige Schutzprojekte, die unseren Wissensdurst stillen, ohne Tiere zu quälen. Das Ziel ist nicht nur, Fakten zu liefern, sondern auch ein Bewusstsein für die eigene Verantwortung zu schaffen und zum aktiven Engagement gegen Tierparks zu motivieren.
Kapitel 1: Überblick und historische Einordnung
Zoos haben eine lange und komplizierte Geschichte, die eng mit der menschlichen Neugier, dem Wunsch nach Macht und der Kontrolle über die Natur verbunden ist. Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung von den ersten Tiergehegen zu den modernen Zoos und zeigt, wie sich die Rechtfertigungen für das Einsperren von Tieren verändert haben. Zugleich wird deutlich, dass der Kern des Problems – der Eingriff in das Leben empfindungsfähiger Wesen – sich nie geändert hat.
Schon in den frühen Hochkulturen hielten Herrscher exotische Tiere als Zeichen ihrer Macht.
In alten ägyptischen und assyrischen Palästen lebten Löwen und Affen in engen Gehegen.
Chinesische Kaiser legten riesige Tierparks an, in denen Hirsche, Vögel und seltene Säugetiere gesammelt wurden. Solche Menagerien hatten keinen Bildungszweck; sie dienten der Unterhaltung der Elite und dem Demonstrieren imperialer Stärke. Für die Tiere bedeutete das ein Leben fernab ihrer Heimat, unter Bedingungen, die sie nicht im Entferntesten an ihre gewohnten Lebensräume erinnerten.
In Europa entstanden im Mittelalter Tiergehege, die meist von Königen oder reichen Adeligen betrieben wurden. Sie sammelten exotische Tiere aus fernen Ländern, die sie über Handelsrouten oder als Geschenke erhielten. Eines der berühmten Beispiele ist die Menagerie im Tower von London, in der seit dem zwölften Jahrhundert Löwen, Leoparden und sogar ein Eisbär gehalten wurden. Die Tiere wurden in einfachen Käfigen präsentiert; ihr Wohlbefinden spielte keine Rolle.
Zuschauer sollten staunen und sich der Macht des Herrschers bewusst werden, der solche Raritäten besaß.
Mit der Zeit wuchs das öffentliche Interesse an exotischen Tieren. Im späten siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert begannen Naturkundler, Tiere zu klassifizieren und in Büchern zu beschreiben. Diese wissenschaftliche Neugier verschmolz mit dem Wunsch, Tiere in Städten auszustellen. 1752 eröffnete Kaiser Franz I. im Wiener Schlosspark Schönbrunn den ersten dauerhaften Tiergarten Europas. Die Anlage war jedoch zunächst nur dem Adel vorbehalten; erst 1779 wurde der Park auch für die Bürger geöffnet. Der Tiergarten diente vor allem der Repräsentation und Unterhaltung.
Wissenschaftliche Erkenntnisse waren ein willkommenes Nebenprodukt, nicht der Zweck.
Das neunzehnte Jahrhundert war eine Zeit des rasanten Wachstums der Zoologischen Gärten.
1828 gründeten britische Gelehrte die Zoological Society of London. Sie errichteten 1829 den London Zoo, der als einer der ersten Gärten Tiere aus wissenschaftlichem Interesse hielt. Bald folgten weitere Städte dem Beispiel: Paris eröffnete 1794 den Jardin des Plantes mit einer öffentlichen Menagerie, Berlin folgte 1844 mit dem Zoologischen Garten. Diese Einrichtungen rühmten sich, dem Publikum Natur zu vermitteln.
In Wirklichkeit waren sie Teil des kolonialen Projekts. Tiere wurden aus Kolonien geraubt und über weite Strecken transportiert. Viele überlebten die Reise nicht. Die, die ankamen, vegetierten in Gehegen, in denen sie weder jagen noch sich sozial verhalten konnten. Für die Besucher war der Zoo ein Fenster in die „exotische“ Welt; für die Tiere war er ein Gefängnis.
Die Tierhaltung im neunzehnten Jahrhundert spiegelte die Haltung der damaligen Gesellschaft wider. Tiere galten als Ressourcen. Tierschutz war kaum Thema. Die Gehege bestanden aus Eisenstangen und Betonböden. Raubtiere konnten nicht laufen; Elefanten wurden an Ketten gelegt. Kinder fütterten Affen mit Bonbons.