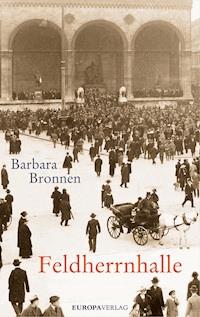3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Vor über dreißig Jahren waren sie ein Paar: Die Fotografin Charlotte und der ehemalige Verlagsleiter Johannes begegnen sich zufällig wieder. Inzwischen beide um die Siebzig, beginnen sie, sich Briefe zu schreiben. Tastend und zögerlich wächst die Hoffnung, aus der alten eine neue Liebe entstehen zu lassen ... Ein mutiger und sensibler Roman über das späte Glück im Alter. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Ähnliche
Barbara Bronnen
Am Ende ein Anfang
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
Für Bernd C. Hesslein
Liebe Charlotte,
der warme Augustregen sammelte sich auf Deiner Stirn und über Deinem Mund. Du trugst keinen Regenmantel. Du schütteltest Dein Haar und schienst die Jahre abzuschütteln wie ein Apfelbaum seine Blüten.
Überraschter Blicktausch: Du? Daraufhin ruhte sich unser Blick für einen Moment aneinander aus. Dein unverstelltes Gesicht, Du hast Dich nicht dazu hergegeben, Dein Alter zu verstecken; schöne große Augen, die frei in die meinen blickten: Deine letzte Jugend dauert, dauert immer noch. Ja, Du hast Dich gefreut! Dann verwandelten sich durch eine unmerkliche Bewegung Deine Züge wieder in das Gesicht einer abweisenden reifen Dame, die nicht belästigt werden will.
Umsteigebahnhof Hannover. Ich landete geradewegs vor Deinen Füßen. Du stiegst ein, ich stieg aus. Entschlossen nahm ich den Koffer aus Deiner Hand und hob ihn in den Waggon, begrüßte Dich, für eine Sekunde Deine nasse Wange an meinem Mund, ein gewichtloser Kuß, Du stiegst, gedrängt von den Wartenden, mit ausweichendem Schulterzucken ein. Ich stand noch eine Weile da, beobachtete Dich erstaunt, als sähe ich Dich zum erstenmal, keine Phantasiefigur, während Dein Mund zu flüstern schien: Es ist besser so. Dann schloß sich die Tür.
Da standst Du, die ich vor dreißig Jahren geliebt habe und die mir unverhofft wiederbegegnete, und die aufbewahrten Bilder wurden sofort wach. Ich hatte versucht zu vergessen, hatte Freundschaft vorgetäuscht und Dir, die mich verließ, um Deinem Mann einen Neuanfang möglich zu machen, temperierte Briefe geschrieben. Vermied eine neue Begegnung. Habe mit Halbbegehrten geliebäugelt und Opfer gesammelt. Führte schöne Frauen an unsere Plätze, in unsere Restaurants, in unser Bett. Doch meistens war es mit meiner Lust bald wieder zu Ende: Ich liebte als Verräter. Bis auf eine, Renate, eine jüngere Frau, der ich mich ausgeliefert fühlte, doch davon gleich.
Ja, eine lange Zeit ist seit meinem letzten Brief an Dich vergangen – eine schrecklich lange Zeit, in der ich nicht mit mir selbst im reinen war (Du würdest sagen: noch weniger als sonst). Prüfend halte ich Dein gestriges und Dein heutiges Bild gegeneinander. Wie liebenswürdig es immer noch ist! Und ohne es zu wollen, unterschiebe ich unserem zufälligen Treffen einen besonderen Sinn.
Wie sehr Du mir gefehlt hast, das merke ich jetzt. Dein Bild im Zug ist stehengeblieben, und Du lächelst mir zu wie früher, wenn wir einander besuchten und uns ungestüm in die Arme fielen. Die Vergangenheit lebt in mir wieder auf. Ich will dieses schöne Bild an mich ziehen, umarmen, ich packe Träume aus. Ich will wiederhaben, was ich einst besaß.
Doch mit dem Unbeschwerten, auch Unbedenklichen, das uns früher verband, ist es vorbei, da mache ich mir nichts vor. Das liegt an meiner wachsenden Neigung zum Zweifel an mir selbst, die in den letzten Jahren zugenommen hat, so daß ich keinen inneren Frieden fand und dachte, es ist besser, Dich vor mir zu bewahren. Meine Unsicherheit und meine Angstzustände hätten Dich nur belastet, abgesehen davon: Du hättest mich nicht wiedererkannt!
Hervorgerufen wurde das durch ein Ereignis, von dem zu berichten mir heute noch schwerfällt, obwohl es inzwischen alltäglich ist: Ich habe meine Position als Geschäftsführer des Verlags von heute auf morgen verloren – mit damals neunundfünfzig Jahren. Einen Beruf, den ich, wie ich dachte, bis in die Siebzig mühelos hätte ausführen können. Etwa fünfundzwanzig Jahre an einem Schreibtisch gearbeitet, an dem der Verlagsgründer schon gesessen hatte und der aus dem Erbe seines Großvaters stammte. Die tickenden Holzwürmer und ihre gelblichen Häufchen gehörten dazu. Ich war der Meinung, von nirgendwo anders aus den Verlag leiten zu können. Natürlich ist das alte anhängliche Möbelstück bei meinem Nachfolger, dem holländischen Großverleger, der damals noch weitere drei deutsche Verlage aufkaufte, sofort eindrucksvoll in der Mitte auseinandergebrochen und hat den arroganten Pinsel in eine gelbliche Vergänglichkeitswolke gehüllt. Heute hat den Verlag übrigens ein Amerikaner gekauft.
Die Situation machte mich mutlos und lähmte mich, um so mehr, als ich keine neue Stelle fand: zu alt. Alles Wissen, alle Erfahrung vergeblich, wenn die Arbeit fehlt.
Die vor mir liegenden unproduktiven Jahre machten mir angst.
Dabei lebte ich mehr in der Gegenwart als manch ein Jüngerer, sah sie schärfer und analysierte sie treffender, und als Verleger hatte ich stets die Zukunft im Auge, auch wenn sie für mich selbst nicht mehr in Frage kam. Ich dachte bei unserer Sachbuch-Produktion auch an jüngere Leser und hatte eine ganze Reihe dazu konzipiert und herausgebracht. Ich war, meine ich, kollegial zu den jüngeren Mitarbeitern, auch wenn ich mich für sie wenig interessierte. Ganz sicher habe ich auf Kritik nicht immer reagiert und zu vieles allein entschieden.
Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem man mir sagte, daß man mich »aus Altersgründen« meiner Mitarbeit entbinde und mir eine Abfindung zusage – es traf bei mir auf tiefe Ungläubigkeit und Überraschung, schließlich Entrüstung. Es war für mich unvorstellbar, daß ich zu alt sein sollte. Ich, der den Verlag erst zur Blüte gebracht hatte! Ich im »Ruhestand«? Zu alt? Was hätte ich darauf erwidern sollen? Das Ende der Lüge von der eigenen Bedeutsamkeit und Unersetzbarkeit.
Noch heute empört mich der Gedanke an diese Stunde. Das produktive Behaglichkeitsempfinden, sobald ich den vielversprechend mit Papieren bedeckten Schreibtisch und die auf mich wartende Arbeit sah, die wachsende Schreib- und Konzeptionslust, all das schwand.
Was die Argumentation, zu alt zu sein, so mörderisch macht: Das bislang Getane gilt nicht mehr. Ist erledigt. Was mir früher nie aufgefallen war (darüber nachzudenken hatte ich nie die Zeit): Es läuft auf die radikale Verurteilung eines ganzen Systems hinaus. Ich hatte keinen Platz mehr in der Welt und fühlte mich wie amputiert. Jemand, der nirgendwo mehr dazugehört. Doch das war für niemanden von Interesse. Es ging um die Ablösung durch einen wirtschaftlich Elastischeren, der die angeblichen Marktgesetze (welche?) bedingungslos anerkennt. Nie mehr braungebrannt, in Proletarierjacke und dreitagebärtig durch die Messen hetzen und hinter drahtgefaßten Kurzsichtigenbrillen politische Bestseller erjagen.
Zweifellos ist es der natürliche Lauf der Dinge, daß die Alten zurückbleiben, während die Jungen voranschreiten. Wenn wir nicht loslassen wollen, erlebt die jüngere Generation das Schicksal von Prince Charles: Man wird alt darüber.
Doch das war kein Trost. Das Demütigende war das Argument. Als hätte ich bereits den Bodensatz des Geistes und Körpers erreicht.
Die Scham, als ich mich von meinen Kollegen verabschieden mußte. Am liebsten wäre ich fortgelaufen.
Tage der Verzweiflung. Wie deprimierend viel einem Bücher bedeuten, wenn man sie macht! Ich war es nicht gewohnt, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Dazu war mir die lesende Unschuld verlorengegangen. Ich wurde rasch ungeduldig – es dauerte ein Jahr, bis ich wieder die ersten zaghaften Gehversuche machte.
Ich spürte, wie ich nachdenklich wurde, wenn ich einen früheren Kollegen traf und er von seiner Arbeit sprach.
Ob er ihr nicht eine übertriebene Wichtigkeit beimaß? Mit dem Sinn der Arbeit, so schien es mir mit einemmal, war es nicht weit her.
Mich überkam tiefe Gleichgültigkeit. Ich nahm am Leben nicht mehr teil und zog mich zurück.
Nach einem halben Jahr ein neuer Versuch. Ich wollte nicht aufgeben. Bewarb mich bei anderen Verlagen. Doch meinen Schwung und meine Durchschlagskraft, auch meine Unbefangenheit war ich los. Ich fühlte meine Distanz. Ich kam nicht an, fand keine neue Arbeit, und wahrscheinlich hätte ich mir, anstelle der anderen, auch keine gegeben.
Der Abstieg schien unaufhaltsam. Jetzt fühlte ich mich tatsächlich alt.
Wie ein verschmähter Liebhaber umkreiste ich nachts den Verlag und blickte sehnsüchtig auf ein erleuchtetes Fenster, hinter dem ein Mann am Schreibtisch saß. Der Alltag wurde quälend, beherrscht von Langeweile und Verzweiflung. Der Bahnhof zog mich an, der Zufluchtsort der Fremden und Gestrandeten.
Ungewißheit war in mein Leben getreten und legte sich über alles. Dabei ging es mir im Vergleich zu anderen Arbeitslosen zunächst finanziell noch gut, aber das Gefühl des Ausgestoßenseins drang immer tiefer in mein Innerstes vor. Die Vagheit des neuen Zustands war beängstigend.
Später dann der zu befürchtende Zusammenbruch des Rentensystems und des Sozialstaats. Meine Miete für die geräumige Wohnung ist zum Glück noch nicht hoch.
Doch meine Abfindung und meine Lebensversicherung, in die Hände eines betrügerischen Verwalters gelegt, schwanden erschreckend rasch, nur einen kümmerlichen Rest konnte ich noch bewahren. Die Betriebsrente des Verlags wurde inzwischen erheblich besteuert und gekürzt.
Am schlimmsten: Den Weihen des bürgerlichen Sonntags ausgesetzt zu sein. Und unter der Woche deprimierte mich der Gedanke, jetzt arbeiten Hunderttausende und du nicht. Es war immer so gut gewesen zu wissen, jetzt ist Bürozeit, jetzt arbeiten wir, gut, Autogeräusche im Ohr zu haben, Stimmen, Müllfahrerlärm – das Leben muß anwesend sein, wenn man arbeitet. Nun störte es mich.
Für jemanden wie mich, der sich immer wohl fühlte in seiner Haut und seine Arbeit liebte, bleibt das Alter etwas Abstraktes. Jetzt merkte ich plötzlich, daß ich nicht mehr jung aussah. Meine gerade Haltung, meine straffe Magerkeit, die leichte Art, den Fuß zu setzen, hatten sich verändert. Die Falten zu beiden Seiten des Mundes sind tief geworden, Du hast es gesehen, Charlotte, mein Haar hat sich gelichtet, mein Gang wurde schlaff. Ich habe die Sicherheit meiner Bewegungen verloren. Es gibt so etwas wie die Rache des Körpers.
Aber auch meine Gefühle, meine Phantasie gingen vor die Hunde. Auf den Straßen und Plätzen beobachtete ich andere Männer und versuchte zu erraten, was sie taten. Den unschlüssigen Gang der Arbeitslosen, die Verlorenheit in ihren Gesichtern und ihre besondere Art herumzustehen erkannte ich auf Anhieb. Ich haßte mich selbst in solchen Augenblicken, haßte die eigene Einsamkeit und Leere in ihren Blicken.
Bis ich endlich spürte, daß meine Augen damit beschäftigt waren, junge Frauen festzuhalten, zögernd erst, heimliche Wünsche im Kopf, schließlich saß ich mit Renate beim Wein: Etwas an ihr, ich weiß nicht mehr, was, hat mich an Dich erinnert. Bis das wirkliche Leben wiederkehrte, an das ich mich nur noch vage erinnern konnte, das Leben mit einer Frau, diesmal mit einer jüngeren, mit seinen guten und schlechten Seiten, der Prüfstein für meine sexuelle Unversehrtheit. Ich hoffte, bis ans Ende meiner Jahre so mit ihr leben zu können, doch das sollte nicht sein: Sie verließ mich. Das war vor zwei Jahren.
So: das fürs erste. Ich bin allein, abends esse ich allein, vielleicht gehe ich mal ins Kino oder besuche meine alten Freunde, die Bertrams. Das ist die Welt, in der ich lebe, das ist mein Leben.
Meine liebe Charlotte, der sich so gut schreiben läßt, ich will Dich sehen und mit Dir reden, nach so langen Jahren der Trennung, unser Alter bedenkend und unsere Möglichkeiten. Altbekanntes wiederfinden und Neues entdecken in unseren Gesprächen. Mit Dir denken an das, was nicht ging und gehen könnte … Vielleicht läßt sich Vergangenes wiedererwecken, was selten gelingt, weil die Erinnerung nie die Erwartung erfüllen kann.
Unser kurzes Treffen und unser Abschied – es war doch kein Abschied für die Ewigkeit? Wir wollen uns doch wieder schreiben und wiedersehen, bald? Ich werde älter, liebe Charlotte, und soviel Zeit bleibt mir nicht. Kann ich gutmachen, was ich an Dir schlecht gemacht habe?
Dein Johannes
P.S. Die Todesanzeige Deines Mannes vor zwei Jahren habe ich natürlich bekommen. Aber ich empfand zuviel Neid auf Dich und Julian, ein trotz allem zusammen gealtertes Ehepaar.
Lieber,
Johannes wird diese unheimliche Einsamkeit, in der ich manchmal mitten in der Nacht erwache, als hätte mich jemand gerufen, nicht kennen, dachte ich, er wird mit Anstand altern, wird endlich Ruhe gefunden haben und eine Frau, die darauf achtet, daß er seine Magenpillen nimmt. Ja, ihm gegenüber sitzt beim Abendessen längst eine jüngere Frau und ißt mit ihm seine geliebte carbonara … So ging es mir durch den Kopf, wenn meine Gedanken manchmal zu Dir hinwanderten.
Ein anderes Mal stand ich vor dem Spiegel und betrachtete mich mit meinem dritten Auge, als hätte ich meine Kamera in der Hand, prüfte mich mit dem argwöhnischen Ausdruck eines Menschen, den man zum Narren gehalten hat – als Fotografin kann ich Auge und Kamera nicht trennen. Ich bin mir immer meiner Wirkung sicher gewesen und habe mich an Huldigungen gewöhnt, doch damit ist es vorbei. Ich falle nicht mehr auf mich herein: Ich bin dabei, die Grenzlinie vom Altwerden zum Altsein zu überschreiten. Ich bin dabei zu lernen, wie man ohne Liebe lebt.
Da ist Johannes, der erfolgreiche Verleger, sicher anders dran, dachte ich, seinen schön geformten Schädel, sein Lächeln, seine lange, mäßig gebogene Nase, seinen energischen Blick, sein festes Kinn, seine kräftigen Augenbrauen und seine gerade Haltung wird man betrachten und von ihm sagen: Immer noch ein gutaussehender Mann, und was für ein hübscher Junge muß der gewesen sein! Für ihn gibt es kein Hindernis zu lieben! Ein Mann lebt in anderen Wirklichkeiten, und Kraft und Lust bezieht er immer noch aus gleichen Quellen: ein Blick, ein Mund, eine Frauenbrust.
So dachte ich, wenn ich meine Haare fönte, über einen Mann, von dem ich lange Zeit nichts mehr gehört hatte und den ich nur jung kannte, na ja, leidlich jung.
Nun also unser überraschendes Treffen.
Ich sah, daß das Bild, das mir von Dir vorschwebte, nicht mehr stimmt. Du bist weniger jung, doch war’s nicht so, daß ich das bedauerte. Das Weiße um Deine Pupillen hat weniger Glanz, da ist ein Schatten um Deine Augen, auf Deiner Stirn, eine Linienführung auf Deinen Wangen, die mich nicht täuscht. Es war zu sichtbar, Du hast gelitten.
Ich mochte diese Spuren auf Anhieb.
Mein Auge ist immer noch präzise. Aber ich muß zugeben, daß ich in Deinem Blick etwas las, das mich erstaunte. Wie flink er sich an eine Hoffnung klammerte, wie bequem!
Die Wiederaufnahme ist eine traurige Möglichkeit, mein Lieber, ich falle nicht darauf herein, und alles ist weit weg, so daß Du mir fast fremd erscheinst. Wir haben uns verändert, jeder von uns. Du rechnest doch nicht damit, daß das von mir kommt, Mitleid, etwas, das ich nicht leiden kann. Ich habe nämlich keinen Grund dazu, Dich zu bedauern, denn ich habe selbst ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch ich bin eine wenn auch nicht gewöhnliche Arbeitslose.
Es begann mit dem Foto einer jungen Frau, einer Schriftstellerin, die en vogue war und gerade ihr erstes Buch veröffentlicht hatte, einem Porträt für meine seit langem geplante Ausstellung im Literaturhaus zum Thema »Jung und Alt«.
Ich war voll Erwartung, als ich nach siebenstündiger Fahrt nach Berlin aus dem Auto stieg und die schwere Tasche mit der Fotoausrüstung die fünf Treppen zu ihrer Wohnung hochschleppte, und als ich oben war, fühlte ich mich schwindlig.
Die Tür stand offen, eine hohe Stimme rief mich hinein. Die Wohnung war fast leer. Wie so oft hatte ich mir nach Zeitungsfotos wider Willen von ihr ein Bild gemacht und überlegt, wie ich sie aufnehme – diese Vorstellungen machten mir jetzt zu schaffen.
Sie hockte, halbnackt, die Beine angezogen, in einem BH-artigen Oberteil, den kurzen engen Rock hochgezogen, auf einer Seemannskiste und zerpflückte mit den Fingern ein gebratenes Huhn. Sie sah umwerfend verrückt und halb verhungert aus, mit einer Haut wie japanisches Porzellan und unendlich langem, dünnem Körper, eine tragische bellezza mit ihrem verrutschten Picasso-Madonnengesicht, und reichte mir ein Hühnerbein. Ich schüttelte den Kopf, sagte, danke nein, meine Augen waren wie überbelichtet, helle Blitze zuckten um meine Iris. Jetzt sie aufnehmen, jetzt, dachte ich, im Kopf diesen Schwindel, und zerrte meine Kamera aus der Tasche, doch da stand sie schon auf und holte mir eine Tasse mit Tee, ein Sonnenstrahl kam durchs Fenster und erleuchtete ihr Albinohaar, es erstrahlte weißschaumig wie Eischnee auf ihrem Kopf, sie lächelte mich über ihre riesige Ketchupflasche hinweg an, mit eisblauen Augen, ohne Tiefe, nein, dachte ich, als sie wieder saß, es geht nicht, sie ist nicht festzulegen.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihren Fotos, sagte sie, Sie sehen Dinge, die sonst keiner sieht, und gerade in diesem Augenblick, als sie ihr Eischneehaar schüttelte, in den Augen dieses narzißtische Schimmern, war mir klar, daß sie um ihr Gesicht wußte und daß ich sie nicht porträtieren konnte, ich fühlte mich wie gelähmt, ich hatte nicht den Mut, es mit ihr aufzunehmen, ich war ihr nicht gewachsen.
Feuchtes in den Augen, packte ich meine Kamera ein und sagte, ich werde Sie nicht aufnehmen, es kommt nichts dabei heraus, ich gehe, ich schaffe es nicht. Sie funkelte mich an, blaß und empört, dann bemühte sie sich um ein Lächeln und sagte: Ach ja? Ja, sagte ich, ich habe nicht mehr den Mut, ich versage, ich bin am Ende. Ich hatte die Augen niedergeschlagen, aber ich spürte, wie sie mich betrachtete, sie sagte, aber warum. Verstehen Sie nicht, antwortete ich, weil meine Augen nicht mehr die jüngsten sind und mir der Blick verschwimmt, weil meine Arthrosehände das Bild verwackeln, weil es mich anstrengt zu reisen, weil ich mein Leben hinter mir und Sie Ihres vor sich haben, kurz, weil ich zu alt bin, um Sie zu kapieren, deshalb.
Nun kam der Moment, für den ich kein anderes Werkzeug brauche als meine Erinnerung: Ihre Magerkeit wirkte auf einmal krankhaft und outriert, ihre Haut bekam einen gräulichen Ton, ihr Blick wurde erbarmungslos kalt, ihre Stimme schwappte über und wurde scharf, sie sagte: Und mein Bild in Ihrer Ausstellung? Was ist damit? Überhaupt, wovor hat man in Ihrem Alter noch Angst? Und das alles mit diesem geziert-aggressiven Unterton, der bedeutete, laß es gut sein, Alte, bleib besser zu Hause und befaß Dich mit Deinem baldigen Tod.
Das war meine Abdankung, lieber Johannes, mein letztes Bravourstück, und seitdem hab ich die Kamera nicht mehr angefaßt … Meine Dunkelkammer neben dem Bad ist unberührt, meine Schriftstellerporträts im großen Flur sehe ich nicht mehr an, die Ausstellung im Literaturhaus habe ich verschoben. Vorbei meine Träume von Ausstellungen in New York, Sydney, Bombay, ich bleibe eine europäischen Feuilletons gerade noch bekannte Fotografin, auf die man zurückgreift, sobald man Porträts deutscher Schriftsteller braucht, wenn sie gestorben sind. Machte ich jetzt ein Selbstporträt von mir, wäre es eins von einer alten Närrin, die hie und da noch einmal wehmütig ihre Kamera in den Armen wiegt wie ein kleines Kind.
Doch eigentlich wollte ich ein wenig von Julian erzählen. Apropos: Findest Du es nicht seltsam, daß sein Tod Neidgefühle in Dir weckt? Das spricht nicht gerade für ein ausgefülltes Liebesleben! Dabei hatte Julian weiß Gott in den letzten Lebensjahren keine glückliche Zeit. Schon vor seinem Tod mußte ich seiner Wachheit und seinem jungen Geist nachtrauern, er war zunehmend verwirrt. Früher hatte er immer beteuert: Wenn seine körperliche Kraft einmal abnähme, stünde es mir zu, untreu zu sein, wir würden uns wiederfinden, auf dem festen Boden des Vertrauens. Uns trennten sechzehn Jahre, und bei aller Untreue blieb ich ihm doch treu.
Diese Nähe schwand, als er krank wurde. Wie sehr nicht nur ihn, sondern auch mich seine Krankheit veränderte! Ich sah, wie er immer starrer und begrenzter wurde, ein Mensch von unbegreiflicher Kindlichkeit, zutraulich wie ein kleines Tier, doch mit niedergeschlagenem Blick. Er sprach immer weniger und wenn, dann monoton in kurzen, schlechtgebildeten Sätzen, an die ich mich nicht mehr erinnere, denn der Sinn der Worte kann nicht von ihrem Klang abgelöst werden.
Mich schockierte und verletzte seine Desorientierung, die er zunächst noch erfolgreich verbarg. Ich zeigte wenig Takt, als er immer mehr an Kraft verlor, seinen jämmerlichen inneren Zustand zu verbergen, und meine Abwehr hat mir sein Leiden nicht verständlich gemacht. Das erreiche ich wohl erst jetzt, mit neunundsechzig, wo ich selbst mit dem Altwerden so meine Probleme habe und mich meine Einbußen fertigmachen.
Gegen seine Gewohnheit wachte er sehr früh auf, und ich hörte seine Schritte, die etwas Müdes und Suchendes bekommen hatten, er tapste wie einer, der mit nichts mehr Schritt halten muß. Ich war es gewohnt, in der Wohnung allein zu sein, tagsüber mein Studio, meine Arbeitsstätte, mein Refugium. Jetzt ging er durch die Wohnung, raschelte stundenlang mit der Zeitung, hantierte in der Küche, ging ins Bad und war gänzlich auf mich fixiert: Immer folgte er mir vertrauensvoll dorthin, wo ich ging, stand da, mit einem leichten Wiegen des Oberkörpers, Anzeichen nervöser Ermüdung, und schien auf ein Wort, eine Berührung zu warten.
Es störte mich, dieses Warten und diese Erwartung, diese immerwährende Bereitschaft zu einem Gespräch, an dem er auch dann festhielt, wenn nicht die Zeit dafür war, überhaupt, was war von einem Gespräch schon zu erhoffen, es machte mich ungeduldig und gereizt. Enttäuscht dachte ich an den anregenden, geistsprühenden Mann.
Was ich brauchte, wenn ich arbeitete, war die ungestörte Verbindung zwischen Kopf und Hand, Ruhe und Dunkel, um meine Augen zu schärfen. Also blieb ich, solange ich konnte, eingebunkert in meiner Dunkelkammer, fror Leben ein, experimentierte mit grobem Ton, harten Tonwerten, scharfriechenden Fläschchen, komponierte Weichzeichnungen, was ich dann wieder verwarf, und zählte mit meinem Blick die Vorräte, wie lange ich ausharren konnte, hortete Nüsse, Brot, Getränke, arbeitete bei lauter Musik, um ihn nicht hören zu müssen, und verlängerte mit unterdrückter Wut meine Einsamkeit.