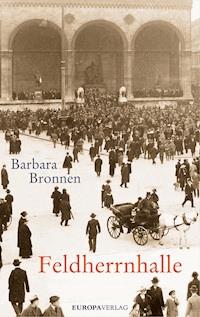3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Zwei Frauen gehen zur Sache – eine ostwestdeutsche Affäre Judith kommt aus Ostberlin. Sie ist Malerin, knapp über dreißig und versucht zu begreifen, was mit ihr, ihrem Staat und ihren Idealen seit 1989 passiert ist. Seit einem halben Jahr lebt sie in München, als heimliche Geliebte des erfolgreichen Rundfunkmannes Johannes, der gerne Brecht zitiert und sich heute noch links fühlt. Besonders glücklich ist Judith nicht in dieser Idylle, aber wirklich Angst bekommt sie erst, als eines Tages Lea bei ihr vor der Tür steht, offenbar mit einer Pistole in der eleganten Handtasche ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Ähnliche
Barbara Bronnen
Leas siebter Brief
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
Für Bernd C. Hesslein in Dankbarkeit für viele Gespräche über unseren deutschen Augenblick
1 Licht und Schatten
Der Futon mit der indischen Decke sah wunderschön aus, diese vielen Spiegelchen, aus denen Johannes zu springen schien und die das Licht brachen, Farbkörper, die Übergänge schufen, wechselnd zwischen Bewegung und Ruhe. Ich habe mich oft daran gerieben, daß die DDR ein Land so ohne Farbe war (womit ich nicht die beliebige Buntheit verklären will), grau und ohne Glanz. Es war nicht nur die Armut, kein Inder würde, bei aller Armut, auf Farbe und Spiegelungen verzichten. Die abweisende graue Mauer begrenzte das Drüben und hielt Verstörend-Illusionäres in Schach. Grau schützt vor Phantasien und Träumen. Und durch Spiegel hätte man in Anderland gehen können.
Träume. Utopien. Gesellschaftliche Träume sind Kraft. Träume sind Mut. Träume sind Veränderung. Träume sind Schönheit. Träume sind Bewegung und vertreiben die Zagheit. Manchmal, wenn ich zur Frauenbuchhandlung Unter den Linden gegangen war und dann noch ein paar Schritte mauerwärts, sprang mich auf der von den Vopos gebotenen Distanz die Phantasielosigkeit dieser Staatsgrenze schmerzhaft an. Wenn sie schon sein mußte, warum war sie nicht wenigstens grün, überwuchert von Bäumen, Sträuchern, Efeugirlanden? Warum nicht bunt, verziert mit Graffiti, wie sie im Westen en vogue waren, gar ein Trompe-l’œil des Wirtschaftswunderlands – ich hätte gar zu gern dran gemalt. Bedrückend, dieser Mangel an Phantasie, weil sie es gewohnt waren, uns geringzuschätzen, diese massive Abweisung, diese unverhüllte grabgraue Grausamkeit. Sie verlangten nach Blindheit, Taubheit, sie brauchten es so.
Ich hab einen Horror vor Menschen ohne Phantasie, sie haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und ihre Seele verkauft. O unsere Architekten, unsere Hanswurste von Verwaltern, unsere Staatsmänner, unsere Wiederkäuer von Volkspoeten! Ich war in bezug auf ihre Bilder und ihr Vokabular mehr als empfindlich, diese Sprache von Herren und Meistern, die uns in die Knie zu zwingen versuchten. Bildermörder, von unseren Staatsschützern bis runter zum Abschnittskommandanten, in ihrer Verachtung für Schönheit und Phantasie. Ohne Phantasie sind sie nur arme Idioten mit Gesichtern hart wie Stein, Wiederkäuer unserer Langeweile, der Furcht und der Qual endloser Wiederholung.
Der große Zauber von Spiel und Neubeginn lag für mich in dieser Decke, etwas von Lebenskünstlertum so, wie ich es mir vorstellte. Und wenn auch nicht alles, wie ich es mir ausgemalt hatte, eingetroffen ist, so gewann ich doch eine farbigere Existenz und spürte, wie lebendig ich werden konnte, weg vom Flüstern und Getuschel in Grau.
Ich zog die Schublade meines Schranks auf, mit den breiten, langen Fächern für meine Bilder. Ich fand Die Straßen des Überflusses, meine Vision des Wirtschaftswunderlands, und stellte das Bild auf die Staffelei. Ein Panorama, 1980 gemalt, als ich noch nicht ahnen konnte, daß meine Farbsehnsucht beinahe über Nacht mit einem Bilderterror, schreiend bunten Plakaten und geisterhaften Leuchtreklamen ohnegleichen belohnt werden würde, ein kollektiver Schock.
Ich blickte das Bild mit nostalgischer Einfühlung an. Eine Augentäuschung, ein Truggebilde, das meine Naivität und meine Hoffnungen zeigte. Nichts von jenem Technicolor-Trümmerhaufen nach einem Bombeneinschlag, diesen optischen Explosionen.
Mein größter Fehler war damals diese Anwesenheit von natürlichem Licht. Mit diesem naiven Licht hatte ich bloß meine Illusionen erleuchtet. Nichts hatte ich von seiner völligen Abwesenheit ahnen können, die ich heute als so quälend, fast tödlich empfinde. Ich pflegte mein Vergnügen an barocker Ekstase, pinselte an ausladenden Marktständen, angefüllt mit herrlichstem Obst, an buntgekleideten Westlern, die Arm in Arm spazierengingen, an schwarzen Pudeln mit Lodencapes, Mädchen in kurzen leuchtenden Kleidern und Hüten, die mit Luftballons spielten, goldenen Schriften und sieben blauen Bergen, hinter denen die Freiheit tobte, mit tanzenden Damen in Galakleidern, rosa Wassern und einer gedeckten Tafel. Ich war nichts als ein Packesel der Werbung gewesen, eine geschmäcklerische Träumerin, und meine Bemühungen, visionär zu sein, hätten nur Wohlstandsdschungel und immergleiche Miniaturen zur Folge gehabt, romantische Balgereien mit einem niedlichen Kapitalismus …
Vorsicht, Judith, wenn du das jetzt für dein Triptychon verwendest. Du willst doch hier nicht Wurzeln schlagen. Mach die Augen auf und bleib auf der Hut! Was dir vorschwebt, geht nur mit Grausamkeit im Blick und Ironie. Du bist doch solcher hingepinselten Unverschämtheit noch fähig? Du mußt nicht geliebt werden für das, was du siehst. Die Menschen sollen ein wenig genauer hinschauen lernen, wenn sie deine Bilder betrachten, und überlegen. Vielleicht wird ihnen dann ihr Leben bewußt. Sie dürfen nicht in deinen Bildern ertrinken. Deine Bilder sollen Geschichten erzählen, die auch die ihren sind.
Dann berührte ich leicht mein erstes kleines Selbstporträt, den Akt Die Nackte, ein quadratisches Bild, mit goldenem Rahmen, nicht größer als 30 mal 30, und stellte es in mein Bücherregal, mein kleiner Talisman.
Ich blätterte in meinen Skizzen zum Triptychon. Heute sah ich meine Aufgabe darin, ohne malerische Sensationen Vergangenheit und Gegenwart sichtbar zu machen. Ich wollte die Geschichte in meinem Licht zeigen. Im Gegensatz zu meinen Anfängen versuchte ich, dem Malerischen aus dem Weg zu gehen und störrischer in meinen Bildern zu sein. Ich suchte das Heutige, Problematische. Ich kannte mich inzwischen besser.
Das erste Bild meines großen Triptychons hatte ich nach jahrelangen Vorarbeiten vor neun Wochen endlich begonnen. Es war schon fast fertig. Die rote Fahne hieß es, ein Bild der Trauer über eine verlorene Utopie, in dem zugleich die Geschichte dieser historischen Hoffnung noch einmal rekapituliert wurde. Die zweite Tafel sollte ein Vexierbild werden: das Bild der Veränderung der DDR nach der Wende, ein Schockbild des Wirtschaftswunderlands, ein Geisterbahn-Zerrspiegel aus künstlichem Licht. Ich wollte die Gegenwart darstellen, hindeuten auf das, was aus unseren Hoffnungen geworden ist. Einen Eindruck erzielen, der bis zur Übelkeit gehen sollte, wenn es mir gelang, vergleichbar den ersten Panoramabildern aus der Wende zum 19. Jahrhundert. Damals, so las ich neidvoll in alten Berichten, reagierten empfindsame Damen und zartbesaitete Stutzer mit Schwindel und Erbrechen auf manche Bilder und wurden gar beim Anblick eines Riesen-Panoramagemäldes von Nausea, der Seekrankheit, befallen. Soll man das den eigentlichen Beginn des Medienzeitalters nennen? Was das dritte Bild werden sollte, wußte ich noch nicht. Die Zukunft der DDR, soviel stand fest.
Es hat mich immer eigentümlich berührt, wenn ich meine mißlungenen Bilder betrachtete. Das Dargestellte verlor ich dann rasch aus den Augen, weil mir meine eigene Geschichte, mein eigener Spiegel entgegenglotzte. Es waren dies Bilder, in denen mein Ich in Stücke zersprang, dann wieder zu einem Nixenwesen zusammengefügt wurde, halb Fisch, halb Mensch. Ich konnte die Bruchstellen, wo das Gute an meinen Bildern endete und das Schlechte begann, genau sehen. An meinem Schokoladenseitenbild der BRD, den Straßen des Überflusses, konnte ich genau ablesen, wie lang der Weg gewesen war, den ich hatte zurücklegen müssen, bis die ernsthafte Auseinandersetzung begann. Da war nichts wegzuwischen und nichts zu übertünchen, da war nur daraus zu lernen.
Ich ging in die kleine Küche und machte mir ein Brot. Nicht einmal ein richtig gutes Messer hatte ich, aber das störte mich nicht. Meine Art zu essen ist immer noch spartanisch, und was Kochen betrifft, habe ich nicht viel dazugelernt. Johannes zog mich oft damit auf. Auch mit meinem Heißhunger auf Bananen – oft verschlang ich ein ganzes Bund.
Ich empfand es als wohltuend, an Johannes zu denken, an den Johannes von damals, als wir uns kennenlernten. Inzwischen hatte sich ja einiges verändert, auch in unserer Beziehung zueinander. Dennoch gab es mir immer noch eine gewisse Sicherheit, wenn ich an ihn dachte.
Johannes und meine Bilder, Johannes und meine Decke, Johannes und meine Bananen …
Immer noch war jede Einzelheit, die mit ihm in Verbindung stand, von Bedeutung. Aber er durfte keine Oberhand gewinnen. Ich mußte mein Leben führen, und das allein. Nach vorn blicken. Es genügte, daß er da war und mich begleitete. Stufenweise würde ich eindringen in die Wirklichkeit dieses immer noch neuen Lebens.
Doch auf geordnetem Fundament. Also noch einmal zurück. Manchmal brauchte ich die Bilder von früher, um neue daraus zu machen … Draußen ein Geräusch, Schritte, ein Knacken der Äste.
Vorbei. Der Anfang unserer Geschichte war wie abgeschnitten. Alles war wieder da: meine Angst, diese Bedrohung, meine Furcht und mein Schrecken. Seit zwei Tagen hatte ich das Gefühl, daß ich beobachtet wurde. Oder wie hieß das richtig? Observiert.
Ich atmete tief durch und trat zum Fenster. Da stand sie wieder, die fremde Frau. Hatte den schmalen Weg betreten, der durch den Garten führte, und starrte unverwandt auf mein kleines Hexenhaus. Sie hatte es auf mich abgesehen, aber wieso? Was wollte sie? Eine Räuberin? Alles, was ich bislang dazu gedacht hatte, ergab keinen Sinn.
Mit der Angst war es etwas anderes. Früher hatte ich solche Ängste nicht. Doch seit ich hier bin, haben sie mich begleitet. Angst vor der Arbeitslosigkeit. Angst, keine Wohnung zu finden. Angst, mit anderen verglichen zu werden. Angst, kein Bild mehr zustande zu bringen. Angst vor dem Desinteresse. Angst vor den Galeristen. Angst vor der Ablehnung. Angst vor der Mieterhöhung. Angst vor Kollegen. Und nun dies. Es war keine angenehme Vorstellung, den Rest meines Lebens mit Ängsten verbringen zu müssen.
Ich saß in meinem Atelier, nennen wir es besser Arbeitsraum. Ateliers sind hier nicht nur unerschwinglich, es gibt sie kaum. Vielleicht 24 Quadratmeter, nicht groß genug. Zwei Balkontüren an zwei Seiten, westliches und östliches Licht. Oberlicht. Eine Bücherwand mit ein paar Fachbüchern, Kunstgeschichten, meine schöne Brecht-Ausgabe vom Aufbau-Verlag. Die dicken blauen Bände MEW, mein Marx-Engels, Volksausgabe 1964, mit roten Zettelchen gespickt (auf der Suche nach Marx-Sprüchen als Motti für meine Bilder). Was immer über den Sozialismus zu sagen ist: so schnell wie man heute glaubt, ist er nicht zu begraben. Mir steht er immer noch näher als der Kapitalismus, so wie Liebe schöner ist als Ehe, so ist das nun mal mit Utopien. Meine alte, fast schon zerschlissene rote Fahne, an der ich hänge. Erinnerung an meinen Vater, dem ich sie abgebettelt hatte, als ich rüberging in den Westen. Symbol meiner Vergangenheit, dieses Antifa-Requisit, Teil meiner Geschichte. Mein Maskottchen, das ich von Wohnung zu Wohnung mitgeschleppt hatte, das Zeichen meiner Hoffnung auf bessere Zeiten. Das sentimentale Sinnbild meiner Liebe, mein Arbeitsmotiv, mein Protest, Abbild meiner Unbehaustheit und Nach-vorn-Bewegung. Ziemlich viele Bedeutungen für so einen alten roten Fetzen, und jede gleich wichtig für mich. Wenn ich lange genug draufschaute, löste das monochrome Rot sich auf in einem Wirbel von Bildern, die einander überlappten, überschnitten und ablösten.
Das ernsthafte Bild Brechts mit der kleinen Nickelbrille. Ein Stoffpüppchen aus der SU, mit langem flachsblondem Haar und niedlichem Gesicht, mit weitem Rock und bunten Borten, einem kleinen blauweiß getupften Halstuch und roten Stiefelchen an den Füßen. Das hat mir Johannes mitgebracht, als ich hier vor sechs Monaten einzog. Vor zwanzig Jahren habe er das in Moskau erstanden (du meine Güte, da war ich gerade mal elf!). Er habe es immer bei sich in der Wohnung gehabt, sagte er. Aber dann, als ich nach München kam, hat er sich’s vom Herzen gerissen, um es mir zu schenken. Daneben mein allererstes Bild, das je in einer Ausstellung war, ein kleiner Akt, ein Aquarell, das er mir hatte rahmen lassen und das immer über meinem Arbeitstisch hing, Erinnerung an meinen Anfang. Dieser sündteure Futon, er hatte 4000 Mark gekostet, das Einstandsgeschenk von Johannes, mein einziger Luxusgegenstand. Sonst nur meine Bilder, an den Wänden aufgehängt oder gestapelt, ein Bündel mit Briefen von Johannes, meine Skizzenmappe, meine Psychologiehefte, beschwert vom rot eingefärbten Stein, auch ein Geschenk von Johannes.
Ich setzte mich an meinen Arbeitstisch, eine große rohe Holzplatte mit zwei Böcken, neu, aber bereits gezeichnet von Farbspritzern und Ölflecken. Vor mir das Glas mit den Pinseln. Liebevoll berührte ich mit den Fingerspitzen meinen sibirischen Rotmarderpinsel, vom Munde abgespart auf meiner ersten Reise in die SU. Heute wäre er nicht zu bezahlen. Meine Arbeit beginnt stets mit einer zärtlichen Berührung dieses Pinsels.
Meine großen Pinsel mit zum Teil selbstgeschnitzten Schäften und mein kostbarer japanischer Pinsel lagen auf einem großen, fleckigen Nudelbrett neben meinen Ölfarbenkübeln und dem Topf mit Leinöl. Ich mag es nicht, wenn die Ruhe meines Arbeitsraumes durch irgend etwas gestört wird.
Ein Bagger auf der nahen Hauptverkehrsstraße brachte meine Gläser zum Klirren, und ich ging zum Bücherbrett, um ein Glas zurückzuschieben. Dabei stolperte ich über mein Epidiaskop, ein riesiges schweres Ding. Ein Klotz von Projektor mit Papiervorlage, den per Frachtgut aufzugeben mich ein Heidengeld gekostet hatte. Eine überdies überflüssige Aktion, dieses veraltete, verrostete Ding mitzuschleppen, kein Maler hier arbeitete mehr mit einem solchen Koloß. Über den Zementfußboden hatte ich billiges Linoleum gelegt, damit ich nicht für Farbspritzer haftbar gemacht werden konnte. Auch meine farbigen öligen Fetzen stapelte ich in einem Korb. Ich richtete den Strahler der Tageslichtlampe auf meine Arbeit und sog den Geruch der Farbe ein, zusammen mit meinem Moschus, einem kleinen Fläschchen, soeben erstanden. Türen und Wände hatte ich weiß gestrichen.
Es war ein quadratisches, einfaches Zimmer in einer Art Hinterhaus zu einer aufgelassenen kleinen Arzneimittelfabrik, vielleicht ein Vorarbeiterhaus aus der Gründerzeit, das nicht abgerissen werden durfte. Es gehörte einem Freund von Johannes, den er dazu überredet hatte, mir dieses Häuschen gegen geringe Miete zu überlassen, außerdem hatte es zwei große Oberlichter, das hatte meine Einwände besiegt. Mir war das Hinterhaus, obwohl es mitten in Nordschwabing lag, rundum zu einsam und zu verkommen erschienen, der Park darum verwildert und teils voll Gestrüpp, ein bißchen unheimlich das Ganze.
Im Badezimmer, das an eine winzige Küche angrenzte – beides hatte Johannes einrichten lassen –, wusch ich meine Hände, ging ins Arbeitszimmer zurück und schob den naturfarbenen Rupfenvorhang am Fenster beiseite, so ungefähr das Billigste, was ich auftreiben konnte. Da stand immer noch diese Unbekannte, eine schwarzgekleidete Frau, im spärlichen Licht der entfernten Straßenlampe, und blickte unverwandt auf mein Haus. Nun schon den dritten Tag zwang sie mich, meine Aufmerksamkeit auf sie zu richten, nur durch ihre Anwesenheit. Ich sah sie durch die Zweige meiner geliebten Pendula, einem gekrümmten, sich dem Boden zuneigenden Baum, der nahe bei meinem Fenster stand. Unter diesem Baum hatte mich Johannes im August geliebt.
Draußen schneite es leicht. Die Äste der Pendula, die das Fenster streiften und die ich, wenn ich aus der Tür zum Garten hinaustrat, beiseite schieben mußte, glänzten schwarz, überhaucht von einem weißen Schimmer. Verwischte Schatten, und dahinter diese verzerrte Person, ein Lichtsäbel schnitt ihr das Kinn weg, während irgendwelche Funkeldinger an Ohren und Brust explodierten. Eine Frau, die fragend hereinstarrte und an ihren blonden Locken zerrte. Die Anwesenheit der Unbekannten da draußen machte mich verrückt. Der Wunsch, Johannes anzurufen, wurde fast übermächtig.
Vielleicht war ich ja selbst plemplem und sah nichts als meine eigene Visage, die zurückstierte, wenn ich durchs Fenster hinausstarrte. Schließlich war es mein Gesicht gewesen, das mich auf die Malerei gebracht hatte, ein wirklich unregelmäßiges, sich ständig änderndes Gesicht, und wenn ich mir die Nacht um die Ohren geschlagen hatte, sah es fast asymmetrisch aus. Ein in letzter Zeit zu rundes Gesicht noch dazu, wie meine Figur, das häufige Essengehen mit Johannes, der Rotwein, die viele Arbeit, die zwei Berufe, die Jagd nach dem Geld – und etwas anderes, das fein an mir zu nagen begonnen hatte und das ich nicht Enttäuschung nennen wollte. Aber in meinen Bildern schien es schon durch, und ich hatte den Verdacht, daß es nicht nur mit diesem Land, sondern auch mit Johannes zu tun hatte.
Ausgerechnet Bananen. Ich legte die Schale auf den Boden. Für mich waren sie wichtig. Sie waren praktisch, schmeckten gut, ohne Mühe immer gleich eine richtige Mahlzeit. Und ohne sie wäre nie mein Bananen-Zyklus entstanden.
Entweder ich konzentrierte mich jetzt auf die Arbeit, oder ich brauchte gar nicht erst anfangen. Wenn ich malen wollte, mußte ich den Kopf frei haben. Ich versuchte, mich mit aller Kraft auf das Bild zu konzentrieren, doch wieder erschien Johannes vor mir.
Vielleicht half es, wenn ich mich meinen Erinnerungen ohne Skrupel überließ. Ich nahm einen meiner Skizzenblöcke. Ich bin eine Phasenarbeiterin, die manchmal wie im Rausch einen Entwurf nach dem anderen produziert, manchmal auch ein Bild. Hier sammelte ich meine Skizzen, Tagebuchblätter, stark reduzierte Zeichnungen, Ideen, Notizen zum Tage, Zeitungsausschnitte, Briefe.
Leinölflecke zierten eine Seite mit einem flüchtig hingeworfenen Frauenbein. Darüber stand: Meine letzte Ausstellung in der DDR. Damit hatte alles begonnen. Mein Gedächtnis hat seinen eigenen Skizzenblock, viel bunter, als ich je würde malen können, voll Farben, die es im Spektrum nicht gibt. Meine Bilder sind immer nur die halbe Geschichte.
Wie eigentlich kam es, daß ich hier gelandet bin?
Meine letzte Ausstellung in der DDR. Diese Überschrift hatte ich später hinzugefügt.
Es war an einem Sommerabend im Jahr 1988 in Berlin. Meine zweite Ausstellung im Palast der Republik. Nicht im großen Rundgang neben Sitte oder Tübke. Leider nicht. Ich war zusammen mit ein paar anderen jungen Künstlern »ins Kollektiv« gehängt worden, aber dafür gleich unten im Foyer, wo naturgemäß viel Betrieb war, vor allem sonntags, wenn das Volk auf Kultur machte.
Es war wie immer, Freunde, Interessierte, meine Eltern, ein paar Funktionäre, ein paar Malerkollegen, mein alter Lehrer Sabrinski von der Kunsthochschule. Sven Schoofs, der Schriftsteller und Grenzgänger, führte mich in einer kleinen Rede als »junge Schwester Mattheuers« ein.
Eben nicht, dachte ich ärgerlich. Man wollte mich ausstopfen, mein Werk eingliedern in seinen parodistischen Jahrhundertschritt. Nicht einen einzigen kostbaren Rotmarder-Pinselstrich hätte ich auf ein ausschreitendes muskulöses Männerbein verschwendet. Für mich wäre es immer der Schritt einer Frau gewesen, leicht und gewaltlos, doch unbeirrbar und fest.
Frank Voss umschlich mich vorsichtig, ein dünnes Hemd, Kettenraucher, einer von diesen Kunstschmarotzern aus Westberlin, der die Ostkünstler aufkaufen und ausschlachten wollte und sich als Wohltäter aufspielte. Dabei würde ich, wenn er überhaupt interessiert war, am allerwenigsten profitieren; denn der Staat rechnete stur nach Quadratmetern ab. Mein größtes Bild war demnach höchstens 800 Mark wert, und davon würde der Staat obendrein noch die Hälfte behalten.
Jung wie ich damals war, noch keine dreiundzwanzig, empfand ich Westleute eher als störend, war aber doch geschmeichelt, daß er mein Werk »interessant« fand. Während ich mit ihm sprach, sah ich ständig über seine Schulter. Gegen meinen Willen suche ich immer nach einem Bild, mache Ausschnitte, mische die Farben, um irgendeine Schattierung, die mich anzieht, zu erreichen.
»Wir sollten in Verbindung bleiben«, sagte Voss.
»Wozu denn?« fragte ich frech. Aber natürlich dachte ich: Warum nicht? Den Bau verlassen, wenigstens mit ein paar Bildern, wäre nicht schlecht.
Festhalten, was keiner sieht. Jemanden ohne Maske ertappen und innerlich den Pinsel zücken. Ich sah den Mann mir gegenüber nur noch als Schattenriß. Ich hatte mein imaginäres »Gemälde« gefunden.
Ein im wahrsten Sinn des Wortes außergewöhnliches Bild.
Ein auffallend gutaussehender Mann Ende Vierzig oder ein bißchen älter (ernsthaft, noch kein graues Haar damals) vor meiner kleinen, 1985 gemalten Szene Frau vor dem Fernseher, einer Gestalt von absoluter und trauriger Einsamkeit. Sein Blick schweifte lange zwischen diesem Bild, meinem letzten Selbstporträt und einer abstrakt-expressionistischen Studie, wirr und ruppig, mit wildem Pinselhieb, hin und her. Mit Ausnahme jenes Mannes schien niemand zu bemerken, daß diese drei Bilder meine Brüche enthielten.
Ich war schon immer der Meinung, daß ein Betrachter für meine Bilder Zeit braucht. Schließlich entsteht erst in ihm das eigentliche Bild, für das ich nur die Vorlage liefere. Es machte mich verrückt und gierig, diesen Fremden vor meinen Bildern zu sehen und nicht zu wissen, was in ihm vorging, ob er verstanden hatte. Um so mehr, als er nun zu vergleichen schien. Denn jetzt verließ er seinen Standort vor meinem schwelgerischen Pinselbild, wechselte zu meinem Selbstporträt und blieb dann vor der Frau vor dem Fernseher stehen, offenbar tief in die Betrachtung dieses Bildes versunken. Eine Frau im Sessel, die ihre Augen auf eine Frau im Fernseher richtet, die in einer Fabrikhalle an einer Maschine arbeitet. Der Fremde kümmerte sich nicht um die Leute, die vorübergingen, und ich hatte die Gewißheit, daß er sich auf mein Bild konzentrierte. Die Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit.
»Vor einem Jahr hatte ich eine große Mattheuer-Retrospektive«, sagte Voss mit leicht überlegenem Tonfall, ich hörte ihn kaum, ganz damit beschäftigt, diesen Anblick männlicher Faszination einzufangen: ein Bild, an das ich mit großer Zärtlichkeit denke. Seither weiß ich die Anziehungskraft meiner Kunst auf ganz besondere Weise zu schätzen.
Ich bin nicht bekannt dafür, daß ich mich lang anstelle, ich ging zu ihm hin und sprach ihn an.
»Was meinen Sie zu diesem Bild?« fragte ich und blickte ihn an.
»Ich meine gar nichts«, sagte er, »ich liebe dieses Bild.«
»Es ist von mir«, sagte ich.
»Da bin ich mir ganz sicher«, antwortete er. Dann wies er auf das daneben: »Aber dieses nicht! Niemals!« Ausgerechnet das Selbstporträt, die Frau in Rot.
»Das ist auch nicht mein Bild«, sagte ich sauer. Er genoß meine leise Wut und lächelte mich an. Da stand er mir in Fleisch und Blut gegenüber, Johannes mit seinem sensiblen, offenen Gesicht, seinem wachen, neugierigen Blick aus melancholischen schönen Augen, seiner nachdenklichen Haltung, den feinen Händen – die Hände eines Schreibenden, und tatsächlich erblickte ich in der Brusttasche seines Jacketts ein schmales gebundenes Heftchen, daneben einen silbernen Füller. Ein Mann aus dem Westen, Redakteur bei einem privaten Sender, der sich nicht, wie die meisten Westbesucher, herablassend wie ein Kolonialherr aufführte.
»Johannes Maas«, sagte er mit einer leichten Verbeugung, »und Sie also sind Judith Herzfeld und haben sich in diesen Bildern versteckt. Nur in diesem einen da sind Sie nicht. Hängen Sie es ab.«
»Einen Teufel werde ich tun«, sagte ich. (Noch in dieser Nacht hab ich es weggeschafft.)
»Würden Sie mir ein paar persönliche Fragen beantworten?«
Es dauerte bis nachts um zwölf, als ich ihm am Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße hastig Adieu sagte.
2 Skizzen
Er hatte mich entdeckt, ich habe ihn aufgespürt. Daß dies meine Bilder zuwege gebracht hatten, war für mich in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Ein Mann mit einem Gefühl für meine Fehlschläge, die unzulängliche Verwirklichung meiner Vorstellungen, aber auch für mein Können. Das war der Anstoß, sich mit ihm zu beschäftigen.
Mehr aber auch nicht.
Ich hatte es, diskret zurücktretend und mich der Betrachtung meiner eigenen Bilder widmend, aus den Augenwinkeln verfolgt, wie er mit einer Frau sprach, die erst spät zur Tür hereingetreten war, eigentlich wohl, weil sie ihn abholen wollte. Die Frau war fast so alt wie meine eigene Mutter und doch sah sie ganz anders aus. Sie schien eine Art Leben zu haben, das meine Mutter nicht hatte. Seine Frau, wie ich später erfuhr. Eine schöne Frau, stellte ich fest, mit einer ganz anderen Existenz. Mit dunklem, zurückgebundenem Haar, eine Frisur, die mich so beeindruckte, daß ich sie später kopierte. Große Ringe an den Ohren, ein blutrotes Kleid, mit einer wunderbaren Rückenlinie, die vom Gesäß bis zum Hals hinauf lief. Keine Frau, vorstellbar in billigen Buden, mit Bücherregalen aus Brettern und Ziegelsteinen und Rupfenvorhängen. Eine fast asketische Schönheit, wie es im Westen gerade Mode war. Ein Widerschein ihres Glanzes fiel auch auf Johannes, ein wenig von ihrem Kardinalsrot überhauchte auch ihn: ein Mann, umhüllt von einer Frau mit Kultur.
Sie musterte mich unauffällig und knapp, verwarf den Gedanken an Eifersucht. Ich konnte es förmlich sehen, wie sie dachte: Gott bewahre, keine Angst, so etwas nimmt er nicht. Beruhigt war sie am Ausgang verschwunden und hatte ihn mir überlassen – oder mich ihm?
Wir saßen im kerzenlichtgesättigten Vinylschwarz einer damals noch keineswegs renovierten Prenzlauer Kneipe, der einzigen, die länger offen hatte und die deshalb von Schwulen bevorzugt wurde. Ein ultraschwarzer Hohlraum, die im Westen nennen es neoschwarz, in dem man wie gefangen blieb und in dem sich Johannes’ ovales Gesicht deutlich abhob.
Austausch mit einer anderen Welt. Damals wohnte ich noch bei meinen Eltern, VVN-Adel mit Ehrenrente (die ihnen nach der Wiedervereinigung aberkannt wurde), in einer heruntergekommenen Altbauwohnung in der Prenzlauer Allee, die Baracke mit der Kohlenhandlung meines Vaters gleich nebenan, kurz darauf habe ich sie mit einem versifften Plattenbau in der Dolgenseestraße in Lichtenberg vertauscht, wo ich wenigstens im nahen Tierpark Spaziergänge machen konnte. Johannes lebte in einer eleganten Altbauwohnung in Schwabing und sah wie aus einem Modejournal aus, feines Jackett, modische Brille, kostbare Uhr, ein – wie er ironisch sagte – Schoßlinker, den sich der Sender hielt.
»Wurzelloser Westlinker.«
»Wurzellose Malvagabundin. Die Palette in ein rotkariertes Taschentuch gesteckt. Pinsel als Krücke.«
Das war die Wahrheit. Ich war eine Verteidigerin der DDR und doch stets Außenseiterin geblieben.
Ich hatte das wurzellos nicht ohne Ironie wiederholt, und er sah mich ziemlich enttäuscht an. Den Stolz, mit dem er das Wort in den Raum gestellt hatte, fand ich unangemessen. Was wußte der schon davon?
Ich hatte keine Lust, mich meiner Wurzellosigkeit zu rühmen, und um abzulenken, erzählte ich vom Prenzlauer Berg, wo ein paar Künstler in einer Umgebung untergeschlüpft waren, die geradezu atemberaubend kleinbürgerlich war.
»Der Traum eines jeden sozialistischen Malers.« Ich lachte.
Damals kam es mir noch nicht wirklich exotisch vor, Bilder des optimistischen Fortschritts zu malen, aber ich bildete mir etwas ein auf meinen scharfen Blick, mit dem ich die Schwächen meiner Republik wahrnahm.
»Vater Anwalt, Mutter Hausfrau, aus Erfurt«, er räusperte sich.
Das Erfurt hatte er betont.
Wie eine provinzielle Idiotin deutete ich auf zwei Transvestiten im Mini, kleine, schräg sitzende Hütchen, blonde Perücken, gekonntes Make-up: »Schau’n Sie mal!«
»Nehmen Sie noch einen Wein?« Er blickte kaum hin. »Die Damen sind aus dem Westen. Sie sind rührend.«
»Wer, ich?«
Er nickte.
»Verstehe«, mein Mund wurde trocken.
Dann stellte ich ihn in punkto Wurzellosigkeit gnadenlos in den Schatten, sagte ihm, was ich wirklich gemeint hatte: »Mutter Jüdin, KPD, Vater parteilos. Verfolgte des Naziregimes, jetzt beide parteilos. Mittlere VVN-Ebene.«
Er half sich mit einem Seufzer, vermutlich ein Ausdruck linker Melancholie, und blickte mich geheimnisvoll an, als entdecke er an mir Unerschlossenes, das er noch herausbekommen müsse. Er wollte mehr: »Erzählen Sie.«
Ich erzählte.
Ich bin als Jüdin ganz unbemerkt aufgewachsen, ich wußte es nicht mal genau. Seit meiner Kindheit umgeben von Antifaschisten, teilte ich ihre Anschauung, die DDR bei allen Mängeln gut zu finden – schließlich haben sie meine Eltern mit aufgebaut. Abgesehen von meinem Großvater, der mich einmal in die Synagoge mitgenommen hat, haben sich meine Eltern dem Usus in der DDR angepaßt und nie von Mutters jüdischer Herkunft gesprochen. Dem Lager war sie rechtzeitig entflohen, ansonsten war das kein Thema.
»Was mir auf die Nerven fällt«, sagte ich, »ist dieser penetrante Positivismus. Man hat es hier geschickt verstanden, die Vernichtung der Juden allein dem Westen zuzuschanzen. Keine Zweifel, keine Meinungsverschiedenheiten über Ursachen und Folgen des Zweiten Weltkriegs. Hier badet man in höheren Prinzipien.«
»Ist was dran«, sagte Johannes. »Dennoch. Schlimmer sind die Verschleierungen und Lügen bei uns.«
»Unser Antifaschismus war nur schlauer«, sagte ich. »Man hat sich bei uns ein paar Hundert Paradejuden gehalten. Doch ein jüdisches Volk, jüdische Tradition und Kultur – das sollte es nach dem Willen der Sozialisten nicht geben. Nur Vorzeigejuden. Ohne wirkliche Autonomie.«
Er sagte nichts mehr, sondern neigte nur lauschend den Kopf.
»Im Westen, das lernten wir schon in der Schule, daß dort die SS-Mitgliedschaft nichts anderes ist als ein Kavaliersdelikt. Da haben Ex-Staatssekretäre oder Bewerber um nazistische Blutorden beachtliche Pensionen. Da sitzen die alten Nazis fett in nie entflochtenen Konzernen, die Ärztekammern sind gespickt mit Verbrechern, die unangefochten praktizieren. In den Universitäten können Professoren seit Jahrzehnten ungestraft die Auschwitzlüge verbreiten, Juristen, Germanisten, Soziologen … Bei euch kann man im staatlich geförderten Verschweigen groß werden. Nichts hat man in Westdeutschland aus der Vergangenheit gelernt.«
»Momentmoment«, er hob die Hand wie ein Schüler, aber ich ließ ihn nicht zum Zuge kommen, ich war in Fahrt.
»Ichweißichweiß«, sagte ich, »es gibt auch ein paar andere.«
»Genau. Und –«
Ich fiel ihm ins Wort. »Und es gibt auch die andere Seite. Ich lebe hier wie meine Eltern im luftleeren Raum. Bin scheinbar wie die anderen Mädchen – und doch stimmt das nicht … Es gibt keine rassistischen Angriffe oder Äußerungen. Meine Beziehung zum Judentum ist lau, unbestimmt, verbannt. Nur manchmal, wenn ich über einem Foto meines Großvaters sitze, kommt es mir vor, als schiebe sich ein Vorhang beiseite, und ich denke an die Synagoge. Ein Blick auf meinen Großvater mit Bart und Käppchen auf dem Hinterkopf. Manchmal kann ich ihn sehen, und dann wieder nicht.«
Johannes schenkte mir schweigend nach, ich nahm einen kräftigen Schluck. »So haben wir wenig gelernt. So komisch es klingt: Ich lebte ruhig und unbedroht von den Schatten unserer Vergangenheit. Unserer, hab ich gesagt! Ich glaube, es ist unmöglich, Mitgefühl zu haben, wenn man nichts weiß. Schuld muß verstanden und auf sich genommen werden. Ständiges Beschwören, daß es die anderen sind, nimmt sie uns nicht ab.«
Meine Augen stellten jungen Strichern nach, ich entschlüsselte ihre Zeichen, ihre Male, ihre Mimik, ihre Bewegungen. Höflich schenkte Johannes nach und blickte mich abwartend an.
»Die Verharmlosung ist hier viel schlimmer«, sagte ich trotzig. »Die Anteilnahme wurde nie geweckt, und deshalb sind wir alle hier zum Betroffensein unfähig. Die Empörung ist verlagert. Aus dem Land geschafft. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Unser Gewissen ist rein.« Ich redete viel zu lang.
»Manchmal hätte ich meinen Vater bei den Schultern packen und die Wahrheit aus ihm rausschütteln wollen, aber ich tat es nicht … Eine Kindheit ohne Knacks, ohne Ecken und Kanten, ja, fast ohne Namen. Ich erinnere mich nur an einmal, als mich eine Freundin fragte: Herzfeld, ja seid ihr denn Juden? Eine Kindheit ohne irgendeine jüdische Gemeinschaft, in die ich hätte hineinwachsen können, ohne diesen nebulösen Glanz, wie ihn Juden im Westen haben, wo die Abstammung vom Judentum zumindest in manchen Kreisen ein künstlerisches, ein literarisches Thema ist. Dieses eine Bild, die Frau in Rot, das Sie nicht mögen, wissen Sie, wann das entstanden ist? Vor ungefähr zwei Monaten! Dieses Jahr, fast vierzig Jahre nach Gründung der DDR, habe ich mich endlich mit meiner Herkunft beschäftigt! Anlaß war der Tod meines Großvaters. In seinem Nachlaß habe ich alle möglichen Briefe und Dokumente gefunden.« Ich schluckte, mein Hals war trocken. »Ein Bild ziemlicher Zerrissenheit und Depression. Ich konnte nicht mehr so tun, als sei Judentum ein Handikap, über das man höflich hinwegsieht. Beim Begräbnis waren plötzlich lauter komische Leute. Versprengte Angehörige, sie haben erstaunliche Dinge erzählt. Da gibt es vieles, was ich nicht weiß: Eines Tages werde ich das malen, aber das dauert noch. Ich habe meine Unschuld verloren.«
»Wissen Sie, was Sie tun sollten?« Er blickte mich herausfordernd an. »Den Pinsel nehmen und das Ganze noch mal.«
»Soweit bin ich noch nicht.«
3 Achtundsechzig
Das Dumme an dieser Werkstatt, diesem Atelier, diesem Arbeitsraum ist, dachte ich, daß er ebenerdig und von einem verwilderten Garten umgeben ist, der etwas Unheimliches hat. Ich wohne zwar gern anonym und verborgen, ohne Nachbarn, die meinen Bildern im Wege sein konnten. Ich mag es, wenn ich mich in meiner Arbeit verlieren kann, ohne daß ich dabei an etwas denken muß, das mir ins Auge sticht. Bäume und wilde Büsche, gar ein kleiner Park, vor dem Gartenhaus die verfallende kleine Fabrik, der kaum vorhandene Weg zum Haus, dies alles verwischte meine Spuren, so daß ich mir einbilden konnte, ich machte meine Bilder nur aus mir selbst. Dennoch fühlte ich mich hier nicht wohl.
Ich schlug eine Seite in meinem Skizzenbuch um. Ein Mann und eine Frau, einander den Rücken zukehrend, ein etwas fahriger Strich, subversiver Einwand zu einer solchen Art der Kommunikation. Ein kleines Familienfoto am Bildrand, verkehrt herum eingeklebt: Offenbar wollte ich es eigentlich nicht mehr sehen. Eine Sechs und eine Acht, gezeichnet wie in einem Kinderbuch.
Meine Hand hielt die Seiten fest. Meine Kindheit in Ostberlin, doch niemand behandelte mich je wie ein Kind. Ich war ein seltsames kleines Mädchen mit einem Hang zur Heimlichkeit und einer Lust zu sehen. Eine kleine Voyeurin, die belauschte und beobachtete, das Auge sensibel, präzise. Schon früh in Bildern gedacht.
Mein Vater liebte Bilder, gerahmte Drucke schmückten unsere Wände, Beckmann, Dix, Grosz vor allem. Unheimliche Bilder, die mich in meinen Träumen verfolgten, und doch wichtige Informationen. Meine Mutter, die starr auf diese Bilder blickte und sagte: Muß das denn sein, ich habe genug davon gesehen. Aber wir sollten es hier nicht vergessen, antwortete mein Vater dann.
Sie taten alles für mich. Und doch bin ich bald darauf ausgezogen.
Es war der kälteste Dezember seit Jahren, und obwohl mein Vater die Kohlenhandlung hatte, war es bei uns nie warm. Er stand in der Küche und rieb sich die Hände, wärmte sie an der Tasse mit dem Kaffee. Dann zog er sich eine zerschlissene russische Lammfelljacke an, speckig und geschwärzt, während meine Mutter die vereisten Haustürstufen mit warmem Wasser auftaute.
»Renn nicht durch die Wohnung mit dem Pinsel im Mund«, sagte sie. Ihren Augen konnte ich ansehen, daß sie mich bereits zu Boden gehen sah, den Schlund durchbohrt von einem Pinsel.
Ich saß am Küchentisch und verfertigte eine Zeichnung für ein Heft des Jüdischen Friedhofs Weißensee, um Geld zu verdienen. Schon als Kunststudentin hatte ich die Leute von der Friedhofsverwaltung kennengelernt, der Friedhof lag ja ganz in der Nähe der Hochschule. Jetzt, als Diplom-Malerin und Mitglied im Verband bildender Künstler wurde ich regelmäßig beschäftigt. Man sorgte für seine Künstler und gab ihnen Aufträge. Nicht gerade aufregende Aufgaben, reine Brotarbeit, aber trotzdem.
Meine Mutter stieß einen Seufzer aus. Sie schloß die Wohnungstür, durch die eine eisige Luft in die Küche gekommen war, und verbarg ihre Hände in den Ärmeln der Strickjacke.
»Brrr«, sagte sie, »wie kalt es ist.«
»Die Temperatur paßt sich der Volksstimmung an«, sagte ich.
Ich blickte in ihr klein gewordenes, ängstliches Gesicht und beschloß innerlich: Wenn sie noch einmal etwas Maßregelndes sagt, ziehe ich aus.
In diesem Augenblick läutete das Telefon. »Acht Uhr«, sagte meine Mutter, »wer kann das sein?«
Mit den gefütterten Pantoffeln rutschte sie zum Flur und hob den Hörer ab. Sie war schwerer geworden und bewegte sich langsamer.
»Ein Herr Maas für dich«, sagte sie vorwurfsvoll, und ich eilte zum Telefon, selbst überrascht.
Als ich aufgelegt hatte, blickte sie mich stumm an.
»Ein Ausstellungsbesucher«, sagte ich, »ich treffe ihn am Nachmittag.«
»Kenne ich ihn?«
»Nein.«
Ich wandte mich ab und setzte mich an den Küchentisch.
»Das ist immer deine Art«, sagte meine Mutter, »nie eine richtige Antwort. Ich weiß nicht, warum du so verschlossen bist.«
Ich werde gehen, ausziehen, dachte ich. Solche Diskussionen haben wir schon zu oft durchgespielt. Ich bin 23.
»Ein Mann aus dem Westen«, sagte ich, »ein Redakteur. Er interessiert sich für meine Bilder. Vielleicht kauft er eins.«
»Paß bloß auf mit einem Westmenschen, der sich immer wieder hinter die Mauer zurückziehen kann. Nicht daß die Stasi plötzlich vor meiner Tür steht, bloß um mal so ’n bißchen rumzuhorchen, ob man dich als IM ködern kann.«
Gleich hatte ich das Gefühl, daß ich ihr zuviel erzählt hatte. Sie legte alles falsch aus und erfand sich Dinge, von denen nicht die Rede gewesen war.
»Ich dachte, wir könnten miteinander reden«, sagte sie, »aber mit dir geht das nie.«
»Ich habe jedenfalls nicht vor, mit ihm ein Verhältnis zu haben«, sagte ich, »außerdem ist er verheiratet.«
»Um so schlimmer«, die Besorgnis wich nicht aus ihrem Gesicht.
Später strampelte ich mit dem Fahrrad Richtung Bibliothek. Ich war hinter Büchern her, die sich mit Sepulkralkunst beschäftigten, für den Friedhofskatalog.
Es war angenehm warm im Lesesaal, und ich flüsterte ein wenig mit meinem Nachbarn, Ewald Bügel vom Brecht-Archiv. Rundum der Anblick geballter Aufnahmefähigkeit, Leser, die Nase in ein Buch gesteckt, eine schläfrige Unaufmerksamkeit für Menschen, ihre Bewegungen, Gesten, ihre Lebendigkeit, vordringliches Rascheln von Buchseiten und geneigte Köpfe, tastende Hände, die Bücher aufschlugen und hielten, Seiten umblätterten, Finger, die Zeilen entlangfuhren. Ich hatte fast zwei Stunden dort zugebracht und mich in ein Werk über italienische Friedhöfe der Moderne vertieft, erschöpft vom postmodernen Design, Friedhöfe wie moderne Flughäfen, mit einem Hauch von Exzentrik. Wie heimelig geradezu daneben die jüdischen Friedhöfe mit ihrem Unkraut, dem Efeu, den verwilderten Bäumen, mit ihren einfachen dunklen Marmorplatten, die schief und krumm in der Gegend stehen und sich der Erde zuneigen, schließlich niedersinken, einsinken, von Erde und Pflanzen bedeckt.
Johannes wartete schon im Egon-Erwin-Kisch-Café, die langen Beine ausgesteckt, vor sich eine Tasse Kaffee. Er erhob sich, schob mir den Stuhl unter den Hintern und setzte sich erst wieder, als ich saß. Mein Blick schweifte über die fleckige Speisekarte mit ihrem Apfelkuchen, Goldbroiler und Krautsalat mit Bockwurst, den staubigen Schirmständer in der Ecke, die traurigen Pflanzen am Fenster, meine Nase sog den Geruch nach Karbol ein. Johannes hatte sich unauffällig gekleidet, grau in grau, dennoch wirkte er geradezu übermäßig gepflegt.
»Was darf ich bestellen?« Ich brauchte die Speisekarte kaum, ich kannte das Angebot. Fast fühlte ich mich unbehaglich unter so viel Höflichkeit.
Dennoch, etwas brachte ich nicht zusammen, ihn und seine Frau, und ich merkte, wie ich versuchte, mir diese Ehe vorzustellen.
Wir musterten einander. Ich erinnere mich genau an Einzelheiten, eine kleine, kahl werdende Stelle am Hinterkopf, die ich entdeckte, als er aufstand, um meinen Kaffee zu holen. Immer noch besser, als warten zu müssen, bis eine mürrische Bedienung kam und unfreundlich irgendwas auf den Tisch knallte. Außer dem Kaffee brachte er mir noch ein Bier mit. Woher wußte er, daß ich Appetit darauf hatte? Seine Fürsorglichkeit tat mir gut.
»Wirklich nichts zu essen?«
»Danke, nein.«
»Wo waren wie stehengeblieben?« Er lachte mich an. Ich entdeckte die Züge wieder, die mich bei unserem ersten Treffen im Sommer so angezogen hatten, die feinen Lachfältchen, die nachdenklichen Augen.
»Ostwestliche Vergangenheitsbewältigung, jüdischer Großvater, Synagoge«, half ich ihm auf die Sprünge.
»Ah ja! Also weiter im Takt: Spät-68