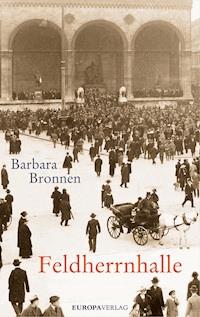3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Barbara Bronnen erzählt die Geschichte einer Frau von vierzig Jahren, die sich Rechenschaft ablegt über ein widersprüchliches, unangepaßtes Leben. Was für die schöne, begabte und lebenshungrige Tochter eines ex-zentrischen Schriftstellers als Suche nach der Mutter beginnt, wird un-versehens zur Begegnung mit dem Vater und der deutschen Geschichte. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Ähnliche
Barbara Bronnen
Die Tochter
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
I
Erstes Kapitel Das Mädchen ohne Hände
Katharina erwachte aus dem Traum in jenem Augenblick, in dem sie gerade abgehoben und zu fliegen begonnen hatte, und sie war sich ihrer bodenlos unsicher und sammelte sich zusammen; sie ließ alle Empfindungen einmünden in dem Entschluß, sich hinfort keinen Tag länger leben zu lassen, sondern ihr Leben flügelhafter selbst in Bewegung zu setzen – als Jonas nach ihr und dem Morgenritual verlangte. Katharina zog die luftige Traumflotte hinter sich her, das Märchen von Mann und Frau, die miteinander fliegen, und ging zu Jonas, während der Boden unter ihren Füßen sich noch hob und senkte, daß ihr schwindelte. Sie nahm den hellwachen Jonas zu sich ins Bett, dessen Schulterblätter sie stets so hielt, daß der Flügelansatz sichtbar blieb; sie bewegte und rollte ihn hin und her, mehr sich als ihm die Traumstunden verlängernd, zog genüßlich seinen Milchapfelatem ein und ließ Musik den Raum erfüllen, während ihre Gedanken sich langsam vom Schoß zum Herzen und dann zum Kopf hinaufbewegten.
Sie hielt Jonas nicht fest, als er, ganz gebündelte Morgenenergie, aufstand und sie mitgehen hieß. Sie fand nur einen Schuh und hinkte zur Küche, bereitete die Milch, den Brei, den Kaffee. Sie verteilte die Tassen und Teller auf dem Tisch, und Jonas setzte stolzglänzenden Gesichts die Vase mit der Moosrose zwischen die Gedecke. Er saß ihr gegenüber und aß den Brei, während er die kleine Windelmühle vor dem Fenster betrachtete, die sich heftig ostwärts drehte und sein Lokomokototifel über den holprigen Löcherkäse lenkte.
Sie lachte mit Jonas über das neue Geschenk zu seinem Geburtstag, ein Blechhuhn, das den Eßtisch nach Körnern absuchte, und Jonas, der nach seinem Vater fragte, hörte aufmerksam zu, als sie Erklärungen abgab, die er mit der knappen Bemerkung »Walta kommt wieda« quittierte – seiner optimistischen Sicht des väterlichen Kommens und Gehens.
Katharina flüchtete an seine Brust und kam sich vor wie eine, die keine Sehnsucht hat, sondern die zufrieden ist mit dem, was sie nicht besitzt; eine suchende Ruhe überkam sie, die vorüberging, als sie feststellte, daß es höchste Zeit war.
Ein Tag war zu planen, sie und das Kind waren aufzuteilen. Sie räumte ab, warf die Eierschalen in den Abfalleimer, wusch das Geschirr ab, das Kind, machte einen Bogen um den Untermieter, der heute endlich auszog, zog an, sich, das Kind, ging zum Telefon, das im gleichen Augenblick schrillte, als sie wählen wollte. »Ich habe Kostümprobe und kann leider erst später kommen«, sagte Susanna. Ihre Stimme klang bedrückt. Katharina fragte rasch: »Ist was? Oder willst du nicht sprechen?«
»Ich muß gleich los«, entgegnete Susanna, »das Übliche. So geht es nicht weiter.«
Katharina hatte Angst um ihre Schwester, deren Ehe seit einem Jahr diffus geworden war. Katharina hatte in den letzten Jahren Susanna lieben gelernt, deren Menschensinn sie immer bewundert hatte, und sie bedauerte, daß sie gerade jetzt, wo es ihr notwendig schien, daß sie miteinander sprachen, meist nur die Zeit aufbrachten, in fliegendem Wechsel einander Jonas weiterzureichen und dazu die notwendigsten Daten – »Frisch gewickelt!« »Kaum gegessen!« »Alles in Ordnung!« – nachzurufen.
»Könnten wir nicht heute wenigstens eine Stunde?« fragte Katharina, und Susanna rechnete: von vier bis sechs, vielleicht, Zeit für sie beide, mit Jonas, verstand sich. Katharina wählte rasch eine Zwei und legte den Hörer neben das Telefon, um ihren Stundenplan zu korrigieren. Jonas brauchte noch jemanden für die Zeit zwischen drei und fünf Uhr, für die sie eine Verabredung mit einem Verleger getroffen hatte. Da meldete Jonas, daß ein Windelwechsel fällig sei; Katharina, den Notizblock in der Hand, verteidigte ihren Kugelschreiber und warf die verschmutzte Hose in die Waschmaschine, die sie in Gang setzte, wobei es ihr durch den Kopf schoß, wie sie es wohl machten, die Chinesen, die keine Windelmühlen haben. Sie legte den Hörer wieder auf die Gabel und fing an, ihre Haare zu waschen, sie rieb und massierte kräftig ihren Kopf, als würde ihr dabei eher einfallen, wer in den zwei Stunden einspringen könnte. Da schrillte abermals das Telefon, Katharina sprang, den Fön in der Rechten, das bespritzte Notizheft in der Linken, das Handtuch hinter sich herziehend, zum Apparat, beantwortete die Fragen eines Journalisten, während sie sich vorsichtig an der langen Schnur zu Jonas vorrobbte, der sich soeben verdächtig gekrümmt auf dem neugekauften Teppich niedergelassen hatte.
»Nein, keinesfalls«, sagte sie knapp, wie die meisten weiblichen Neinsager verhaltenstherapeutisch trainiert, wobei sie sich beruhigt wieder rückwärts bewegte: Jonas war in ein Zwiegespräch mit seinem Penis vertieft. »Entweder fünfhundert oder wir lassen es.« Sie erschrak beinahe über die Geduld und Liebenswürdigkeit, mit der sie das sagte, und merkte an der Reaktion, daß nur eine barschere Tonart für voll genommen würde. »Nein danke, ich möchte lieber nicht«, sagte sie schnell und legte den Hörer wieder auf, als sei er aus glühendem Eisen. Sie mußte lachen über ihre Reaktion, und Jonas forderte sie auf: noch, und sie lachten gemeinsam: noch, noch, noch. Sie strich den Journalisten auf ihrer Liste der zu erledigenden Dinge durch, sah die Zettelanhäufung an, strich aus, schrieb um, stellte neu zusammen, zerknüllte, wählte rasch nochmals eine Zwei, legte den Hörer neben den Apparat und wickelte gähnend Jonas, der ihr wie ein Hypnotiseur suggerierte »Mamai gut geschlafen«, und war gerade dabei, ihm die Schuhe anzuziehen, als es läutete und sich gleichzeitig der Schlüssel im Loch drehte: Es war Ada, ihre Mutter, wie immer eine Viertelstunde zu früh.
Katharina hatte noch nicht herausgefunden, was Ada zuerst tat: aufsperren oder läuten oder die Wohnung betreten, das alles kam mit seltsamer Gleichzeitigkeit, als versuchte sie jeden Tag aufs neue, einen Blick hinter den Vorhang zu werfen, der Katharinas Leben vor ihr verbarg.
Katharina fühlte sich sofort ungeschützt, wenn Ada sie ansah und mit den üblichen Fragen nach der Nachtruhe und dem Gang der Dinge bedachte. Sag mir was von dir war die Forderung, die Katharina aus all den Kümmerungen und Kümmernissen heraushörte, die gleichzeitig auch Adas Angst hörbar machten. Denn was würde geschehen, wenn Katharina wirklich anfinge, von sich zu erzählen, die Frage, wie geht es dir, ernst nähme: Ada wäre zu Tode erschrocken.
»Was macht die Arbeit?« fragte Ada, die nur wissen wollte, daß die Arbeit voranging, und Katharina schmiß unbemerkt einen Pfennig über die Balkonbrüstung, was bei ihr zu den Aufräumarbeiten zählte. »Es ist eine Sünde«, sagte Ada und meinte den Puddingrest, den sie die Toilette hinunterspülte, »überhaupt, du hast dich gestern ja gar nicht mehr gemeldet.«
»Ich bin fortgegangen.«
»Du hast nicht abgehoben«, sagte Ada. »Als ich anrief, hast du doch behauptet, du wärst gerade gekommen und Jonas wäre noch auf der Treppe.«
»Stimmt, so war es: Wir sind gekommen und gleich wieder gegangen«, sagte Katharina.
»Aber da war es doch schon halb acht«, entgegnete Ada entrüstet, »du willst mir doch nicht etwa weismachen, daß du mit dem Kind um diese Stunde noch einmal fortgegangen bist.«
»Doch, wir sind.« Katharina holte tief Luft. »Wir sind die Treppen hinaufgestiegen. Auf dem letzten Treppenabsatz habe ich das Telefon gehört. Ich bin vorausgelaufen, weil ich dachte, es sei etwas Berufliches. Ich habe dir gesagt, daß ich in Eile bin und Jonas auf der Treppe steht. Ich habe Jonas gewickelt, und dann sind wir gleich wieder die vier Treppen runtergegangen.« Katharina sprach langsam und mit scheinbarer Nachsicht und spürte, wie die Dinge sich gegen sie wendeten. »Wir sind noch zusammen essen gewesen.«
»Aber Katharina«, sagte Ada anklagend, und Katharina gab es auf.
»Gut, ich lüge«, sagte sie müde und spreizte die Hände. »Was wolltest du denn eigentlich gestern, was war so wichtig?« schoß sie nun zurück, und Ada bauschte einen Vorwand auf. Es war Katharina bewußt, daß es ihre Schuld war, wenn Ada Vorwände benutzte. Denn was würde sie tun, wenn Ada anriefe und sagte: Ich bin einsam, ich will mit dir sprechen? Wie oft schon hatte sie Ada abgewiesen, vertröstet und sich freigelogen?
Ada ging zur Küche mit Schultern, in denen der Triumph saß wie bei gewissen Marmorengeln auf Friedhöfen, und packte die Milch aus, die sie jeden Tag mitbrachte, um Katharina ein wenig von der Last der täglichen Einkäufe abzunehmen. Katharina dankte wie jeden Tag, doch der Dank nützte heute nichts: Ada behielt Tränen in den Augen, und Katharina spürte, daß das kleine Mädchen in ihr nicht sterben durfte, von dem Ada wußte, daß es log, weil es immer log, und das in jedem Fall beunruhigte, ob es nun log oder nicht.
»Die da unten ist schon zu ihm gezogen«, sagte Ada, die das Leben anderer mit den Lippen nachlebte, »das ging aber rasch.«
Katharina lächelte: »Sie hatten Glück.«
»Du siehst blaß aus«, sagte Ada, »du solltest nicht immer so spät ins Bett gehen.« Katharina zuckte die Achseln, vergrub ihr Gesicht in der Zeitung.
»Ist das Susannas Wäsche?« Ada inspizierte wie zufällig die Kammer, in der Katharinas Wäsche hing (manchmal auch Susannas, seit Katharina eine Waschmaschine besaß). »Nein, nein«, sagte Katharina, die diesmal ihre Wäsche, weil Jonas ihr im Spiel Stück für Stück umständlich zugereicht hatte, mit kurzweiliger Sorgfalt aufgehängt hatte. Ada umarmte, lobte sie: Endlich war Katharina auf ihre Forderung nach mehr Ordnung eingegangen. Katharina war außerstande, das Mißverständnis aufzuklären, wie es ihr überhaupt immer so vorkam, als spräche ihr Ada jeden Wert ihrer Handlungen ab, wenn sie sie lobte, weil jedes Lob seine Geschichte hatte, und diese Geschichte war vierzigjähriges Mäkeln, Tadeln, Herunterschrauben.
Endlich ging Ada, an der Hand Jonas, der, immer ganz er selbst, ein Tuch Katharinas um die Babylenden geschlungen, mit der Großmutter schäkerte, sie zum Lachen brachte, und so von Tag zu Tag ein wenig mehr die biedermeierlichen Lebensgewohnheiten der Siebzigjährigen untergrub.
Katharina ging auf den Balkon und sah auf das ungleiche Paar herab, das aus der Haustür trat, beide asymmetrisch, was ihre Gangart betraf: Ada, weil die Arthrose in Knie und Hüfte jeden ihrer Schritte schmerzhaft machte, Jonas, weil er die Füße mit den Zehenspitzen aufsetzte, als wollte er zum Fliegen abheben. Sie sah Ada schlank, gut gekleidet, schön, geduldig das blödsinnige meterlange Auto hinter sich herziehen, auf dem Jonas Platz nahm, nachdem er sich (wobei er fast nach hinten fiel) nach oben gewandt und zu Katharina hinaufgewinkt hatte. Nun winkte auch Ada, und das Gewinke, von Katharina bis vor kurzem noch so gehaßt, riß nicht ab, bis beide um die Straßenbiegung verschwanden. Es war offensichtlich, daß Jonas solche zeremoniellen Gesten liebte (und vermutlich hatte auch Katharina sie früher geliebt), ebenso, wie er gerne grinsend Kußhände einstreute (wobei er allerdings den umgekehrten Weg vorzog, nämlich, erst die Hand auszustrecken und sie dann auf den Mund zu legen und zu küssen, den Kuß gewissermaßen bei sich behaltend).
Das Zeremoniell, bei dem es Katharina warm ums Herz wurde, war kaum beendet, als das Telefon schrillte. Es war Martha von Uslar, Katharinas Großmutter, eine immer noch selbständig lebende Dame von bald neunzig Jahren, die, wie jedes Mitglied der Frauenfamilie, separat wohnte, ein paar Straßen von Katharina entfernt, noch selbst ihre Wäsche in den Waschsalon trug und mangelte und eigenhändig ihre Fenster putzte. »Ist Ada noch da?« Sie gab vor, hinter Ada herzutelefonieren, und benutzte dazu ihre hohe Telefonstimme. »Ich habe gestern ein so wunderschön bemaltes Holzkästchen aus meiner Zeit gesehen, aber es ist sehr teuer, und ich wollte sie fragen, ob ich es kaufen soll.« Katharina verstand, daß Martha von ihr unterstützt werden wollte. Sie kannte Marthas Vorliebe für Kästchen, in denen Kästchen lagen und so fort (ihre Schubladen waren voll davon, und alles lag da, ineinander verschachtelt, wohlgeordnet und leserlich etikettiert), und redete Martha zu, dies seltene Stück zu erwerben. Doch Martha, die anständig von ihrer Oberstleutnantspension leben konnte, war durch Adas Bevormundung (»das brauchst du doch nicht mehr«) teils beunruhigt, teils fand sie auch darin dankbar Vorwände für Gespräche.
»Außerdem brauche ich Ada dringend, damit sie mir einen Brief für die Versicherung entwirft. Stell dir vor, von meiner letzten Kur, für die ich sage und schreibe 1200 Mark bar auf den Tisch gelegt habe, wollen die nur 186,63 Mark ersetzen! Es ist eine Unverschämtheit. Da zahlt man seit sechzig Jahren und finanziert diese Glaspaläste, damit da Tausende von Arschhockern bei Klimaanlage und mit Telefon herumsitzen. Monatlich 245 Mark, und das kommt dabei heraus. Ich werde nun meine letzten Patronen verschießen müssen und einen Brief an die Dachorganisation schreiben, damit die mal eins aufs Dach kriegen.«
Katharina lachte, auch über Marthas unerschütterlichen Glauben, daß jede Institution von einer militärischen Spitze geleitet werde, die ein Brief Marthas persönlich träfe. Marthas zahlreiche Akten, die ihre Korrespondenzen mit Zahnärzten (denen es nie gelingen würde, die gleiche Zahnqualität nachzubilden, die Marthas Naturzähne besessen hatten), Versicherungen, Stadtverwaltungen, Friedhofsverwaltungen und dem Offiziersbund enthielten, hatten den vier Frauen schon zu manchem lustigen Nachmittag verholfen.
Doch Martha war mit alldem nicht erfolglos. So hatte sie es kürzlich, nach zahlreichen Eingaben an die Stadtverwaltung, immerhin erreicht, daß ein wackliger Steinsockel am Zaun des nahegelegenen städtischen Kindergartens durch einen neuen ersetzt wurde. In ihrem letzten, eingeschriebenen Brief hatte Martha als »Witwe des Generals von Uslar« dem Bürgermeister persönlich gedroht, ihn haftbar zu machen, wenn ein Kind zu Schaden käme.
»Du kannst Gott danken, daß du deine Mutter hast, die dir so aufopfernd hilft«, sagte Martha, »sie tut ja alles für den Kleinen, und das, obwohl sie so schlecht beisammen ist, die Ärmste, und laß dir halt mal auch von ihr etwas sagen.« Katharina begriff, daß dem letzten Satz eine Klage Adas zugrunde lag. Sie kannte die Art, wie Ada und Martha ihren Part mit verteilten Rollen spielten, wobei jede der anderen einen Vorwurf über Katharinas Verhalten übermittelte, mit der stillschweigenden Verpflichtung, ihn Katharina zukommen zu lassen.
»Ja, schon, ich meine, ich glaube schon, sie tut wirklich viel für uns, und Jonas, ja, der hat sie ja auch wirklich gern, aber trotzdem, sie soll sich ja auch nicht übernehmen, und außerdem, man muß halt bei ihr doch, ich meine, man muß bei ihr immer ein bißchen achtgeben, du weißt schon, was ich meine, und schließlich sind wir halt jeder sehr verschieden, aber ich bin schon froh …«
»Ich habe gestern übrigens für Jonas ein Badehöschen gekauft«, sagte Martha. »Es ist an der Zeit, daß dem Kind das natürliche Schamgefühl eingeimpft wird.« Anders als bei Ada gelang es Katharina bei Martha gelegentlich auch zu schweigen und die Moral, die jene vertrat, nicht anzugreifen. Katharina dankte für das Geschenk und wartete auf den nächsten Vorstoß, der vermutlich das Religiöse betraf. Ihre Erwartung wurde erfüllt: »Was mache ich nun mit dem wertvollen handgestickten Taufkleidchen, das ich noch von meiner Mutter habe?« Katharina überhörte, was dahinter stand, und riet, es aufzuheben, diese Kostbarkeit, und auf keinen Fall der Caritas zu spenden, dankte für die neueste Katastrophensammlung von Zeitungsausschnitten, die Martha ihr geschickt hatte, und lenkte ab auf Ada: War etwas auszurichten?
»Rede ihr zu, daß sie zum Abendessen kommt«, forderte Martha herrisch. »Sie ißt zu wenig, die Frau wird ja klapperdürr. Gestern hat sie mir abgesagt, vorgestern hat sie mir abgesagt. Aber ich weiß ja, daß sie kommen will. Ich brauche ihre Rücksicht nicht. Solange ich kochen kann, koche ich.«
Katharina blätterte in ihrem Notizbuch und rief Ella an, auf der Suche nach einer Freundin, die nicht fest arbeitete und Jonas vielleicht für eine Stunde übernehmen konnte. Ellas träger Tonfall machte deutlich, daß ihre Reise nach innen voranschritt und immer weniger mit ihr zu rechnen war. »Weißt du, was er mir für eine Botschaft zukommen ließ?« sagte Ella.
»Er« war Ellas Guru, den sie seit einem Jahr in regelmäßigen Abständen in Indien aufsuchte und mit dessen Hilfe sie ihr Leben ändern wollte.
»Follow your feelings«, antwortete Ella, »das gilt auch für dich.«
Katharina, die in diesem Augenblick keine Zeit hatte, ihren widersprüchlichen Gefühlen zu folgen, lehnte die zweite religiöse Anwerbung an diesem Morgen ab und verschob den Gedanken, wie man es wohl lernen konnte, einen Happen von einer Glaubensnahrung zu bekommen, auf später. Sie rief Gisa an, die Katharina mit einem Wortschwall überschüttete und zwanzig Minuten lang ohne Pause darüber sprach, daß »dieses« biologische System ein evolutionärer Irrtum sei, daß es ja auch bei Tieren und Pflanzen zweigeschlechtliche Wesen gebe, daß es immer noch die Männer seien, die über die Erde herrschten, und daß Frauen nie den Gott und den Krieg erfunden hätten, sondern ihre Götter, die seien immer die Kinder geworden, sie sprach von der grauenhaft zunehmenden Anhäufung industriellen Reichtums in Männerhänden und davon, daß das weibliche Prinzip in der harmonischen Unordnung liege, im Gegensatz zum männlichen, das im pedantischen Chaos bestehe. »Wir müssen sofort damit anfangen zu verändern, jedoch, ohne Macht anzustreben; wir müssen einen anderen Weg finden, vielleicht, indem wir verweigern, indem wir damit anfangen, keine elektrischen Eierkocher zu kaufen …«
Katharina, Spiralnebel im Kopf, legte auf, sah auf die Uhr. Blieb nur noch Lola, bei der ständig belegt war, weil sie, wie sich später herausstellte, bei anderen Frauen Erkundigungen über einen Mann einzog, von dem sie nichts wußte, obwohl sie (wie jene anderen Frauen auch) eine Nacht mit ihm verbracht hatte, und die es nun unerklärlich fand, warum er so plötzlich, während sie das Frühstück zubereitete, verschwunden war.
Es war in der Tat etwas Komisches an ihren Frauenfreundschaften: Die meisten ihrer Freundinnen waren in einem Zustand ständiger Auflösung und Zerfallenheit mit sich selbst. Sie kämpften einen erbitterten, jahrelangen Kampf darum, eine andere zu werden. Manche scheiterten an den zu vielen Worten und manche an den Männern, deren Unveränderbarkeit in der Tat etwas Exotisches anhaftete, manche an Selbstmitleid. Manche liefen Gefahr, sich an Symptome zu verlieren, andere wieder suchten seit Jahren die Veränderung, indem sie sich auf den Grund gingen. Geblieben waren Schrumpffrauen, deren Stimmen einander in fataler Ein-Tönigkeit glichen, und in deren Gesichtern die gleiche uneingestandene Sehnsucht danach, eine Hand zu halten; Frauen, deren Kraft, sich täglich neu auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen, allmählich abnahm, oder andere, die langsam, auf schleimiger Kriechspur, den Weg zu einem Mann einschlugen, den sie mit jedem Satz verrieten. All das war eine Frage der Energie in einem Leben, wo rundum der Schwung abnahm und wo jeder vor sich hinschlingerte in seiner kleinen Eigendynamik und sich in einen Strudel hineinziehen ließ, um nicht schutzlos einfach fortgeschwemmt zu werden.
Es war eine Frage des Respekts, sich im Spiegel anzusehen ohne allzugroße Verwunderung. Vielleicht hatte sie zu lange Zeit schweigend vor ihrem Bild verharrt, weil jetzt alles über ihr so zusammenschlug. Und sie sah in ihre Augen und kam erst wieder zu sich, als ihr schwindelte, weil sie ineinandergeflossen war mit ihrem Spiegelbild. Vierzig Jahre lang siehst du in den Spiegel und zerbrichst dir den Kopf über dich und versprichst dir dein Paradies, schiebst es auf morgen, und du liebst dich – weil du noch lebst –, obwohl es immer noch vor dir liegt. Du siehst dich in deinen Augen zurück zum Kind und vor zu der alten Frau, die du einmal sein wirst. Du siehst, daß es immer noch in dir schläft, was einmal erwachen wird, und bist froh, daß dein Blick noch nicht aufgegeben hat zu hoffen.
Katharina fand sich vorübergehend ab mit der Unverläßlichkeit ihres äußeren Bildes, die zunahm, je älter sie wurde. Es verging eine Zeit, in der sie unschlüssig ihr Haar und das blasse Gesicht ansah. Dann zog sie sich selbst am Schopf aus dem Spiegelsumpfkabinett und beschloß, das gläserne Bild durch eins aus Beton zu ersetzen und die nächsten zwei Stunden ihre Arbeit für das Allerwichtigste auf der Welt zu halten. Sie schob den dazwischenfahrenden Gedanken, daß das recht arrogant sei, in den hintersten Winkel ihres Gehirns, wählte abermals eine Zwei und legte den Hörer neben den Apparat; sie stopfte Watte in ihre Ohren, um nicht das Baugetöse auf der anderen Straßenseite zu vernehmen, und verschloß die Augen vor dem dörflich anmutenden Kirchturm gegenüber und dem Haus, in dem ein Freund, der Vater eines Pyromanen, und eine Freundin, die Mutter eines weiblichen Clowns, wohnten – Nachbarn, mit denen sie abends Lichtsignale austauschte. Sie wandte ihren Blick von der Straße, auf der gerade Kindergartenzöglinge in Zweierreihen vorbeischritten. Sie verschloß die Nüstern vor dem Abgasgeruch, der durch die undichten Fensterritzen einströmte, zog ihre Poren zusammen, um nicht die Giftpartikel eindringen zu lassen, und nahm ihr einfaches Werkzeug, die Feder, zur Hand.
Katharina hatte ihr Schreibeland, ein großes Zimmer in ihrer Vierzimmerwohnung mit den vier Meter hohen, goldgelb gestrichenen Wänden, die in der Morgensonne aufleuchteten, so eingerichtet, daß sie sich darin wohl fühlte. Ihre Wohnung im obersten Stockwerk eines achtzig Jahre alten Hauses, in der sie acht Jahre lang zusammen mit Hartmann gewohnt hatte, war nach der Scheidung heruntergekommen. Leergeweint, damit beschäftigt, ihr gebrochenes Herz zu heilen und die Fehlschläge ihrer Ehe aus dem Kopf zu verbannen, hatte sie voreilig ihre Wohnung zu einer Wohngemeinschaft umgestaltet. Ein Jahr lang lebte sie mit Ella und Frantz, der ihr an einer U-Bahn-Haltestelle zugelaufen war, zusammen, und auf den Wänden wuchsen Menetekel, wenn sie mit ihren Gästen und Kebsmännern aus Hartmanns Gefäßen trank. Frantz’ Hände schrieben an die Wand, gegen die sie anschrieb mit den dickschwarzen Lettern »ich bin ich«, und später, als sie auszog, damit Frantz auszog, und als Iris, die Ärztin, sein Zimmer einnahm, wurden alle Wände zu Steckwänden, gezählt, gewogen und geteilt das weibliche Leid: Ella, Iris, Katharina – bis sie sich durchrangen zur parolenhaften Anerkennung wie »ich mag dich« und dann »ich mag mich«, bis schließlich die Malerkolonne grinsend ihre Vergangenheit mit Spachtelkitt versiegelte und mit Zweifachfarben übermalte.
Seit drei Jahren lebte sie mit einem Untermieter zusammen, der höflich die Entfernung hielt und der nun auszog, da es ihr möglich war, die Wohnung allein zu unterhalten. Sein Zimmer, das auf der anderen Seite des Flurs lag, sollte nun Jonas bekommen. Es hatte lange gebraucht, aber Katharina hatte nun gelernt, die Wohnung zu ihrer eigenen zu machen und sie nicht dafür verantwortlich zu machen, wenn sie nicht fertig geworden war mit ihren Erinnerungen an Hartmann. Sie hatte den Rahmen, den er der Wohnung gegeben hatte, durch ihren eigenen ersetzt, und so war es nun eine andere Wohnung geworden, weil sie eine andere geworden war. Sie hatte die Räume, zum erstenmal in ihrem Leben, so eingerichtet, wie sie es liebte, sparsam, mit den schweren, herrenzimmerartigen Möbeln ihrer Urgroßeltern aus schwarzgebeizter Eiche mit dunklem Leder. Sie schlief in dem riesigen Mahagonibett, in dem ihr Vater sie gezeugt hatte. Ihr Schreibtisch, ein großräumiges Möbel mit Rindslederplatte, war der Tisch ihres Urgroßvaters, von dem aus er seine Lederwarenfabrik dirigiert hatte.
Die Wohnung hatte große, leere Flächen, neben denen es tropisch wucherte, bequeme Plüschplätze und einen riesigen Flur, geeignet für Jonas’ Autofahrten. Die Möbel waren gepflegt und gut erhalten, weil die Mütter sie täglich poliert hatten.
Die rechte Hälfte der Schreibtischfächer war angefüllt mit Heften, Tagebüchern, Notizen. Dem Schreibtisch gegenüber stand ein Aktenschrank mit geschliffener Glasfront, hinter der sie ihre Projekte und Exposés aufbewahrte. In einer silbernen Schatulle hatte Katharina alte Zettelchen aufbewahrt, die Liebesbeweise ihrer Freunde enthielten und in denen sie manchmal stöberte.
Die Breitseite des Arbeitszimmers nahm eine vier Meter lange Fotofolge ein, die Katharinas Leben von ihrer Geburt an in Stationen festhielt und weiter zurückführte bis zu ihren Urgroßmüttern. Über ihrem Schreibtischstuhl, der solide und massiv aus einem Stück Eiche geschnitten war, mit Ledersitz und Seitenlehnen, und in dem man Stunden verbringen konnte, ohne gekrümmt zu sitzen, hing eine alte Daguerreotypie, auf der ihre fünfjährige Großmutter Martha und deren weißbärtiger Großvater abgelichtet waren, der einen Totenschädel in der Hand hielt. »Das Alter, die Jugend und der Tod« stand in Kurrentschrift gedruckt darunter.
An der Wand gegenüber die Abbilder ihrer Frauengeschichte: die Großmutter Martha, 89, verwitwet, adelige Hausfrau; die Mutter Ada Bebra, 70, geschieden, Hausfrau, Sekretärin, heute Geschäftsführerin in einem Puppenladen; sie selbst, Katharina Bebra, 40, Dr. phil., Journalistin, Schriftstellerin, geschieden von einem Schriftsteller, ein lediges Kind. Daneben hatte Katharina die regenbogenfarbenen Zelte ihrer Träume und Sehnsüchte aufgeschlagen. Fantastische Gemälde eines Geisteskranken, der seine lüsterne Fracht an andere Ufer übersetzte; Narrenschiffe, auf deren Masten apokalyptische Wesen flüchteten; ein plastisches Planetarium, wo in den Nachthimmel jeder Stern eingeschraubt war, damit er nicht herabfallen konnte; eine ornamentale taoistische Darstellung vom »Kampf des inneren Gemachs« und ein Kupferstich »Leda und der Schwan«, den Katharina mit einem Schleier, in den winzige Sterne aus getriebenem Silber eingearbeitet waren, bedeckt hatte.
Katharina, die sich schon als Kind nicht hatte entscheiden können, ob sie Schriftstellerin werden wollte oder Mätresse, spürte ein flutartiges Ansteigen der Lüste beim Anblick des Bildes, doch ebenso stark war der Sog, der von ihrer Arbeit ausging, und sie holte sich Ruhe vom Bild des Eremiten und arbeitete die ihr verbliebenen zwei Stunden, weil hier und jetzt geschehen mußte, was zu keiner anderen Stunde geschehen konnte. Sie hatte Glück und stand fest in ihrer Arbeit, bis es Zeit war für einen längst fälligen Behördengang. Sie kleidete sich rasch an und rannte die hundertvierundvierzig Stufen hinunter und schwang sich aufs Rad, fuhr, sprang ab, wartete den Aufzug nicht ab, sondern nahm die zwei Stockwerke in einem Schwung, betrat das Zimmer eines freundlichen Sozialbeamten, um ihm mitzuteilen, daß sie hinfort, gottlob, nicht mehr die Hilfe des Staates in Anspruch nehmen mußte, dankte, lief, schwang sich aufs Rad, eilte, da es Luxus war, die Treppe mit leeren Händen hochzugehen, in eine Apotheke und schlingerte mit zwei Windelkartons à sechzig Stück heimwärts. Sie sah, daß Jonas’ Automobil bereits vor der Haustür parkte, und rannte atemlos die Treppe hinauf, schloß auf, nahm Jonas, der ihr entgegenrannte, in die Arme und ertappte Ada, die über ihren Schreibtisch gebückt stand und zurückprallte.
Oh, wie sie sie gleichzeitig verstand und verabscheute, diese Grenzüberschreitungen, weil sie sehr wohl wußte, daß sie sich Ada vorenthielt, dennoch, diese früheren Versuche, ihre Tagebücher zu lesen, ihre Briefe zu öffnen! Versuche, die ihren Erfindungsgeist mobilisiert hatten: die zahllosen Verstecke, die notwendig gewesen waren, bis sie, die Schülerin, das Tagebuch am Ende ins Ofenrohr einzwängte und geschwärzt wieder hervorzog!
Katharina sagte nichts, doch war es Adas Gesicht und Haltung abzulesen, was sie dachte: Das ist nicht meine Katharina, die das geschrieben hat, und Katharina lachte Jonas an und tat, als träfe sie es nicht – da schoß Ada einen neuen Pfeil ab: »Heute sind deine Haare aber schön«, was hieß: zurückhaltend, nicht zu rot und nicht zu dunkel, ganz nach Adas Geschmack frisiert und ganz im Gegensatz zu sonst, zu immer. Dennoch mußte in ihrem Blick etwas gelegen haben, das Ada hastig fortfahren ließ: »Ich sage es unumwunden, ob es mir gefällt oder nicht. Du selbst hast mich dazu aufgefordert, nicht einfach zu schlucken, was mir mißfällt, also darf ich doch einmal sagen, was mir gefällt, oder darf ich auch das nicht mehr?« Wie rasch es ging, daß sie einander so unerquicklich wurden – Katharina hatte kaum das Zimmer betreten, und schon nahmen sie sich schlecht miteinander aus.
»Jonas hat wenig gegessen«, klagte Ada. »Wenn du schon nicht zum Kinderarzt gehen willst, so gestatte es wenigstens mir, ich will das gerne übernehmen.« Katharina schüttelte den Kopf und lehnte den Vorschlag ab, obwohl es ein Fortschritt war, daß Ada nicht mehr, wie sie es früher getan hätte, ungefragt mit Jonas den Arzt aufsuchte. Doch welche Furcht es immer wieder in ihr auslöste, dieses ständig besorgte mütterliche Kopfschütteln, als dürfe es nicht so sein (was doch so war), daß es Jonas an nichts fehlte.
Um anders mit Ada umzugehen, lobte Katharina das genähte Höschen, belohnte die Tatsache, daß Ada allein den extra frisch zubereiteten Karottenbrei und das so sündhaft teure Tatar hatte essen müssen, mit einem ihrer Seidenschals, den sie spontan unter dem Durcheinander hervorzog. Ada übertrumpfte sie mit zwei schönen indischen Armreifen, von denen sich Katharina dankend sogleich einen über den Arm zog, woraufhin Ada vorwurfsvoll feststellte, daß Katharina der andere wohl nicht gefiele. Katharina streifte auch den zweiten Armreif über und lobte Adas Verhalten am Spielplatz, die ihr berichtete, wie sehr das Eigentumsdenken bereits in den Zweijährigen gezüchtet werde durch das falsche Reagieren der Mütter, mit denen sie sich in eine Diskussion über Erziehungsfragen eingelassen hatte. Adas Meinung zu vielem war Katharina einsichtig und erschien ihr richtig, doch jeder Bericht forderte ein so uneingeschränktes Rühmen und Preisen, daß jedes Lob wertlos zu werden schien.
»Ich habe die Zeitungsausschnitte auf den Schreibtisch gelegt«, sagte Ada und lieferte damit beiläufig eine Erklärung für die Haltung nach, in der Katharina sie angetroffen hatte, »ein Artikel handelt von den zunehmenden Verhaltensstörungen bei Kindern, einer von den kindlichen Schäden bei übermäßiger Sonnenzufuhr, und der dritte, den zu lesen ich dir dringlichst rate, mahnt ausdrücklich den Anfängen zu wehren, wenn ein Kind stottert. Ich lasse Jonas jetzt jeden Satz, den er stotternd vorbringt, nochmals ruhig und langsam nachsprechen und habe mit einer Strichliste begonnen, wie oft er stottert, wenn ich ihn habe.«
Ada holte die Liste hervor, die für heute fünf energische Striche aufwies. Jonas, der vor zwei Wochen eruptiv das Sprechen entdeckt hatte, neigte dazu, sich zu viel vorzunehmen. In rauschhafter Begeisterung über das Neuland Sprache konnte er sich oft nicht entscheiden, was er zuerst sagen wollte, und stotterte, was Katharina erklärlich, keineswegs krankhaft und eher von beabsichtigter Komik erschien. Sie war sicher, daß er sehr wohl wußte, daß es Banane hieß und daß er es vorzog, Banananane zu sagen, weil das Wort so länger und schmackhafter auf der Zunge lag. Sie dankte für die Fülle der philiströs zweifarbig angestrichenen Katastrophen-Dokumente – darin war Ada die gelehrige Tochter der Kassandra Martha – und versuchte, Wärme in ihre Worte zu legen.
»Bist du denn vorangekommen«, fragte Ada, »du hast nicht einmal die Waschmaschine abgestellt. Dafür nehme ich dir das Kind nicht ab, daß du nicht einmal dazu kommst …« Katharina hörte den Rest nicht mehr, sondern lief zur Waschmaschine und hängte die Wäsche auf, Jonas und Ada im Gefolge. Sie spürte Adas zurückgestaute Räsonierlust, als sie die Wäsche wie immer aufhängte, jedes Stück mit nur einer Wäscheklammer notdürftig und rasch befestigte, und duldete Adas Ellenbogen, der sie beiseite schob: »Laß mich das mal machen«, sagte Ada, deren Stimme vor lustvollem Leiden vibrierte, »bring du das Kind ins Bett. Was ist denn das?« Sie hob den anstößigen Fremdkörper, eine Unterhose Walters, spitzfingrig in die Höhe und hängte sie achselzuckend auf.
Katharina nuschelte etwas vor sich hin, das nicht zu verstehen war, und doch schien es ihr, als wäre es zu verstehen und als hätte sie lauthals herausgeschrien: Ada, das geht dich nichts an. Es war eine stillschweigende Übereinkunft, daß Ada dergleichen nicht immer vernahm, denn so herrisch sie auftrat, so schnell brach sie auch zusammen, zersplitterte wie ein Stück Eis, das man gegen eine Mauer warf, so brüchig war ihre angenommene Härte.
Katharina legte den von Ada sorgfältig präparierten, frisch gewandeten, neu umwundenen, gesäuberten, bestäubten, gesalbten Jonas ins frisch bezogene Bettchen. Sobald er lag, bekam sein Blick etwas Starres, Abwesendes, als sei er schon unterwegs zu seinen Träumen, die keine Alpträume zu sein schienen, denn er hatte bislang im Schlaf noch nie geschrien. Katharina schloß behutsam die Tür hinter dem Kostbarsten, das sie nie sättigen sollte, diesem Sonntagssohn mit wünschlichen Gedanken, der eine Blume in seiner Tasche trug.
Sie ging hinüber ins Zimmer, wo ihre Mutter saß und auf sie wartete, entschlossen, ihr zum Abschluß etwas Freundliches zu sagen. »Ähnlicher wird er dir von Tag zu Tag, das Goldkind« – und Katharina nahm die Liebeserklärung an sie, die auch dahinterstand, entgegen. Sie wußte, wieviel an Jonas Jonas war, und brauchte nicht zu widersprechen. Sie nickte lächelnd und hatte nicht das Gefühl zu lügen; sie küßte Ada und wurde, als Ada die Wohnung verließ, wieder zu jener Frau, die sie sein wollte – ein andere jedenfalls als Adas Tochter.
Katharina hütete sich, länger über sich und Ada nachzudenken, und sprach den letzten Satz des Morgens laut vom Papier. Sie hatte es sich in den zwei Jahren, in denen sie häufig allein mit Jonas an ihrer Arbeit saß (während er seiner nachging), angewöhnt, laut zu sprechen, was sie schrieb, damit er nicht sprachlos aufwuchs, während sie schweigend Sprache zu Papier brachte. Sie erinnerte sich an die Zeit, als sie die Techniken des Alleinseins mit einem Kind mühsam erlernte: auf Lallsprache heruntergekommen, manchmal schreiend im Badezimmer mit den Fäusten gegen die Wände trommelnd, damit Jonas sie nicht hörte, manchmal weinend vor Verzweiflung, dann wieder voll zerschmetterter Ausgelassenheit und schweißgebadeter Heiterkeit. Und immer, jeden Morgen, diese grenzenlose Freude, wenn sie ihn rufen hörte: Mamajajajajajajaja (und sie empfand die tiefe Bejahung, die in dem verlängernden Singsang lag), dieses nicht endenwollende Staunen, daß es ihn gab. Bis sie es langsam und schwer erübt hatte, sich einzurichten in dieser neuen Form von Alleinsein, und auch wieder ihre Fühler ausstrecken konnte nach jenen, die Unruhe in ihr erzwungenes Gleichmaß hineinbrachten, den Männern.
Katharina schaffte ihre Müdigkeit ab, und ihre Hand wuchs mit der Feder, die sie verlängerte, und sie umarmte glücklich die eng beschriebenen zwei Seiten und dann ihr Kind, das ihr so tiefe Arbeitsruhe geschenkt hatte durch seinen zweistündigen Schlaf. Katharina beneidete sich nicht mehr um die viele Zeit vor Jonas, in der sie sich zeitlos hatte bewegen können, denn sie wußte erst seit Jonas, wie bemessen Zeit war und wie sehr zu nutzen. Es mußte ja alles anders zugehen, seit es Jonas gab, und doch hätte sie mit niemandem auf der Welt tauschen mögen, der über Freiheiten verfügte, die sie nicht mehr hatte.
Sie mußten hinaus, die Zeit drängte, Katharina streichelte Jonas’ entspannten Körper, der noch ohne Knoten und Kampfspuren und Verzerrungen der gestreiften Muskeln war, sie umgab ihn mit einer frischen Windel, kämmte sich, zeichnete den Lidstrich, bürstete Jonas. Sie nahm ihn in eine Hand und die üblichen drei Mülltüten in die andere, und sie gingen die Treppe hinunter, wobei Jonas vor jedem Eingang verharrte und nach den Geräuschen horchte, die aus den Räumen kamen.
Aus einer Wohnung erscholl eine wohltönende Baritonstimme mit Schubert-Begleitung vom Plattenspieler: Es war der Besitzer von elf kleinen Abschreibungsfirmen, der eigentlich Opernsänger hatte werden wollen. Aus der anderen kam heiligmachender Giftduft, begleitet von raschem Schreibmaschinengeräusch: der stets braungebrannte und seinen Körper durch Boxübungen löblich mobil haltende Lyriker tippte, »dem Glück des andern immer nah«, ein Gedicht. Jonas verweilte im Sitzstreik einige Minuten vor der Tür eines Professors für Anthropologie, der nicht nur altes Blechspielzeug sammelte (was ihm die Liebe Jonas’ eintrug), sondern auch ausgefallene Lustwerkzeuge erfand, die sich der Lyriker manchmal auslieh, so daß Katharina, wenn sie mit dem Lyriker schlief, auf diesem Umweg ebenfalls in den Genuß der Erfindungen gelangte.
Es war ein Haus der Verflechtungen, ein musisches Haus, in dem Katharina und der Lyriker ihre Worte beim Bariton kopierten und der Erfinder seine zulässigen Objekte und Sammelstücke in der Galerie im ersten Stockwerk ausstellte. Ein Haus, in dem Ella zweimal ihr spanisches Bett von Katharina zum Professor und vom Professor wieder zu Katharina die Treppen entlang geschleift hatte; ein Haus mit einem Keller, aus dem Katharina zischend und fluchend die klebrig-weichen Plunderhäufchen, die vier gleichgekleidete Modelle zurückgelassen hatten, mit denen der Lyriker (der keinen Kellerraum besaß) kurzfristig hintereinander zusammengelebt hatte, in den Müll trug. Ein Haus, in dem es noch möglich war, zu läuten und Bedürfnisse, die verschieden sein durften, anzumelden.
Katharina warf die drei Mülltüten in die Tonne und kettete Jonas auf den Kindersitz, hob ab, wobei sie feststellte, daß nun zum drittenmal einer, der es auf die Besitzlosen abgesehen hatte, das Zugseil der Gangschaltung durchgeschnitten hatte. Sie trat mit heftigen Stößen aufs Pedal, wich den nach ihr zielenden Autos aus, in denen die neuen Barbaren saßen. Sie flogen pfeilschnell über die Straßen, Katharinas Rockbüschel und der durchbrochene Schal bildeten eine Parallele zum silberglänzenden Asphalt, und Katharina fühlte sich im herrlichen Gleichgewicht mit sich selbst, ein Werkzeug beherrschend, das sich so unkompliziert fortbewegte und das ihr ähnlich zurückhaltend schien wie ihr Werkzeug, die Feder.
Jonas lachte, als ein Autofahrer die Kurve schnitt und eine Handbreit vor ihnen haltmachte mit einer nachlässig scheuchenden Geste, als vertriebe er eine Fliege. Und Katharina, in der ein sinnlos umfassender Haß aufstieg gegen diese Welt, die nicht traumtanzte, sondern stampfte, die nicht das leichtfüßige Rad nahm, sondern mit ihren Motoren die Luft zur Waffe gegen sie machte, spuckte auf die Windschutzscheibe. »Mörder!« schrie sie außer sich. »Mach das nicht noch einmal mit mir!«
Sie stand mit zitternden Knien auf der Straße, und der Mann, über dessen Kinn der Speichel floß, stieg aus, die Faust gegen sie erhoben. Es war ihm anzusehen, daß er sie nicht nur für dumm und überspannt hielt, sondern auch für einen Polizeifall. Katharina ließ sich auf einen Disput mit ihm ein, in dem sie ihn, ruhiger werdend, darauf aufmerksam machte, daß er im Augenblick, da er ins Auto stieg, nicht mehr allein auf der Welt sei.
»Sie Kommunistin«, sagte er, und Katharina schwieg. Erst jetzt sah sie sich den Mann an, auf den sie in ihrem Schrecken reagiert hatte: Hier stießen Schichten zusammen, die nichts mehr voneinander wußten. Für diesen Mann war nichts geschehen, denn sie lebten ja noch.
Katharina fuhr weiter, zwei Augen hinten, zwei vorne, je eins nach rechts und links gerichtet, stieg ab, als sich unvermutet ein Autoschlag vor ihr öffnete, und zog es vor, weil das Kniezittern, das sie vor Jonas’ Geburt nicht gekannt hatte, erneut begann, die Gehsteige zu benutzen und an jeder Querstraße abzusteigen. Sie betraten die Buchfabrik, die größte des Landes, gespeist von Fichtenplantagen, die man früher Wälder nannte, und getränkt von Kopf-Erlebern, Lebensfälschern, die, Talente des intellektuellen Inzests, in der Wartehalle saßen. Sie warteten, und Katharina spürte, wie ihre Haut austrocknete vor Angst, weil sie nicht einhalten konnte, was sie vertraglich zugesichert hatte. Sie ließ sich in ein Gespräch mit einem Autor ein, der sich Gedanken machte wie kein zweiter über die Mechanik der Kulturindustrie, ein Zielgruppenschreiber im Konfirmandenanzug, der auf einem Feldbett schlief und sein Essen im Stehimbiß einnahm.
Ihr Hautjucken nahm zu, und sein sozialpolitisches Rotwelsch bedrohte sie, sie roch die saure Milch der gesetzlichen Denkungsart, die er über Gebühr aus den Brüsten der Alma Mater herausgesaugt hatte, und der Geruch würgte sie im Hals. Er, der mit sämtlichen »Medienhebeln«, also auch den politischen, operierte, bediente sein flinkfreundliches Sprachwerkzeug perfekt und zog, selbst Teil des Gesetzeskörpers, einen Codekreis um sich, der Katharina bannte wie ein Kreidestrich ein Huhn. Wie so oft sagte sie auch jetzt noch »ja« zu Männern, deren Sätze sie nicht verstand, und sie dachte nach und kam nicht dahinter, aber sie wagte nicht zu fragen, da sie die Frage schon nach dem ersten Satz versäumt hatte. Sie griff sich an den Hals und rang nach Luft, bis sich endlich die Spannung entlud, sie spürte es nahen, dieses Kichern, das zunahm und anschwoll. Und sie kicherte in einem fort, während er weitersprach, taktvoll, als sei nichts geschehen. Da, endlich, ertönte über Lautsprecher ihr Name; sie konnte aufstehen, sich ihm und seinen übervielen Worten entziehen.
Katharina, von der die Hysterie abfiel, betrat selbstbewußt (trat sie etwa schon sicherer auf mit Kind?) die Verlegerkoje, ließ sich ein in ein Gespräch über Einstein, in dessen Leben kein Platz gewesen war für Frau und Kind und der sich deshalb scheiden ließ und eine ausgezeichnete und dazu freundliche Köchin heiratete, die ihm das Essen vor die Tür stellte, während er seine Relativitätstheorie vollendete.
»Sie sind eine couragierte Frau«, sagte der väterliche Verleger mit seinem österreichischen Singsang, »aber haben Sie sich nicht etwas übernommen: Kind und Arbeit und Haushalt und am Ende gar noch Privatleben?« Das letztere sagte er leicht spöttisch, neugierig. Ralph Roth war ein intelligenter und sympathischer Mann, der wiederholt Interesse für Katharina gezeigt hatte, aber sie hatte ihn abgewiesen. Nicht zuletzt aus Stolz, denn sie hatte sich immer dagegen gewehrt, beruflich etwas zu erreichen, was auf andere Ursachen als auf ihre Leistungen zurückzuführen war. Ihr Stolz in dieser Hinsicht war enorm und möglicherweise sinnlos und ging so weit, daß sie zwei Jahre lang einem Mann, in den sie verliebt war, aus dem Wege ging, nur weil er damals ihr Vorgesetzter war. Ähnlich war es ihr übrigens auch mit Männern gegangen, die Vermögen besaßen. Ob es nur aus Stolz war oder aus Dünkel oder aus Zufall, Katharina hatte sich noch nie auf einen Mann eingelassen, der zu den Besitzenden zählte, und in ihrem Freundeskreis gab es niemanden, der etwas sein eigen nannte, es sei denn eine Wohnung oder bestenfalls ein Domizil auf dem Lande. (Sie überlegte, ob es noch etwas gab, das mit Sicherheit eine Beziehung ausschloß, und fand heraus, daß es für sie, die sonst keine Rassenvorurteile kannte, keinesfalls ein Amerikaner sein dürfte. Da saßen zu tiefe Vorurteile in ihr gegen alles, was aus Amerika kam, und sie erinnerte sich an die Amerika-Feindlichkeit ihres Vaters, seine schäbig gekleideten Genossen im Salzkammergut, die winzige KP-Zeitungsredaktion in der russisch besetzten Stadt und die redliche Beschränktheit seiner Ostberliner Freunde, sie entsann sich ihrer frühen Abneigung gegen Buschhemden und jene rosa Hautbeschaffenheit und eine bestimmte formlose Art zu gehen, wie sie die Amerikaner der Besatzungszeit gehabt hatten.)
»Ich glaube nicht«, entgegnete Katharina, »daß ich mich falsch eingeschätzt habe, denn es ist zu schaffen, auch ohne Köchin, mit der ich nie werde rechnen können.« Sie war überzeugt, daß sie auf dem Weg war, ihr Leben zu leben und das Kind zu haben. »Ich bitte Sie, mich aus diesem Vertrag zu entlassen«, sagte Katharina, gab ihrer Stimme einen Anlauf und schaltete ihren Mutterblick ab, für den jetzt kein Platz war. »Ich weiß, daß ich mich verpflichtet habe, dieses Buch zu schreiben. Aber ich schaffe es nicht. Es waren nicht die Krankheiten meines Sohnes im ersten Jahr. Ich denke heute einfach anders über das Thema als damals. Meine Vorstellungen sind von denen des Exposés abgekommen. Ich habe mich verändert.«
Katharina hatte ein Sachbuch vorgeschlagen, mit dem sie sich zur Befürworterin der künstlichen Befruchtung im Falle alleinstehender Frauen machen wollte. Heute, nach zwei Jahren eines neuen Lebens mit Kind und Freund, war sie nicht mehr der Meinung, daß es eine richtige Entscheidung wäre, dem Kind den Vater vorzuenthalten. Sie fand, daß das Kind, das man in die Welt setzte, das Recht hatte auf seinen Vater, das Recht hatte, eine Alternative zum Verhalten einer Frau zu erfahren. Denn solange sich Mann und Frau noch verschieden verhielten, würde das Kind in eine Gesellschaft hineinwachsen, in der es Männer und Frauen gab. Es würde es schwer haben, mit Geschöpfen umzugehen, die es nicht oder zu wenig kannte.
»Ich verstehe nicht, warum die Zusammenarbeit mit Frauen niemals sachlich sein kann«, antwortete der Verleger. »Vertrag ist Vertrag. Sie haben sich schriftlich verpflichtet, dieses Buch abzuliefern. Nun kommen Sie mir damit, daß Sie sich verändert haben. Ich will Ihnen einmal etwas sagen«, Katharina sah, wie sich seine Augen verengten, »das interessiert nicht. Mich nicht, das Verlagshaus nicht, die Vertreter nicht, den Leser nicht. Ich will ja zugestehen, daß es Fälle gibt, in denen die Ablieferung eines Buches erschwert oder unmöglich gemacht wird. Wir haben darüber gesprochen. Ich würde es akzeptieren, wenn zum Beispiel Ihr Kind sterben würde. Das wäre selbstverständlich ein Grund, und dann ließe sich darüber reden, inwieweit der Vertrag abgeändert werden könnte und Sie vielleicht einen Roman liefern über den Tod Ihres Kindes. Alles andere halte ich für Ausflüchte.«
Katharina spürte, wie sie erstarrte. Der Satz hatte ihre tiefsten Ängste mobilisiert, mit denen sie sich herumschlug, seit Jonas zweimal beinahe zu Tode gekommen war. Jede Mutter lebt mit dieser Angst ein Leben lang, das wußte sie, aber wie war es denn möglich, das zu einer Geschäftsfrage zu machen?
Eine Antwort blieb ihr im Hals stecken, es war nicht möglich, zu tun, wonach es sie drängte: aufzustehen und das Haus zu verlassen.
»Es ist ja alles gut und schön, die ganze Chose mit der Emanzipation«, sagte Ralph, »aber ich habe es allmählich satt, mit Frauen zusammenzuleben, die unpünktlich, schlampig, gehetzt und vertragsbrüchig sind. Ihr Verhalten ist in höchstem Maße inkorrekt, unsachlich und deshalb für mich inakzeptabel.«
Auch das Dilemma, Dinge zu liefern, mit denen sie sich nicht mehr identifizieren konnte, wenn sie im fertigen Buch standen, war ihr nicht fremd. Katharina, die selbst mit Frauen zusammengearbeitet hatte, kannte die Schwierigkeiten sehr wohl. Da gab es nie eine Gleichzeitigkeit. Einmal hatte die eine, einmal die andere Konflikte, abwechselnd war immer eine deprimiert oder überlastet oder im Kopf mit anderem beschäftigt, immer war eine zu trösten, wenn die andere gerade obenauf war, und so war es ein Gezerre und Getröste, bis die Arbeit vollendet war, wie kein Mann es kannte, dem eine Frau den Weg freischaufelte.
Sie hatte sich dennoch immer an ihre Verträge gehalten und sich damit abgefunden, von Freunden angegriffen zu werden, die es sich leisten konnten, Arbeiten abzubrechen und auf das Geld zu verzichten. Sie erinnerte sich an die 68er Jahre, als sie es aushielt, von denen, deren Achtung sie gebraucht hätte und über die sie aufwertende Artikel schrieb (wogegen diese Leute wiederum nichts einzuwenden hatten), als reaktionär abqualifiziert zu werden, weil sie weiterhin an einer immer mehr nach rechts driftenden Boulevardzeitung ihr Brot verdienen mußte. Sie war sich damals sicher, daß manche ihrer Freunde politische Gründe nur als Vorwand benutzten, um eine Sache aufzugeben, die ihnen über den Kopf wuchs, weil sie ständige Auseinandersetzung forderte. Die Zeit hatte ihr recht gegeben: Viele von ihnen hatte es in den letzten zehn Jahren in andere Berufe getrieben, oder sie waren in den Pferchen Eingeweihter verkümmert, oder sie waren ausgebrochen, und einer von ihnen war aufs Meer hinausgeschwommen und nie mehr zurückgekommen.
Katharina kannte Ralph, der einer von jenen gewesen war, die es immer gut mit ihr gemeint hatten, seit der Zeit, als sie für die Zeitung gearbeitet hatte. Ralph, damals noch ein kleiner Redakteur, war halben Herzens für sie eingetreten, wenn sie so gar kein Gespür bewiesen hatte für die Leser einer Straßenverkaufszeitung, die der Chefredakteur, ein aufgeschwollener Kneipenhocker, dem jeder Meinungsaustausch zu einem Gebell geriet, so genau zu kennen schien. Dieser wußte, ebenso wie alle Redakteure bei Rundfunk und Fernsehen, genau, wie jener Leser (Zuhörer, Zuschauer) beschaffen war und was die wollen und wie die zu behandeln waren, und er warf ihr Dünkel vor und Revoluzzertum, wenn sie seine Vorstellungen bezweifelte und mehr Zutrauen äußerte. Oh, wenn sie nur wüßten, jene »Konsumenten«, wie »die da oben« (von denen Katharina wiederum sehr wohl wußte, wie man sie zu unpersönlichen Zielen heranspezialisierte), die mit weingeistigen Hirnen an den Hebeln saßen, von ihnen dachten, mit welcher Verachtung sie sie in der Unmündigkeit hielten, damit sie nicht entdeckten, was sie nicht durften, damit sie vergaßen, was Verzicht bedeutete und Beschränkung, damit sie verlernten, ihre Hände zu gebrauchen.
Und so hatte Katharina jahrelang ihre verkrüppelten Hände über die Tastatur der Schreibmaschine gleiten lassen, um Artikel zu machen über Menschen, die Filme über etwas gemacht hatten, und Bücher über die Probleme von Menschen, die unter etwas litten, und es hatte alles immer weniger mit ihr zu tun, was sie tat. Weil ihre Augen voller Tränen waren, sah sie die Menschen nicht mehr, die sie ausbeutete, um mit einem Zweispalter sechzig Mark an ihnen zu verdienen. Und es endete damit, daß sie mit denen, über die sie Artikel schrieb (die die anderen vervielfältigten), im Bett lag, und ihre Hände strichen über ihre Körper, um zu begreifen, was nicht zu begreifen war in dieser kurzen Zeit. Sie interviewte Körper, die nur deshalb antworteten, weil die Gehirne wollten, daß ihre Worte gedruckt werden würden. Sie ließ sich zuviel ein auf jene Menschen, die sie eigentlich nur eine Stunde hätten kosten dürfen, und ihre Hilflosigkeit kostete sie Geld, und mit jenen Trugbildern von Nähe und Verstehen schwanden auch ihre Zeit und Kraft.
Als man ihr kündigte, weil der Chefredakteur sie als Zumutung für seine Leser empfunden hatte, fing sie an, sich gehenzulassen, und es dauerte eine Zeit, bis sie davon abkam, daß Menschen aufzureißen waren und auszubeuten, bis sie verstand, daß ihre Art, mit Menschen umzugehen, unwürdig war und daß es Grenzen gab.
»Und was haben Sie sich nun gedacht?« Der Verleger wurde ungeduldig.
»Ich könnte Ihnen, wenn auch nur ungern, einen Kompromiß vorschlagen: ein Buch zu schreiben gegen künstliche Befruchtung«, sagte Katharina leise, und sie sah, während sie sich erklärte, jenen angestrengten Zug in seinem Gesicht, den sie bei Männern sehr wohl kannte, wenn eine Frau anderer Meinung war; den Ausdruck jener Chefs, die eine Hand ans Ohr hielten und sagten, sie könnten nichts verstehen, sie hätten sie akustisch nicht verstanden, weil sie so leise sprachen, die Frauen, immer zu leise mit ihren Stimmen, die schüchtern bettelten, man möge sie doch anhören. Diese Unhörbarkeiten der Verliererinnen bei allen Konferenzen, wie sie immer unsicher und ängstlich klangen, und wie es in ihnen bröckelte, selbst wenn sie sich Mut machten. Diese Kinderstimmen, die zu schweigen hatten, wenn die Erwachsenen redeten.
»So ein Buch würde nicht gehen. Ihr Buch muß provokant sein. Sie müssen einsehen, daß wir nicht drucken können, was keine Käufer findet. Wir sind kein Wohlfahrtsinstitut. Sie sind doch eine moderne Frau, ledige Mutter« (das klang schon fast nach Vielmännerei), »Sie ernähren sich und Ihr Kind alleine, und es kann doch beileibe nicht Ihr wahres Anliegen sein, die ganze Emanzipationsidee zu verraten. Meine liebe Katharina, also das können Sie wirklich nicht von mir erwarten, daß ich da mitspiele.« Und er wandte alle jene Argumente gegen sie an, die der moderne Hexenhammer, der Ratgeber für ein rationales Leben, enthält, mit dem die Männer, als seien sie mit dem Teufel im Bunde, den Frauen alle weibliche Kraft aus dem Leib hämmern wollen. Er gab sich gynophil wie viele Männer, die die Emanzipation zu ihrer Sache gemacht hatten, weil es Karriere verhieß und private Erleichterung verschaffte. Katharina hatte wiederholt erlebt, wie dieses Prinzip sich gegen sie wandte und wie man (das Rezept der bürgerlichen Linken seit der Französischen Revolution) ihren Kopf forderte, weil sie nicht ins revolutionäre Konzept paßte.
Katharina sah keinen anderen Weg, als ihre Einstellung zur Emanzipation zu klären, und sie verstand aus den Blicken der Sekretärin, die den Kaffee brachte, daß jene mehr begriff als Ralph, in dessen Haltung etwas lag, das sie warnte. Es war wie früher, als alle möglichen Schicksalsschläge auf das Konto der Frauen gingen, ob es Unwetter waren oder Krankheiten. Für Ralph war es der Ausfall eines Projektes, für das er sich eingesetzt hatte und das von neuzeitlichen Heldinnen handeln sollte, die des Mannes nicht mehr bedurften.
»Ich sagte Ihnen schon, ich habe mich verändert, und ich werde mich weiterhin verändern«, wiederholte sich Katharina, »und ich glaube nicht daran, daß Menschengeist, der Gläsern entsteigt, ein Fortschritt ist. Dazu fehlt nicht nur die Voraussetzung, daß wir nämlich allesamt eine kolossale Umformung erlebt hätten, sondern ich glaube nicht, daß es gut für uns wäre, wenn sie stattfände.«
»Aber Sie können doch nicht so mir nichts dir nichts von heute auf morgen Ihre Meinung ändern«, sagte Ralph vorwurfsvoll, entschlossen, das Holz zu spalten, und Katharina sah, daß es schlimmer war mit ihm, als sie erwartet hatte. Sie spürte, wie die Furcht in ihr hochstieg, da nie und nimmer herauszukommen, weil es unmöglich war, sich zu erklären.
»Von heute auf morgen kann keine Rede sein«, sagte sie. Ihre Stimme bekam jene Hysterie, die immer durchschlug, wenn sie sich behaupten mußte. »Ein Vierteljahr ist viel Zeit, wenn man sich täglich mit einer Sache auseinandersetzt. Ich kann nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Gut, ich lebe allein mit dem Kind.« Sie warf einen raschen Blick auf Jonas, der gerade einen Bücherstoß umgeworfen hatte. Eine besänftigende Geste der Sekretärin bewies ihr, daß sie es übernehmen würde, das zu ordnen.
»Gut, ich bin frei. Frei von allen Lasten, frei für die wundersamen Experimente mit neuen Lebensformen.« Sie sagte es leicht höhnisch, als sie in seinen Augen jenes gewisse bedauernde Funkeln entdeckte, als dächte er: Warum habe ich eigentlich geheiratet, wenn es Frauen gibt wie diese, die dir auch ohne Trauschein das Kind frei Haus liefern. »Gut, ich bin frei«, sie wurde zornig. »Aber vielleicht bin ich gar nicht gerne frei. Vielleicht bin ich sehr traurig über soviel Freiheit. Vielleicht habe ich sogar Angst. Vielleicht bin ich nur frei, weil ich niemanden habe – und wäre lieber verheiratet. Ich glaube nicht mehr an die Freuden der Einsamkeit. Da ist man gegenseitig zu Besuch und sitzt dann da wie eingeladen, während zu Hause die bequemen Pantoffeln stehen, und ißt die Suppe, die der andere gekocht hat auf seine Art, und schläft zusammen in einem Bett, das kein gemeinsames ist und nie sein wird.«