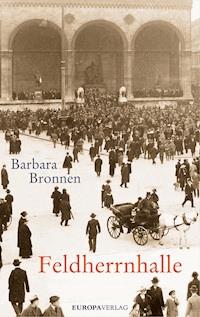4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
»Anfänge gibt's zuhauf, aber Ende gibt's nur eins. Ich will ein gutes Ende, das habe ich verdient«, sagt die Vierundneunzigjährige zu ihrer Enkelin, auf deren Dienste sie angewiesen ist. Aber wie mit einem jungen Menschen auskommen, der im Pflegen keinen Sinn findet? Und wie eine eigenwillige alte Frau pflegen, die bis zuletzt ihre Selbständigkeit verteidigt? Die Aufzeichnungen, welche die Enkelin über ihre Erfahrungen mit der Greisin macht, zeugen bis in alle Widersprüchlichkeiten hinein von der fortschreitenden Unfreiheit und Abhängigkeit im Alter. Doch wird die Junge bei der Auseinandersetzung mit der herrischen, eigenwilligen alten Dame gezwungen, auch ihr eigenes Leben aus der Perspektive des Alters zu sehen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Ähnliche
Barbara Bronnen
Die Überzählige
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
Ich danke der Stadt München und dem Deutschen Literaturfonds, die mir durch ihre Stipendien die Vorarbeiten zu diesem Roman ermöglichten.
Meiner Mutter
Der Zeh
Sie schläft.
Sehr ruhig, sehr zart, sehr klein, sehr leicht liegt sie da in ihrer Geschichte und doch sehr fest.
Ich sehe sie an.
So wird eines Tages das Leben meiner Großmutter, die vierundneunzig Jahre alt ist, zum Tod hinabgleiten. In ihren eigenen vier Wänden, worauf sie besteht, auf ihrem Bett, dem Bett, in dem ihre Mutter gestorben ist.
Jedoch, wenn es gutgeht, keinesfalls so! Nicht wie jetzt, zwischen den Tageskissen, die karierte Reisedecke um die Beine geschlungen. Nein! Keinesfalls in einer hellen Bluse, die über die Arme hinausgewachsen ist, und im grauen Alltagsrock.
Vierundneunzig Jahre alt zu werden ist schon schlimm genug. Da darf man keinesfalls überrascht werden.
Nein. Es ist unerläßlich, daß der Tod dann kommt, wenn meine Großmutter richtig auf ihn vorbereitet ist: im seidenen Nachthemd mit den Klöppelspitzen und unter dem Gesäß das Gummituch. Beides liegt bereit für den Tag oder die Nacht, die sein wird, lauert unter dem Bett in einer festverschnürten Plastiktüte, in ein Kästchen gebettet, das den Rosenkranz und das Weihwasser birgt. Auch das Sterbekreuz, eingeschlagen in schwarz-goldene Seide, harrt griffbereit auf dem Tischchen neben dem Bett seiner einzigen Lebensaufgabe.
Immer ist meine Großmutter imstande gewesen, für alles vorzusorgen – daran kann auch der Tod nicht rütteln. Sie ist von Kopf bis Zeh gerüstet. Sie hält ihren Schutzschild gegen seine Pfeile, Speere und Schwerthiebe vor sich. Nur unter einer einzigen Bedingung ist sie bereit, dem Bett-Tod ihren Frieden anzubieten und den Schild sinken zu lassen: Er muß sauber sein.
Ein sauberer Tod.
Ich weiß seit jeher, daß »darunter« alles reinlich ist, denn so hat sie es mir immer eingeschärft: »Zieh dich täglich frisch an untenherum und sei sauber, damit nicht einer Einblick nehmen kann in Vernachlässigtes bei Unfall oder Tod, denn nichts ist peinlicher für den Arzt wie für den Patienten.«
Ich nehme einen Stuhl und setze mich neben das Bett.
Sie liegt da, gekrümmt, zusammengerollt wie ein Kind, als gäbe sie sich Mühe, Platz zu sparen. Sie hat nie viel Platz gebraucht in ihrem Leben.
Da liegt sie, diese Bürde, ausgesondert, verbannt, abgetrennt.
Ich stehe auf und setze mich an den Bettrand, blicke auf die Uhr. Wann wacht sie endlich auf?
Ihr Metier, das Sterben, verleiht ihr eine neue Anziehungskraft. Der Geruch des Todes zieht mich an und stößt mich ab im selben Augenblick. Ich beobachte an ihr jene speziellen Körperbewegungen, wie sie Astronauten im luftleeren Raum eigen sind. Schwerelos wird sie dahingleiten, elastisch und graziös entschweben.
Ich taste mich an sie heran. Der Raum ist dämmrig.
Nur sie. Der »Pflegefall«.
Alles andere ist draußen.
Draußen die Welt. Die Zeit. Auch ich, auch ich bin ausgesperrt.
Ich scharre mit den Füßen. Sie soll endlich aufwachen. Lange sitze ich da.
Ich bin dem Wechsel meiner Gedanken nicht gewachsen. Aus welcher Luft holt sie sich diesen ruhigen Atem? Unruhig bin ich, voll banger Neugierde zu erfahren, wie sie eigentlich ist.
Ich stehe auf, zünde eine Kerze an und stelle sie auf das Tischchen. Ich gehe in die Knie und berühre ihre Hand. Schläft sie denn immer noch? Stieß sie nicht eben mit dem Handrücken leicht meine Hand zurück?
Sie mag es nicht, wenn man ihr zu nahe kommt. Es ist schlimm, daß ich es tun muß. Meine Einbrüche sind ein Teil der unbarmherzigen Veränderungen, die ihren Verfall ausmachen.
Diese Veränderungen sind Verletzungen.
Ich muß an ihren Handgelenken zerren, damit sie auf der Erde bleibt. »Lang lebe ich nicht mehr«, ist ihre ständige Rede seit der Augenoperation, »ich bin ja schon beinahe tot.« Ich muß alles tun, um sie am Leben zu erhalten. Ich weiß, daß sie meine Pflege braucht. Ich bin der Widerstand und hindere sie, aus ihrer Haut zu fahren.
»Solange ich noch warm bin, wecke mich Punkt drei!«
Noch fünf Minuten.
Matt wirkt sie, aber beharrlich. Sie geht ihren Schlafgeschäften nach. Ihr Magen arbeitet hörbar. Aus dem Mundwinkel rinnt Speichel. Der Kopf strebt auch im Liegen zu den Füßen. Die Schenkel, arthritisch verkrümmt, bringt sie nicht mehr zusammen.
Die Berührtheit vom Tod hat sie für mich verändert. Wir sind bis zur Stunde ihres Todes aufeinander angewiesen. Sie ist immer da. Ich bin ihrem Rhythmus ausgesetzt.
Manchmal scheint sie sich zu fangen, ist rege und anteilnehmend, dann wieder in sich gekehrt. Etwas ist anders geworden.
Ihr Organismus arbeitet mit einem Trick.
Meine Großmutter ist dabei zu schwinden. Stelle ich sie auf die Waage, so hat sie stets an Gewicht verloren. Immer häufiger ist sie wie erloschen. Ihr fehlt es an Licht.
Dann wieder ist sie voll Ekel, voll Wut. Voll Spannung, als befände sie sich bereits in einer Aufwärtsbewegung.
Was kann ich nur dagegen tun? Die Ungewißheit, die Wechselhaftigkeit zerren an mir. Soll ich die Astronautenkost, vom Arzt verordnet, absetzen?
Wie weit ist sie schon entfernt? Wo ist sie überhaupt? Ich setze mich wieder ans Bett und schlage laut auf ein Kissen.
Nicht einmal Fingerabdrücke werde ich auf ihr hinterlassen. Immer wenn ich sie ansehe, fühle ich ein inneres Erkalten, Vereinsamen.
Wie kann sie sich verlassen vorkommen, wenn ich täglich zu ihr gehe?
Der Trick mit dem Verfall macht sie einsamer von Tag zu Tag, ureinsam.
Wieder sehe ich auf die Uhr: noch drei Minuten.
Warum nur haben wir beide die Orientierung verloren? Verbraucht vom Überkommenen, befinden wir uns in einem Dilemma.
Oft wissen wir nicht, wie wir miteinander sprechen sollen. Ich habe keine neuen Worte. Welche Worte können uns jetzt helfen?
Wir haben ein Leben lang gefällige Leerformeln ausgetauscht.
Wo sind die nur hingekommen?
Manchmal fallen mir noch welche ein. Sie klingen fremd. Auch für sie.
Dann sieht sie mich oft so seltsam an.
Oder Gesten.
Ich brauche neue. Heitere. Leichte.
Wie macht man hilfreiche Gesten?
Meine sind immer falsch, von Schweiß beschlagen.
Ich bin der Aufgabe, das richtige Wort, die leichte Geste zu finden, nicht gewachsen.
Ich habe nichts gelernt. Alles, was ich tun kann, ist bemüht oder widerwillig.
Ich streiche der Schlafenden, die keinen Widerstand leisten kann, leicht übers schleirige Haar. Greifen können will ich sie mit der Hand, so, wie sie im Leben nur das begreifen konnte, was sie wirklich anfaßte.
Immer hat sie das Obst berührt und das Gemüse und ihre Dinge, Unfaßliches aber abgelehnt.
Ich sehe auf meine Finger. Sie sind gekrümmt.
Was kümmert sie mich? Warum rühre ich sie an?
Ich blicke auf ihre Hände, die sich für nichts zu schade gewesen waren. Jedesmal sind sie hinter meinem Schmutz hergekommen und haben ihn getilgt. Sie macht keine Fäuste wie ich im Schlaf, vogelleicht ist die Hand selbst unter der Fuchtel des Todes und immer noch nervig im Altsein. Ängstlich umklammere ich sie und denke, bald wird sie noch mehr verbleichen, diese Hand, die immer rastlos für die kleinen Dinge da war, doch kaum für sie selbst.
Ich spreche mir Mut zu, meine Großmutter weiter anzusehen und mir auszudenken, wie ich sie einmal werde vermissen müssen und daß ich oft noch nachts mit Angst auffahren werde, ob ich es gutgemacht habe mit ihr. Denn ich besitze zwei linke Hände, so hat sie immer gesagt, und da kann ich noch so erfolgreich sein: »So ist das nichts gemacht, wie du das machst!«
Voll Schrecken denke ich, daß in Zukunft alles in Zusammenhang mit meiner Großmutter stehen wird. Das macht mir Angst. Angst vor unseren Schranken. Angst vor meiner Abwehr.
Ja, wie unsere Gegenwart tauschen? Wie ihr Sterben verstehen als Lebende? Sie hat kein schlechtes Gewissen, ich schon, so sehr mißtraue ich mir.
Ich stampfe mit dem Fuß auf. Hört sie mich nicht endlich?
Weit hergeholt erscheint mir der Gedanke, daß sie sterben soll. Dumm und kleinlaut hoffe ich jetzt, daß sie, die dies alles eingefädelt hat, es auch wieder lösen wird.
Zum Fenster, zum Licht: Als hätte sie sich nun orientiert, hebt sie leicht den Kopf. Sie lauscht auf die Zeit. Dann gähnt sie und gibt mir damit ihr Zeichen, daß sie aufwachen wird.
Mir wird schwindlig.
Sie prüft mich schräg, einäugig für die Dauer eines Augenblicks, und windet sich dann wieder in ihre bläulichen Schleier hinein. Leise lallt sie: »Ach du bist’s, Fränzla. Nur noch ein bissele«, und wieder taucht sie weg.
Ohne Zähne und noch voll Müdigkeit nuschelt sie beinahe unverständlich. Bevor sie endgültig erwacht, lasse ich rasch ihre Hand los, weil das zuviel Kontakt ist.
Weshalb bin ich eigentlich hier? Was kann ich tun?
Da sitze ich wieder mit meiner großen Frage, meinem Schrecken. Ich halte den Atem an. Es wird über meine Kraft gehen. Meine Angst wächst, wenn sie sich träumend davonstiehlt; wenn sie schweigt, vergeht mir der Mut.
Wozu mich betrügen? Es ist nicht nur das Auge. Es ist der Vorgang des Ausscheidens.
Ich zwinge mich, sie wieder anzusehen. Das Auge mit dem blicklosen Blau sieht immer noch aus, als habe man sie geschlagen. Rundum ist es entzündet und verquollen, das Lid ist dick und rot, darunter die beständige Träne.
Im Mund fühle ich den gewohnten Ekel.
Ich sehe auf die Uhr und denke: Jetzt muß ich sie wecken. Man könnte denken, es wäre einerlei, die Tage kommen und gehen und nichts kann ich vertauschen. Doch es ist besser, mich nach ihrem Wunsch zu richten.
»Die Gefahr ist zu groß«, hat sie gesagt, »daß ich den ganzen Tag verdämmere. Das habe ich meiner Lebtag nicht getan und will es auch nicht tun an meinem Sterbetag.«
Es ist Schlag drei Uhr.
Ich lege ihre Starbrille an jenen Platz, an dem sie sie gleich suchen wird, und berühre ihre Füße, knete sie leicht. Sie läßt sich treiben, eine scheinheilige Reglosigkeit im Gesicht. Oder ist es nur mein Argwohn? Wie ein Kind im Dunkeln summe ich, mir Mut machend, ein Lied, und ich knete die Zehenknochen, die Ballen – seltsam, diese Mischung von Schwund und Schwung! Ich schlucke und denke an das, was mir bevorsteht: Bald werde ich sie auf den Stuhl heben müssen, so leicht werden diese Beine unter ihr wegknicken.
Da seufzt meine Großmutter, und dann stöhnt sie. Andere hätte es vielleicht nicht verwirrt, aber mir ist es unangenehm, wie Wollust klingt es, und sie sagt: »Ah, tut das gut, aber fester, fester, fester«, und ich drücke ihre Fußknochen und reibe die Waden. Da stößt sie mich mit dem Fuß von sich und sagt hellwach: »So ist es Pfusch! Und diese letzte Zeit, die gehört mir, die wirfst du mir nicht so einfach hinaus, also drück gefälligst fester und stell dich nicht so an, denn du machst es dir immer zu einfach.«
Und ich greife fester zu. Sie stöhnt gierig und sagt: »Ah, so ist’s gut. Du kannst, wenn du nur willst. Merke dir eins: Anfänge gibt’s zuhauf, aber Ende gibt’s nur eins. Denke nicht: Ende gut, alles gut. Ich will ein gutes Ende, das habe ich verdient.«
Ich schiebe, hoble, übertreibe den Druck, sage: »Jaja, diese Zeit, die gehört dir«, klammere mich an ihre Füße und greife in die Zehen hinein wie ein Klavierspieler.
Sie krächzt: »Na endlich!«
Überrascht entdecke ich keinen Argwohn in ihren Zügen, wie er sonst zu ihr gehört. Ich sehe, wie sie sich in Gedanken wieder in die Reihe stellt, und halte mich an ihren Füßen fest, als hoffte ich, daß sie mich mitzieht.
Da runzelt sie die Brauen, wie sie es immer tut, wenn ihr etwas gegen den Strich geht, und sagt: »Sind die Stiefmütterchen bezahlt?«
»Ja«, antworte ich erschrocken, »ich habe selbstverständlich deine Kusine bezahlt.«
»Wieviel?« fragt sie, und für einen Augenblick bekommt ihr Gesicht einen beinahe ordinären, zumindest triumphierenden Zug, weil sie es genießt, andere mit Aufträgen versehen zu können und dann zu bezahlen; das gibt ihr mehr Freiheit.
»Uschi rief an, als du schliefst, und fragte, welche. Ich sagte, violette, das ist doch keine Frage!« Ich lache auf, meiner Großmutter zu Gefallen. »Sie wollte auch wissen, ob die höheren oder die niederen Primeln. Die höheren kosten sechs, die niederen vier Mark.«
»Und du hast …?«
»Ich habe gesagt, die niederen, ich hoffe, in deinem Sinn, weil sie besser zum Moos passen. Es soll ja Harmonie haben.«
»Niedere Primeln zu den Stiefmütterchen, Gott sei Dank!«
Meine Großmutter entspannt sich, ich atme auf.
»Und das Kuvert – mit Reserve?«
Ich nicke. »Vierzig Mark.«
»Na ja, die Uschi braucht neues ›Grabsteinrein‹; außerdem rechnet sie ja immer gewissenhaft ab.« Sie erteilt mir mit einer Geste ihres Ärmchens gewissermaßen die Absolution und neigt sich zu mir. »Sie kümmert sich rührend um mich, fragte neulich, ob sie mich mit auf den Friedhof nehmen soll. Ich dankte und sagte: ›Da komme ich noch früh genug hin!‹«
Sie macht eine ihrer herrischen Hände, und ich reiche ihr sofort das Foto von Opas Grab, das neben einem Foto, das Opa leibhaftig zeigt, steht, sehe, wie sie es packt und neben ihren Körper hält, als nähme sie Maß. Ich schlucke schwer an ihrem intimen Umgang mit der Wohligkeit des Grabes. Ich apportiere ihre Nippsachen, ihre Seidenblumensträuße und die bronzene Madonna ans Bett, wie man einem Kind, das noch nicht laufen kann, seine Spielsachen bringt. Sie greift in die Perlen, die Spitzen, an Straß und Brokat, und spinnt den Faden, an dem sie und diese von ihr kostümierte Madonna hängen, erzählt vom Brautschleier ihrer Mutter, der die Madonna ebenso ziert wie die Spitze von ihrem Hochzeitskleid. »Und der Samt, der ist von meiner Kommunion, und …«
Ich gehe, eine Entschuldigung murmelnd, zur Toilette. Ich kehre zurück, da sitzt sie aufrecht im Bett. Das Haar hat sich dünn und weiß gelöst, sie starrt auf den regenbogenfarben-, talmigold- und silberfunkelnden Schlüsselanhänger in Globusform, hat auf das Knöpfchen gedrückt, so daß die Erdteile und Meere, von einer winzigen Glühbirne erhellt, aufleuchten. Ein Geschenk meines Sohnes. Ihre Freude am Funkelnden hat etwas von der Lust am Buntglitzernden, wie sie die Indianer hatten, als sie noch alles hergaben für wertlosen Glimmer.
Jetzt bemerkt sie mich, wirft mir einäugig einen ihrer Sichelblicke zu und entblößt das Gebiß, das sie unbemerkt der zweckentfremdeten Zuckerdose entnommen hat. Es soll ein Lächeln sein, doch es wird schief. Sie bleckt verzerrt, hebt die Oberlippe. Das Grinsen verstärkt sich, es bleibt stecken, eine Grimasse wird es. Die Fratze macht sie mir, diese Hyäne! Sie läßt sie auch noch stehen, lange, sie will sich mir so entblößen. Dann, endlich, hebt sie die bleiche Hand und fährt sich mit ihr übers Gesicht, der Spuk verschwindet, und sie sagt scharf: »Hast du den Klodeckel auch zugemacht?«
»Ja«, sage ich ergeben und höre, wie ich ausatme, und sie hört es auch, denn sie hört zunehmend besser, seit das Auge erstorben ist, ebenso wie sie Tag für Tag besser jedes feinste Härchen erfühlt, das auf ihrem Kinn wächst. Nun habe ich es beschrien: Ihr Zeigefinger weist auf das Kinn und bedeutet mir: Die Pinzette! Ich nehme sie vom Telefontischchen, auf dem sie früher nie hätte liegen dürfen. Jetzt jedoch liebt meine Großmutter geradezu das Wort Reichweite. Ich nähere mich, von ihrem üblichen Schreckensschrei »Vorsicht auf mein Auge!« begleitet, ihrem Kinn, hebe das zerknitterte Fleisch an, schiebe es zusammen und versuche, das Haar zu fassen, das ich abpflücken soll, das sich jedoch, je stärker ich drücke, um so tiefer zurückzieht. Sie hebt die rechte Hand und sagt zwischen den Zähnen: »Ich könnte dir eine runterhauen, wahrhaftig.« Ich sage nichts darauf. Das gefällt ihr nicht; im Augenblick regloser Wut treffe ich das Haar auf Anhieb, ziehe es heraus, was ihr einen wohligen Schmerz verursachen muß, denn sie sagt wieder: »Ahhh! Das brennt gemein!« Aber es klingt gut.
Doch das war nur eine Pause. Meine Großmutter ist kurze Zeit still, sie nimmt das feuchte Tüchlein, wischt sich ums böse Auge und sagt: »Aber du hast die Klobürste nicht benutzt – mir tun die Kinder heute leid, die nichts mehr lernen.« Damit meint sie meinen Sohn. Ich antworte, daß ich nicht groß habe müssen, und es ist mir unangenehm. Doch meine Großmutter fährt fort, als hätte ich nichts gesagt: »Und jedesmal ist der Deckel offen. Neulich war die Frau Graser mit dem Professor hier zu Besuch, und da ging sie aufs Klo und kam zurück und sagte: ›Wie lang haben Sie denn schon das Klo?‹ Ich dachte, sie meint das ganze Bad, die Wände, und sagte: ›Das ist vor vier Jahren gestrichen.‹ Sagte sie: ›Ich meine das Klo, weil das Klo so ungebraucht aussieht, wie neu.‹ Da meinte sie die Muschel. Und als der Professor mich das erste Mal allein besuchte, da hatte er auch den Deckel offengelassen, und ich sagte: ›Ich muß es auch der Enkeltochter sagen, jedesmal, der Deckel ist offen, warum muß der Deckel offen sein, so ein Deckel, der hat doch seinen Sinn.‹ Und als der Professor zuletzt hier war, da war er wieder auf dem Klo, und als er zwei Stunden später im Flur stand und sich verabschiedete, da machte er so ein Gesicht, sagte: ›Jetzt muß ich nochmal reingucken‹, und öffnete die Tür zum Klo. Sagte ich: ›Was gucken Sie denn da?‹ Sagte er: ›Ob auch der Deckel zu ist.‹ Und als ich neulich mit ihm bei der Frau Graser eingeladen war, da war er auch am Klo und dann ich, weil wir ein Glas Wein und Tee getrunken hatten. Und auf dem Heimweg, als er mich stützte, habe ich gesagt: ›Sagen Sie mal, Sie waren doch vor mir, da war aber der Deckel zu, wie kommt es, daß der Deckel zu war?‹ Da sagte er: ›Ich hab’ eben bei Ihnen was gelernt.‹«
Meine Großmutter lacht hoch und fügt stolz hinzu: »›Was‹, sagte die Graserin, ›da ist Ihre Muschel noch so schön?‹ Die hätte ja genügend zu bewundern gehabt hier in der Wohnung mit den wertvollen Sachen, aber nein, sie fragt nach der Muschel. Hast du den Klodeckel zugemacht?«
Ich sage nochmals: »Ja«, halte die Luft an, hoffe, dies alles fängt nicht nochmals von vorne an. Wie der Schatten den Bewegungen des Körpers folgt, so beginne ich wider Willen mit den Gedankenbewegungen meiner Großmutter mitzuschaukeln und weiß nun, daß die heiligen Glitzerdinge in ihre Schreine zurückgeschafft werden müssen.
Ich weise auf die Madonna, meine Großmutter nickt und sagt: »Aber stell sie richtig hin!« Ich räume die Fetzenpuppe hinter Glas, das Grabbild auf die Barockkommode zu Bismarck neben dem Ewigen Licht, das meine Großmutter unterhält, und blicke ihr Jugendfoto an, ihren elenden Gesprächen ausgesetzt.
»Die Dinge hängen alle zusammen bei mir«, sagt sie, und das stimmt.
Die Wohnung ist ihr ganzer Stolz. Seit fünfunddreißig Jahren, seit dem Tod des Großvaters, lebt sie nun darin. Zwar hatten ihre besten Stücke die »Amis« gestohlen, aber vieles hat sie doch behalten können, und sie ist stolz darauf, wenn die Besucher sagen, in diesem Haus habe niemand eine so schöne Wohnung vermutet. Das Haus ist sozialer Wohnungsbau, und seine Mieter sind allesamt, wie sie bedauert, »von niederem Stand«.
Sie spricht von ihren Gegenständen, und ich stelle mir meine Großmutter vor, so jung, so schön, so ernst und so erwachsen wie auf dem Foto. Sie lächelt ihr Augenlächeln, so wie man es ihr beigebracht hat, denn lachen, sagt sie immer wieder, sei häßlich. Auch würde sie nie beide Hände zusammenklatschen oder mit den Achseln zucken beim Sprechen, geschweige denn eine Temperamentsgeste vollführen, denn das wäre »jüdisch«.
»Schön warst du«, sage ich, und nun lächelt sie wirklich und sagt ganz wunderbar freundlich: »Das schöne Käthla, so nannten sie mich, das Käthla mit dem Lächeln der Mona Lisa. Hol mal die Unbekannte!«
Ich hole rasch die von der Seine, meine Großmutter fährt ihr übers Gipsgesicht und sagt: »So schön im Tod kann nur ein schöner Mensch sein. Sie muß wunderbar gewesen sein – was geschieht in Brokdorf?«
Solche Übergänge gewohnt, fasse ich die Vorgänge zusammen, und sie spricht von mangelnder Menschenwürde und zweifelhaftem Erbe heutzutage, und ich muß jene Zeitung holen, die meiner Großmutter auf den Leib geschrieben ist. Dabei fällt mir die Zeitung neben dem Bett zu Boden, ich bücke mich, und meine Großmutter sagt hart: »So verweichlicht seid ihr schon, nicht einmal mehr zupacken könnt ihr«, zieht mir die Zeitung aus der Hand, weist auf die mir verhaßte Spalte FÜR UNSERE FRAUEN, und ich muß den mit der Anrede »Liebe Kameradinnen!« versehenen Artikel zum hundertsten Male vorlesen, laut und deutlich, weil ich sonst über Entscheidendes hinweghusche. Auswendig kenne ich es bereits, wie diese Dragonerin den Bogen schlägt vom alten keltischen Kreuz von Monasterboice und den irischen Frauen bis zu der entscheidenden Frage: »Macht Handeln nach dem gesunden Menschenverstand Befehle überflüssig?«, was, wie jeder soldatische Depp weiß, nur eine rhetorische Frage ist. Nun sagt meine Großmutter, weil sie genug hat: »Verdirb dir nicht die Augen!«, heißt mich die Zeitung wieder an ihren Platz räumen für morgen und bittet mich, sie aufzurichten als Übergang zum Aufstehen. Ich stütze sie wie gewohnt ab, schiebe die Kissen unter ihren Rücken, da dreht sie sich unwillig mit einem Ruck um, schüttelt die Kissen, ordnet sie neu, haut darauf und sagt: »So ist das nichts gemacht, wie du das machst.« Doch das ist noch gar nichts. Fränzla, paß auf, sage ich mir, jetzt kommt noch mehr, denn im Sitzen hat sie den Überblick.
»Hol den Wedel«, fordert meine Großmutter. Ich gehe dorthin, wo er hingehört, da zischt sie: »Er hängt an der Leine vor dem Fenster, zum Lüften, bei dem Wetter«, und schaut recht listig, inmitten ihres Reiches ruhend und in voller Erwartung der Wiederkehr meines Unverstands. Ich hole den ausgelüfteten, also staubfreien Wedel und denke: Ich brauche doch nur wie sie meine Existenz diesem Wedel anvertrauen, und er wird ihr Sinn verleihen. Doch kaum habe ich zu wedeln begonnen – über diese Dame mit dem Hündchen, das an ihrem Cul riecht, über diesen Eisbären von Nymphenburg, der heute nicht mehr hergestellt wird, und dieses komplizierte Bierzipfelarrangement, über das Trainingsrad neben dem alten Kachelofen, den siebenarmigen Leuchter, das porzellanene Bildnis von Käthchen Schwind –, da wird mir mein Zähneknirschen bewußt. So schwer ist es, mich mit diesem Wedel durch ihre Lebensmaske zu schlagen, doch ich treffe ein Kästchen in der Vitrine. Es fällt herunter, und aus ihm fliegt ein Kästchen, das sich öffnet, und da ist ein neues Kästchen, und als ich’s aufhebe, da ist es wie im Märchen, und drinnen liegen lauter bunte Steine.
»Jetzt hört sich doch alles auf!« schreit meine Großmutter auf, ringt ihre knochigen Hände, springt blitzschnell mit ungewohnter Behendigkeit auf ihre Füße und rafft die Kästchen, die Steine an sich, verbirgt sie unter ihrer Bluse und kehrt ins Bett zurück, die nächste halbe Stunde wie ein Kind murmelnd. Ich höre es rasseln und klappern, wenn die Steine gegeneinanderschlagen beim Spiel, und sehe, wie sie mit den Händen darüberflitzt und sie befühlt, flatternd und tanzend; auf ihrem Gesicht liegt eine Freude am Fühlen, an Glattem und Kühlem, und wahrscheinlich ist sie gerade jung, weit weg von ihrem »Martyrium«, mit Blumen im Haar und dem neuen Ring von Opa am Finger. Doch dann steigt in ihren Augen wieder jene Wachsamkeit auf; sie richtet ihren Blick auf mich, ich sehe schnell weg und wedele. Beruhigt schiebt sie die Kästchen unter ein Kissen.
»So, jetzt das hintere Zimmer«, sagt sie, »ich muß ja doch noch einmal über alles drüber.«
Ich gehe ins hintere Zimmer, das eine Vorratskammer für mich geworden ist mit Fächern voller Bettwäsche und Frotteetüchern für später, denn jetzt würde niemand auf der Welt sorglich damit umgehen, und ich könnte einmal die viele Wäsche gut brauchen, wenn der Krieg kommt. Hier ist an sich nichts zu tun, also tue ich, als ob ich etwas täte, so wie ich es als Kind immer getan habe: Ich stehe, Spiel- und Standbein wechselnd, da, sehe die staublosen Schränke an, die polierte Kommode und harre eine halbe Stunde aus, die ich mit Gymnastik auffülle.
»Du mußt längst fertig sein«, kommt da die Stimme, »jetzt den Boden!«
Geräuschlos hole ich rasch den Sauger, dieses bedrohliche, verbotene, weil mit »elektrischer Lebensgefahr« verbundene Teufelswerk. Um sie aber zu täuschen, öffne ich den knarrenden Schrank, in dem die Putzsachen aufbewahrt sind, und zerre laut den mechanischen Teppichkehrer hervor.
Beim ersten Surren des Elektrosaugers fängt meine Großmutter auch gleich an zu tremolieren, als hätte ich sie selbst unter Strom gesetzt, und schreit: »Wenn ich die Feuerwehr holen muß, kostet es zwanzig Mark. Dich trifft der Schlag!« Ich überhöre sie, stelle den Staubsauger auf jeden Fleck, zähle bis einundzwanzig und mache eine Übung, dann verschiebe ich ihn und so weiter, bis das Zimmer sauber ist.
Meine Großmutter sitzt da wie enterbt und zischt: »Jetzt auf den Knien, denn nur auf den Knien wird es sauber, und jede Fuge, jeden Winkel!« Sie zittert noch immer von Kopf bis Fuß, und ich gehe in die Knie, stippe zimperlich den Lappen ins Wachs und wienere, bis sie mich heißt, an die Fächer zu gehen und in die E-c-k-e-n, vor allem in die Ecken, und mit dem Pinsel in die F-u-g-e-n, die Fugen … und immer links rum, l-i-n-k-s! Ich wichse mit dem schneeweißen Tuch den staubfreien Dauerzustand, wische über diese Familienbilder, die Fotos in den Fächern und diese Unterweltsbilder – alle sind sie über den Jordan gegangen.
»Weit und breit kaum einer mehr, mit dem man mit Schwung über die Fahrt in den Tod sprechen kann«, höre ich sie nebenan murmeln. »Auch der junge Pfarrer ist nichts. Sein Vorgänger ist versetzt, der alte in Pension, auch eine Neueinrichtung: Welcher Pfarrer früher hätte sich, solange er noch warm war, aus seinem Bau treiben lassen!« Zum Glück ist sie das Idol des alten, denn er findet keinen Gedanken meiner Großmutter verkehrt, kommt auf Anruf, wenn sie diese Art Grimm in den Augen bekommt, und spendet Trost; sie kann sich immer bei ihm einhängen.
Da tut es nebenan einen Plumps. Meine Großmutter ist aus dem Bett gefallen, dieses Aas. Fruchtlos sind meine ewigen Reden gewesen, daß sie nur zu rufen brauche, wenn sie aufstehen wolle. Immer dieser zähe Stolz, als könne sie ohne mich auskommen! Da liegt sie, und nichts hebt sie aus sich selber heraus, und es ist eine Bescherung. Sie schreit schrill und stöhnt unvernünftig. Ich fasse sie an, da ruft sie: »Rühr mich nicht an! Den Arzt her, da ist etwas gebrochen. Ich hab’s gehört, das Knirschen, und nur weil du nie zur Stelle bist; wenn ich dich brauche.« Ich höre ein Klopfen gegen den Boden von unten, und meine Großmutter wimmert noch lauter. Dann dreht sich der Schlüssel im Schloß, und es ist die Frau Wirsing, die unter ihr wohnt, von oben bis unten mit einem rosa Morgenmantel beklebt, das blonde Haar aufgetürmt. Sofort hängt meine Großmutter an Frau Wirsings Plastikmantel, und ich komme mir vor wie ein Loch im Boden. Mit hoher, klagender Stimme, die vor Schmerz stockt, singt meine Großmutter ihr Lied, wir heben sie gemeinsam auf die Couch, und dann geht es los: Eisbeutel, Jod, Sprühverband, obwohl am Arm nichts zu sehen ist. Frau Wirsing holt einen Kognak und flößt ihn meiner Großmutter ein. Ich streife beunruhigt und überflüssig durchs Zimmer.
Dann geht die Frau Wirsing wieder ins Bett, denn sie hat Mittagsschlaf; ich bleibe zurück mit einem Fleck in Großmutters Bluse und weiß wieder einmal nicht, wie man es richtig macht. Meine Großmutter trinkt noch einen Kognak und dann noch einen und lobt die guten Manieren der Frau Wirsing, die ihren Sturz so rasch gehört habe, direkt auffallend, wie sie sich um sie kümmere.
Ich bin wieder einmal durchgefallen. Eine Zeitlang bleibe ich ihren fruchtlosen Klagen ausgesetzt, dann ist auch das vorbei; meine Großmutter zieht sich oben herum um und nimmt den Stock in die eine Hand, mich an die andere. Wir tapsen zur Tür, die ich zweimal hinter uns verschließe, um uns die Treppen hinunterzuarbeiten, das ist für den Kreislauf.
Meine Großmutter feiert Triumphe und läutet ungeniert die Frau Wirsing heraus, dann die Frau Wibka und läßt sich bewundern. Da hören wir über uns ein Schlurfen, meine Großmutter zieht mich am Arm, aber so schnell können wir nicht davon. Es ist die Frau Weiser, die neben ihr wohnt und die sich wieder einmal mit ihren zwei Krücken anhängen will, nur weil sie niemand hat, der sich um sie kümmert. Nun haben wir sie auf dem Hals. Wir warten höflich, und dann kriechen wir hinunter. Die Haare stellen sich meiner Großmutter auf, weil sie das Weisersche Geseire mit anhören muß. Wir stehen im Hof herum, sehen auf die Garagen und ärgern uns über die lärmenden Kinder am Spielplatz. Die beiden tun zueinander recht höflich, dann sagt meine Großmutter: »Also, wir gehen jetzt wieder hinauf.« Natürlich erwidert Frau Weiser sofort: »Ich gehe mit, zusammen ist es unterhaltsamer«, und dann kriechen wir schweigend wieder hinauf, meine Großmutter macht ihr müdes Gesicht und winkt der Frau ab.
»Geschickt ist sie ja, das Luder«, sagt sie, als die Tür wieder zu ist. »Jetzt den Kaffee!«
Ich hole die Kanne, den Topf für das Wasser und den für den Filter zum Abtropfen, das Filterpapier und die Dose. Ich befeuchte das Papier und tue zwei gehäufte Maße Kaffee mit dem dafür gedachten Plastiklot hinein, das zwischen Patentverschlüssen, Eislöffelchen und gehorteten Plastikstreifen, mit denen Beutel verschlossen werden, seinen Platz hat.
Meine Großmutter ist erst noch ein bißchen aufgeladen, dann verliert sich das, und ich finde sie wieder, diese alte Frau, die meine Zärtlichkeit braucht. Sie seufzt: »Ich mach’ dir lauter Scherereien, gell, Fränzla, Gott, wenn ich nur sterben könnte«, und ich sage unbefangen: »Aber Urli, du wirst doch hundert Jahre alt, das weißt du doch!«
Sie verscheucht den Satz mit einer reservierten Handbewegung, weist auf die spezielle, längliche Schatulle, in der sie die Zehnmarkscheine hortet. Ich hole ein Kuvert, beschrifte es mit meinem Namen, reiche es ihr, sie nimmt einen Schein, tut ihn hinein, befeuchtet das Kuvert, verschließt es.
Sie gibt mir das Kuvert, und dann darf ich mir noch eine Tafel Schokolade nehmen, und sie sagt: »Das war’s für heute.«
Die zehn Finger
»Du mußt mich halt erschlagen.«
Seit ihrem achtzigsten Geburtstag, als meine Mutter, meine Schwester und ich uns um sie versammelten, ist dies eine der stehenden Redewendungen meiner Großmutter. Manchmal fügt sie noch hinzu: »Wie alt bin ich jetzt? Du meine Güte! Andererseits, es lohnt sich nicht, daß du dich schuldig machst, der Tod kommt ja doch von selbst.«
Wenn es nach ihr ginge, hätte die ohnehin bald abgeschlossene Geschichte meiner Großmutter ein früheres, unkomplizierteres Ende gehabt. Immer wieder macht sie sich Vorwürfe, daß sie »Scherereien« bereite. »Herumhängen und Trübsal blasen, das war nie meine Art, vergiß das nicht!« sagt sie dann und berührt ihr Nähzeug.
Die Linie von der Geburt zum Tod wäre im Sinne meiner Großmutter eine Gerade, kein Zickzackweg wie jetzt. Der kürzeste Weg. Bei ihr jedoch scheint Gott der Allmächtige einen verschlungenen, am Ende gar ins Unendliche führenden Weg vorzuziehen.
»Bei meiner Schwiegermutter hätte es das nicht gegeben!«
Wir saßen um sie herum, an ihrem achtzigsten Geburtstag, berührten vorsichtig mit den Lippen ihre Rosentassen und führten kleine Tortenhappen mit der Kuchengabel zwischen die Zähne, kauten geräuschlos, lauschten den Geschichten vom Tod.
Die Schwiegermutter meiner Großmutter, die Generalin, war noch so gestorben, wie es sich gehört: »Sie war nicht eine Minute in ihrem Leben krank, hat sich hingelegt und ist in den Stiefeln gestorben, am 2. Februar 1925 mit neunzig Jahren, ganz schwarz geräuchert wie ein Ofenloch von den tausend Zigarren, die jeden Ersten gekauft wurden, das Stück für einen Pfennig.« Auch der Schwiegervater hatte einen leidlichen Abgang: »Der ist zwei Jahre zuvor über den Rinnstein gestolpert und hat sich nicht wieder erholt. Ein paar Tage bettlägerig war er vor dem Sterben, das schon, und die Generalin rief mich und sagte: ›Komm her, ich kann den Papa nicht allein umdrehen.‹ Und er hat sich geniert. ›Herrgott!‹, hat sie gesagt, ›brauchst dich doch nicht vor dem Käthla zu genieren, hast ja bloß noch a Rübla.‹ Ein so guter Mann, ein so schöner Mann!« rief dann meine Großmutter aus. »Und selbst im Tod noch so stattlich.«
Voller Bitterkeit hingegen klang es, als sie vom Tod ihrer Mutter sprach. Was sie für natürlich hält, ich jedoch für Kunst: mit dem Tod zu leben, beherrscht meine Großmutter wohl seit dem Sterben ihrer Mutter.
»Ich kann beruhigt am Grab meiner Eltern stehen«, betonte sie, »ich habe meine Mutter gepflegt bis zum letzten und ihr die Augen zugedrückt. Immer für die andern dasein, so hat sie uns erzogen; ich war noch keine dreißig, als meine Mutter starb, aber ich habe niemanden an sie herangelassen und Tag und Nacht bei ihr gelebt und geschlafen. Keine Krankenschwester hat sie berühren dürfen, keine Sekunde habe ich sie aus den Augen gelassen.«