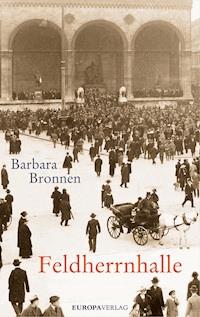3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Der Roman »Liebe um Liebe« der vielfach ausgezeichneten deutschen Schriftstellerin Barbara Bronnen ist die Geschichte einer Ehe, abwechselnd geschildert aus den Blickwinkeln der beiden Hauptfiguren Viktor und Irene Seide. Als der Journalist Viktor arbeitslos wird, gerät die Beziehung in eine tiefe Krise ... Eine bewegende Liebesgeschichte zwischen zwei reifen Menschen – zugleich Sozial- und Gesellschaftsroman. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Ähnliche
Barbara Bronnen
Liebe um Liebe
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
Für Dieter, meinen Mann
Alles Wissen ist vergeblich, wenn die Arbeit fehlt
VIKTOR
3. Juni 1987: Ich stand vor meinem Schrank und nahm die alte Lederjacke in die Hand. Seit meiner Kündigung hatte ich sie nicht mehr angehabt, und jetzt, da ich sie ansah und den Kuli- und Tintenspuren, den Flecken von Druckerschwärze im abgeschabten Leder mit den Fingern nachfuhr, erschien sie mir als Uniform des Journalisten. Ich hob die Jacke an die Nase, als röche ich in ihr die Idee dieses Berufs, meiner Arbeit schlechthin. Gespräche mit den Kollegen fielen mir ein, in denen von diesem Bekleidungsstück die Rede war, vom Kauf einer neuen Jacke, und mir war, als hätte hinter diesen Gesprächen immer etwas anderes gesteckt als bloße Äußerlichkeit.
Ich hielt sie im Arm, beinahe wiegte ich sie – wie gern hätte ich es wieder angezogen, dieses spröde Stück, das mir Bedeutung verliehen hatte. Die Jacke hatte mir Kontur gegeben, hatte das Beunruhigende, das mich nun zu überschwemmen drohte, eingedämmt und verborgen, mir als dicke, feste, tierische Haut gedient, die mich mit ihrem Reißverschluß, einem hohen Kragen und gespannter Schulterhärte eingebunden hatte: ein Futteral, das mein eigentliches Leben umschlossen und mir Sicherheit gegeben hatte.
Ein Futteral, das mir jetzt weder paßte noch anstand. Ich hängte die Jacke in den Schrank zurück.
Er hatte in den Tag gelebt, ohne an seinen Handlungen und Bewegungen teilzunehmen, und jetzt, da der Tag vorüber war, fühlte er ein Bedauern und ein Zögern wie jemand, der meint, etwas vergessen zu haben, ohne zu wissen, was es eigentlich war. Er stand an der Schwelle seines Zimmers und tastete in der Jackentasche nach Zigaretten.
Wozu, dachte er und zündete sich die letzte Zigarette des Tages an, wozu bin ich heute morgen überhaupt aufgestanden?
Seine Hände zitterten, er fühlte sich gleichzeitig abgespannt und überwach wie jeden Abend seit zwei Jahren. Er rückte seine Brille zurecht und trat vor den Spiegel. Eine Weile stand er da, mit an den Körper gepreßten Armen, unfähig, sich zu bewegen, im Kopf ein Gefühl von Ohnmacht und Schwindel. Bald würde er ein magerer, alter Mann sein, zu nichts mehr nütze. Ohne Arbeit altert man rascher. Die fünfzig Jahre waren ihm anzusehen.
Nach über zwei Jahrzehnten einigermaßen gesicherten Daseins war Ungewißheit in Viktors Leben getreten und hatte sich über alles gelegt wie feines Gewebe. Eine vage Beunruhigung hatte seine Bewegungen eingeschränkt und jeden Schritt verunsichert.
Er zog das Sakko aus, hielt es eine Weile abwesend in der Hand und hängte es in den Schrank. Warum hatte er es angezogen? Zu Hause brauchte er kein Sakko. Aus Gewohnheit griff er in die Tasche und fand eine alte Honoraranweisung.
Ohne Jacke fröstelte er und fühlte sich schutzlos, seine Arme waren nervös und hingen nutzlos herab. Der letzte Arbeitstag fiel ihm ein, seine Angst, die Kollegen bei der Zeitung könnten etwas von dem Gespräch mit dem Chefredakteur erfahren haben, die Demütigung, als er sich von den Kollegen im Feuilleton hatte verabschieden müssen. Zweiundzwanzig Jahre hatte er als Musikjournalist gearbeitet.
Jetzt war er arbeitslos. Er drückte die Zigarette aus, setzte sich an den Schreibtisch, schloß die Augen und lehnte sich zurück. Wenn man ihn früher nach seiner Arbeit fragte, hatte er gesagt: Wir machen die NZ. Wir. Er und die Kollegen. Er hatte sich als zugehörig empfunden, als einer von den fast zweitausend Angestellten.
Seit der Kündigung hatte er kaum mehr etwas gearbeitet. Seit zwei Jahren ohne Arbeit! Die Zeitspanne erschien ihm länger als sein ganzes Leben davor.
Früher hatte er sich manchmal sein Altsein vorgestellt: Wenn man nicht mehr arbeitet, wird man ganz ruhig, hatte er gedacht, man ist mit sich selbst im Einklang. Aber es war nicht so. Er war erschöpft und zerrissen, dazu traurig und mutlos obendrein. Er war voller Neid auf die Normalität aller, die Arbeit hatten.
Als Kind hatte er in einer Kleinstadt gelebt. Er war in die Schule gegangen, der Vater, der eines Herzleidens wegen im Krieg nicht eingezogen worden war, zur Arbeit. Viktor hatte gefragt: Was ist das, Arbeit? Der Vater hatte ihn daraufhin ins Gemeindehaus mitgenommen, hatte neben ihm im Zimmer gesessen und etwas auf ein Blatt Papier gekritzelt. Viktor hatte sich neben ihn gesetzt und dasselbe getan. Hie und da war ein Mann hereingekommen, der Vater hatte sich eine Weile mit ihm unterhalten und dann wieder seinen Akten zugewandt.
Seitdem glaubte er zu wissen, was Arbeit war. Überall arbeiteten Menschen in Zimmern auf diese ruhige, von kurzen Gesprächen unterbrochene Art, zogen Brote aus ihrer Aktentasche und gingen mittags in die nächste Wirtschaft zum Essen. Und am Wochenende traten sie fein gekleidet auf die Straße oder setzten sich ins Café, in die Sonne, tranken und lachten.
Es war ihm damals als eine große Kraft erschienen zu arbeiten. Er würde um Rat gefragt, von seiner Frau bewundert werden und Geld haben. Und er würde geeignete Mittel und Verfahren finden, um in jenes Zimmer zu gelangen, das dem Bürgermeister vorbehalten war: ein Zimmer mit schönem, weichem Teppich, einem Lederstuhl und dem großen Schreibtisch aus Mooreiche mit den vielen Fächern.
Als er zum erstenmal hörte, daß es so etwas wie Streik gibt, verstand er das nicht. In der Wochenschau hatte er Männer gesehen, die mit Plakaten durch die Straßen zogen und großen Lärm machten. Auch aus dem Radio waren laute Stimmen aufgebrachter Menschen gedrungen.
Seinen ersten Arbeitslosen hatte er gesehen, als der Vater mit ihm durch die Straßen gegangen war. Der Mann hatte mit gesenktem Kopf auf den Boden geblickt und war an ihnen vorbeigegangen. Den Gruß des Vaters hatte er nicht bemerkt. Der Vater hatte seinem Sohn erklärt, der Mann habe seine Arbeit verloren. Viktor war es vorgekommen, als hätte der Mann deshalb so versunken auf den Boden gestarrt, weil er seine Arbeit wiederfinden wollte.
Arbeit war etwas Gutes, Nützliches, das einen liebenswert und wichtig machte. Arbeitslosigkeit verdammte dazu, auf den Straßen nach Arbeit zu suchen.
Er setzte sich an den Schreibtisch und blätterte im Kalender. Noch vier Tage, dann war Sonntag. Er war ein Mensch, der nicht arbeitete, und dennoch wartete er auf die Sonntage. Nicht, daß er diesen Tag liebte, aber er sehnte sich nach einem Ausruhen vom beständigen Schmerz, der sich einstellte, wenn er die Menschen zur Arbeit gehen sah und die Frauen hinter den Fenstern beobachtete, die zu Hause geblieben waren und ihrer Hausarbeit nachgingen. Er spielte bei einer Komödie mit, um sich und den anderen vorzumachen, er nehme an ihrem normalen Rhythmus teil. Deshalb zog er es vor, an den Wochenenden spazierenzugehen wie die anderen auch; er hielt es wie seine Kollegen, die kleine Ausflüge an den Stadtrand machten oder ins Schwimmbad gingen.
Er blätterte in der Zeitung. Sein Auge blieb an dem Wort Tamilen haften, und unwillkürlich dachte er an Insekten. Er überlegte, woher das kam. Das Wort Termiten fiel ihm ein, vielleicht lag es daran. ›Nur‹ noch zwei Millionen Arbeitslose.
Früher, wenn er diese Zahlen in der Zeitung gelesen hatte, hatten sie ihn nicht berührt. Erst jetzt fühlte er, daß er die Realität dieser Meldungen, die die Kollegen von der NZ ins Blatt setzten, nicht begriffen hatte. Arbeitslose, das waren andere gewesen.
Er hatte weitergesprochen, weitergeschrieben, weitergeraucht. Das alles hatte es für ihn nicht gegeben.
Mit neunzehn verdiente er erstmals Geld. Bei Zeitungen oder Verlagen hatte er trotz eines Volontariats keine Arbeit gefunden, und um leben zu können, begann er mit einer Lehre als Koch; er hatte schon immer gern gekocht. Nach einem Monat in einem bürgerlichen Restaurant trug er seinen ersten Lohn in sein bescheidenes Untermietzimmer.
Damals hatte Arbeit für ihn bedeutet: früh aufstehen, sauber schneiden, am Feuer aufpassen und abschmecken. Er hatte begriffen, daß es zweierlei Arbeit gab: Wenn man früh zur Arbeit in die Küche ging, ohne den ganzen Tag auch nur ein schmales Stück Himmel zu sehen – der tropfende Schweiß, die stickige Luft, der beständige Küchengeruch in den Haaren, die schmerzenden Hände, der gebückte Rücken – das war etwas anderes, als in einem ordentlichen Büro zu sitzen und Schriftstücke aufzusetzen, Gäste zu empfangen und mit ihnen zu diskutieren.
Ein bitterer Geschmack hatte sich erstmals dem Wort Arbeit beigemischt. Bald nachdem er im Restaurant angefangen hatte, erlebte er seine erste große Liebe. Er war glücklich gewesen, eigenes Geld zu besitzen und ein Zimmer zu haben. Er hatte das Bittere vergessen und sich tagsüber auf den Abend gefreut.
Er zog sich aus. Ein langer Tag, an dem er immer wieder die Wohnung abgeschritten hatte, war vorüber. Ein Knopf war von seinem Hemd abgesprungen. Mit gesenktem Kopf suchte er den Boden nach dem Knopf ab.
IRENE
5. März 1980: Ich säuberte das Bad. Im Waschbecken fand ich ein feuchtes Knäuel von Viktors graumeliertem Haar, hielt es eine Weile nachdenklich auf der Handfläche, betrachtete es ohne Hast, drehte es zwischen den Fingern und legte es schließlich liebevoll auf die Kehrichtschaufel.
Sie zögerte es hinaus, ins Bett zu gehen. Sie stand im Bad und war sich bewußt, daß sie Viktor schon seit einiger Zeit auswich und vor sich selbst fortlief. Sie fühlte es in den Kniekehlen, die Beine zitterten vor Anstrengung. Ein unorganischer Schmerz, ein Schwellengefühl, ein Schwindel und ein Schaudern vor dem Schritt über diese Schwelle hinweg.
Sie hielt das Gesicht näher an den Spiegel heran und musterte es Partie für Partie. Ihre Augen waren anders, alles war auf unerwartete Weise anders und merkwürdig geworden. Bei ihrem Anblick fühlte sie eine seltsame Befangenheit. Ihr war, als sei die Unmittelbarkeit im Umgang mit sich selbst gestört; eine unerwartete Zurückhaltung war eingetreten, ein fast körperlicher Vorbehalt. Wenn sie früher auf die Straße getreten war und ihre Augen herumwandern ließ, hatte sie es vergnügt getan, leichthin, flink, im Einverständnis mit sich selbst. Es hatte ihr Freude gemacht, die Menge zu zerteilen, in sie einzugehen und dennoch aufzufallen, Blicke zu erhaschen – die Gehsteige voller Menschen, die Frische des Morgens, die Wärme.
Sie stand aufrecht und mußte sich für einen Augenblick am Waschbecken festhalten, ein Schwindelgefühl hatte sie überkommen. Sie hatte für einen Augenblick Viktor dasitzen sehen, an seinem Schreibtisch, untätig, und wie immer, wenn sie daran dachte, kam diese traurige Stimmung über sie und hüllte sie völlig ein. Wie entfernt sie voneinander waren am Ende des Tages, an dem jeder sein Leben gelebt hatte. Sie hatte gearbeitet, Viktor hatte dagesessen oder war durch die Wohnung gegangen. Sie war nicht bereit, das Leben mit ihm zu teilen, so wie es jetzt war, und immer unmöglicher erschien es ihr, am Ende eines solchen Tages zueinanderzufinden.
Und wie es zwischen ihnen stand, so war es auch nach außen. Es kam ihr vor, als wollte sie nichts an sich heranlassen. Die Blicke der Männer, die an ihr vorübergingen, verödeten. Sie hielt sie sich vom Leib – wie Viktor.
Warte ab, hatte sie sich anfangs gesagt, eines Tages kehrst du zu dir selbst zurück. Doch entließ sie sich nicht mehr aus dem zurückhaltenden Griff, fast schien sie sich zu schämen. Sie verriet sich.
Sie fühlte, wie ein pflichtbewußtes Zerren ihres Innern sie zu Viktor zurückzog, und schämte sich ihres Mangels an Teilnahme. Sie empfand die Verhärtung ihres Widerstandes, den sie an sich entdeckt hatte, seit Viktor zu Hause herumsaß. Seine nervöse Untätigkeit zog sie in eine gespannte Atmosphäre. Wenn sie aufrichtig war, empfand sie von Tag zu Tag eine immer wildere Auflehnung und Empörung.
Was war dieses tief animalische Schaudern vor seiner Regungslosigkeit? Ein Mann ohne Arbeit war wie eine Schildkröte ohne Panzer, weich und nackt und verwundbar.
Sie wandte sich den Rücken zu und zog sich aus.
14. November 1972: Da lag Viktor, eine Hand auf meinem Geschlecht, und war eingeschlafen, und ich strich über seine Hand und fühlte: Das bist du. Reine Empfindung war es, und ich ahnte die Möglichkeiten des Liebens, die in mir lagen, fühlte das Leben.
Ich lag da, bis er sich im Schlaf leicht seitwärts wendete und mich freigab. Behutsam stand ich auf, als fürchtete ich, etwas zwischen uns zu zerreißen; auf Zehenspitzen ging ich ins Bad, als fürchtete ich, etwas zu verschütten.
VIKTOR
Er blickte auf den abgewandten Körper seiner Frau und ihren im Kissen vergrabenen dunklen Lockenkopf. Seit einiger Zeit kehrte sie ihm den Rücken zu, wenn sie schlief.
Er rollte sich zusammen wie ein Säugling, um den Schmerz in seinem Magen zu beschwichtigen. Er spürte einen kaum zu zügelnden Zorn. Mit Fünfzig lebendig begraben. Abgemeldet. Isoliert. Ihm machte diese Lähmung angst; manchmal konnte er sich nicht von der Stelle rühren. Dieses Gefühl nahm ihm den Atem. Er setzte Belag an; die Untätigkeit war wie ein Befall mit Schimmel.
Er berührte leicht das Haar seiner Frau und zog die Hand gleich wieder zurück. An ihrer Seite fühlte er sich noch älter. Zu spüren, wie sie ihren Schritt verlangsamen mußte, wenn sie nebeneinander gingen, machte ihn rasend. Noch älter aber fühlte er sich in Gegenwart seines Sohnes.
Seit seinem dreizehnten Geburtstag veränderte sich Gabriel spürbar. Immer häufiger, so schien es ihm, brachte er ihm duldsame Achtung entgegen, als wäre er sein Großvater. Die beiden behandelten ihn nachsichtig, verdammt, ja, das taten sie. Sie nahmen sich heraus, ihn zu beschwichtigen, weil er alt war und ohne Arbeit.
Ohne seine Familie fühlte er sich nicht so alt. Zitternd vor Unruhe verspürte er Groll und Auflehnung. Wie sollte er nicht Schimmel ansetzen bei diesem täglichen Einerlei! Mit dem Aufstehen begann für ihn ein unwürdiges Leben: vorsichtig herumschleichen, im Zimmer hocken, durch die Straßen gehen, heimkehren, warten, stets die gleichen Worte und Rücksichten üben – diese miese Duldsamkeit, die er für sie und das Kind aufbringen mußte.
Es gab Tage, an denen er wütend und sehnsüchtig an Olga, die Fotografin, dachte. Er hatte sie einmal sehr begehrt. Warum nur war er ihr immer aus dem Weg gegangen?
Sogleich schob er seinen Körper näher an Irene heran. Er sollte zärtlicher zu ihr sein. Und war sie nicht jünger? Vier Jahre, das war viel. Er verspürte einen Anflug von Begierde. Jäh wurde dieser Wunsch vom Gedanken an ein Versagen erstickt.
Ohne Arbeit. Was kannst du den Frauen schon bieten. Die spüren das. Riechen das. Die Erfolglosigkeit ist wie eine Hecke, die dich umschließt. Niemand ruft an. Die eigene Frau zieht sich zurück. Der Tag ist nicht fern, da wird sie mich betrügen.
Er litt unter seiner Einsamkeit. Eine zornige, rücksichtslose Ungeduld packte ihn angesichts des gleichgültigen Rückens seiner Frau und der Dumpfheit des Raumes. Wie muffig und schimmlig es hier roch, was für eine schwüle Luft hier herrschte! Voll Wehmut dachte er an den Geruch, der früher das Zimmer durchzogen hatte, den herben, würzigen Geruch von Schweiß und Liebe.
Er blickte auf Irenes Rücken, der ihn zurückwies, und ihn überkam die Hartnäckigkeit eines alten Sportlers: Er rückte näher an sie heran. Seine Sehnsucht vermengte sich mit Begierde, seine Angst vor der Zukunft mit einer verzweifelten, wütenden Sinnlichkeit, einem Aufschrei, einem Protest gegen seine ihn niederziehenden Gedanken.
Als vernehme sie diesen Aufruf, stellte sich Irene unmerklich auf Viktors Verlangen ein und überließ sich seinen vertrauten Berührungen. Die Bejahung im leichten Wenden und Wiegen ihres Körpers spürend, schlüpfte er zu ihr unter die Decke und umschlang sie.
Zornig nahm er sie. Zähneknirschend stieß er die Angst von sich, als könne er sie so aus seinem Leben vertreiben, und trieb sie immer tiefer in Irene hinein.
Als sie voneinander abließen, stand am Himmel ein kleiner, blasser Mond.
IRENE
Sie lauschte auf Viktors Atem. Die Zeit schien stillzustehen, und trotz seines Atmens herrschte im Zimmer eine tödliche Stille. Es war die Stille eines abgeschlossenen, einsamen Ortes. Vorsichtig erhob sie sich, als könne eine heftige Bewegung alles aus dem Gleichgewicht bringen.
Immer, wenn sie in Gabriels Zimmer ging, fühlte sie eine beruhigende Wärme, die sich in ihr ausbreitete. Eine lindernde Strömung ging von Gabriel aus, von seinem sanften Atem, und aus seinem leicht geöffneten Mund schien ein feiner Nebel hervorzugleiten, der sie einhüllte.
Draußen war es dämmrig. Sie entzündete eine Kerze, nahm eine Decke und kauerte sich zu seinen Füßen ans Bettende.
Gabriel schlief fest. Die Bettdecke hatte er zur Hälfte abgestreift. Das Licht der Straßenlampen kam durch das geöffnete Fenster, und eine helle Garbe fiel auf seine Schultern. Mit müden Augen, müde von der durchwachten Nacht, sah sie ihn an und horchte auf seine Atemzüge. Das blonde Haar war über der Stirn feucht und formte sich zu einer Locke. Im spukhaften, schwankenden Licht der Kerze erschien auf seiner Stirn und den bernsteinfarbenen Wangen ein nachdenklicher Ausdruck. Seine Brauen hoben sich, und er stieß einen rauhen Seufzer aus.
Sie betrachtete den bloßen Oberkörper. Er war muskulös und leicht gebräunt; die Adern bildeten über der Brust ein feines Netz. Das Durchsichtige, Zarte und zugleich Kräftige berührte sie.
Sie spürte den Kopfschmerz, wühlend und bohrend, und hielt sich still, ganz still, um die Ängste ja nicht aufzurühren; ihr schien, als hockten sie in ihrem Kopf, bereit, loszuspringen.
Was führte sie an Gabriels Bett? War es recht, einen Schlafenden so lange zu betrachten? Doch sie konnte sich von seinem Anblick nicht lösen und beobachtete, wie er sich zur Seite wandte und die Rechte zur Faust ballte, als wolle er um sich schlagen.
Sie beugte sich über den Kopf des Jungen und sog seinen Geruch ein. Er duftete nach Sonne und Gesundheit, nach Milch. Milch! Sie mußte lächeln. Trotz ihres Verlangens, die helle, wohlriechende Stirn zu küssen, verweilte sie in der gleichen Haltung, ohne sich zu nähern.
Gabriels Brust bewegte sich heftiger. Sie blickte in den kleinen Spiegel über dem Bett. Immer stärker schmerzten die Schläge in ihrem Kopf. Ihre Augen waren müde, die Züge verkrampft. Rasch wandte sie den Blick von ihrem Gesicht ab und wieder Gabriel zu, dem goldenen Schimmer auf seinen Wangen, diesem jungenhaften Schmelz. Die Farbe der Jugend. Wie jung er aussah, wie unverbraucht, was für ein wunderbarer Glanz! Hier bleiben können, in dieser milden, angstfreien Welt!
Sie verspürte einen plötzlichen, ziehenden Schmerz im Herzen. Die Offenheit des Zimmers, der Rhythmus, die Grazie und die Geschäftigkeit der Jugend, die es erfüllten, verursachten ihr Schmerz, den Schmerz der Erinnerung und der Revolte. Sie fühlte, wie sich alles in ihr gegen ihre Abgeschlossenheit und Isoliertheit aufbäumte. Wäre es doch möglich, diesen Glanz in sich selbst aufs neue zu erwecken, diese Intensität des Lebens, der Lust! Mit den Fingerspitzen fuhr sie sich über Stirn und Wangen. Ihre Haut war gespannt und trocken.
Gabriel lächelte im Schlaf, schmatzte und seufzte. Seine Zunge glitt über die Oberlippe. Er legte einen Fuß auf die Decke und winkelte ihn an. Sein nacktes Bein und sein Gesäß waren glatt und leicht gebräunt. Sie fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen.
Was war eigentlich los? So alt war sie nun wieder nicht, daß so ein Bengel sie dermaßen beunruhigen konnte. Nein, es war nichts als die naive Reaktion auf ein schönes junges Geschöpf. Das Leben in seiner ursprünglichen, duftenden Gestalt, die Idee vom Leben, die sie sich einst gemacht hatte, rührte sie ans Herz. Kinder machten, daß man dieses Bild nie vergaß. Das Bild der Jugend: Seltsam, als sie noch jung war, gerade noch, hatte sie es nicht gesehen.
Der Gedanke erschreckte sie. Märchen fielen ihr ein, Geschichten von Menschen, die sich ewige Jugend kaufen wollten, die ihre Seele dem Teufel verschrieben, ihre Frauen, Kinder, Männer dahingaben, wenn sie nur dies erringen konnten: ewige Jugend, andauernde Lust.
Ihr Blick haftete immer noch auf dem entblößten Hinterteil, und unwillkürlich dachte sie an Viktors müde gewordenes Fleisch, nicht ohne gleichzeitig diesen Gedanken abzuweisen. Sie fühlte sich übel, und in ihrem Magen wuchsen abwechselnd Völlegefühl und schmerzhafte Leere – ein Hunger. Auf der Stirn fühlte sie Schweißtropfen. Vorsichtig nahm sie den Zipfel der Bettdecke und wischte sie fort.
Wie würde es sein, ohne den Akt der Liebe zu leben? Der Gedanke vertiefte ihre Bestürzung. Sie konnte es sich nicht vorstellen.
Ihr Unbehagen wurde unerträglich, als sie entdeckte, daß sie immer noch auf die Hinterbacken starrte. Es war zu albern. Da saß eine fast Fünfzigjährige mit Falten im Gesicht und einem fleckigen Dekolleté und starrte mit knurrendem Magen einen Bengel an wie eine Erscheinung.
Sie floh aus dem Zimmer, rannte in die Toilette und würgte. Was habe ich nur, dachte sie, mein Gott, mir ist schlecht! Endlich erbrach sie sich. Schmerzhaft verließen die unverdaulichen schlimmen Brocken ihren Körper. Als sie in ihr Bett zurückkehrte und sich neben Viktor niederlegte, fühlte sie, daß der Hunger stärker geworden war; unstillbar und nagend fraß er an ihren Eingeweiden. Ermattet und resigniert versank sie im Bett.
Als sie einschlief, verblaßte am Himmel der kleine, bleiche Mond.
2. Februar 1983: Ich kam von einem Treffen mit dem Redakteur, der meine Sendungen betreute. Viktor war seit zwei Monaten zu Hause. Ich rannte. Zu Hause war Viktor, dort war Gabriel, sie warteten mit dem Essen auf mich.
Ich lief an den Geschäften vorbei und machte nur kurz vor einem Blumenladen halt, um für Viktor eine Rose zu kaufen.
Mir war wohl und warm. Als ich die Treppe hinaufstieg, dachte ich: Es geht mir gut. Ich freue mich auf zu Hause.
Wir aßen. Weißt du was? fragte Viktor. Nein, sagte ich. Weißt du den neuesten Witz? fragte Gabriel und erzählte.
In meinem Zimmer saß Viktor und wartete mit dem Wein. Gabriel kam frisch gebadet, mit rosa Wangen, und küßte uns: Gute Nacht! Er hauchte mich an: die Zähne waren geputzt. Kitzle mich, du auch. Feuchte Küsse, Glück.
Viktor und ich saßen auf dem Sofa. Er zog mich in seine Arme. Er schlief bald ein. Leise stand ich auf, ging durch die Zimmer, ordnete ein wenig dies und das und öffnete die Fenster. Meine zwei schliefen.
Viktor, wir schaffen es, keine Angst. Wir gehören zusammen.
War ich nicht glücklich?
VIKTOR
Alles begann jeden Morgen von neuem. Er lag im Bett, und als erstes ging ihm auf, was geschehen war. Sogleich empfand er eine Unbehaglichkeit und Verspanntheit im Rücken und ein Rauschen im Kopf, wenn er begann, seine Situation zu durchdenken. ›Aufstehen‹ bedeutete für ihn ein schwindelerregendes Durcheinander von Befehlen, die einander zunichte machten, begleitet von Muskelkrämpfen und einem nervösen Beinezittern. Ob er aufstand oder nicht, war für niemanden auf der Welt mehr wesentlich – außer für Irene und Gabriel.
Die Welt draußen war geschäftig und laut, und nichts ersehnte er mehr, als in dieses Lärmen wieder hineingezogen zu werden. Er lag im Halbdunkel wie gelähmt, um sich tote Zeit, die ihn einschnürte. Zeit als lastende Masse hatte er früher gekannt; jetzt preßte sie ihm die Lungen zusammen. Der Augenblick kam immer näher, in dem er sich von den trüben, bohrenden Gedanken befreien mußte.
Das Aufstehen gelang ihm nur mit einer Überrumpelung seiner selbst. Er empfand eine gedankenlose Schwärze, die er ausnützte, um seine Zweifel zum Verstummen zu bringen; seine Muskeln krampften sich zusammen, und ehe er wußte, was er tat, stand er schon auf dem Boden. Jetzt brauchte er nur noch ins Bad zu gehen und sich zu waschen und anzuziehen, der Tag konnte beginnen. Mit einer gewissen Erleichterung verließ er Irenes Zimmer, wusch sich, machte sich in der Küche einen Kaffee, ging in sein Zimmer, setzte sich an den Schreibtisch und stand gleich wieder auf. Der Schreibtisch war für ihn ein Arbeitsplatz. Was sollte er da, wenn er nicht arbeitete?
Wie jeden Morgen erschien ihm die Wohnung fremd und beängstigend still; unbehaglich ging er herum, als wäre er fremd hier.
Was hatte er hier verloren?
Er war es nicht gewohnt, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Er war kein Stubenhocker. Wütend trat er gegen ein Stuhlbein. Seine Körperhaltung drückte Steifheit und Ablehnung aus, als er sich wieder setzte. Er blickte auf die Uhr. Um diese Zeit hatte er im Verlag Kaffee getrunken. Selbst das Frühstück zu Hause einzunehmen, war er nicht gewohnt. Er vermißte den Stoß von aktuellen Zeitungen, die er im Verlag jeden Morgen gelesen hatte.
Er legte die Handflächen vors Gesicht. Sie rochen zu sauber, früher hatten sie immer ein wenig nach Druckerschwärze gerochen. Druckerschwärze war ein männlicher Geruch; Frauen rochen nie nach Druckerschwärze. Der Geruch hatte besagt, daß er arbeitete. Jetzt war er weit weg vom Umgang mit frisch bedrucktem Papier, weit weg von der mysteriösen Macht der Worte.
Verdrossen blätterte er in der Zeitung. Gewissenhaft, wie unter Zwang, las er jede Überschrift, dann legte er das Blatt beiseite. Im ersten halben Jahr der Arbeitslosigkeit hatte er die Zeitung Wort für Wort gelesen, als könne er so verhindern, über sich nachzudenken. Jetzt wollte er von nichts mehr etwas wissen; vielleicht war er schon gar nicht mehr fähig, wahrzunehmen, was draußen vorging.
Nach seiner Kündigung hatte er erst eine schnoddrige Auflehnung empfunden, dann überkam ihn eine tiefe Gleichgültigkeit. Ich komme auch so durch, hatte er sich gesagt. Endlich muß ich nicht mehr in diesen Saftladen. Doch allmählich war diese Stimmung dem Neid auf die Kollegen gewichen, und das Gefühl des Ausgestoßenseins hatte zugenommen. Wieso ausgerechnet er und nicht Biberti?
Zu Anfang hatte er diese Gefühle noch beschwichtigen können. Ein halbes Jahr später war ihm immer mehr ins Bewußtsein gesickert, daß er nicht mehr arbeitete, und er spürte, wie unaufmerksam er wurde, wenn er frühere Kollegen traf und sie von ihrer Arbeit sprachen; er griff nach einer Illustrierten; an ihren Gesprächen nicht mehr interessiert, wich er ihnen schließlich aus. Er empfand, daß sie ihrer Arbeit eine übertriebene Wichtigkeit beimaßen, ja, sie taten so, als seien sie durch ihre Arbeit erschaffen worden. Die teilnahmsvollen und mitleidigen Blicke ertrug er nicht mehr, nicht mehr Olgas forschenden Blick, Bibertis aufgesetzte Lustigkeit.
Das Gefühl des Ausgestoßenseins war immer tiefer in sein Innerstes vorgedrungen. Das Leben war belanglos, ohne Substanz, und mit dem Sinn der Arbeit war es nicht weit her.
Damals hatten seine schrecklichen Träume begonnen. Für gewöhnlich träumte er vom Schreiben, träumte die Träume schreibend, aber nun träumte er, daß er Bittbriefe schrieb.
Was hatte sich Irene eigentlich damals für Gedanken gemacht?
Er erinnerte sich an den Tag, als er es ihr berichtete. Die Nachricht mußte sie wie ein Blitz getroffen haben, denn er hatte sonst von seinen Schwierigkeiten wenig erzählt. Die Querelen mit dem Chef, die Umstrukturierung der Abteilung, das neue ›christliche‹ Programm: Davon hatte er gesprochen, doch nie erwähnt, wie schwankend die eigene Position geworden war.
Nach zwei Tagen sagte sie: »Warum gerade du?« Sie lächelte ihn dabei an und umarmte ihn. Sie hielt flammende Reden und machte den Verlag herunter, klagte ihn an. »Die haben dich ganz schön ausgenutzt«, sagte sie. Nachts drückte sie ihn ganz fest an sich und sagte, daß sie ihn liebe. Ihr Mitgefühl hatte ihn gestärkt, er hatte sich verstanden gefühlt. Ihr Verhältnis war ihm inniger erschienen denn je. Immer wieder wollte sie wissen, wie er sich fühle.
Das war ein Jahr ganz gut gegangen. Dann wurde seine Situation Alltag. Alles wurde quälend und belastend. Auch Irene und Gabriel wurden von seiner Stimmung angesteckt. Der Junge entwickelte eine hämische und unzufriedene Art, zog sich zurück und schien nur noch bei Irene aufzutauen.
Was hatte sie empfunden?
Er erinnerte sich ihres forschenden Gesichtsausdrucks und wie sie ihn beobachtet hatte, als hätte sie eine verborgene Schuld ans Tageslicht zerren wollen. Ihr Gesicht bleich, dunkle Ringe unter den Augen, gerötete Lider, gefaßtes Lächeln.
Seine Hilflosigkeit, als sie nachts das erstemal heftig geweint hatte, fiel ihm ein. Rückhaltlos, geschüttelt von Schluchzen, hatte sie sich völlig ihrem Schmerz ergeben. Er war neben ihr gelegen und hatte wütend die Luft durch die Zähne gestoßen. Was ist, hatte er immer wieder gefragt, was ist? Doch Irene hatte nicht geantwortet und nur noch heftiger geweint. Er fühlte, daß sie ihn wieder einmal vagen Schuldgefühlen überließ.
Eine schwere Krise erfaßte seine gesamte Existenz.
Er erinnerte sich, wie er vor ihr gestanden hatte, im Bademantel, den Spüllappen in der Hand. »Ich glaube, daß mich noch etwas anderes beschäftigt. Es hat mit meinem gesamten Leben zu tun. Ich habe eine Sehnsucht nach etwas, das ich nicht genau benennen kann. Ich denke oft, ich wäre besser daran, wenn ich eine Philosophie hätte, einen Glauben.«
Er hatte sie angesehen.
»Ich glaube an dich«, hatte Irene gesagt.
IRENE
4. Juni 1987: Ich massierte Creme ein und starrte unverwandt in mein Gesicht im Spiegel. Ich wußte, daß ich ein Bild suchte, das Zeichen, daß ich noch der Welt des Geschlechts zugehörte. Es mußte es noch geben, dieses andere im Gesicht, das dahinter lag, aber ich entdeckte es nicht.
Mein Mund hatte sich geschlossen wie der einer alten Frau.
Wenn sie so im verdunkelten Zimmer vor dem Monitor saß und ihren letzten Trickfilm ablaufen ließ, genoß sie die Atmosphäre der Schwärze und Stille, in der ihre Arbeit das einzige Leben war. Schließlich war ein Trickfilm nichts anderes als Bewegung in einem Raum, eine Metamorphose, geboren aus dem methodischen Aufschlüsseln von Bewegungsabläufen. Ihre Freundin, die Cutterin Michaela, die mit ihr die Akademie besucht und später drei Jahre in den Disney-Studios gelernt hatte, pflegte zu sagen, Irene Seides Leben sei in ihren Filmen.
Irene hielt den Film an und machte auf dem Fahrplan eine Notiz für Michaela. An dieser Stelle mußte eine Phase um eine Sekunde verkürzt werden. Es war eine Kinderserie über ›Othello‹, einen ungeschickten Hasen mit traurigen Augen, riesigen Ohren und einer irgendwie auffallend großen Hinterpartie, mit der er an jedem Ort kunstvolle Wasserzeichen zu hinterlassen vermochte. Nur einer konnte sie entziffern: eine seltsame Larve, nackt und fleischfarben, die panisch nach einem Versteck suchte, um sich endlich verpuppen zu können.
In den achtzehn Jahren ihrer Arbeit hatte sie die verschiedensten Formen des Trickfilms erprobt: Collagen, Silhouettenfilme und den Photophasentrick. Früher, bevor sie ihr eigenes Studio aufbaute, hatte sie als Trickzeichnerin in einem Filmstudio die Vorspanne gemacht; dann hatte sie eine Villa gemietet und vier teure Zeichner beschäftigt, die ihre eigenen Animationen ausführten. Die Kosten waren jedoch zu hoch gewesen, und sie hatte aus ihrem Defizit den Schluß gezogen, es wäre besser, als selbständige Animatorin allein zu arbeiten. Sie blieb beim Legetrick.
Ein Kompromiß. Der Legetrick war einfacher und ersparte Arbeitsvorgänge. Durch einfaches Verrücken oder Verlegen wurde animiert und die Bewegung direkt unter der Kamera erzeugt. Anstatt wie zuvor auf Folien die gesamten Bewegungsabläufe der Figuren vorzufertigen – pro Sekunde bedeutete das fünfundzwanzig gezeichnete Bilder –, konnte sie sich nun mit einem Vorrat verschiedener Münder, Augen und Gliedmaßen die Figuren in jeder Bewegung zurechtlegen, ehe sie sie mit der Kamera auf belichtetes Material bannte. So gelang es ihr nun, pro Monat eine Folge einer Serie fertigzustellen.
Ein langes Jahr hatte sie die Redaktionen mit Ideen und Entwürfen, mit Storyboards und Pinselzeichnungen bombardiert – mit lila Zauberwesen, bratenfarbenen Hökerkühen und rosapfotigen Maulwürfen.