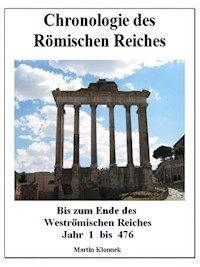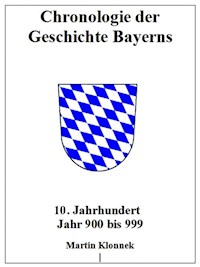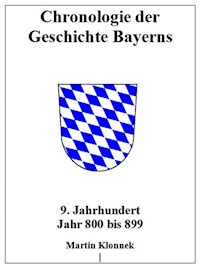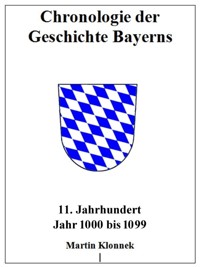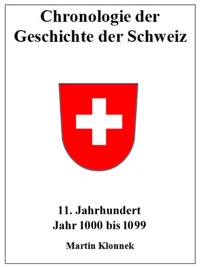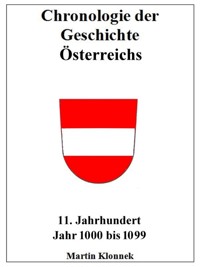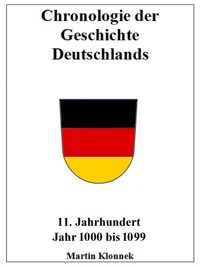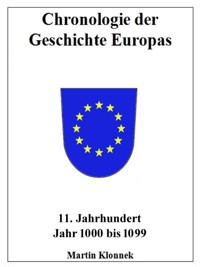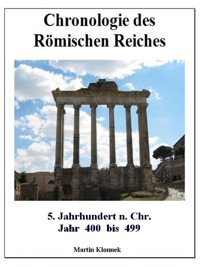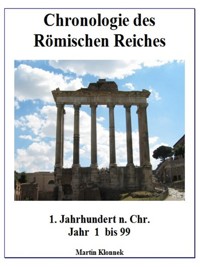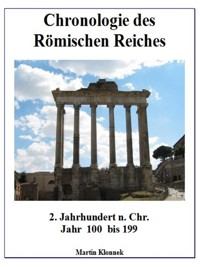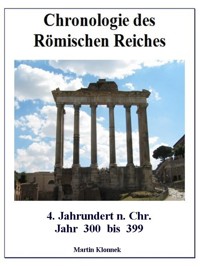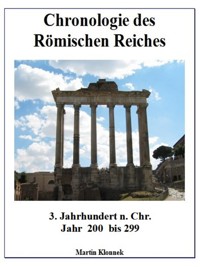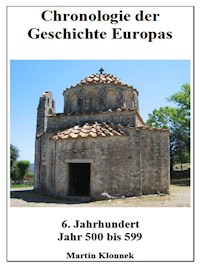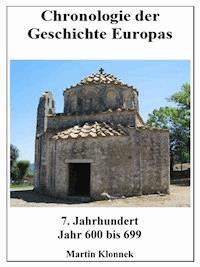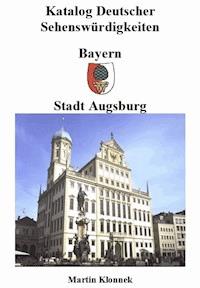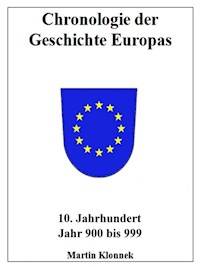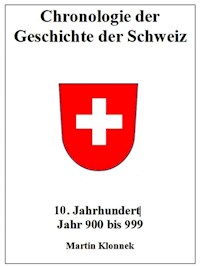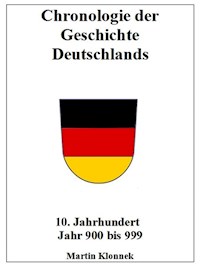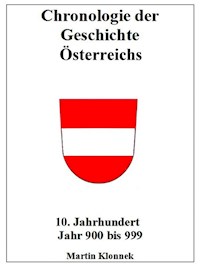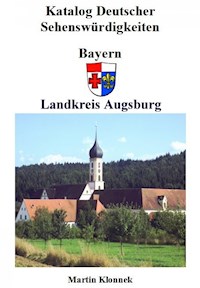
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Sehenswürdigkeiten des Landkreises Augsburg. Detaillierte Beschreibung aller Sehenswürdigkeiten des Landkreises Augsburg mit Fotos sowie Vorschläge für Fahrradtouren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
Katalog Deutscher Sehenswürdigkeit
Bayern, Landkreis Augsburg
Martin Klonnek
Vers. 1.0 –II/2015
Copyright: © 2015 Martin Klonnek
Inhaltsverzeichnis:
Wissenswertes über den Landkreis Augsburg
Geschichte des Landkreises Augsburg
Plan des Landkreises Augsburg
St. Felizitas, Bobingen
Wallfahrtskirche Unsere Liebe Frau, Bobingen
Königstherme, Königsbrunn
St. Vitus, Oberottmarshausen
St. Martin, Kleinaitingen
St. Ulrich und Afra, Graben
Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frauen Hilf, Klosterlechfeld
Schloss Untermeitingen
St. Stephan, Untermeitingen
Museum Schwabmünchen
Kapelle Zu Unserer Lieben Frau, Schwabmünchen
St. Nikolaus, Großaitingen
St. Georg, Wehringen
St. Gallus, Langerringen
St. Martin, Schwabmühlhausen
St. Johannes Baptist, Gennach
St. Silvester, Hiltenfingen
Kloster Oberschönenfeld
St. Laurentius, Reinhartshausen
Wallfahrtskirche Mater Dolorosa, Klimmach
St. Radegundis, Waldberg
St. Martin, Döpshofen
St. Michael, Fischach
St. Wolfgang, Mickhausen
St. Johannes Evangelist, Mittelneufnach
St. Alban, Walkertshofen
St. Martin, Langenneufnach
Schloss Elmischwang, Wollmetshofen
St. Nikolaus, Kutzenhausen
St. Laurentius, Agawang
St. Gallus, Deubach
St. Martin, Willishausen
St. Bartholomäus, Diedorf
St. Adelgundis, Anhausen
St. Peter und Paul, Wollishausen
St. Johannes Baptist, Dietkirch
St. Katharina, Ettelried
St. Martin, Gabelbach
St. Vitus, Steinekirch
Burgruine Wolfsberg, Steinekirch
Burgstall Zusameck, Dinkelscherben
St. Anna, Dinkelscherben
St. Stephan, Häder
Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt, Neuhäder
St. Vitus, Mödishofen
St. Pankratius, Aretsried
St. Maria Magdalena, Horgauergreut
St. Martin, Horgau
St. Maria Immaculata, Zusmarshausen
St. Michael, Wörleschwang
St. Georg, Unterschöneberg
Wallfahrtskirche St. Michael, Violau
St. Leonhard, Baiershofen
St. Vitus, Altenmünster
St. Leonhard, Reutern
St. Mariä Verkündigung, Welden
St. Thekla, Welden
St. Johannes der Täufer, Adelsried
St. Andreas, Biburg
St. Nikolaus von Tolentino, Schlipsheim
St. Stephanus, Hainhofen
Schloss Hainhofen
Schloss Aystetten
Schloss Hammel
Mariä Himmelfahrt, Täfertingen
St. Maria von Loreto, Westheim
Bismarckturm, Steppach
St. Nikolaus, Stadtbergen
St. Oswald, Leitershofen
St. Martin, Batzenhofen
St. Martin und Schloss Gablingen
St. Georg, Lützelburg
St. Vitus, Langweid
Kapelle Schmerzhafte Muttergottes, Eggelhof
Ballonmuseum, Gersthofen
St. Clemens, Herbertshofen
Wallfahrtskirche St. Jakobus der Ältere, Biberbach
Burg Markt
St. Laurentius, Ehingen
Wallfahrtskirche Unsere Liebe Frau, Ehingen
Kloster Holzen
St. Georg, Westendorf
Ehem. Benediktinerkloster Thierhaupten
Tourenübersicht
Radtour - „Durch das Lechfeld“
Radtour - „Durch die Wertachau“
Radtour - „Durch den Naturpark Augsburg-Westliche Wälder“
Radtour - „Staudenrundfahrt“
Radtour - „Rund um Gessertshausen“
Radtour - „Durch die Reischenau“
Radtour - „Durch den Holzwinkel“
Radtour - „Durch das südliche Schmuttertal“
Radtour - „Durch das nördliche Schmuttertal“
Radtour - „Meitingen-Holzen-Thierhaupten“
Wissenswertes über den Landkreis Augsburg
Der Landkreis Augsburg liegt im östlichen Mittelschwaben und ist Bindeglied zwischen Altbayern und Schwaben.
Mit einer Fläche von 1.071 km² gehört er zu den größten bayerischen Landkreisen.
Er erstreckt sich von West nach Ost, von Zusmarshausen bis Augsburg in einer Länge von ca. 28 km, von Ellgau im Norden bis Schwabmühlhausen im Süden mißt er ca. 60 km.
Verkehrstechnisch günstig führen die Bundesautobahn 8 München-Stuttgart sowie die Bundesstraßen 2, 10, 17 und 300 quer durch den Landkreis.
Er bildet zusammen mit der Stadt Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg den drittgrößten bayerischen Wirtschaftsraum.
Die industriell geprägten Orte sind Meitingen und Gersthofen im Norden; Neusäß, Stadtbergen im Osten und Königsbrunn, Bobingen und Schwabmünchen im Süden des Landkreises.
Daneben nimmt die Forst- und Landwirtschaft einen wichtigen Stellenwert ein.
Naturräumlich zählt der Landkreis zum schwäbisch-bayerischen Alpenvorland.
Es ist eine hügelige und waldreiche Landschaft, durchzogen von den Flüssen Zusam, Neufnach und Laugna im Westen und Singold, Schmutter, Wertach und Lech im Osten.
Zu den markanten Landschaften zählen die flachen, waldarmen und vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Gebiete "Lechfeld" im Südosten, begrenzt durch die Flüsse Wertach und Lech sowie die "Reischenau" bei Dinkelscherben im Westen.
Sehr waldreich und hügelig ist dagegen der "Holzwinkel" um Welden sowie die "Stauden", ein im Mittelalter fast völlig abgeholztes Gebiet, zwischen Mittelneufnach und Gessertshausen im Südwesten.
Fast 90 Prozent der heutigen Fläche bestehen aus Wald und Wiesen,
67.000 Hektar stehen unter Natur- oder Landschaftsschutz.
Das größte Stück mit fast 60 Prozent der Kreisfläche gehört zum Naturpark "Augsburg-Westliche Wälder", einem Naherholungsgebiet ersten Ranges, der auf einer Vielzahl von markierten Wegen zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet werden kann.
Betreut wird der Naturpark vom Verein "Naturpark Augsburg-Westliche Wälder e.V.", der im Schwäbischen Volkskundemuseum in Oberschönenfeld bei Gessertshausen das "Naturpark-Haus", ein naturkundliches Informationszentrum unterhält.
Geschichte des Landkreises Augsburg
4000-1800 v. Chr.,
Erste Besiedelungsspuren in der Jungsteinzeit, belegt durch zahlreiche Funde.
1500-750 v. Chr.,
Urnenfelderkultur, Glockenbecherkultur.
750-450 v. Chr.
Hallstattzeit: Besiedlungen im Raum Horgau und entlang der Wertach.
500-15 v. Chr.,
Keltische Besiedlung.
15 v. Chr.
Gründungsjahr der Stadt Augsburg. Die römischen Legionäre eroberten unter dem Oberbefehl von Drusus und Tiberius, den Stiefsöhnen von Kaiser Augustus das Alpenvorland und errichteten am Zusammenfluss von Lech und Wertach das Militärlager Augusta Vindelicum.
80 n. Chr.
Unter Kaiser Claudius wird die Römerstraße "Via Claudia Augusta" fertiggestellt.
Sie führt von Oberitalien über Füssen und Augsburg bis an die Donau.
um 260
Einfall der Alamannen in das Gebiet westlich von Augsburg.
5. Jh.
Besiedlung durch die Sueben (Schwaben).
787
Karl der Große besiegt in der Nähe von Augsburg den Bayernherzog Tassilo.
915-955
Einfälle der Ungarn in das Gebiet.
955
Schlacht auf dem Lechfeld. Die Ungarn werden von dem Augsburger Bischof Ulrich und König Otto I. geschlagen.
1388
Städtekrieg: Zerstörung der Burg Zusameck bei Dinkelscherben durch die Augsburger.
1462
Zerstörung der Burg Wolfsberg bei Dinkelscherben durch Augsburger Truppen.
1525
Bauernkrieg: Aufgebrachte Bauern plündern das Kloster Oberschönenfeld.
1547/48
Schmalkaldischer Krieg.
1628-36
Die Pest wütet im Landkreis.
1633/34
Die Schweden besetzen das Gebiet.
1648
Letzte Schlacht des Dreißigjährigen Krieges in Zusmarshausen und Hainhofen.
1786
Erste Ballonfahrt des Barons von Lütgendorf von Gersthofen aus.
1802-1806
Säkularisation: Auflösung der kirchlichen Güter.
1805
Napoleon entwirft im Gasthof zur Post in Zusmarshausen den Plan für die Schlacht bei Elchingen.
1931
Plan des Landkreises Augsburg
St. Felizitas, Bobingen
00000101 - St. Felizitas, Bobingen
Pfarrkirche von Bobingen
Ort:
Bobingen
Art:
Kirche
Stil:
Spätgotik
Klasse:
* - sonstige Sehenswürdigkeit
Lage:
Kirchplatz, Stadtmitte von Bobingen
Parken:
Rathausstraße oder Bahnhofstraße
www:
www.stadt-bobingen.de/index.php?id=1105,131
Geschichte:
Die Pfarrkirche von Bobingen wurde bereits im 11. Jh. erbaut.
Eine Urkunde aus dem Jahr 1180 belegt den Erwerb durch das Kloster St. Ulrich in Augsburg.
Der Turm und Teile des Langhauses stammen noch aus dem 13. Jh.
Im 15. Jh. wurde die Kirche vergrößert und erhöht.
1719 erfolgte eine umfassende Renovierung durch den Maurermeister Martin Holzapfel und im Jahr 1762 eine erneute Reparatur durch Hans Georg Kilian Holzapfel.
1880 wurde die Kirche regotisiert, dabei wurde das Gewölbe im Chor und Langhaus neu errichtet und die Fenster mit neuem Maßwerk versehen.
1931 und 1979 erfolgte die Restaurierung.
Äußeres:
Das einschiffige Langhaus der Kirche und der eingezogene, dreiseitig geschlossene Chor, haben ein Netzrippengewölbe und außen ein einheitliches Satteldach.
Der quadratische, achtgeschossige Turm auf der Südseite mit einem Spitzhelm über vier Giebeln, ist durch Rundbogenfriese und Deutsche Bänder gegliedert.
Innenraum:
Der Hochaltar von 1931 stammt von Hans Miller; das Altarbild ist eine Kopie der Kreuzigung von Peter Paul Rubens.
Die hölzernen Altarfiguren der Kirchenväter und der hl. Felizitas wurden um 1750 geschaffen, die Pieta ist ein Werk des Bildhauers Lorenz Luidl von 1690.
Am Aufgang des Oratoriums befindet sich ein epitaphartiges Votivbild aus Gips aus dem Jahr 1527 mit der Kreuzigungsgruppe und dem Stifter, Weihbischof Johann Laymann.
Wallfahrtskirche Unsere Liebe Frau, Bobingen
00000102 - Wallfahrtskirche Unsere Liebe Frau, Bobingen
Rokokobau der Füssener Schule
Ort:
Bobingen
Art:
Kirche
Stil:
Rokoko
Klasse:
** - sehenswert
Lage:
Lindauer Str., im Süden von Bobingen
Parken:
Kornstraße
www:
www.stadt-bobingen.de/index.php?id=1110,131
de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrtskirche_zu_
Unserer_Lieben_Frau_(Bobingen)
Geschichte:
Schon im Mittelalter stand hier eine einfache Kapelle, die 1472 erstmals erwähnt und im Jahr 1671 umgebaut wurde.
Zu Beginn des 18. Jh. war die "Muttergotteskapelle" mit ihrem Gnadenbild so ruinös, dass ein Neubau erforderlich war.
Der erste Entwurf für einen Kirchenbau von Franz Xaver Kleinhans wurde 1748 abgelehnt; nach geänderten Plänen ein Jahr darauf aber doch genehmigt.
Der Bau wurde 1751 vollendet. 1860, 1934 und 1973 erfolgten Restaurierungsarbeiten..
Äußeres:
Die Wallfahrtskirche zeigt mit ihrem eingezogenen, quadratischen Chor und der zentralisierenden Halbkuppel des Langhauses Ähnlichkeit mit Bauten der Füssener Baumeister Johann Georg Fischer und Johann Jakob Herkomer
Der quadratische Ostturm mit geschweifter Haube ist nur als Dachreiter sichtbar.
Auch die geschwungenen, vierteiligen Fenster deuten auf den Einfluss Dominikus Zimmermanns hin.
Innenraum:
Der hell beleuchtete Innenraum zeigt feinstes Rokoko.
Der graziöse Stuck auf rosa Grund stammt von Franz Xaver Feichtmayr d.Ä.
Die Fresken malte Vitus Felix Rigl; im Chor "die Wunderkraft Mariens" und "Errettung der Menschen aus der Not"; im Langhaus "Verherrlichung der Immaculata".
Der prächtige rot-blau marmorierte Hochaltar um 1750, stammt von Georg Einsle; in der Mittelnische befindet sich das Gnadenbild: eine Muttergottesfigur, seitlich die Figuren der hl. Anna und des hl. Joachim.
Die klassizistischen rot-grau marmorierten Seitenaltäre wurden 1781 von Philip Jakob Einsle geschaffen.
Zwischen den beiden Fenstergruppen ist die Stuckkanzel originell eingefügt.
In den Wandnischen befinden sich Holzfiguren der Schmerzhaften Muttergottes und Christus als Schmerzensmann, beide Mitte 18. Jh.
Das Gemälde "Hl. Aloisius" im Langhaus stammt von Johann Anwander (1755).
Königstherme, Königsbrunn
00000103 - Königstherme, Königsbrunn
Freizeitbad
Ort:
Königsbrunn
Art:
Freizeiteinrichtung/Bad
Stil:
Klasse:
** - sehenswert
Lage:
Königsalle 1
Parken:
Parkplätze an der Königsallee
www:
www.koenigstherme.de
Die Königsbrunner Königstherme ist ein Freizeitbad der ganz besonderen Art; sie folgt der Tradition antiker Thermen und stellt die moderne, weiterentwickelte Version des antiken Thermengedankens dar.
In exotischer Atmosphäre kann man hier das ganze Jahr über königlichen Freizeit-, Bade-, und Saunaspaß nachgehen.
Wie ein riesiger, aufgespannter Regenschirm breitet sich das Dach über den großen Innenbereich mit 25 m Schwimmbecken für sportliche, 32 Grad warmen Thermalbecken und 3 Hot-Whirlpools.
Um die Wasserlandschaft gruppieren sich Liegewiesen, Ruhezonen und eine große Solariumwiese mit Sonnenbänken.
Die Einrichtung ist behindertengerecht; der Boden ist rutschfest und besteht aus Natursteinplatten. Für Kleinkinder gibt es einen Kinderbereich mit Wasserspielplatz und Minirutsche.
Der Außenbereich besteht aus dem Außenbecken mit Wildwasserkanal,
Wasserfällen, Wasserliegen mit Sprudel und Massagedüsen sowie einer
Sonnenwiese.
Eine Attraktion sind die drei Rutschen: eine Kinderrutsche, die steile Turborutsche und die 80 m lange Riesenröhre "Black Hole".
Außerdem gibt es im Innenbereich noch einen Fitnessraum, Fernsehecke, Imbiss, sowie ein Außenrestaurant mit herrlichem Blick auf das Badeparadies.
Die Hauptattraktion der Königstherme ist allerdings die Saunenwelt.
Der Besucher hat die Auswahl zwischen 8 verschiedenen Saunen, darunter finnische Saunen, Bio-Sauna und Blockhaussaunen im Außenbereich.
Außerdem gibt es ein Irisch-Römisches Dampfbad, im Forum einen Hot-Whirlpool, römische Nacktsolarien, eine Saunabar, Ruhezonen sowie ein Innen- und Außen-Tauchbecken.
In dem, im römischen Stil eingerichteten "Terpidarium" kann man auf beheizten Liegen Körper und Geist regenerieren. Das "Laconium", ein römisches Schwitz- und Entschlackungsbad, ist ideal für Menschen denen eine finnische Sauna zu heiß ist.
Im "Serailbad" kann man zwischen Schönheits-, Gesundheits- und Pflegepackungen wählen; das "Blütenbad" in zwei Kleopatra-Wannen belebt durch sanfte Sprudel-Massagen, ein original orientalisches "Hamam-Bad" bietet Seifen- und Bürstenmassagen.
Zum Komplex der Königstherme gehört auch der Eistreff. Es ist eine moderne, überdachte Eissporthalle, in der man auch bei Musik und Laser-Lichtorgel Schlittschuhlaufen kann.
St. Vitus, Oberottmarshausen
00000104 - St. Vitus, Oberottmarshausen
Pfarrkirche von Oberottmarshausen
Ort:
Oberottmarshausen
Art:
Kirche
Stil:
Spätbarock
Klasse:
* - sonstige Sehenswürdigkeit
Lage:
Hauptstraße
Parken:
Parkplatz am Rathaus
www:
www.oberottmarshausen.de
Geschichte:
Die Pfarrkirche in Oberottmarshausen stammt aus dem 13 Jh.
Im Jahr 1471 wurde erstmals der Patron St. Vitus bezeugt.
1702 erfolgte ein durchgreifender Umbau, ebenso Erweiterungen am Chor und Langhaus durch den Baumeister Valerian Brenner.
Am 4. Oktober 1707 wurde die Kirche geweiht.
Franz Kleinhans erneuerte 1739 den Turm. 1798 erfolgen weitere Instandsetzungsarbeiten sowie die Neuausstattung des Innenraumes.
1938 wurde die Kirche restauriert.
Äußeres:
Das vierachsige Langhaus hat eine leicht ansteigende Flachdecke.
Der Chor ist eingezogen mit dreiseitigem Schluss und flacher Korbbogentonne mit Stichkappen.
An der Südostecke des Langhauses befindet sich der quadratische, fünfgeschossige Turm mit Rundbogenfriesen und Satteldach mit Giebelaufsätzen.
Innenraum:
Der marmorierte Hochaltar mit vergoldeten Ornamenten stammt von 1705 und ist 1798 verändert worden.
Das Altarbild "14 Nothelfer" und das Ovalbild mit der hl. Dreifaltigkeit im Auszug, malte 1798 Johann Josef Anton Huber.
Seitlich befinden sich Holzfiguren des hl. Joachim und der hl. Anna.
Die Seitenaltäre haben Bilder von Benedikt Degenhart um 1846: links Muttergottes, im Auszug der hl. Wendelin; rechts der hl. Joseph mit Christuskind, im Auszug der hl. Sebastian.
Die Kanzel mit vergoldeten, klassizistischen Ornamenten ist eine Arbeit
des ausgehenden 18 Jh.
Johann Josef Anton Huber malte 1798 die Deckenfresken: im Chor die göttlichen Tugenden, die durch Putten dargestellt werden; im Langhaus ein längsovales Mittelbild mit Christus auf einem Wolkenthron, das Kreuz und die Weltkugel haltend, umgeben von anbetenden Engeln.
St. Martin, Kleinaitingen
00000105 - St. Martin, Kleinaitingen
Pfarrkirche von Kleinaitingen
Ort:
Kleinaitingen
Art:
Kirche
Stil:
Spätbarock
Klasse:
* - sonstige Sehenswürdigkeit
Lage:
Am Kirchberg
Parken:
Parkplatz an der Kirche
www:
www.kleinaitingen.de
Geschichte:
Die Pfarrkirche in Kleinaitingen wurde als Tochtergründung der Pfarrei Großaitingen bereits Anfang des 12. Jh. errichtet, seit 1143 unterstand sie dem Domkapitel Augsburg.
Die unteren Geschosse des Turmes stammen noch aus dem 13. Jh.
Im Jahr 1480 wurde der Chor neu erbaut und der Turm erhöht.
1627 erfolgten Erweiterungsarbeiten durch Jakob Aschberger und 1733 durch Joseph Meitinger. Dabei wurden die Langhausmauern erhöht und der Dachstuhl neu errichtet.
1760-90 wurde der Innenraum neu ausgestattet.
1915 erfolgte die Restaurierung.
Äußeres:
Das Langhaus der Pfarrkirche ist vierachsig, der Chor eingezogen, dreiseitig geschlossen mit abgerundeten Ecken.
Der sechsgeschossige Turm auf der Südseite hat Rundbogenfriese sowie einen neugotischen Spitzhelm über vier Giebeln.
Innenraum:
Der marmorierte, mit vergoldeten Ornamenten versehene Hochaltar stammt von 1760.
Das Altarbild des hl. Martin wurde Mitte des 19. Jh. gemalt.
Seitlich befinden sich Figuren der hl. Anna (erste Hälfte des 16. Jh.) und des hl. Joachim (18. Jh.).
Die Seitenaltäre sind Arbeiten des ausgehenden 18. Jh.
Johann Baptist Heel malte 1767 die Fresken; im Chor: der hl. Martin auf Wolken umgeben von Putten; im Langhaus: "Tod des hl. Martin" und "hl. Laurentius".
St. Ulrich und Afra, Graben
00000106 - St. Ulrich und Afra, Graben
Pfarrkirche von Graben
Ort:
Graben
Art:
Kirche
Stil:
Neubarock
Klasse:
* - sonstige Sehenswürdigkeit
Lage:
Kirchbergstraße
Parken:
Parkplatz an der Kirchbergstraße
www:
www.graben.de/index.php?id=178,55
Geschichte:
Die Pfarrkirche St. Ulrich und Afra wurde in der zweiten Hälfte des 11. Jh. erstmals erwähnt; durch Schenkung kam sie an das Domkapitel Augsburg.
1354 erfolgte ein Neubau, von dem noch der Turm im Kern erhalten ist.
Der Chor und das Langhaus wurden 1504 neu errichtet; am 14. September 1505 erfolgte die Weihe.
Um 1513 wurde der Friedhof ummauert und als Befestigungsanlage mit Gräben, Schießscharten und Türmen ausgebaut (1786 abgebrochen).
Von 1787 bis 1792 erfolgte eine Umgestaltung und Neuausstattung des Kirchenraumes durch Matthias Müller und Philip Jakob Einsle.
1894, 1909 und 1939 wurde die Kirche restauriert.
Äußeres:
St. Ulrich und Afra ist ein flachgedeckter, einschiffiger Bau mit gerundeten Ecken und eingezogenem, zweiachsigem Chor mit dreiseitigem Schluss.
Das Langhaus hat ein steiles, hohes Satteldach mit freiliegenden Gauben; unter dem Dachansatz befinden sich Kleeblattbogenfriese.
Nördlich des Chores steht der siebengeschossige, quadratische Turm mit Ecklisenen, Bogenfriesen und einem gotischen Spitzhelm über vier Giebeln.
Innenraum:
Der neubarocke Hochaltar wurde Ende des 19. Jh. errichtet; das Altarbild der Kreuzigung stammt von 1840. Seitlich stehen Figuren der hll. Johannes.
Die Deckenfresken wurden 1789 von Johann Baptist Enderle gemalt: im Chor: in einem Achteckfeld mit gemaltem Stuckrahmen "Hl. Ulrich vor der Schlacht auf dem Lechfeld" und "Hl. Ulrich und König Otto reiten über das Lechfeld".
Im Langhaus: ein Ovalfeld mit den Szenen "Hl. Afra vor dem Richter" und "Martyrium der hl. Afra".
Im Chor befinden sich Wandmalereien von G. Locher: an der Nordwand "die Auferstehung", gegenüber "Anbetung der Hirten".
Die Gemälde an der Emporenbrüstung stammen von Johann Baptist Enderle:
untere Brüstung: "Christus und Maria", "die Seeschlacht von Lepanto" und "Maria erscheint einem Sterbenden"; oben: "König David mit Harfe", "Musizierende Engel" und "die hl. Cäcilie".
Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frauen Hilf, Klosterlechfeld
00000107 - Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frauen Hilf, Klosterlechfeld
Ort:
Klosterlechfeld
Art:
Kirche
Stil:
Rokoko
Klasse:
*** - besonders sehenswert
Lage:
Franziskanerplatz
Parken:
Parkplatz hinter dem Kloster
www:
www.lechfeld.de/index.php?id=404
de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrtskirche_Maria_Hilf_(Klosterlechfeld)
Geschichte:
Die Wallfahrt zu "Unserer Lieben Frauen Hilf" wurde von Regina Imhof, der Schlossherrin von Untermeitingen und Witwe des Augsburger Bürgermeisters Raimund Imhof, gegründet.
Sie stiftete an der Stelle eine Kapelle, wo sie nach einer Irrfahrt im Nebel den Weg zu ihrem Schloss wieder fand.
Als Vorbild für die ehemals fensterlose, runde Kapelle, dem heutigen Chor, diente das Pantheon Sta. Rotonda in Rom.
Die Baumeister waren Elias Holl, der Erbauer des Augsburger Rathauses und sein Bruder Esaias.
Nach Reparatur der Schäden des 30-jährigen Krieges und wegen der Zunahme der Wallfahrt wurde die Kapelle erweitert; 1656 fügte Karl Diez im Westen das Langhaus und zwei Sakristeien hinzu, 1669 erhöhte Kaspar Feichtmayer die Gnadenkapelle, errichtete den Chorumgang und baute 1691 die beiden runden Seitenkapellen an.