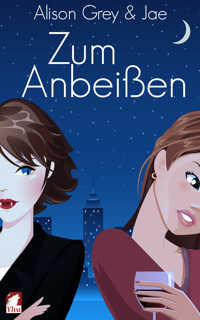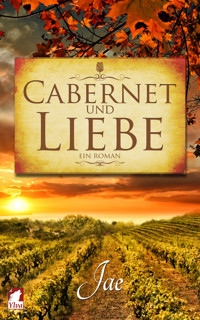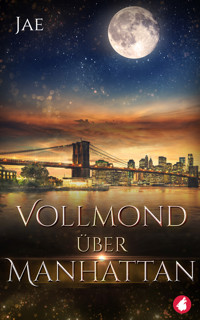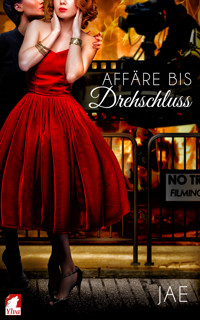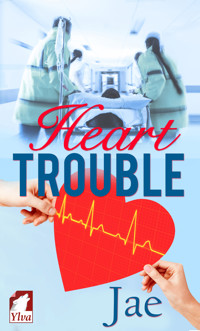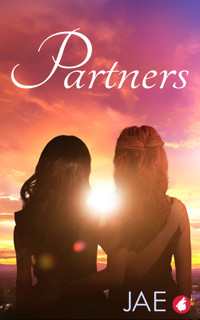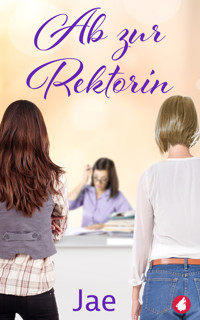Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ylva Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe in Zeiten des Erdbebens: Zwei Frauen, zwei Welten – und ein Kampf ums Überleben und die Liebe im historischen San Francisco von 1906. Kate Winthrop ist die einzige Tochter eines reichen Reeders. Ihre Eltern haben ihr Leben schon geplant: sie soll einen wohlhabenden Mann heiraten und einen Erben für das Winthrop-Imperium in die Welt setzen. Doch Kate hat andere Ziele. Ihre wahre Leidenschaft gilt der Fotografie – und den Frauen. Nach dem Tod ihres Bruders ist die sizilianische Immigrantin Giuliana Russo völlig auf sich gestellt und nimmt eine Stelle als Dienstmädchen im Haus der Winthrops an. Sehr zum Missfallen von Kates Eltern freunden sich Giuliana und Kate trotz ihrer Standesunterschiede an. Als sich die beiden Frauen näherkommen, wird San Francisco von einem schweren Erdbeben erschüttert und Feuer breiten sich in der Stadt aus. Wird die Naturkatastrophe ihre aufkeimenden Gefühle füreinander ersticken oder werden sie den Mut haben, für ihr Überleben und ihre Liebe zu kämpfen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Von Jae außerdem lieferbar
DANKSAGUNG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
Über Jae
Ebenfalls im Ylva Verlag erschienen
Sie möchten keine Neuerscheinung verpassen?
Dann tragen Sie sich jetzt für unseren Newsletter ein!
www.ylva-verlag.de
Von Jae außerdem lieferbar
Perfect Rhythm – Herzen im Einklang
Hängematte für zwei
Herzklopfen und Granatäpfel
Vorsicht, Sternschnuppe
Cabernet & Liebe
Die Hollywood-Serie:
Liebe à la Hollywood
Im Scheinwerferlicht
Affäre bis Drehschluss
Die Portland-Serie:
Auf schmalem Grat
Rosen für die Staatsanwältin
Die Serie mit Biss:
Zum Anbeißen
Coitus Interruptus Dentalis
Die Gestaltwandler-Serie:
Vollmond über Manhattan
DANKSAGUNG
Ein herzliches Dankeschön an meine Lektorin, Andrea Fries, und an mein erstklassiges Betaleserinnen-Team: Alexandra, Gaby, Nicky, Peggy, Sandra, Stephie und Susanne.
KAPITEL 1
Italy Harbor
San Francisco, Kalifornien
18. März 1906
Giuliana blinzelte gegen den rauen Wind an und sah auf die Bucht hinaus. Der Nebel lichtete sich und gab den Blick auf Alcatraz frei, aber von der Bon Viaggiu und ihrem braunen, dreieckigen Segel gab es noch immer keine Spur. Die meisten anderen Feluccas waren bereits zurück. Wellen umspülten die kleinen Boote und drückten sie gegen den Pier. Normalerweise fand sie den sanften Rhythmus beruhigend, aber heute konnte er nichts gegen ihre wachsende Nervosität ausrichten.
Wo blieb Turi nur?
Sonst fuhr Turi mitten in der Nacht hinaus aufs Meer und beeilte sich morgens, um als Erster zurückzukehren und einen guten Preis für seinen Fang zu erzielen.
Heute waren ihm die anderen Piscaturi zuvorgekommen. Eine Gruppe genuesischer Fischer saß am Pier. Sie flickten ihre Netze und sangen Arien, während Giulianas sizilianische Landsleute Kisten voller Fisch und Krabben aus ihren Booten an Land brachten.
Neben Giulianas Krabbenstand hatten die schwarz gekleideten Frauen bereits Wasser in riesigen Töpfen zum Kochen gebracht. Dampfwolken stiegen auf und die Frauen drängten sich um die Töpfe, um die Morgenkälte zu vertreiben. Das Aroma gekochter Meeresfrüchte und frisch gebackenen Sauerteigbrots drang zu Giuliana hinüber und mischte sich unter den Geruch von Fisch und salziger Luft.
Da Giuliana noch keine Krabben zum Kochen hatte, brannte ihr Feuer noch nicht. Sie scharrte mit den Füßen, um sich warmzuhalten, und versuchte, nicht an ihren Vater zu denken. Er war vor sechs Jahren aufs Meer hinausgefahren, um Sardinen zu fangen, doch nie ins Dorf zurückgekehrt. Sein Verlust schmerzte, fast als wäre es gestern gewesen. Doch gleichzeitig schien er eine Ewigkeit zurückzuliegen. Manchmal konnte sie sich kaum noch an sein wettergegerbtes Gesicht erinnern.
Was, wenn Turi ebenfalls nicht zurückkommen würde? Dann wäre sie ganz allein in Amerika.
Der dumpfe Klang eines Nebelhorns unterbrach ihre Gedanken. Wieder sah sie auf die Bucht hinaus.
Kreischende Möwen umkreisten ein einzelnes Boot. Es war weiß mit grüner Umrandung, so wie das Boot ihres Vaters und wie alle Feluccas ihres Dorfes.
Die Bon Viaggiu! Ihr Herz machte einen kleinen Sprung. Siehst du? Er ist zurück. Du hast dir ganz umsonst Sorgen gemacht.
Aber Turis Boot segelte nicht vor dem Wind. Es wurde von einem dampfgetriebenen Fischkutter abgeschleppt.
Zuerst glaubte Giuliana, Turi hätte sich an den Kutter gehängt, so wie die Fischer das manchmal taten, um schneller in den Hafen zurückzukommen. Aber das Boot lag nicht tief im Wasser, hatte also keinen Fang an Bord. Etwas stimmte nicht.
Turi! Sie rannte zum Rand des Piers und sprang auf und ab, um über die Masten der anderen Boote sehen zu können.
Als die Bon Viaggiu anlegte, vertäute sie hastig das Boot, raffte ihr Kleid und sprang an Bord.
Turi saß im Heck des Boots. Seine breiten Schultern, die von jahrelanger Arbeit mit den schweren Netzen gestählt waren, hingen schlaff herab.
Giuliana schlitterte auf ihn zu und spreizte die Arme, um nicht die Balance zu verlieren, als das Boot zu schaukeln begann. Sie kniete sich vor ihn und umklammerte seine Beine, die bis zur Hüfte in Gummistiefeln steckten.
Er zitterte unter ihren Händen.
»Turi? Bist du verletzt?«, fragte sie auf Sizilianisch.
Er hustete und hob langsam den Kopf, als kostete die Bewegung ihn all seine Kraft. Seine Haut war blass, obwohl sie normalerweise noch dunkler war als ihr olivbrauner Teint. Nur seine Wangen waren gerötet. Er zitterte am ganzen Körper und hielt sich die Brust, als ein Hustenanfall ihn schüttelte. »Nur eine Erkältung«, sagte er in ihrer Muttersprache.
Das sagte er schon seit Tagen. Bisher hatte sie ihm geglaubt. Jetzt streckte sie die Hand aus und berührte seine Stirn. Hitze drang an ihre kalten Finger. »Du glühst!«
Er antwortete nicht. Als er aufstand, schwankte er, griff sich an den Kopf und fluchte.
Die vertrauten Schimpfwörter heiterten Giuliana etwas auf. Sie schlang sich seinen Arm über die Schulter, um ihn zu stützen. Sein Leinenhemd war feucht. Es roch nach Schweiß, nicht nach Meerwasser.
Er stützte sich auf sie, als sie vom Boot kletterten.
Bedda matri, er war schwer! Einen Moment lang schwankten sie beide. Giuliana spannte die Muskeln an, um nicht unter seinem Gewicht zusammenzusacken.
Turi hustete erneut. An ihn gedrängt konnte Giuliana das Pfeifen hören, als er nach Luft schnappte.
Ihr Bruder machte zwei Schritte den Pier entlang und blieb dann stehen. Er zitterte wie ein nicht festgemachtes Segel im Wind.
Besorgt musterte sie ihn. »Willst du dich kurz hin…?«
Ohne Vorwarnung brach er zusammen.
Sie versuchte, ihn abzufangen, aber er war zu schwer. Beide landeten auf den verwitterten Planken des Piers. Schmerz durchfuhr ihre Hand, als sie sich abfing, aber sie ignorierte ihn. Im Moment zählte nur Turi. Sie schüttelte ihn verzweifelt. »Turi! Wach auf! Du musst aufwachen. Bitte!«
Seine Augen blieben geschlossen, aber mit jedem angestrengten Atemzug hob und senkte sich seine Brust.
Sie kniete sich neben ihn und sah sich nach Hilfe um. »Ajutu!«, rief sie und wiederholte den Hilferuf dann auf Englisch. »Bitte! Jemand muss uns helfen!«
Zwei Fischer sprangen über ihre Netze, die sie zum Trocknen ausgebreitet hatten. Andere kletterten aus ihren Booten. Innerhalb von Sekunden trugen sie Turi den Pier entlang.
»Wartet!«, rief Giuliana auf Sizilianisch. Sie lief ihnen nach. »Wohin bringt ihr ihn?«
Einer der Männer antwortete, aber es war zu windig, um ihn zu verstehen. Nur das Wort ospitali drang zu ihr herüber.
Einen Moment lang wollte sie protestieren. Sie hatten nicht das Geld, um einen Arzt zu bezahlen. Aber dann hielt sie sich zurück, denn sie ahnte, dass das Krankenhaus Turis einzige Chance war.
Giuliana hatte kaum einen Blick für die massiven Granitsäulen oder die majestätische Kuppel des Rathauses übrig, als sie in den Keller des Gebäudes stürmte, wo das zentrale Notfallkrankenhaus untergebracht war. Dorthin hatte der von Pferden gezogene Krankenwagen Turi gebracht.
Ihre ledernen Schnürstiefel, die Turi ihr mit seinem Ersparten zu Weihnachten gekauft hatte, hallten auf dem Marmorboden wider.
Eine Krankenschwester schob einen metallenen Materialwagen an ihr vorbei.
»Scusi … entschuldigen Sie, Miss«, sagte Giuliana. »Ich suche mein Bruder, Salvatore Russo. Er ist krank, deshalb man hat gebracht ihn hier.«
»Wenn er nicht im Operationssaal ist, dann ist er vermutlich in der Abteilung für Männer.« Die Krankenschwester deutete aufs andere Ende des Gangs.
Rasch bedankte sich Giuliana, eilte in die angegebene Richtung und drückte sich an zwei Pflegern vorbei, die einen stöhnenden Patienten auf einer Trage transportierten.
Die Abteilung für Männer bestand aus einem großen Saal. Betten mit Metallgestellen standen aufgereiht an zwei Wänden, während eine Krankenschwester an einem Schreibtisch in der Mitte des Raums saß und sich im Licht eines Gaskronleuchters Notizen machte.
Giuliana ging auf sie zu, doch dann erhaschte sie einen Blick auf einen Patienten zu ihrer Linken. Turi!
Er saß, gestützt von mehreren Kissen, im Bett. Seine Augen waren geschlossen.
Fast wäre sie gegen einen Materialwagen geprallt, als sie auf ihn zulief und sich auf die Bettkante setzte. »Turi?«, flüsterte sie.
Langsam öffnete er die Augen.
»Oh Turi, es tut gut, dich wach zu sehen«, sagte sie auf Sizilianisch.
Er versuchte, etwas zu sagen, aber sein Husten unterbrach ihn.
Sie zog die weiße Decke etwas höher. »Versuch nicht zu sprechen.«
Nicht, dass er es gekonnt hätte. Er hustete ununterbrochen und sein Zittern wollte einfach nicht aufhören. Erschöpft lehnte er sich gegen die Kissen.
Giuliana hielt seine Hand. Die vertrauten Schwielen waren beruhigend. Mit beiden Händen rieb sie seine kalten Finger und sah sich nach einem der Ärzte in Westen und mit Melonenhüten um.
Ihr verzweifelter Blick fiel wohl einer Krankenschwester auf, die eben den Krankensaal betreten hatte und nun auf sie zukam. Kurz bevor sie Giuliana erreichte, stolperte sie über etwas und stieß gegen den Materialwagen. Verbandsmaterial flog in alle Richtungen.
Eine leere Metallschüssel prallte gegen Giulianas Brust und sie fing sie reflexartig auf.
Mit fast katzenartiger Geschmeidigkeit gelang es der Krankenschwester, auf den Füßen zu bleiben und sogar den Materialwagen zu fassen zu bekommen, bevor er umfallen konnte.
Der Lärm ließ eine weitere Schwester hinzueilen.
»Um Himmels willen, Miss Croft, wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass die Bettpfanne unters Bett gehört, nicht davor?«, fragte die Krankenschwester, die gestolpert war.
Ihre Kollegin errötete. »Tut mir leid, Doktor Sharpe.«
Doktor? Giuliana starrte die Frau an. Erst jetzt fiel ihr auf, dass die Fremde keinen weißen Schwesternkittel mit hoch geschlossenem Kragen und keine weiße Haube trug. Stattdessen trug sie einen dunkelbraunen Rock. Ihre feuerroten Haare leuchteten gegen den weißen Stoff ihrer Hemdbluse und waren schlicht zurückgebunden, statt nach der neuesten Mode kunstvoll auf ihrem Kopf aufgetürmt zu sein.
»Ist ja nichts passiert«, sagte die Ärztin zu der Krankenschwester, nun deutlich freundlicher. »Jeder macht mal Fehler. Sehen Sie einfach zu, dass es nicht wieder vorkommt.«
Die Schwester nickte und begann, die überall verteilten Verbandsmaterialien einzusammeln.
Die Ärztin trat an Turis Bett heran.
Giuliana starrte sie noch immer an. Auf Sizilien konnten nur Männer Ärzte werden und sie hatte nicht gewusst, dass es in Amerika anders war. In den fünf Jahren, die sie nun schon hier lebte, hatte sie bisher noch keine Ärztin getroffen.
»Ich weiß, was Sie denken«, sagte die Ärztin. »Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich von den besten Medizinern des Landes ausgebildet wurde und meine medizinischen Fähigkeiten denen meiner männlichen Kollegen in nichts nachstehen.«
»Sie sind sogar besser«, sagte die Krankenschwester lächelnd.
Dr. Sharpe lachte. »Lassen Sie das nicht die Kollegen hören.« Sie sah Giuliana an. »Ihr Mann wird hier bestmöglich versorgt werden.«
»Er ist nicht mein Mann. Ich bin seine Schwester. Giuliana Russo.«
»Erfreut, Sie kennenzulernen, Miss Russo. Mein Name ist Dr. Lucy Hamilton Sharpe.« Die Ärztin hielt ihr die Hand hin.
Giuliana zögerte kurz, da ihre eigene Hand womöglich schmutzig war oder nach Fisch roch. Als sie zugreifen wollte, stellte sie fest, dass sie noch immer die Metallschüssel hielt.
»Geben Sie die Schüssel doch einfach mir.« Dr. Sharpe nahm sie ihr ab und gab sie der Schwester, bevor sie Giulianas Hand schüttelte.
Giuliana hatte mit weicher Haut und einem zaghaften Handschlag gerechnet, aber jetzt wurde sie eines Besseren belehrt. Dies war nicht die Hand einer verwöhnten, reichen Dame, die nicht körperlich arbeiten musste. Es war die starke, leicht schwielige Hand einer Person, die nicht vor harter Arbeit zurückschreckte.
Neugierig musterte Giuliana sie. Die Sommersprossen auf der Nase der Ärztin deuteten an, dass sie einige Zeit in der Sonne verbracht hatte, ohne ihre helle Haut wie die anderen Damen in San Francisco mit einem Sonnenschirm zu schützen.
Das Husten ihres Bruders erinnerte sie daran, dass sie nicht hier war, um die Ärztin anzustarren, so faszinierend sie auch war. Rasch wandte sie den Blick ab. »Können Sie helfen mein Bruder?«
Dr. Sharpe sah auf Turi hinab, der die Augen geöffnet hatte und sie mit fiebrigem Blick ansah. Mit ruhiger Hand zog sie die Decke etwas tiefer und öffnete die beiden obersten Hemdknöpfe.
Giuliana sah mit großen Augen zu. Zu Hause in Santa Flavia wäre es als sehr kess betrachtet worden, das Hemd eines Mannes zu öffnen, mit dem man nicht verwandt war. Aber Miss Sharpe war Ärztin und musste ihn natürlich untersuchen.
Sie nahm etwas aus ihrer Ledertasche. Zwei schwarze Gummischläuche waren mit einem glockenförmigen Stück Ebenholz verbunden, das Dr. Sharpe nun auf Turis Brust legte.
»Was ist das?«, fragte Giuliana.
Die Ärztin klemmte sich die Enden des Instruments in die Ohren. »Man nennt es Stethoskop. Ich kann damit seine Lungen und sein Herz abhören.« Sie bedeutete Turi, seinen Mund zu öffnen, und sah in seinen Rachen. Als sie sich aufrichtete, blickte sie von ihm zu Giuliana. »Er leidet an bilateraler Pneumonie.«
Giuliana biss sich auf die Lippe. Sie mochte es nicht, wenn allzu offensichtlich wurde, dass sie nur ein ungebildetes Mädchen aus einem kleinen Fischerdorf aus Sizilien war. Doch wie ihre Mutter immer sagte, war Familie wichtiger als Stolz, deshalb fragte sie: »Was bedeutet das?«
»Es bedeutet, dass seine Lungen entzündet sind. Sie sind mit Eiter und anderer Flüssigkeit gefüllt. Deshalb kann er auch kaum atmen.«
»Aber Sie können ihn helfen, ja?«
Nun war es Dr. Sharpe, die sich auf die Lippe biss. »Wir werden es versuchen, aber es ist eine sehr ernste Erkrankung, Miss Russo.«
Schwach drückte Turi ihre Hand und sah sie fragend an. Im Gegensatz zu Giuliana hatte er kaum Englisch gelernt. Das ist nicht nötig, hatte er immer gesagt. Auf dem Boot brauchte er kein Englisch und außerdem würden sie in ein oder zwei Jahren ohnehin nach Sizilien zurückkehren.
»Sie sagt, dass du bald wieder ganz gesund bist«, sagte sie auf Sizilianisch und versuchte zu lächeln, als sie ihm in die Augen sah.
Er nickte und schloss die Augen. Sein schweißgetränktes Haar, das genauso dunkel wie ihr eigenes war, fiel ihm ins Gesicht und betonte nur noch mehr, wie blass er war.
Sanft strich sie ihm ein paar Strähnen aus der Stirn.
»Sie sind verletzt«, sagte Dr. Sharpe und deutete auf Giulianas Hand.
Giuliana sah auf ihre aufgeschürfte Hand hinab. Es war, als würde sie die Hand einer Fremden betrachten. Sie verspürte nicht den geringsten Schmerz. »Oh.« Vermutlich war es passiert, als sie Turi aufgefangen hatte und sie beide auf dem Pier gelandet waren.
»Lassen Sie mich das verbinden.«
Mit einem Kopfschütteln versteckte Giuliana ihre Hand hinter dem Rücken. Es war schon schlimm genug, für Turis Behandlung bezahlen zu müssen. Wenn sie nun auch noch selbst behandelt werden musste, würden sie in dieser Woche kein Geld zu ihrer Familie schicken können.
»Ist schon in Ordnung«, sagte Dr. Sharpe. Ihre grünen Augen leuchteten sanft. »Ich werde Ihnen nichts berechnen. Ich muss ohnehin warten, bis Miss Croft mit dem Senfumschlag für Ihren Bruder zurückkommt.« Sie nickte der Krankenschwester zu, die daraufhin davoneilte.
Zögernd zog Giuliana ihre Hand hinter ihrem Rücken hervor.
Die Ärztin setzte sich auf einen Hocker und nahm sanft Giulianas Hand. Sie griff nach einem winzigen Werkzeug vom Materialwagen und begann, Holzsplitter aus Giulianas Haut zu ziehen. Als sie fertig war, verteilte sie Salbe auf den Wunden und verband sie. »So. Halten Sie die Hand einige Tage lang trocken, dann ist sie wieder so gut wie neu.«
»Danke.« Giulianas Sorge galt Turi, nicht sich selbst. Sie legte ihre Hand in den Schoß und musterte ihn. Oh bitte, Madonna. Hilf ihm.
Die Krankenschwester kam mit einem Arm voller medizinischer Utensilien zurück.
Dr. Sharpe nahm sich eine Metallschüssel und mischte ein gelbbraunes Pulver, vermutlich den Senf, den sie erwähnt hatte, mit einer weißen Substanz, die wie Mehl aussah. Dann goss sie etwas Wasser aus einem Krug an Turis Bett in die Schüssel. Schließlich fügte sie ein paar Tropfen einer Flüssigkeit hinzu. Es roch wie das Kerosin, das sie zu Hause in ihren Lampen benutzten. Nachdem sie alles zu einer Paste vermengt hatte, trug sie diese auf ein sauberes Stück Stoff auf und legte es auf Turis Brust. Als sie sich von ihm abwandte, sah sie die Schwester streng an. »Behalten Sie den Senfumschlag gut im Auge, bitte.«
»Ist gefährlich?«, fragte Giuliana.
»Nein. Aber wenn wir ihn zu lange darauf lassen, wird er seine Haut verbrennen.«
»Ich behalte ihn im Auge«, sagte die Krankenschwester.
Giuliana würde dasselbe tun. Sie war entschlossen, ihrem Bruder nicht von der Seite zu weichen, bis es ihm wieder besser ging.
»Miss Sharpe?«, rief ein Mann in einem eleganten Anzug vom Eingang des Krankensaals her. »Wir warten im Operationssaal auf Sie. Oder haben Sie endlich Vernunft angenommen und eingesehen, dass bei einer Operation zu assistieren zu viel für das delikate Gemüt einer Frau ist?«
»Auch wenn ich Ihre Sorge um mein ›delikates Gemüt‹ zu schätzen weiß, Dr. Ferber, so muss ich doch sagen, dass Ihre Versuche, mich aus dem Operationssaal fernzuhalten, meinem Gemüt viel mehr zu schaffen machen, als zuzusehen, wie ein Mann während einer lebensrettenden Operation aufgeschnitten wird.« Dr. Sharpe sah ihm in die Augen. Ihre Stimme zitterte nicht. »Und inzwischen sollten Sie eigentlich wissen, dass ich keine Frau bin, die zu Ohnmachtsanfällen neigt. Außerdem muss es Doktor Sharpe heißen und nicht Miss.«
Dr. Ferber und Giuliana starrten die Ärztin an.
Trotz ihrer Sorge um Turi musste Giuliana sich ein Lächeln verkneifen. Dr. Sharpe erinnerte sie an ihre eigensinnige Nonna, die stets unbeirrt ihre Meinung vertreten hatte. Nach Dr. Ferbers Gesichtsausdruck zu schließen, machte diese Eigenart Lucy Sharpe genauso unbeliebt bei manchen Männern wie Giulianas Großmutter.
Dr. Ferber schüttelte den Kopf, bevor er den Gang hinabschritt.
Lucy Sharpe folgte ihm. An der Tür drehte sie sich noch einmal um und sagte: »Ich komme später wieder, um nach Ihrem Bruder zu sehen.«
Giuliana nickte und setzte sich auf den frei gewordenen Hocker, um über Turis keuchendes Atmen zu wachen.
Giuliana schreckte aus einem Albtraum auf, in dem Turi auf hoher See ertrank. Er rief nach ihr, aber sie konnte ihn nicht erreichen. Sie presste sich eine Hand auf die Brust und sah sich um.
Es war dunkel geworden. Turi lag neben ihr im Bett. Sie war wohl eingeschlafen und ihr Kopf war auf die Matratze gesunken. Gähnend setzte sie sich auf und rieb sich die Augen.
Es geht ihm gut. Siehst du?
Aber ihr Bruder atmete viel zu schnell und wälzte sich unruhig im Bett hin und her. »Mamma!«, rief er. Was er sonst noch sagte, ergab nicht viel Sinn. Träumte auch er?
»Turi! Wach auf«, flüsterte sie auf Sizilianisch, in dem Versuch, die anderen Patienten nicht zu wecken. »Du träumst nur.«
Er reagierte nicht.
Mit einem Kloß im Hals berührte sie seine Stirn. Sein Körper strahlte so viel Hitze ab wie ein gusseiserner Ofen.
Turi schlug um sich. Sein Handrücken prallte gegen ihre Schulter und schleuderte sie fast vom Hocker.
Zwei Krankenschwestern eilten hinzu und fesselten seine Arme an das Bettgestell.
Ohne die Augen zu öffnen, kämpfte er gegen sie an. Noch letzte Woche hätte er sie leicht abschütteln können, doch nun war er zu schwach.
»Nein, nein!« Giuliana sprang auf, um ihn zu beschützen. »Lassen Sie ihn los! Er hat mir nicht verletzt!«
»Er verletzt sich selbst, Miss«, antwortete eine der Schwestern.
»Was ist hier los?« Eine selbstbewusste Stimme machte sich trotz des Lärms bemerkbar. Dr. Sharpe kam auf sie zu. Die Ärmel ihrer Bluse waren zerknittert, als hätte sie diese bis zu den Ellbogen hochgekrempelt.
»Ich glaube, Mr. Russo geht es schlechter«, antwortete eine der Krankenschwestern.
Dr. Sharpe beugte sich über ihn, fühlte seinen Puls und hörte seine Brust ab. »Falls Sie lieber draußen warten möchten, Miss Russo«, sagte sie, ohne aufzusehen.
Giuliana verharrte neben Turis Bett. »Nein«, sagte sie mit fester Stimme. Auch sie war keine Frau, die zu Ohnmachtsanfällen neigte. »Ich bleibe.«
Die Ärztin blickte auf und nickte ihr kurz zu, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder Turi zuwandte. Sie schob die Decke zurück und knöpfte sein Hemd auf.
Trotz seines Fiebers war Turis Haut blass und wirkte gräulich. Sein weißer Bauch war von winzigen rot-blauen Äderchen überzogen und sah aus wie Marmor.
Ein Stöhnen entrang sich Turis Brust, aber er wachte nicht auf, als die Ärztin seine Arme und Beine abtastete und ihn dann wieder zudeckte.
Dr. Sharpe richtete sich auf und drehte sich mit grimmiger Miene zu Giuliana um. »Es ist eingetroffen, was ich befürchtet hatte. Die Entzündung hat sich ausgebreitet. Er leidet nun an einer Sepsis, einer Vergiftung des Blutes.«
Giuliana umklammerte den Ärmel der Ärztin. »Bitte helfen Sie ihn!«
Dr. Sharpe senkte den Blick. »Es gibt nichts, was ich oder ein anderer Arzt für ihn tun könnte. Wir können ihm nur etwas Wasser oder Brühe einflößen und abwarten, ob er noch die Kraft hat, gegen die Krankheit anzukämpfen.« Sanft drückte sie Giulianas Finger, die noch immer ihren Ärmel umklammert hielten. »Es tut mir leid.«
Nein, nein, nein. Giuliana wollte keine Entschuldigung. Sie wollte, dass Turi wieder gesund wurde. Langsam löste sie ihre Finger von Dr. Sharpes Ärmel und sank zurück auf den Hocker.
Das erste Licht des Tages drang durch die vergitterten Fenster des Krankenhauses. Giuliana sah und hörte zu, wie draußen die Welt erwachte. Pferdehufe klapperten über das Kopfsteinpflaster und Milchkannen schepperten, als ein Milchwagen die Straße entlangrumpelte.
Dr. Sharpe ging von Bett zu Bett, um zu sehen, wie jeder Patient die Nacht überstanden hatte.
Hatte sie überhaupt geschlafen?
Nervös wartete Giuliana, bis die Ärztin Turis Bett erreicht hatte. Sie nickten einander zu. »Er nicht hat die Brühe getrunken. Aber er sich nicht mehr bewegt wie eine Sardine auf dem Pier. Vielleicht er sich schläft gesund. Wie unser Papà, wenn er war krank. Er sich hat ins Bett gelegt mit das Fieber und er schlief und schlief und als er wieder aufgestanden, er war ganz gesund.« Sie merkte, dass sie plapperte, und schloss den Mund.
Aber Dr. Sharpes Aufmerksamkeit galt nicht ihr. Sie starrte Turi an. Statt seine Brust wieder mit dem Stethoskop abzuhören, hob sie seinen Arm an und bewegte seine Finger.
Giuliana wagte nicht zu atmen. Was machte die Ärztin da? Turis Arm war nicht verletzt.
Langsam senkte Dr. Sharpe seinen Arm zurück aufs Bett und drehte sich mit ernster Miene zu Giuliana um. »Es tut mir sehr leid. Er ist verstorben.«
»Was? Nein, nein, nein.« Er konnte nicht tot sein. Nicht Turi. Giuliana umklammerte seine Hand, die steif auf der Decke lag. »Er nur schläft. Er ist nicht …«
»Es tut mir leid, Miss Russo. Er muss irgendwann in der Nacht gestorben sein. Ich bin sicher, dass er keine Schmerzen hatte.«
Blut rauschte durch ihre Ohren und sie sah Dr. Sharpes Gesicht, das Mitleid zeigte, wie aus sehr weiter Entfernung. »Nein. Das nicht ist möglich. Nein. Nein.« Sie senkte den Kopf und presste das Gesicht gegen seine Brust, die sich nun nicht mehr unter angestrengten Atemzügen hob und senkte.
Die Wahrheit traf sie wie ein harter Schlag auf eine bereits geprellte Stelle. Ihr Bruder war tot. Nie wieder würde sie sein vergnügtes Lachen hören, wenn er mit einem Boot voller Krabben zurückkehrte und auf den Pier sprang. Nie wieder würde sie zusehen, wie er sich fast an seinem Essen verschluckte, weil er ihre Spaghetti nicht schnell genug essen konnte. Und nie wieder würde er ihre geliebte Insel sehen.
Tränen brannten in ihren Augen, aber sie konnte nicht weinen. Zu viele Gedanken gingen ihr durch den Kopf. Was würde nun aus allen werden? Nicht nur aus ihr, die nun ganz allein auf dieser Seite des Ozeans war, sondern auch aus ihrer Familie in Santa Flavia?
Als ältester Sohn hatte Turi den Platz ihres Vaters als Versorger der Familie eingenommen. Er hatte versucht, als Fischer genug Geld zu verdienen, aber die Leute in ihrer Heimat waren so arm, dass er kaum genug Fische verkaufen konnte, um ihre jüngeren Geschwister vor dem Verhungern zu bewahren. Schließlich hatte er einen gewagten Plan geschmiedet. Wie andere junge Männer des Dorfes wollte er nach Amerika gehen, dem Land, in dem alles möglich war, und dort für ein oder zwei Jahre arbeiten.
Widerwillig hatte ihre Mutter ihn gehen lassen, aber nur unter der Bedingung, dass Giuliana mitkommen würde. So wäre er nicht völlig allein in diesem fremden Land und hätte jemanden, der für ihn kochen und ihm den Haushalt führen würde.
Nun würde Turi in diesem fremden Land beerdigt werden und Giuliana würde allein zurückbleiben.
Als sie schließlich den Kopf von Turis Brust hob, merkte sie, dass Dr. Sharpe nicht gegangen war. Sie stand schweigend neben dem Bett und leistete ihr Gesellschaft. »Falls Sie irgendwelche Hilfe brauchen …«
Giuliana straffte die Schultern. Sie hatte keine Zeit für Trauer. Nun war es an ihr, alles Notwendige zu tun. »Ich möchte ihn zu Hause bringen.«
»Nach Hause? Aber …«
»Es ist Tradition, wo ich herkomme«, sagte Giuliana. Turi hatte sie ständig damit aufgezogen, sie würde zu amerikanisch werden. Er hätte gewollt, dass sie die alten Bräuche ehrte.
Die Ärztin nickte. »Na schön. Ich werde dafür sorgen, dass Ihnen jemand hilft.«
»Gut, dass Nonnu das nicht sehen kann«, murmelte Giuliana auf Sizilianisch und deutete auf den einfachen Kiefernsarg, in dem Turi nun lag. Ihr Großvater war ein großartiger Zimmermann gewesen.
Nedda Galati, deren Familie der Krabbenstand neben Giulianas gehörte, klopfte ihr auf die Schulter. »Du hast getan, was du konntest«, sagte sie in ihrer Muttersprache.
Giuliana antwortete nicht. Sie ging in ihrem kleinen Zimmer in einer Pension im Arbeiterviertel südlich der Market Street auf und ab und versuchte, sich beschäftigt zu halten, um nicht nachdenken zu müssen. Jedes Mal, wenn sie in Turis Gesicht sah, traten ihr Tränen in die Augen.
Nedda und ihr Mann halfen ihr, Turis Kopf anzuheben, damit sie Salz darunter streuen konnte. Sie legten seine liebsten Besitztümer – seine beste Pfeife, sein Rasiermesser und die Fotografie ihrer Eltern – zu ihm in den Sarg. Ihre Großmutter hatte dasselbe getan, als ihr Großvater gestorben war. Sie wollte nicht, dass Turis Seele zurückkehrte, um nach den Dingen zu suchen, die er am meisten geschätzt hatte.
Neddas Mann Francesco öffnete die Tür und das einzige Fenster, sodass Turis Seele nicht eingesperrt bleiben würde.
Das Aroma von gekochtem Kohl und Würstchen von einem ihrer polnischen Nachbarn stieg Giuliana in die Nase. Ihr Magen knurrte.
»Du solltest etwas essen.« Nedda schob ihr den Teller mit der Caponata, einem süßsauren Gemüsegericht, hin.
»Ich habe keinen Hunger«, sagte Giuliana, obwohl sie den ganzen Tag nichts gegessen hatte.
Nedda und Francesco sahen sich an. Sie blieben bei ihr, als sie sich neben den Sarg setzte, um sich von ihrem toten Bruder zu verabschieden, aber nicht wusste wie.
Sie starrte hinab auf Turis regloses Gesicht. Wie konnte das nur passieren? Vor wenigen Tagen hatte sie ihn noch quer durch den Raum angestarrt, weil sein Schnarchen sie wachgehalten hatte. Und jetzt … jetzt war er tot. Sie konnte es noch immer nicht glauben.
Francesco räusperte sich. »Was hast du jetzt vor?«, fragte er auf Sizilianisch. »Ich nehme an, du gehst zurück nach Hause?«
Giuliana sah zu Turi, als könnte er für sie antworten.
Vor fünf Jahren hätte sie nicht gezögert. Sie hätte die Gelegenheit ergriffen, um nach Hause zurückzukehren. In ihrem ersten Jahr in San Francisco hatte sie sich nach vielen Dingen aus Santa Flavia gesehnt: dem Essen ihrer Mutter, dem vertrauten Anblick der alten Männer, die auf dem Marktplatz Boccia spielten, und ihren jüngeren Geschwistern, deren kleine Körper sich nachts an sie drängten. Aber mit jedem Jahr, das verging, hatte das Heimweh abgenommen, bis sie kaum noch wusste, wo sie hingehörte. Würde sie sich mit ihrer amerikanischen Denkweise, wie Turi es genannt hatte, wie eine Außenseiterin fühlen?
»Ich weiß es nicht.« Sie betrachtete das Bild ihrer Eltern im Sarg. »Was würde mit meiner Familie geschehen, wenn ich nach Hause fahre?« Dann wären sie genauso schlimm dran wie vor fünf Jahren, bevor sie und Turi nach Amerika gegangen waren. Vielleicht sogar schlimmer, denn als Frau konnte Giuliana nicht wie Turi für ihre Mutter und ihre Geschwister sorgen. Auf Sizilien gab es keine Arbeit für Frauen.
»Du willst also bleiben? Ganz allein, in Amerika?«, fragte Nedda mit großen Augen.
Giulianas Kehle schnürte sich zusammen, bis sie kaum noch atmen konnte. »Ich muss es tun. Zumindest für eine Weile, bis meine Geschwister älter sind.«
»Aber wie willst du genug Geld verdienen, um sie alle durchzufüttern?«
Giuliana grub die Zähne in ihre Unterlippe. »Ich weiß es nicht. Vielleicht …« Sie sah Francesco mit hoffnungsvollem Blick an. »Vielleicht könnte ich dir helfen, deine Fische zu verkaufen. Man sagt mir immer wieder, wie gut mein Englisch ist. Mir ist aufgefallen, dass Ida, Tommasos amerikanische Frau, mehr Fische verkauft als alle anderen und ihr die Restaurantbesitzer mehr bezahlen, deshalb habe ich sie gebeten, mir die Sprache beizubringen. Ihr wisst ja, dass die Leute einen gern betrügen und zu wenig für die Krabben bezahlen, wenn sie glauben, dass wir nur ungebildete Tölpel sind.«
Francesco seufzte. »Giuliana, ich … Ich möchte dir gern helfen, aber ich verdiene kaum genug, um meine eigene Familie durchzubringen.«
»Ich verstehe.« Giuliana versuchte, nicht den Kopf hängen zu lassen. »Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen.«
Er drückte kurz ihre Finger. Seine Hände mit ihren Schwielen fühlten sich so sehr wie Turis an, dass ihr erneut Tränen in die Augen traten. »Ist schon in Ordnung. Eine Sache kann ich für dich tun. Ich könnte dir das Boot abkaufen. Das Geld würde dir eine Weile reichen … oder du könntest davon die Reise zurück nach Sicilia bezahlen.«
Das Boot verkaufen … Turis Boot. Bei dem Gedanken schien sich eine eiskalte Hand um Giulianas Herz zu legen und langsam zuzudrücken. Nein, das konnte sie nicht tun, auch wenn Francescos Vorschlag vernünftig klang. »Ich kann nicht. Noch nicht.«
»Ich verstehe.« Francesco erhob sich. Er und seine Frau küssten Giuliana auf beide Wangen und versprachen, zusammen mit den anderen Fischern pünktlich zur Prozession zum Friedhof zu erscheinen.
Dann ließen sie Giuliana allein mit Turi und ihrer Verzweiflung zurück. Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie ganz auf sich gestellt. Die anderen sizilianischen Familien in der Stadt würden ihr auch nicht helfen können. Niemand hatte genug Geld übrig. Was sollte sie also tun?
Sie beugte sich über den Sarg und küsste ein letztes Mal Turis kühle Stirn. »Ich werde hierbleiben«, flüsterte sie ihm auf Sizilianisch zu. »Ich werde Arbeit in einer Fabrik oder bei einer Familie finden.«
Aber das war leichter gesagt als getan. Wie die meisten anderen Frauen in ihrem Dorf konnte Giuliana nicht lesen und schreiben. Wie sollte sie die Stellenanzeigen in den Zeitungen lesen?
KAPITEL 2
Winthrop-Anwesen
Nob Hill
San Francisco, Kalifornien
21. März 1906
Heute war es so weit. Vor Vorfreude und Nervosität kribbelte es Kate am ganzen Körper, als sie das Speisezimmer betrat. Sie hoffte, sie würde beim Frühstück still sitzen können. Ihre Mutter hasste es, wenn sie herumzappelte. Sie setzte sich an den Mahagonitisch, zog den Silberring von der Serviette und legte sie über ihren Schoß. »Guten Morgen, Mutter. Morgen, Vater.«
Ihr Vater sah von seiner Zeitung auf. »Guten Morgen.«
Wenn sie Glück hatte, würde sie bald die Fotografien für genau diese Zeitung machen. Beim Gedanken daran wurde ihr fast schwindelig.
Ihre Mutter erwiderte ihren Gruß, hielt den Blick aber stirnrunzelnd auf ihren Teller gerichtet. »Der Schinkenspeck ist schon wieder kalt.« Sie durchbohrte ihn mit der Gabel. »Man könnte meinen, Obedience hätte endlich gelernt, das Essen zu servieren, solange es noch warm ist. Ich habe es ihr schon tausendmal gesagt. Wenn es nicht so schwer wäre, ordentliche Dienstboten zu finden, würde ich sie kurzerhand hinauswerfen.«
»Obedience kann die ganze Arbeit nicht allein bewältigen«, sagte Kate.
»Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht versucht, ein weiteres Dienstmädchen anzustellen. Du weißt genau, wie schwer es heutzutage ist, ein zuverlässiges Mädchen zu finden.« Ihre Mutter schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Viele junge Frauen arbeiten stattdessen lieber in den Fabriken im Arbeiterviertel.«
»Warum stellen wir nicht einfach einen chinesischen Hausdiener an?« Kate griff nach dem Krug und goss ein wenig Sahne über ihren Haferbrei. »Die Harringtons haben einen und sie scheinen sehr zufrieden mit ihm zu sein.«
Das Stirnrunzeln ihrer Mutter vertiefte sich. »Du weißt genau, dass ich die Chinesen nicht mag. Sie sind nicht vertrauenswürdig.«
Kate streute Zucker über ihre Haferflocken. »Woher willst du das wissen, wenn du noch nie einen angestellt hast?«
»Das weiß jeder«, antwortete ihre Mutter. »Ist es nicht so, Cornelius?«
Ohne von seiner Zeitung aufzusehen, nickte ihr Vater. »Das Problem sollten wir bald gelöst haben. Unsere Anzeige ist heute wieder in der Zeitung und diesmal haben sie den Hinweis auf einen großzügigen Lohn hinzugefügt, so wie ich es gesagt habe. Seht ihr?« Er drehte die Zeitung um und zeigte ihnen die Stellenanzeigen.
Ihre Mutter schob den Teller mit dem kalten Schinkenspeck beiseite. »Ich hoffe, dass sich diesmal ein kompetentes Mädchen melden wird.«
Die Standuhr in der Diele schlug neun.
Noch ehe sie zehn schlug, würde Kate entweder die neueste Mitarbeiterin des San Francisco Call sein oder sich niedergeschlagen auf den Nachhauseweg machen.
Ihr Vater faltete die Zeitung und trank seinen Kaffee aus. »Ich fahre jetzt ins Büro. Die Millicent legt morgen nach Shanghai ab und ich will sichergehen, dass die Ladung vollständig ist.«
Die Erwähnung des Schiffs, das den Namen ihrer Mutter trug, ließ deren Gesichtszüge etwas weicher werden.
Schnell schluckte Kate den letzten Löffel ihres Haferbreis herunter und sprang dann auf. »Ich komme mit. Ich muss einige Dinge in der Market Street erledigen.«
Die feine Porzellantasse ihrer Mutter klapperte auf dem Unterteller. »Aber ich brauche dich hier, wenn die Bewerber für die Dienstmädchenstelle kommen. Was hast du denn in der Market Street zu erledigen, das wichtiger als das sein könnte?«
»Ich bin sicher, du wirst dich für die beste Kandidatin entscheiden«, antwortete Kate, ohne auf die Frage ihrer Mutter einzugehen. Wenn ihre Mutter wüsste, dass Kate zum Call-Gebäude wollte, um nach einer Anstellung als Fotografin zu bitten, würde sie Kate nur davon abhalten. Anfangs hatte sie nichts gegen Kates Hobby gehabt, doch inzwischen hielt sie es für eine unnatürliche Obsession, die eine junge Dame ihres gesellschaftlichen Standes nicht haben sollte. Sie wollte, dass ihre Tochter im Salon Tee trank, für einen wohltätigen Zweck häkelte und sich von jungen Herren aus reichen Familien den Hof machen ließ.
Doch eine solche Existenz war für Kate viel zu langweilig. Sie verbrachte ihre Zeit lieber in der Dunkelkammer. Es musste doch mehr im Leben geben, als nur in eine wohlhabende Familie einzuheiraten. Genau genommen wollte sie überhaupt nicht heiraten, aber es war besser, das ihrer Mutter nicht zu sagen.
»Aber wie willst du allein nach Hause zurückkommen?«, fragte ihre Mutter.
»Ich nehme das Cable Car. Es hält direkt vor dem Fairmont-Hotel und ich muss nicht weit laufen«, sagte Kate. Sie wusste, dass ihre Mutter es nicht mochte, wenn sie wie eine gewöhnliche Arbeiterin ohne männliche Begleitung auf der Straße herumlief.
Kate seufzte. Manchmal fragte sie sich, ob das Geld ihrer Familie ihr wirklich mehr Freiheiten einbrachte im Vergleich zu ihren Dienstmädchen oder anderen Frauen der Arbeiterschicht.
»Kate«, rief ihr Vater aus der Diele. »Kommst du?«
Ohne einen weiteren Einwand ihrer Mutter abzuwarten, verließ Kate hastig das Speisezimmer.
Kate bat ihren Vater, das Automobil vor dem Emporium zwischen der Fourth Street und der Fifth Street anzuhalten. Den Rest des Weges würde sie zu Fuß zurücklegen und ihn glauben lassen, sie würde ins Kaufhaus gehen.
Sie sprang vom Wagen, ohne auf die Hilfe ihres Vaters zu warten, und trat auf den Bürgersteig. »Danke.«
»Gib nicht zu viel Geld aus«, sagte er.
»Werde ich nicht.« Ganz im Gegenteil. Wenn alles nach Plan lief, würde sie bald eigenes Geld besitzen und nicht mehr auf das Geld ihres Vaters angewiesen sein.
Sie sah zu, wie er seinen Packard, Modell N, in Bewegung setzte und eine Pferdedroschke überholte, bevor er seinen Weg zu seinem Büro am Ende der Market Street fortsetzte. Einen Moment lang stand sie mitten auf dem Bürgersteig von San Franciscos Hauptstraße. Hohe Gebäude – Hotels, Banken, Restaurants und Geschäfte – säumten die breite Allee auf beiden Seiten. Ein Cable Car rumpelte die Mitte der Straße hinab, während Pferdekutschen, Automobile und Fahrräder die äußere Fahrbahn benutzten. Zeitungsjungen rannten zwischen den Fahrzeugen herum, überquerten verwegen die Straße und sprangen manchmal auf die Trittbretter der Cable Cars oder Automobile auf.
Eine Weile sah sie dem Treiben zu, bevor sie sich auf den Weg zu der Kreuzung machte, wo Market, Kearny und Third Street zusammentrafen. Hier hatten die drei führenden Zeitungen der Stadt, der Chronicle, der Call und der Examiner, ihre Büros.
Kate ignorierte das Chronicle-Gebäude mit seinem Glockenturm und den Examiner mit seinen spanischen Dachziegeln. Heute Morgen hatte sie nur ein Ziel: das Spreckels-Gebäude, wo der San Francisco Call beheimatet war. Mit seinen achtzehn Etagen war es das höchste Gebäude westlich von Chicago. Die Terrakottakuppel ließ es wie eine gekrönte Königin wirken, die über ihren Untertanen aufragte.
Kate sah hinauf zu dem Sandsteinturm. Nur einmal war sie dort oben gewesen, als sie mit einem ihrer Verehrer im Restaurant ganz oben im Gebäude gespeist hatte. Der Ausblick über die Stadt war unvergesslich gewesen, während ihr Begleiter sie weniger beeindruckt hatte.
Heute jedoch war sie nicht hier, um den Ausblick oder das Essen zu genießen. Sie marschierte durch die marmorne Eingangshalle zu den Fahrstühlen.
Zwei Männer traten nach ihr ein. Einer von ihnen trug einen Presseausweis am Aufschlag seines Mantels.
Kate starrte ihn sehnsüchtig an. Sie würde alles tun, um mit einem solchen Ausweis das Gebäude wieder zu verlassen.
Die Fahrstuhltüren glitten mit einem lauten Klingeln auseinander und die beiden Männer überließen ihr höflich den Vortritt.
Tief durchatmen. Zeig ihnen nicht, wie nervös du bist. Kate straffte die Schultern, ehe sie den Aufzug verließ.
Die Zeitungsredaktion war eine Welt für sich – eine Welt, zu der sie gehören wollte.
Ein Geräuschkonzert prasselte auf sie ein, sobald sie eintrat. Das Klappern von Schreibmaschinen hallte von den Wänden wider. Telegrafenleitungen klickten und irgendwo klingelte ein Telefon. Boten und Telegrammjungen rannten zwischen den Schreibtischreihen herum. Einige der Arbeitsplätze waren zu dieser Tageszeit noch leer, aber zehn Reporter und Redakteure saßen über ihre Schreibmaschinen gebeugt und hämmerten auf die silbernen Tasten ein. Zigarettenrauch stieg auf und füllte den Raum mit Dunst. Der Geruch von Tabak und Rauch vermischte sich mit dem von Tinte und Papier.
Die meisten der Reporter waren Männer, die mit aufgekrempelten Hemdsärmeln und gelockerten Krawatten arbeiteten. Kate entdeckte nur eine einzige Frau.
Das wird sich hoffentlich bald ändern. Mit erhobenem Kopf schritt sie an den Schreibtischen vorbei und klopfte an eine Tür, an der in Großbuchstaben CHEFREDAKTEUR stand. Das Klappern der Schreibmaschinen übertönte jedes andere Geräusch. Hatte jemand »herein« gerufen? Sie konnte es nicht sagen und an der Tür lauschen konnte sie auch schlecht.
Ein letztes tiefes Durchatmen, dann griff sie nach der Messingtürklinke, in die die Initialen von Claus Spreckels, dem Besitzer des Gebäudes, eingraviert waren. Sie öffnete die Tür und schielte in den Raum.
Ein Mann mit kräftiger Statur saß hinter einem Schreibtisch, der unter der Last mehrere Papierstöße zu ächzen schien. Er zog an einer Zigarre, was seinen grauen Zwirbelbart zucken ließ.
»Guten Morgen, Mr. Fulton. Mein Name ist Kathryn Winthrop. Hätten Sie kurz Zeit für mich?«
Der Chefredakteur sah von seinem chaotischen Schreibtisch auf. »Wenn es um eine Anzeige oder Ihr Abonnement geht …«
»Nein, es geht um etwas anderes.« Kate betrat das Büro und schloss die Tür hinter sich. Nun musste sie nicht mehr schreien, um den Lärm der Zeitungsredaktion zu übertönen. Sie sah sich einen Moment lang um und nahm die Aktenschränke und die gerahmten Zeitungsausgaben an den Wänden zur Kenntnis, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem Mann hinter dem Schreibtisch zuwandte.
Er runzelte die Stirn, schob die Zigarre in den anderen Mundwinkel und musterte sie durch den Rauchschleier hindurch. »Sind Sie nicht Cornelius Winthrops jüngste Tochter?«
»Seine einzige Tochter«, sagte Kate. »Aber deshalb bin ich nicht hier.« Sie wollte nicht, dass er sie einstellte, nur weil ihrem Vater die größte Reederei der Westküste gehörte. »Ich bin hier, weil ich gern für den Call arbeiten würde.«
»Nun ja, ich bin nicht sicher, ob wir im Moment eine weitere Sekretärin benötigen, aber ich kann mich gern für Sie erkundigen und Sie wissen lassen, wenn wir eine offene Stelle haben.« Er wandte sich wieder seiner Arbeit zu.
Kate trat näher an den Schreibtisch heran. »Sie missverstehen meine Absichten, Mr. Fulton. Ich suche nicht nach einer Stelle als Sekretärin. Ich möchte gern als Fotografin arbeiten.«
Zum ersten Mal nahm er die Zigarre aus dem Mund und hielt sie zwischen seinen dicken Fingern, während er sie anstarrte. Seine buschigen Augenbrauen zogen sich zusammen. »Fotografin?«, wiederholte er, als hätte sie gesagt, sie wolle sich Flügel wachsen lassen und zum Mond fliegen.
Kate stand mit erhobenem Haupt da. »Ich habe ein wenig mit Planfilm und Rollfilm experimentiert, aber hauptsächlich verwende ich Trockenplatten. Ich entwickle meine Bilder selbst. Ich habe Ihnen auch Kostproben meiner Arbeit mitgebracht, damit Sie sich selbst von ihrer Qualität überzeugen können.« Sie öffnete ihre bestickte Tasche, nahm ihre besten Fotografien heraus und hielt sie ihm hin.
Mr. Fulton machte keine Anstalten, den Stapel entgegenzunehmen oder auch nur einen Blick auf die oberste Aufnahme zu werfen. »Miss Winthrop …« Als er die Hand hob, fiel Asche auf seinen Schreibtisch. Mit einer geistesabwesenden Handbewegung wischte er sie weg. »Ich glaube Ihnen gern, dass Ihre Fotografien ausgesprochen … hübsch sind.«
Hübsch? Die Art, wie er das sagte, ließ Kate die Stirn runzeln.
»Fotografie ist ein netter Zeitvertreib für eine Dame wie Sie, aber ich glaube kaum, dass es angemessen wäre, wenn Sie Bilder von den Vorfällen machen würden, über die wir berichten«, sagte Fulton. »Eine Dame muss sich über solche Dinge nicht den Kopf zerbrechen.«
Kate biss die Zähne zusammen. Sie versuchte, ruhig und bestimmt zu sprechen, als sie sagte: »Ich bin eine treue Leserin Ihrer Zeitung. Wenn ich mir solche Fotografien ansehen kann, sehe ich nicht ein, warum ich sie nicht auch selbst machen könnte.«
Sein Stuhl ächzte, als er sich zurücklehnte und den Kopf schüttelte. »Das ist nicht dasselbe. Das Zeitungsgeschäft ist zu hart für das weibliche Gemüt.«
»Aber Sie haben doch eine Reporterin.« Kate deutete zur Redaktion, die hinter seiner Bürotür lag. »Und ich bin sicher, sie macht ihre Arbeit gut.«
»Miss Gardner schreibt über Mode, Kunst und Haushaltsangelegenheiten, aber unsere übrigen Reporter und unsere Fotografen sind rund um die Uhr auf der Straße unterwegs. Sie müssten Aufnahmen von Verbrechen, Skandalen und unangenehmen Vorfällen machen.«
»Dazu bin ich bereit«, sagte Kate. »Geben Sie mir eine Chance und ich werde mich innerhalb eines Monats beweisen. Sie müssten mich nicht einmal bezahlen, bevor Sie sich von meinem Können überzeugt haben.«
Mr. Fulton stieß einen Seufzer aus, der seinen Schnurrbart erzittern ließ. »Ich weiß Ihren Enthusiasmus durchaus zu schätzen, Miss Winthrop, aber Sie sollten ihn in einem Bereich einsetzen, der sich für eine Dame ziemt. Ihr Vater stimmt mir da sicher zu.«
Leider würde er das wohl. Mit hängendem Kopf stand Kate vor seinem Schreibtisch. Was konnte sie sonst noch sagen, um ihn umzustimmen?
»Wenn Sie mich nun bitte entschuldigen würden, ich muss wieder an die Arbeit. Eine Zeitung schreibt sich nicht von alleine.« Er schob seine Zigarre zurück in den Mund.
Kate war hier offenbar nicht erwünscht. Sie starrte ihn sekundenlang an, bevor sie zur Tür schlurfte.
Als sie nach draußen trat, sah die Journalistin von dem Artikel über Mode, Kunst oder Haushaltsangelegenheiten auf, an dem sie gerade arbeitete. Durch den Rauch im Raum sahen sie einander an.
Als wüsste sie, was eben geschehen war, sandte Miss Gardner ihr ein mitleidiges Lächeln.
Einige Minuten später trat Kate zurück in das Chaos auf der Market Street.
Vielleicht hätte sie mit einer solchen Reaktion rechnen sollen, aber sie hatte geglaubt, der Chefredakteur des Call wäre anders. Immerhin befürwortete der Call das Wahlrecht für Frauen. Aber scheinbar bezog sich das nur auf das Recht zu wählen, nicht auf das Recht, im Zeitungsgeschäft zu arbeiten.
Was sollte sie nun tun? Sie sah hinüber zum Gebäude des Examiner. Sollte sie dort ihr Glück versuchen? Oder vielleicht beim Chronicle?
Aber vermutlich würde die Antwort dieselbe sein. Auch deren Chefredakteure würden glauben, dass Frauen keine Aufnahmen von Verbrechen, Skandalen oder anderen unschönen Ereignissen machen sollten … oder konnten. Niemand würde sich ihre Bilder auch nur ansehen.
Sie wollte in die Welt hinausrufen, wie ungerecht es doch war, aber die Leute würden sie nur anstarren und irgendjemand würde ihren Eltern erzählen, wie unziemlich sie sich benommen hatte.
Seufzend stapfte sie zur Cable-Car-Haltestelle, um nach Hause zurückzufahren.
KAPITEL 3
South of Market
San Francisco, Kalifornien
21. März 1906
Giuliana ging die Sixth Street entlang, vorbei an einer Reihe billiger Hotels und Pensionen, und hielt dabei Ausschau nach jemandem, der ihr helfen konnte. Irgendjemand musste die Stellenanzeigen in der Zeitung doch lesen können, oder?
Doch um sich herum hörte sie nur unvertraute Sprachen. Ein Gemüseverkäufer, der seinen Handwagen vor sich herschob, pries seine Waren vermutlich auf Deutsch an. Die Jungen, die in der Gasse Baseball spielten, hörten sich Polnisch an und der Besitzer der chinesischen Wäscherei auf der anderen Straßenseite würde die englischsprachige Zeitung sicher auch nicht lesen können. War man südlich der Market Street, konnte man kaum glauben, dass man sich in einer amerikanischen Stadt befand.
Vielleicht würde sie in der Market Street mehr Glück haben.
Schließlich entdeckte sie einen Zeitungsjungen auf der anderen Straßenseite.
Sie wich einem klingelnden Cable Car aus und einem Straßenfeger, der Pferdeäpfel vom Kopfsteinpflaster kehrte.
Der Zeitungsjunge wedelte mit der neuesten Ausgabe und schrie die Nachrichten des Tages hinaus.
Als Giuliana vor ihm stehen blieb, hielt er die Hand auf. »Das macht fünf Cent, Miss.«
»Ich nicht brauche die ganze Zeitung. Nur der Teil mit die Anzeigen.«
»Fünf Cent«, wiederholte er und streckte noch immer die Hand aus.
Jeder Cent, den sie ausgab, war ein Cent weniger, der ihren jüngeren Geschwistern zugutekam, aber falls sie keine Arbeit fand, würden ihre Geschwister nichts zu essen bekommen. Seufzend drückte sie dem Jungen die Münze in die Hand.
Er gab ihr eine Zeitung und fuhr fort, die Schlagzeilen zu verkünden.
»Bitte.« Giuliana hielt ihn am Ärmel fest, damit er nicht weitergehen konnte. »Bitte hilf mir. Ich suche Arbeit, aber ich nicht kann lesen. Bitte lies mich die Anzeigen.«
Er setzte dazu an, den Kopf zu schütteln, deshalb fügte sie schnell hinzu: »Oh. Ich verstehe. Du nicht kannst lesen. Tut mir leid. Ich dich nicht wollte beschämen.«
Er reckte die Brust. »Natürlich kann ich lesen.«
»Ist schon in Ordnung.« Sie tätschelte seine Schulter. »Ich nicht werde erzählen die anderen Jungen.«
Er stampfte mit dem Fuß. »Aber ich kann lesen. Ich schwöre es.«
»Dann zeig mir. Lies mich die Anzeigen«, sagte Giuliana.
Als er die Zeitung entfaltete, verkniff sie sich ein Grinsen. Männlicher Stolz war überall auf der Welt derselbe. Oft hatte sie mit dieser Strategie ihre Brüder dazu überlistet, zu tun, was sie wollte. Sie stellte sich neben ihn und blickte auf die lange Liste der Anzeigen. Gut. Scheinbar gab es keinen Mangel an Stellenangeboten in San Francisco.
Papier raschelte, als er die Zeitung anhob und ihr die Anzeigen vorlas.
Je mehr sie hörte, desto entmutigter wurde Giuliana. Die erste Stellenanzeige verlangte Erfahrung in Büroarbeiten. Die zweite suchte nach einer Krankenschwester. In der dritten wollte jemand ein deutsches oder schwedisches Mädchen und die vierte war auf der Suche nach einer Stenografin. Giuliana wusste nicht einmal, was das war. Sie wusste nur, dass sie für keine dieser Stellen geeignet war.
Schließlich tippte der Junge mit dem Finger auf die letzte Anzeige. »Für sofort gesucht: ein ordentliches, sauberes Mädchen guten Charakters für Hausarbeiten in einer dreiköpfigen Familie.«
Giuliana schöpfte wieder Hoffnung. Mit Hausarbeit kannte sie sich aus.
»Guter Lohn«, las der Junge weiter. »Interessenten werden mit Referenzen vorstellig in der California Street 1075.«
»Guter Lohn«, flüsterte Giuliana. Das klang genau nach dem, was sie brauchte. Einen dreiköpfigen Haushalt zu versorgen, sollte auch kein Problem sein. Wenn man Nonna mitzählte, waren sie zu Hause zu neunt gewesen. Sie hatte Mamma geholfen, ihre drei jüngeren Schwestern und den kleinen Antonino zu versorgen, seit sie zurückdenken konnte. »California Street? Wo ist das?«
»Auf dem Nob Hill, wo die reichen Pinkel wohnen.« Er zeigte nach Norden.
»Pinkel?«
Er nickte. »Die stinkreichen Leute, die ihre Villen während dem Goldrausch von 1849 da oben gebaut haben.«
Giuliana zuckte mit den Schultern. Während ihrer fünf Jahre in San Francisco war sie mit den meisten Teilen der Stadt vertraut geworden, denn sie hatte Turi beim Ausliefern von Fischen und Krabben geholfen, aber dabei war sie nie in die Nähe der Villen reicher Familien gekommen.
Sie dankte dem Jungen und machte sich auf den Weg zur Cable-Car-Haltestelle. Bei jedem Schritt murmelte sie die Adresse, um sie nicht zu vergessen. Gut, dass sie beim Krabbenverkaufen am Hafen gelernt hatte, Zahlen zu lesen. Nun musste sie den Schaffner nur bitten, ihr zu sagen, wenn sie die California Street erreichten, dann würde sie das Haus schon finden.
Als sie an der Haltestelle ankam, war der Schaffner gerade dabei, mit der Hilfe mehrerer wartender Fahrgäste das Cable Car auf der Drehscheibe zu wenden. Rasch kletterten die Leute an Bord, sodass das Cable Car bald bis auf den letzten Platz voll war.
Giuliana blieb nichts anderes übrig, als sich auf das Trittbrett zu stellen und an einer der Stangen festzuklammern. Sie gab die Münze für die Fahrkarte dem uniformierten Schaffner und versuchte nicht daran zu denken, wie viel Geld sie heute ausgab. Wenn die wohlhabende Familie sie einstellte, dann wäre das jeden Cent wert gewesen.
Der Fahrzeugführer läutete die Messingglocke und legte die Hebelstange zurück.
Als sie neu in der Stadt gewesen war, hatte das Gefährt sie verwirrt. Wie konnte es die steilen Hügel hinauffahren, ohne von Pferden gezogen zu werden oder, wie die neumodischen Automobile, einen Motor zu haben? Inzwischen wusste sie, dass der Wagen sich mit dem Umlegen der Hebelstange in ein dickes Kabel einhakte, das unterirdisch verlief und das Cable Car mitzog.
Der Wagen ratterte die Straße hinauf. Als der Hügel steiler wurde, musste sich Giuliana stärker an der Stange festklammern.
Nach weniger als zehn Minuten erklomm das Cable Car Nob Hill. Der Fahrzeugführer schwang die Hebelstange nach vorn, sodass die Bahn zum Stehen kam.
»California Street«, rief der Schaffner und zeigte auf die Straße, die quer zu den Schienen verlief.
Giuliana stieg aus.
Als das Cable Car ratternd den Hügel zum Hafen hinabraste, stand Giuliana noch kurz da und sah sich um.
Der Ausblick vom Hügel war atemberaubend. Im Süden, woher sie gekommen war, glänzte die bronzene Kuppel des Rathauses in der Sonne, die langsam durch den Nebel brach. Im Osten lag das exotische Chinatown und dahinter der Finanzdistrikt. Im Norden, jenseits des Russian Hill, konnte sie das graublaue Wasser der Bucht und des Golden Gates ausmachen. Die Segel der Boote wirkten wie winzige weiße Punkte.
Sehnsucht überkam sie. Sie wollte dort draußen am Pier sein und die Meerluft einatmen, während sie darauf wartete, dass Turi mit seinem nächtlichen Fang heimkehrte.
Dann schüttelte sie streng den Kopf. Turi würde nie wieder zurückkommen und ihre Zukunft lag hier, nicht unten am Hafen, jedenfalls wenn es ihr gelang, die Anstellung bei der reichen Familie zu bekommen. Sie zwang sich, den Blick von der Bucht abzuwenden, und sah nach Westen. Nach den Nummern auf den Häusern zu ihrer Linken und Rechten zu schließen, musste sie in diese Richtung gehen.
Sie raffte ihren Rock und bewahrte mit der freien Hand ihren Strohhut davor, vom Wind davongetragen zu werden. Entschlossen überquerte sie die Straßenbahnschienen und ging in westlicher Richtung die California Street hinauf. Es war eine steile Kletterpartie, die sie nach Luft schnappen ließ. Vielleicht waren es aber auch die prachtvollen Anwesen, die ihr den Atem raubten. Je höher sie kam, desto größer und majestätischer wurden die Häuser.
Zu ihrer Rechten nahm ein Gebäude einen ganzen Straßenblock ein. Den Namen auf dem großen Schild konnte sie nicht lesen, doch das Wort daneben war ihr vertraut, denn die Pensionen in ihrer Straße hatten dieselbe Aufschrift: Hotel. Mit seinen weißen Granitwänden sah das siebenstöckige Gebäude wie ein Palast aus. Ein Schild auf dem Dach verkündete etwas, das Giuliana nicht lesen konnte. Die Handwerker, die mit Werkzeugen und Farbeimern ein und aus gingen, ließen Giuliana vermuten, dass es sich um eine Ankündigung der Neueröffnung handelte.
Das Gebäude zu ihrer Linken war sogar noch eindrucksvoller. Mit seinen Rundbogenfenstern, Türmchen, Giebeln und Erkern erinnerte es Giuliana an eine mittelalterliche Burg. Zwei Männer trugen ein riesiges Ölgemälde zu einem der Eingänge.
Mit offenem Mund ging Giuliana weiter. Als sie oben auf dem Hügel ankam, wurde die Straße flacher. Sie ging vorbei an einem riesigen Sandsteinhaus und einem Granitpalast, dessen Eingang von zwei Marmorlöwen bewacht wurde.
Ihr Herz klopfte schneller, als sie sich dem Haus mit der Nummer 1075 näherte. An der Straßenecke blieb sie stehen. Da war es. Unter den wachsamen Blicken der beiden Steinlöwen stand eine riesige Marmorvilla. Ein schmiedeeiserner Zaun umgab das Grundstück. Giuliana schielte durch die Gitterstäbe und bewunderte die Rosenbüsche, die hinter dem Tor wuchsen.
Würde sie hier wohnen dürfen? Bisher kannte sie nur ihre Fischerhütte in Santa Flavia und das winzige Zimmer in der Arbeiterpension. Sie konnte sich kaum vorstellen, wie es sein musste, in einer solchen Villa zu leben.
Beeil dich lieber, bevor dir ein anderes Mädchen die Stelle wegschnappt!
Mit einem Kloß im Hals öffnete sie das Tor und ging den breiten, gepflasterten Weg entlang, bis sie die kreisförmige Auffahrt vor der Villa erreichte. Langsam stieg sie die Granittreppe hinauf. Auf der obersten Stufe nahm sie sich einen Moment Zeit, den parkähnlichen Garten um das Haus herum zu bewundern, bevor sie sich der Pforte zuwandte, die auf beiden Seiten von vier verschnörkelten Säulen flankiert wurde.
Der obere Teil der Eingangstür bestand aus buntem Glas, das ein Segelschiff auf dem Meer darstellte.
Giuliana lächelte und nahm es als gutes Omen. Sie atmete tief durch und griff nach dem schweren Türklopfer. Ihr pochendes Herz war fast lauter als das Klopfen gegen das Holz. Sie bemühte sich, nicht herumzuzappeln, während sie wartete.
Ein Mann in einem schwarzen Anzug öffnete. Er sah auf sie herab und sein Blick glitt über ihr einfaches schwarzes Kleid und den mitgenommenen Strohhut.
Falls das der Herr des Hauses war, verhieß sein geringschätziger Blick nichts Gutes.
»Guten Morgen«, sagte sie so würdevoll, wie sie konnte. »Mein Name ist Giuliana Russo. Ich bin hier für die Stelle. Ist sie noch frei?«
»Sie ist in der Tat noch unbesetzt. Ich werde anfragen, ob Mrs. Winthrop dich empfängt. Warte hier.« Er deutete auf die Eingangshalle und ging dann den langen Gang hinab.
Also war er ein Diener oder ein Angestellter, nicht der Hausherr.
Mit dem Strohhut in der Hand trat Giuliana ein und schloss die schwere Tür hinter sich. Die runde Eingangshalle war so groß wie das Haus ihrer Familie. Ein riesiger Kronleuchter hing von der hohen Decke. Sein Licht spiegelte sich im glänzenden Marmorboden. Die silbernen Kerzenhalter auf dem Tischchen neben der Tür mussten mehr wert sein als Turi und sie innerhalb eines ganzen Jahres mit ihren Krabben verdient hatten. Eine mit rotem Teppich ausgelegte Wendeltreppe mit Mahagonigeländer führte hinauf in den zweiten Stock.
Der Diener kehrte zurück. »Mrs. Winthrop empfängt dich im Salon.« Er ging voraus.
Giuliana eilte ihm nach, weil sie sich nicht in dem riesigen Haus verirren wollte.
Er öffnete eine Tür und bedeutete ihr, einzutreten.
Mit wackeligen Knien und feuchten Händen betrat Giuliana den Salon. Ein kleiner Tisch und drei Stühle nahmen die Mitte des Raums ein, während in einer Ecke ein Schaukelstuhl stand. Marmorbüsten und Porzellanvasen mit winzigen Goldrosen zierten auf Hochglanz polierte Mahagonitische. Ölbilder und Aquarellzeichnungen hingen an den Wänden. Eine der erstaunlichen Erfindungen der Amerikaner, elektrische Glühbirnen, ließen den Kronleuchter hell erstrahlen.
Giulianas Blick glitt zu der einzigen Person im Raum. Eine schlanke Dame mittleren Alters, gekleidet in ein fliederfarbenes Kleid mit hohem Spitzenkragen, erhob sich aus einem grünen, samtbezogenen Sessel.
Der Diener schloss die Tür und ließ sie allein. Schweigen breitete sich im Salon aus, das nur vom Ticken der Uhr auf dem Marmorsims unterbrochen wurde.
Die Dame musterte sie eingehend, sodass Giuliana Angst hatte, sie würde als ungenügend eingestuft werden.
Schließlich konnte sie die Stille nicht mehr ertragen. Gerade, als sie etwas sagen wollte, fragte Mrs. Winthrop: »Du bist nicht von hier, oder?«
War das für Mrs. Winthrop gut oder schlecht? »Nein. Ich komme von Sicilia vor fünf Jahren«, sagte Giuliana mit einem vorsichtigen Lächeln. »Das ist ein sehr schöner Ort. San Francisco auch, natürlich.« Sie merkte, dass sie ins Plappern kam, was oft geschah, wenn sie nervös wurde.
Mrs. Winthrop seufzte. »Setz dich bitte.«
Giuliana tapste vorsichtig über den goldfarbenen Perserteppich, sank auf einen der Samtsessel und legte ihre verkrampften Hände in den Schoß.
»Hast du irgendwelche Referenzen mitgebracht?«, fragte Mrs. Winthrop.
»Referenzen?« Giuliana wusste nicht, was das bedeutete.
»Ein Empfehlungsschreiben von einem vorigen Arbeitgeber«, sagte Mrs. Winthrop.
Hatte das in der Stellenanzeige gestanden? Giuliana konnte sich nicht daran erinnern. Sie biss sich auf die Lippe. »Eh, nein. Ich habe keine Schreiben.«
Mrs. Winthrop hob eine ihrer Augenbrauen, die perfekt geformt und dünner als Giulianas waren. »Aber du hast doch sicherlich schon einmal in einer ähnlichen Position gearbeitet, oder nicht?«
Giuliana ließ den Kopf hängen. »Nein.« Sie schielte hinüber in Mrs. Winthrops missbilligendes Gesicht. »Aber ich habe geputzt das Zuhause von mein Bruder. Ich habe gewaschen seine Wäsche, seine Essen gekocht und seine Kleidung genäht. Ich bin sehr sauber und arbeite hart, Ma’am. Das mich haben meine Mutter und meine Großmutter gelernt. Sie haben immer gesagt: Ein sauberes Haus ist ein glückliches Haus.« Jetzt plapperte sie schon wieder.
Die Hausherrin studierte sie für eine gefühlte Ewigkeit. Schließlich sagte sie: »Zeig mir deine Hände.«
»Meine Hände?«
Mrs. Winthrop warf ihr einen tadelnden Blick zu.
Rasch streckte Giuliana die Hände aus, mit den Handflächen nach oben, anstatt weitere Fragen zu stellen. Ihre Lippen formten eine dünne Linie, als Mrs. Winthrop ihre Hände musterte.
Im Vergleich zu den eleganten Fingern der Hausherrin waren ihre Hände fast hässlich. Vor Jahren hatte eine große Krabbe ihr in den Zeigefinger gebissen und eine gezackte Narbe hinterlassen. Außerdem hatte sie sich mehrfach verbrannt, ehe sie gelernt hatte, die Krabben in den Topf mit dem kochenden Wasser gleiten zu lassen, ohne sich zu verbrühen. Das Salzwasser und der Dampf hatten ihre Haut rau und rot werden lassen.
Am liebsten hätte sie die Hände zu Fäusten geballt, um sie zu verstecken, aber Mrs. Winthrop schien zu gefallen, was sie sah.
»Gut«, sagte sie. »Ich habe festgestellt, dass Dienstmädchen mit weichen Händen sich immer als faul herausstellen.«
»Oh, nein, Ma’am. Ich bin nicht faul. Ich verspreche.« Giuliana legte ihre Hände zurück in ihren Schoß.
Die Uhr auf dem Kaminsims tickte laut vor sich hin. Schließlich nickte Mrs. Winthrop. »Nun gut, Julie. Wir versuchen es mit dir. Ich hätte gern, dass du morgen früh anfängst, wenn möglich.«
»Selbstverständlich«, antwortete Giuliana. Sie hielt es für besser, Mrs. Winthrop nicht darauf hinzuweisen, dass sie den falschen Namen verwendet hatte.
Mrs. Winthrop erhob sich und gab somit das Zeichen, dass die Unterhaltung beendet war.
Giuliana stand ebenfalls auf, zögerte aber zu gehen. Sollte sie nach der Bezahlung fragen?
Ehe sie sich entscheiden konnte, sagte Mrs. Winthrop: »Für Kost und Logis musst du selbst sorgen. Mit Ausnahme meiner persönlichen Zofe habe ich nachts nicht gern Bedienstete im Haus.«
»Oh.« Also würde sie nicht hier wohnen dürfen, sondern musste weiterhin das Zimmer in der Pension bezahlen. Sie nahm allen Mut zusammen. »Was ist mein Lohn, Ma’am?«
»Wenn wir mit deinen Diensten zufrieden sind, bezahlen wir dir vier Dollar pro Woche und natürlich die Fahrten mit dem Cable Car. Sonntags und einen Nachmittag pro Woche hast du frei.«
War das eine großzügige Bezahlung? Giuliana war sich nicht sicher, aber sie wusste, dass es weit mehr war, als Turi und sie mit einer Woche Krabbenfischen verdienten. Außerdem hatte sie bisher nie einen freien Nachmittag gehabt.
»Ich erwarte, dass du morgen früh um sechs Uhr hier bist«, sagte Mrs. Winthrop. »Unpünktlichkeit werde ich nicht dulden.«
»Ich komme um sechs Uhr, Ma’am.«
»Nun gut.« Mrs. Winthrop nickte wie eine Königin, die eine Untertanin entließ, und läutete nach dem Diener, damit er Giuliana nach draußen begleitete.
Ungeschickt machte Giuliana einen Knicks und folgte dann dem Diener den Gang hinab. Erst als sich die schwere Pforte hinter ihr geschlossen hatte, atmete sie auf. Sie hatte eine Stelle gefunden! Turi wäre stolz auf sie gewesen … zumindest hoffte sie das.
Sie ging vorbei an den Rosensträuchern, die zu dieser Jahreszeit keine Blüten trugen, und streckte die Hand aus, um das eiserne Tor zu öffnen.