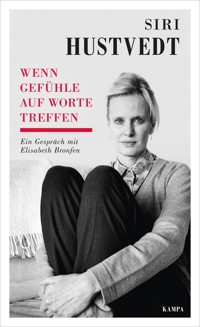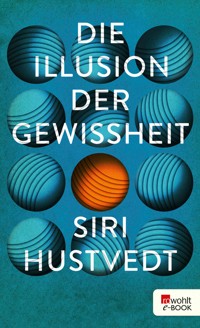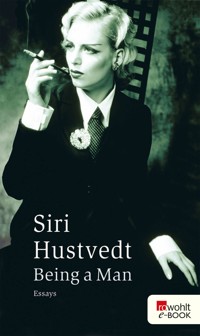
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Being a Man" spiegelt die oft überraschenden und immer treffenden Ansichten Siri Hustvedts zu Literatur, Kunst und Kultur wider. Immer leidenschaftlich, immer klar, immer ehrlich, entlarvt sie kulturelle Stereotype und lässt uns einen neuen Blick auf kulturelle und gesellschaftliche Phänomene werfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Siri Hustvedt
Being a Man
Essays
Über dieses Buch
Being a Man spiegelt die oft überraschenden und immer treffenden Ansichten Siri Hustvedts zu Literatur, Kunst und Kultur wider. Immer leidenschaftlich, immer klar, immer ehrlich, entlarvt sie Stereotype und lässt uns einen neuen Blick auf kulturelle und gesellschaftliche Phänomene werfen.
Vita
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sechs Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Der Sommer ohne Männer» und «Die gleißende Welt». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Leben, Denken, Schauen», «Nicht hier, nicht dort», «Being a Man» und «Die Illusion der Gewissheit» vor.
Impressum
Being a Man enthält alle Essays aus A Plea for Eros, bis auf Nicht hier, nicht dort (Yonder), Ein Plädoyer für Eros (A Plea for Eros) und Gatsbys Brille (Gatsby’s glasses). Diese erschienen in dem Essayband Nicht hier, nicht dort (Rowohlt Verlag).
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel «A Plea for Eros» 2006 bei Picador, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2018
Copyright © 2006 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«A Plea for Eros» Copyright © 2006 by Siri Hustvedt
Umschlaggestaltung any.way, Hamburg
Umschlagabbildung A. Inden/Corbis
ISBN 978-3-644-40016-0
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Franklin Pangborn: Eine Apologie
Acht Tage im Korsett
Being a Man
Abschied von der Mutter
Mit Fremden leben
9/11, ein Jahr danach
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Damen in Boston: Persönliche und unpersönliche Wörter
Charles Dickens und das kranke Bruchstück
Dinge sehen
Flottierende Zeichen
Wahnsinn
«Es gab gar kein Ich mehr»
Die Magie der Fiktion
Auszüge aus einer Geschichte des verwundeten Selbst
Gewidmet meiner Mutter, Esther Vegan Hustvedt
Franklin Pangborn: Eine Apologie
Ich weiß nicht mehr, wann Mr Franklin Pangborn mir zum ersten Mal auffiel. Er blieb immer eine Randerscheinung auf der Filmleinwand und hat sich durch die Häufigkeit seiner Auftritte unvergesslich gemacht. In dem einen Film taucht er plötzlich hier, im nächsten dort auf. Er beherrscht einen Augenblick oder eine ganze Szene, aber nie einen gesamten Film. Erst nachdem ich viele amerikanische Filme aus den dreißiger und vierziger Jahren gesehen hatte, wurde sein Name allmählich gleichbedeutend mit jenem gespreizten Unterlegenen, den ich mit der Zeit lieb gewann. Mir gefällt die Glaubwürdigkeit des von ihm gespielten Charakters, und mir gefällt sein Name. Dar in verbinden sich die erhabenen Konnotationen von Franklin, wie bei Ben und Roosevelt, mit dem Pathos von pang (Schmerz, Krampf, Wehen), und die Tatsache, dass dieses pang gepaart ist mit born (geboren), entzückt mich ob seiner Dickens’schen Treffsicherheit.
Mit gewissen Abwandlungen spielte Pangborn immer denselben Mann. Noch bevor er ein Wort sagte, war sein Charakter definiert. Er war der personifizierte Geizkragen und hielt sich selbst ständig in Schach. Seine Haltung war aufrecht bis zur Verrenkung: Rücken gespannt, Hintern her aus, Kinn leicht gereckt, die Gesten eine Spur hochnäsig effeminiert: Er ist der Mann, der, falls er lange genug auf der Leinwand bleibt, gedemütigt werden wird. Er führt ein lächerliches Leben, ein Leben, bestimmt von Regeln, die um jeden Preis eingehalten werden müssen, ein Leben würdevoller Selbstüberschätzung, mit vollständig zugeknöpftem Anzug, in obsessiver Sauberkeit und Korrektheit. Wenn er spricht, bläht seine Stimme sich zu Artikulierungen auf, die entschieden unamerikanisch sind. Tatsächlich ähnelt sein Tonfall verdächtig jenem anderen Englisch, das mitunter auch als King’s English bezeichnet wird. Für Amerikaner bedeutet dieser Akzent entweder echte Vornehmheit oder Dünkel. Pangborn hat die Stimme eines Schmalspursnobs.
War um aber finde ich Franklin Pangborn liebenswert? Warum bereitet mir dieser ganz und gar pingelige Mensch, der in einem Film nach dem anderen auftaucht, ein solches Vergnügen? Zum Teil, weil er sich immer wieder als untauglich erweist. In einer richtigen Machtposition wird so ein Charakter abstoßend, aber Pangborn tritt immer wieder als der «Verwalter» von etwas auf – Geschäft, Hotel, Apartmenthaus –, dessen Anweisungen durch das Tollhaus um ihn her um untergraben werden. Und doch hat sein Wunsch, die Ordnung zu wahren, Grenzen einzuhalten und die Verrücktheit anderer zu ignorieren, sowohl eine edle als auch eine bedauernswerte Dimension. Von guten Manieren geleitet, hält der steife Mann durch, oft gebeutelt, aber selten besiegt. Er ist das Inbild bedrohter Höflichkeit.
In meiner Kindheit und Jugend hatte meine norwegische Mutter bestimmte Vorstellungen von Form und fühlte sich den Zeichen bürgerlichen Lebens verbunden, die nicht immer mit den demokratischeren Idealen meines amerikanischen Vaters übereinstimmten. Vor einiger Zeit erzählte sie mir, dass man – in Norwegen jedenfalls – zum Abendessen nie Kerzen aufstellte, ohne vorher kurz den Docht angezündet zu haben. Auch durften es keine Stummel sein. Sie durften neu sein, aber die Dochte mussten geschwärzt werden, bevor die Gäste eintrafen. Ich fragte meine Mutter nach dem Grund. «Keine Ahnung», sagte sie lachend. «Es war einfach so.» Seither zünde ich selbst ebenfalls kurz die Kerzendochte an, bevor meine Gäste zum Dinner kommen. Das bringt wohl einen Pangborn’schen Aspekt meiner Persönlichkeit zum Ausdruck, einen vollkommen irrationalen Willen zur Form. Natürlich hatte mein Vater nichts gegen geschwärzte Dochte. Es ist gut möglich, dass er dieses Zeichen guter Manieren in seinen inzwischen vierundvierzig Ehejahren mit meiner Mutter nicht einmal bemerkte. Dochte waren ihre Domäne – eine, die häuslich und weiblich war.
Meine Eltern waren jedoch unterschiedlicher Meinung zum Thema Zäune, ein tiefgreifenderer Streitpunkt mit weitreichenderer Pangborn’scher Bedeutung. Meine Mutter sehnte sich nach einem Zaun um unser Grundstück in Minnesota. Für sie hatte er etwas Nostalgisches, das Tröstliche des Abgeschirmtseins, war aber auch von ästhetischem Wert. Als Europäerin fand sie Zäune normal. Mein Vater ist auf einer Farm in der Prärie aufgewachsen. Er erinnert sich an Scheunenrichtfeste, Quiltnähkränzchen und Squaredance. Zäune sperrten Kühe ein, doch das eigene Anwesen derart zu markieren hätte keinen gutnachbarlichen Eindruck gemacht. Pangborn ist ein Charakter, der sich durch Zäune definiert, durch formale Einteilungen, die abgrenzen wollen, durch Differenz, Hierarchien. In der allgemeinen amerikanischen Mythologie haben diese Zäune etwas Feminines. Franklin Pangborns Charakter steht in störrischem Gegensatz zu einem ungezwungenen, demokratischen, maskulinen Ideal, wie es durch die Linse amerikanischer Filme der 30er und 40er Jahre zu sehen ist.
Bei einem frühen Kurzauftritt in Preston Sturges’ Atemlos in Florida führt Pangborn als Verwalter eines Apartmenthauses an der Park Avenue potenzielle Mieter zur Wohnung eines Paares – gespielt von Claudette Colbert und Joel McCrea –, das in Not geraten ist und die Miete nicht bezahlt hat. Der elegante Pangborn in dunklem Anzug mit makellos weißem Einstecktuch in der Brusttasche, dient als Kontrastfigur für den fast tauben Weenie King, einen Millionär aus dem Westen in einem schäbigen hellen Mantel und mit Cowboyhut, begleitet von seiner aufgedonnerten Gattin. Ebenso ungehobelt wie reich, schlägt der King mit dem Stock gegen die Flurwände und brüllt unlogisches Zeug, während Pangborn sich alle Mühe gibt, angesichts dieses vulgären Herumblödelns seine Würde zu wahren. Der Weenie King, eine Hollywood-Phantasie vom amerikanischen Westen, kümmert sich keinen Deut um irgendwelche Formen, Benehmen oder Zäune. Zunächst beantwortet Pangborn die meisten Fragen des King mit einem ständigen «Gewiss doch», das von einem vielsagenden Räuspern unterbrochen wird – ein Tic, der bei der von Pangborn verkörperten Figur immer wieder auftritt. Es ist, als hätte sich seine ganze Missbilligung in seiner Kehle festgesetzt. Die Frau des King bemerkt, dass die Wohnung schmutzig ist. Der Verwalter stimmt ihr zu und entschuldigt sich. Aber der King äußert lautstark, dass er Dreck liebe, der sei (unter anderem) so natürlich wie «Krankheit» und «Wirbelstürme». Sturges weiß, dass Schmutz hier das entscheidende Wort ist. Pangborn ist nämlich im höchsten Grade makellos.
Nachdem ich erwachsen geworden war, begann ich zu putzen. Ich bin zu einer hingebungsvollen Sauberfrau geworden, die Böden schrubbt und Wäsche bleicht, überhaupt zu einer Feindin von Schmutz und Staub und Flecken. Es ist wahrscheinlich unnötig anzumerken, dass meine Mutter ihr ganzes Leben lang inbrünstig putzte. Mein Mann, der mich manchmal bei diesen Bemühungen ertappt – auf allen vieren in den Tiefen eines Schranks –, ruft dann gern «Aufhören!» Er sieht Ordnung und Sauberkeit langfristiger. War um eine Jacke aufhängen, wenn man sie eine Stunde später beim Verlassen des Hauses wieder anzieht? War um einen Aschenbecher leeren, wenn noch ein weiterer Zigarrenstummel hineinpasst? Ja, war um eigentlich? Ich räume auf und mache sauber, weil ich gern die Umrisse jedes Objekts um mich her um deutlich erkenne und weil ich in meinem häuslichen Leben gegen Ungenauigkeit, Zweideutigkeit, Wirbelstürme und Verfall (wenn nicht gar Krankheit) ankämpfe. Es ist eine klassisch weibliche Haltung, was nicht heißen soll, dass sie nicht auch von jeder Menge Männer geteilt wird. Ich weiß nicht, ob man Pangborn in einem Film wirklich beim Saubermachen sieht, aber das ist gar nicht nötig. Sein Charakter ist fleckenlos und obsessiv, eine Figur perfekter Ordnung. Im Verständnis der amerikanischen Mythologie ist er ein Verräter seines Geschlechts, ein Anti-Cowboy, der sich auf die Seite der Mädels geschlagen hat. Der Spaß besteht dar in, ihn aus der Fasson zu bringen, sodass er schwitzen und stolpern und schmutzig werden muss.
Sturges, der sich immer der Klassenvorurteile von Amerikanern bewusst war, die gleichwohl im Geldüberfluss schwelgen, macht den aus dem Westen kommenden Weenie King zum Märchenonkel des Films. Der King zieht aus einem zusammengerollten Bündel Banknoten, das doppelt so dick ist wie seine Faust, Scheine und reicht sie der Dame des Hauses, die er unter der Dusche versteckt findet. Pangborn bleibt allein im großen Wohnzimmer des Luxusapartments zurück, erschöpft und angewidert von den Unbilden, die er im Lauf eines Arbeitstags durchmachen muss, Unbilden, die ihn etwas verknittert haben.
Ohne den Populismus des Westens und seine Weenie Kings hätte die von Franklin Pangborn dargestellte Figur nicht so wirkungsvoll sein können. Hochnäsig, verklemmt, urban und verweichlicht, ist er eine Ausgeburt von Vorurteilen der Prärie, Pangborns ausgesuchte Diktion und seine Umgangsformen sind Zielscheibe des Spotts. In Mein Mann Godfrey sehen wir ihn nur wenige Sekunden, aber diese Sekunden sind wichtig. Unter den Wunscherfüllungsfilmen der Depressionszeit zählt dieser nach wie vor zu den besten. Pangborn spielt typischerweise einen Mann, der versucht, inmitten von Chaos die Dinge am Laufen zu halten. Er ist vermutlich der Vorsitzende des törichten Wohltätigkeitskommitees, das eine Schnitzeljagd für Schwerreiche veranstaltet. Unter den «Sachen», die die Teilnehmer mitbringen sollten, ist ein «Verschollener». Carol Lombard entdeckt William Powell (Godfrey) auf einer Müllhalde am Fluss, und nach etlichem Hin und Her schleppt das von Lombard gespielte überkandidelte, aber gutartige Wesen den unrasierten, zerlumpten Godfrey auf eine glitzernde Party von Leuten in Frack und Abendkleid. Pangborn prüft die Authentizität des «Verschollenen», indem er zunächst dar um bittet, Godfreys Schnurrbart anzufassen. (Ein anderer Teilnehmer hatte zuvor versucht, mit einem Schwindler zu betrügen.) Pangborn tut es mit einer Verbeugung, den Worten «Gestatten?» und einem Räuspern der herrlichen Kehle. Aber mein Herz erobert er mit seiner Geste. Er hebt die Finger, und mit einem eleganten Schnörkel, wie man ihn seit dem 18. Jahrhundert am französischen Hof nicht mehr gesehen hat, winkt er mit der Hand in Richtung Bart und erklärt ihn für echt. Es ist ein hinreißender Augen blick. In dieser Handbewegung sehen wir sowohl die strengen Regeln der Höflichkeit, die den direkten Kontakt mit dem Körper eines anderen untersagen, als auch den Widerwillen vor einem ungewaschenen, unparfümierten und insgesamt unannehmbaren Körper. Nachdem er für echt, als ein wirklich «Verschollener» befunden wurde, bezeichnet Godfrey die Umstehenden als «einen Haufen Schwachköpfe», wird von Lombard als Butler eingestellt, und die Geschichte beginnt.
Ich lebe nun seit zwanzig Jahren in New York und bin dabei hin und wieder unter Schwachköpfen gelandet. Obgleich ich nie das Vorurteil meiner Heimatstadt – die Reichen seien schlechter als andere Menschen – geteilt habe, trifft es wohl zu, dass riesige Mengen Geld von außen betrachtet leicht etwas Lächerliches an sich haben und dass das Spektakel des Verschwendens und Verspielens für den eingefleischten Midwesterner etwas Geschmackloses hat, das ihm den Magen umdreht. Und nichts sieht alberner und dümmlich selbstgefälliger aus als ein Wohltätigkeitsballs. In Hollywood wusste man das und nutzte es aus. Als die Farm meiner Großeltern in Minnesota den Bach hinunterging, gab es in New York schlitzohrige Großstädter, die es geschafft hatten, ihre Kohle zu behalten. Mein Mann Godfrey lief auch vor Zuschauern in der hintersten Provinz, Zuschauer, die sich an der Opulenz des luxuriösen New Yorker Hauses ergötzten, aber gleichzeitig über die Absurditäten von dessen Bewohnern lachten. Godfrey ist der Froschkönig eines amerikanischen Märchens, ein Mensch, den die Erfahrung von Armut verändert. Pangborn jedoch ist gegen Zauberei gefeit. Als statisches Wesen der bürokratischen Verwaltung wird er sich nie ändern.
Dieses Statische kommt am besten in W.C. Fields’ Der Bankdetektiv zum Ausdruck. Pangborn spielt dar in den Bankprüfer J. Pinkerton Snoopington. Im engen schwarzen Anzug, mit Melone und Kneifer, ist er der Inbegriff eines Trottels. Pangborns Schicksal ist es, beinah von Fields, alias Egbert Sousé, zu Fall gebracht zu werden. Fields’ Hass auf Banken und Banker ist ja wohl bekannt. Und obwohl seine Ästhetik anarchisch und nicht agrarisch-populistisch, misanthropisch und nicht humanistisch ist, muss seine Wut auf Banker bei den Kinobesuchern der 40er Jahre etwas tief in ihrem Innern angesprochen haben. Man sollte sich dar an erinnern, dass es die Phantasie damals stärker anregte als heutzutage, wenn ein Bankprüfer gequält wurde.
W.C. Fields war auch kein großer Frauenfreund. Er spielt einen Mann, bei dem jeder Schritt von einer törichten weiblichen Idee eingeschränkt wird. Fields’ Mythos zufolge wurden Ehe, Ordnung, Verhaltenscodes und vor allem Enthaltsamkeit von Frauen erfunden, um die natürlichen Gelüste des Mannes zu zähmen. Es ist bemerkenswert, dass Sousé, während er sein Opfer Snoopington in das Black Pussy Cat Café lockt, den Bankprüfer fragt, ob ihm Lompocs schöne Girls aufgefallen seien. Der Bankprüfer räuspert sich gewichtig und sagt, er sei verheiratet und habe eine erwachsene Tochter «im Alter von achtzehn Jahren». Mit anderen Worten: Die Ehe hat ihn für andere Frauen blind gemacht. Der Mann ist kein Mann. Sousé dagegen flüstert wollüstig: «So mag ich sie, mit siebzehn, achtzehn…» Sousé setzt Snoopington im Black Pussy Cat Café mit einem Mickey Finn außer Gefecht, führt, beziehungsweise trägt ihn in ein Zimmer im New Old Lompoc House und lässt ihn (oder befördert ihn) aus einem Fenster dieses neuen alten Etablissements fallen, wonach er den angeschlagenen und zerzausten Bankprüfer nochmals die Treppen hinauf in das Zimmer bugsiert, um ihn dort ins Bett zu bringen – alles nur, weil Snoopingtons einziger Wunsch es ist, die Bücher der Bank zu prüfen, bei der Sousé und sein zukünftiger Schwiegersohn einen «unerlaubten» Kredit aufgenommen haben.
Schon diese kurze Zusammenfassung offenbart den Dickens’schen Geist von Fields, einem Komiker, dessen Freude, die Dinge beim Namen zu nennen, so groß ist wie die am visuellen Witz. Sollten wir Zweifel an der Inspirationsquelle des Regisseurs haben, so hilft uns der Bankprüfer auf die Sprünge. Auf seinem Krankenbett sorgt der pedantische Snoopington sich lautstark um seine Frau. «Meine arme Gattin», jammert er, «meine Klein Dorrit.» Aber es zeigt sich, dass Sousé die Willenskraft des Bürokraten unterschätzt hat. Es gelingt dem Bankprüfer irgendwie, sich aus seinem Krankenbett herauszuquälen und pflichtgetreu in der Bank zu erscheinen. Obwohl offensichtlich noch benebelt und nicht ganz sicher auf den Beinen, sieht man seinem gebügelten Anzug nichts von dem vorangegangenen Missgeschick an. Der listige Sousé versucht dar auf hin, Snoopingtons Brille zu zertreten, um den Bankprüfer blind zu machen. Es gelingt Sousé, mit dem Fuß auf die Brille zu treten, worauf der Bankprüfer seine Aktentasche öffnet. Die Kamera zoomt zu einer Großaufnahme ihres Inhalts. Der Mann hat dar in in Reih und Glied fünf weitere Brillen. Die Augengläser sagen alles. Von der Pflicht getrieben, ist dieser Mann für alle Fälle gewappnet. Im kniffligen Reich der Geschäftsbücher, Zahlen und Konten kann ihm niemand das Wasser reichen. Wir wissen mit absoluter Gewissheit, dass er als Bankprüfer leben und sterben wird. Sousé hingegen wird durch einen verrückten Zufall und durch eine kühne Schiebung sagenhaft reich. Am Ende des Film hat er sich glücklich in seiner Villa niedergelassen, wo seine ehemals beleidigende Familie ihn jetzt abgöttisch liebt. Fields geht zufrieden ab. Er ist, wie früher auch, auf dem Weg zum Black Pussy Cat Café. Seine Familie findet ihn «wie ausgewechselt».
Eingezäunt, auf einer Sprosse der gesellschaftlichen Leiter steckengeblieben, drängt es den Pangborn’schen Mann nicht nach Veränderung. Wie die meisten Kinder zieht er das Immergleiche, die Routine, die Beständigkeit vor. Auch das verstehe ich. Wiederholung ist die Essenz von Bedeutung. Ohne sie sind wir verloren. Liebe zum System wird allerdings absurd, wenn sie auf die Spitze getrieben wird. Franklin Pangborn spielte einen Mann, der das System anbetete, in dem er sich befand, ein System, das von jener manichäischen Gottheit Amerikas beherrscht wird, seinem Gott und seinem Teufel: Geld. Geld verfolgt Pangborns Figur in fast allen Filmen. Er selbst hat nicht viel davon, aber er verfällt seinem Zauber, der Teil seiner überwältigenden Mechanismen ist, und er ist übermäßig von seiner Macht beeindruckt. Als Prototyp des Verwalters fällt er auf die Reichen her ein. In einem anderen Film von Preston Sturges, Weihnachten im Juli, spielt Pangborn den Manager eines Kaufhauses, der dar auf brennt, dem Helden und dessen Freundin zu gefallen, die fälschlicherweise glauben, zu Geld gekommen zu sein und einen ausgedehnten Einkaufsbummel machen. Der Manager zeigt ihnen ein Bett, das mit einem ausgeklügelten Mechanismus versehen ist und mit einem Knopfdruck alle Annehmlichkeiten bietet. Pangborn führt dieses Wunderwerk der amerikanischen Konsumwelt vor, und dann erklärt er in einem zugleich hochtrabenden, sittsamen und unterwürfigen Ton: «Und am darauffolgenden Morgen …» Er drückt auf den bewussten Knopf, worauf das Bett in sich zusammenklappt.
Mir ist klar, dass es nicht nur der von Pangborn verkörperte Charakter ist, den ich mag, sondern die Tatsache, dass er in Hollywoodfilmen einer Zeit auftrat, als der Dialog noch eine wichtige Rolle bei der Filmarbeit spielte, als die antiquierte Wendung «Und am darauffolgenden Morgen …» für einen Lacher geschrieben werden konnte, als W.C. Fields eine Zeile auf Klein Dorrit verschwenden und als ein Weenie King einen Monolog über seine Liebe zum Dreck, zu Wirbelstürmen und Krankheit halten konnte. Heute ist es selten, dass ein Studiofilm uns überhaupt viel Dialog liefert, und wenn, handelt es sich unweigerlich um eine Sprache ohne geschichtliches Gedächtnis, um eine Sprache, die Angst vor Verweisen hat, weil das Publikum sie nicht verstehen könnte, um eine Sprache, die durch die Politik des Komitees und die Testvorführungen abgewürgt wird. Und während ich dies beklage, weiß ich ganz genau, dass Studios damals wie heute von einem Gedanken angetrieben werden, der im Grunde populistisch ist: die größte Anzahl Menschen ins Kino zu locken, damit sie einen Film sehen, der allen oder fast allen gefällt – abgesehen von Intellektuellen und Miesepetern. Aber selbst in schlechten Filmen der Pangborn-Ära spielte das Sprechen eine größere Rolle als heute. Ich vermisse das Sprechen in Filmen.
Doch wenn ich in Brooklyn aus dem Haus gehe und den Leuten auf der Straße zuhöre, ihren Ausdrücken, ihrer Redeweise, ihren Wendungen und Aussprüchen, so haben sie wenig Ähnlichkeit mit dem, was ich im Kino in «großen» Filmen höre. Die Menschen in meinem Viertel sind ziemlich anfällig für großartige Ausdrücke, komische Wortverwechslungen und für Sprachblüten. Neulich hörte ich eine Frau zu einer anderen sagen: «Er ist nichts als ein kleiner», sie machte eine Pause, «ein kleiner Reklamespruch.» Ein Mann, der nebenan vor dem koreanischen Deli saß, sann laut über das Wort Humanismus nach. «Ihr nennt das Humanismus, humanistisch, humanes Sein», brüllte er jedem zu, der es hören wollte. Vor Jahren saß ein alter Mann in der U-Bahnstation der 59th Street und sang eine Reihe wunderbarer Wörter: «Coppelia, episkopal, Echolalie …» Er hatte eine wohltönende Stentorstimme, die mir noch immer in den Ohren klingt. Einmal versprach ich mich und bestellte im La Bagel Delight, einem Bagelshop in meiner Gegend, bei dem Mann hinter der Theke einen Zimt-Rosinen-Reagan. Er sah mich an und sagte: «Die haben wir nicht, aber ich gebe Ihnen einen Pumper-Nixon.» Witz und Wundersames leben in der Alltagssprache. Nur werden sie in Hollywood nicht angezapft.
Die Wahrheit ist, dass die Welt und unsere Phantasien sich oft überschneiden. Franklin Pangborns Figur, dieser etepetete wie aus dem Ei gepellte Stockfisch ist nicht nur eine Erfindung des Kinos. Ich habe einmal mit eigenen Augen seine Reinkarnation gesehen. Vor einigen Jahren waren mein Mann und ich in Paris. Er hatte dort zu tun, und man brachte uns in einem Luxushotel in der Nähe des Louvre unter. Zufällig hatte Gérard Depardieu es sich in den Kopf gesetzt, meinen Mann kennenzulernen, und wir verabredeten uns in der Hotelhalle. Depardieus Name war damals schon lange gleichbedeutend mit französischem Kino. Mir kam es so vor, als würde in jedem französischen Film, den ich mir anschaute, dieser Mann auftreten. Seine Berühmtheit war unbestritten. Der Schauspieler betrat das Hotel. Anders als viele Filmstars enttäuschte er im wirklichen Leben nicht. Depardieu ist ein sehr stattlicher Mann, ein gewaltiger Mann, und er sprüht vor Energie. In einer Lederjacke, seinen Motorradhelm unter den Arm geklemmt, kam er auf uns zu, sein Gang war entschlossen, aber tapsig. Er verströmte nichts als Testosteron, eine ungeschminkte Männlichkeit der Straße, die mich, ehrlich gesagt, umhaute. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass der Hoteldirektor bemerkte, wer gerade sein Haus betreten hatte. Auf seinem Gesicht lag sichtbare, aber kontrollierte Aufregung. Man konnte eindeutig dar aus ablesen, wie unser Status in diesem Hotel wuchs, je näher Depardieu uns kam. Seine scharfen Augen blickten unverwandt auf den Star. Der Schauspieler erreichte unseren Tisch in der Halle. Er begrüßte meinen Mann, die beiden anderen Personen, die bei uns waren, und mich. Ich erinnere mich, wie er voller Freude meinen Namen ausrief, meine Hand mit dem kraftvollen Druck schüttelte, den ich erwartet hatte, und sich dann setzte. Der Maître d’Hôtel eilte herbei. Kerzengerade, mit gerecktem Kinn, tipptopp in seinem teuren dunklen Anzug und mit eleganter Krawatte versuchte er Gleichmut zu bewahren. Es gelang ihm nicht. In seiner Freude fing er ein klein wenig an mit den Armen zu flattern, als wollte er vom Boden abheben. Dann, mit würdevollem Neigen des Kopfes zu dem Star, erkundigte er sich nach dessen Wünschen. Depardieu bestellte beiläufig ein Glas Rotwein. Der Hoteldirektor machte auf dem Absatz kehrt und spurtete davon, um es zu holen. Weitere Bestellungen hatte er nicht entgegengenommen. Er vergaß uns.
Als ich ihn davoneilen sah, dachte ich an Franklin Pangborn. Franklin Panborn war in dieser Hotelhalle wiedergeboren worden, und ich war hier, um Zeugin seiner beseelten Torheit zu werden. Der arme Hoteldirektor benahm sich lächerlich, aber er tat mir auch leid. Er hatte seine eigenen strengen Maßstäbe der Etikette gebrochen und einen Narren aus sich gemacht. Aber schließlich machen wir uns hin und wieder alle zum Narren. Und das ist, nehme ich an, der Grund für diese etwas weitschweifige, aber von Herzen kommende Würdigung des Pangborn-Prinzips.
1998
Acht Tage im Korsett
Vorigen Sommer wirkte ich als Statistin bei der Verfilmung von Henry James’ Roman Washington Square mit. Ich bin keine Schauspielerin. Die Regisseurin Agnieszka Holland ist eine Freundin von uns, aber eigentlich interessierte sie sich für unsere Tochter Sophie, die als eine von Mr. Almonds Kindern besetzt war. Unter einer sengend heißen Junisonne kamen Sophie und ich zu einer Anprobe in Baltimore an. Sophie wurde zuerst angezogen, und sie sah so hübsch aus, wie eine junge Romanheldin nur aussehen kann. Eine der beiden Garderobieren reichte mir ein Korsett, einen Reifrock und einen Petticoat, die ich anzog, und dann schnürte sie mich. Sie suchten ein Kleid, das lang genug für mich war, und ich stieg vor einem hohen, breiten Spiegel in der Umkleidekabine hin ein.
Innerhalb weniger Minuten fühlte ich mich schwach werden. Mich überkam das Gefühl, das ich immer bei einem Schwächeanfall habe – starke Verlegenheit. Diesmal kam noch die belastende Angst hinzu: dass ich vor meiner achtjährigen Tochter zusammenbrechen würde. Ich schwankte, fiel hin, aber mir wurde nicht schwarz vor Augen. Ich wünschte, ich könnte sagen, jemand hätte gerufen, ‹Schnürt ihr Korsett auf!›, wäre hinausgeeilt, um Riechsalz zu holen, und hätte mein aschfahles Gesicht mit einem Fächer gekühlt. Aber dem war nicht so. Sie brachten mir netterweise Wasser und Trauben, während ich mich erholte. Ich scherzte, dass ich die Rolle wohl allzu gut ausgefüllt hätte, um in kürzester Zeit das klassische Bild einer in Ohnmacht fallenden Dame des 19. Jahrhunderts abzugeben, aber ich glaube nicht, dass es an dem Korsett lag. Ich war schon einmal vor einem Spiegel beinah ohnmächtig geworden – in einem Yogakurs. Damals hatte ich eine Tanztrikothose und ein Sweatshirt an. Mein Lehrer korrigierte meine Haltung, und ich war ohne Vorwarnung zusammengebrochen. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich, tief atmend, meinen Kopf zwischen den Knien.
Vor Spiegeln überprüfe ich mich immer selbst – auf Petersilie zwischen den Zähnen, auf Makel und schmutziges Haar –, wäge ab, welche Schuhe zu welcher Kleidung passen. Doch hin und wieder werden Spiegel etwas mehr – der Sitz eines mir bekannten Körpers wird am Ende den Geist enthüllen. Wie in Sagen und Märchen stellt der Spiegel einen Augenblick lang meine Geisterdoppelgängerin zur Schau, und ich sehe sie nicht gern. Es ist ein Moment, in dem ich mir selbst fremd bin. Aber die Spiegelung von etwas Ungewohntem ist nicht immer ein Schock. Verwandlungen sind reizvoll, und Kleidung ist der schnellste Weg, aus dem eigenen Leben in das eines anderen zu springen. Das Fischbeinkorsett, das ich acht Tage lang trug, katapultierte mich in eine andere Zeit und in eine andere Ästhetik, und es gefiel mir.
Das Korsett ist ein verrufenes Kleidungsstück. Ihm wurde und wird die Schuld am körperlichen wie seelischen Elend der Frauen gegeben, es wird dafür gescholten, dass es Frauenkörper ruinierte und ihren Geist verschloss. Interessant dabei ist jedoch, dass, während Frauen sie trugen, es männliche Ärzte waren, die die Kampagne gegen das Korsett führten. Die meisten Frauen sprachen sich dafür aus. Im 20. Jahrhundert übernahmen die Feministinnen die Kritik der Ärzte und prangerten das Kleidungsstück als verkrüppelnd an. Ohne Zweifel gab es Frauen, die in der Sommerhitze oder vor einem Kaminfeuer in zu eng geschnürten Korsetts zu ihrem eigenen Besten in Ohnmacht sanken. Doch als ich tagein, tagaus mein Korsett trug, verfiel ich seinem Reiz. Ein Korsett zu tragen ist ein bisschen so, wie dauernd umarmt, wieder und wieder in der Taille von einem Arm gedrückt zu werden. Das ist angenehm und irgendwie erotisch – eine anhaltende innige Umarmung.
Aber ein Korsett zu spüren macht nur einen Teil seiner Wirkung aus. Wie jede Kleidung ist es vor allem anderen eine Idee. In diesem Fall fördert es die Idee eines weiblichen Körpers, der radikal anders ist als der Körper eines Mannes. Im Sommer 1986 reiste ich mit meinen drei Schwestern durch Asien, und wir besuchten in den Bergen von Taiwan ein buddhistisches Mönchskloster und ein buddhistisches Frauenkloster. Die Mönche und die Nonnen sahen genau gleich aus – kleine, niedliche, haarlose Körper, rasierter Kopf. Die Mönche trugen orange Kleider, die Nonnen weiße. Hätten sie sich nackt ausgezogen und nebeneinandergestellt, wäre der Unterschied zwischen ihnen lächerlich klein gewesen, nicht größer und nicht kleiner, als er wirklich ist – eine genitale Variante und einige unterschiedliche sekundäre Geschlechtsmerkmale an Brustkorb und Hüfte. Nie war mir die Wahrheit über Kleidung, Frisuren und Make-up so ins Auge gesprungen. Das kulturelle Drum und Dran beim Geschlecht ist enorm. Wir machen es und leben es und sind es.