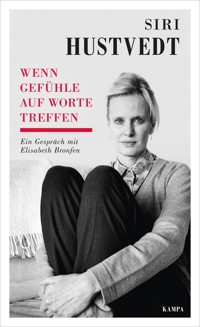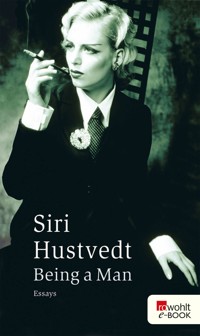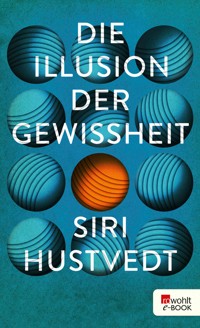9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom trügerischen Glück und der Gefährdung der Liebe Brooklyn zu Beginn des neuen Jahrtausends: Psychiater Erik Davidsen erzählt von einem bewegten Abschnitt seines Lebens. Es scheint ein «Jahr der Geheimnisse», das Jahr, in dem sein Vater stirbt und im Nachlass Briefe gefunden werden, die auf ein dramatisches Ereignis in dessen Jugend hindeuten. Das Jahr, in dem seine Schwester von einer Unbekannten verfolgt und belästigt wird. Das Jahr, in dem eine betörend schöne Jamaikanerin in Eriks Haus zieht, die jedoch etwas zu verbergen scheint ... «Siri Hustvedt schreibt im Wortsinn traumhaft.» Salman Rushdie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Siri Hustvedt
Die Leiden eines Amerikaners
Über dieses Buch
Vom trügerischen Glück und der Gefährdung der Liebe
Brooklyn zu Beginn des neuen Jahrtausends: Psychiater Erik Davidsen erzählt von einem bewegten Abschnitt seines Lebens. Es scheint ein «Jahr der Geheimnisse», das Jahr, in dem sein Vater stirbt und im Nachlass Briefe gefunden werden, die auf ein dramatisches Ereignis in dessen Jugend hindeuten. Das Jahr, in dem seine Schwester von einer Unbekannten verfolgt und belästigt wird. Das Jahr, in dem eine betörend schöne Jamaikanerin in Eriks Haus zieht, die jedoch etwas zu verbergen scheint ...
«Siri Hustvedt schreibt im Wortsinn traumhaft.» Salman Rushdie
Vita
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sechs Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Der Sommer ohne Männer» und «Die gleißende Welt». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Leben, Denken, Schauen», «Nicht hier, nicht dort», «Being a Man» und «Die Illusion der Gewissheit» vor.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel «The Sorrows of an American» bei Henry Holt and Company, New York.
Gertraude Krueger übersetzte die Printseiten 1–223, Uli Aumüller die Seiten 224–Ende. Die Übersetzung sämtlicher Gedichte und Lieder stammt von Helmut Frielinghaus.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2019
Copyright © 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Sorrows of an American» Copyright © 2008 by Siri Hustvedt
Covergestaltung any.way, Hamburg
Coverabbildung Millenium/Look
ISBN 978-3-644-00270-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Tochter
Sophie Hustvedt Auster
Wende dich nicht ab.
Schau weiter auf die bandagierte Stelle.
Dort wird das Licht in dich eindringen.
Rumi
Meine Schwester nannte es «das Jahr der Geheimnisse», aber wenn ich jetzt zurückblicke, erkenne ich: Das Wichtige war nicht, was da war, sondern was nicht da war. Eine meiner Patientinnen meinte einmal: «In mir wandern Geister herum, aber sie reden nicht immer. Manchmal haben sie nichts zu sagen.» Sarah blinzelte meist oder hielt die Augen ganz geschlossen, weil sie Angst hatte, das Licht würde sie blind machen. Ich glaube, wir haben alle Geister in uns, und es ist besser, wenn sie reden, als wenn sie es nicht tun. Nachdem mein Vater tot war, konnte ich nicht mehr mit ihm persönlich reden, aber in meinem Kopf unterhielt ich mich weiter mit ihm. Ich sah ihn weiter in meinen Träumen, hörte ihn weiter zu mir sprechen. Und trotzdem wurde mein Leben eine Zeitlang von dem beherrscht, was mein Vater nicht gesagt, was er uns nicht erzählt hatte. Wie sich herausstellte, war er nicht der Einzige, der Geheimnisse hütete. Am sechsten Januar, vier Tage nach der Trauerfeier, fanden Inga und ich den Brief in seinem Arbeitszimmer.
Wir waren mit unserer Mutter in Minnesota geblieben und machten uns an das Sichten seiner Papiere. Wir wussten, dass es biografische Aufzeichnungen gab, die er in seinen letzten Lebensjahren verfasst hatte, sowie eine Schachtel mit Briefen an seine Eltern – viele davon aus seiner Zeit als Soldat im Pazifik während des Zweiten Weltkriegs –, aber es fanden sich auch andere Dinge in dem Zimmer, die wir noch nie gesehen hatten. Das Arbeitszimmer meines Vaters hatte einen ganz besonderen Geruch, der sich ein wenig von dem im Haus unterschied. Hier hatte er vierzig Jahre lang Zigaretten geraucht und Kaffee getrunken, und die unzähligen Tassen hatten Ringe auf dem Schreibtisch hinterlassen; ich fragte mich, ob das die Atmosphäre dieses Zimmers geprägt und den unverwechselbaren Geruch hervorgebracht hatte, der mir beim Eintreten entgegenschlug. Das Haus ist inzwischen verkauft. Ein Zahnarzt hat es erworben und umfassend renovieren lassen, aber ich habe das Arbeitszimmer meines Vaters noch vor Augen – die Bücherwand, die Aktenschränke, den langen, selbstgebauten Schreibtisch mit dem Plastikbehälter für Kleinkram darauf. Obwohl dieser Behälter durchsichtig war, klebte auf jedem Fach ein kleines handgeschriebenes Etikett – «Büroklammern», «Batterien für Hörgerät», «Garagenschlüssel», «Radiergummis».
An dem Tag, als Inga und ich uns an die Arbeit machten, herrschte trübes Wetter. Durch das große Fenster schaute ich auf die dünne Schneedecke unter einem eisengrauen Himmel. Ich spürte, dass Inga hinter mir stand, hörte ihren Atem. Marit, unsere Mutter, schlief, und meine Nichte Sonia hatte sich irgendwo im Haus mit einem Buch verkrochen. Als ich eine Schublade mit Hängeordnern aufzog, kam mir der jähe Gedanke, dass wir dabei waren, das Gehirn eines Menschen zu plündern, ein ganzes Leben auseinanderzunehmen, und ohne jede Vorwarnung stand das Bild der Leiche vor mir, die ich während meines Medizinstudiums seziert hatte. Sie lag mit klaffender Brusthöhle auf dem Tisch. Roger Abbot, einer meiner Partner im Sektionssaal, hatte die Leiche Zwiddeldum genannt, auch Dum Dum oder einfach nur Dum. «Erik, da kommt eine Ladung von Dums Ventrikeln. Hypertrophie, Mann.» Einen Moment lang stellte ich mir die kollabierte Lunge meines Vaters in seinem Innern vor, dann erinnerte ich mich an seinen festen Händedruck, bevor ich sein kleines Zimmer im Pflegeheim verließ. Da hatte ich ihn das letzte Mal lebend gesehen. Plötzlich war ich erleichtert, dass er eingeäschert worden war.
Lars Davidsens Ablagesystem war ein elaborierter Code aus Buchstaben, Zahlen und Farben, der innerhalb jeder Kategorie eine absteigende Hierarchie bezeichnete. Erste Gedanken kamen vor ersten Textfassungen, erste Textfassungen vor letzter Textfassung und so weiter. In diesen Schubladen steckten nicht nur seine Jahre als Professor und Autor, sondern jeder Artikel, jeder Vortrag von ihm, die umfangreichen Notizen, die er sich gemacht hatte, und auch die Briefe, die er in über sechzig Jahren von Kollegen und Freunden erhalten hatte. Mein Vater hatte jedes Werkzeug katalogisiert, das je in der Garage hing, jede Rechnung für die sechs Gebrauchtwagen, die er im Lauf seines Lebens besaß, jeden Rasenmäher und jedes Haushaltsgerät – eine umfassende Dokumentation einer langen und außergewöhnlich kargen Lebensgeschichte. Wir entdeckten eine Aufstellung für eine geordnete Lagerhaltung auf dem Dachboden: Kinderschlittschuhe, Babysachen, Strickzeug. In einer kleinen Schachtel fand ich ein Schlüsselbund. Daran hing ein Schildchen, auf das mein Vater in seiner kleinen, säuberlichen Handschrift geschrieben hatte: «Unbekannte Schlüssel».
Tagelang zogen wir mit großen schwarzen Müllsäcken durch dieses Zimmer, warfen Hunderte von Weihnachtskarten und Zeugnisheften weg, unzählige Verzeichnisse von Dingen, die es nicht mehr gab. Meine Nichte und meine Mutter machten meist einen Bogen um diesen Raum. Sonia wanderte mit einem Walkman verkabelt im Haus herum, las Wallace Stevens und schlief den komatösen Schlaf, in den die Jugend so leicht versinkt. Ab und zu kam sie herein, klopfte ihrer Mutter auf die Schulter oder umschlang Inga mit ihren langen, dünnen Armen und entschwebte, nachdem sie so ihre stillschweigende Unterstützung gezeigt hatte, in ein anderes Zimmer. Sonias Vater war vor fünf Jahren gestorben, und seitdem machte ich mir Sorgen um sie. Ich erinnerte mich, wie sie, den Körper steif gegen die Wand gedrückt, mit seltsam teilnahmsloser Miene in dem Krankenhausflur vor seinem Zimmer gestanden hatte, ihre Haut so bleich, dass ich an Knochen denken musste. Ich weiß, dass Inga ihren Kummer vor Sonia verbergen wollte, dass sie wartete, bis ihre Tochter in der Schule war, und dann Musik anstellte, sich auf den Fußboden legte und vor sich hin wimmerte, aber ich habe nie erlebt, dass Sonia sich ein Schluchzen gestattete, und ihre Mutter auch nicht. Drei Jahre später, am Morgen des 11. September 2001, waren Inga und Sonia mit Hunderten anderer Menschen auf der Flucht nach Norden, fort von Sonias Schule, der Stuyvesant High School. Sie waren nur wenige Straßen von den brennenden Türmen entfernt, und erst später erfuhr ich, was Sonia aus dem Schulfenster gesehen hatte. Von meinem Haus in Brooklyn aus sah ich an dem Morgen nur Rauch.
Wenn unsere Mutter nicht ruhte, wanderte sie von einem Zimmer zum anderen, ließ sich treiben wie eine Schlafwandlerin. Ihr fester und doch leichter Gang war nicht schwerer als in alten Zeiten, aber er war langsamer geworden. Sie schaute nach uns, bot uns zu essen an, trat aber nur selten über die Schwelle. Wahrscheinlich erinnerte das Zimmer sie an die letzten Jahre meines Vaters. Das fortschreitende Emphysem ließ seine Welt Stück für Stück schrumpfen. Am Ende konnte er kaum noch gehen und blieb die meiste Zeit in den achtzehn Quadratmetern seines Arbeitszimmers. Bevor er starb, hatte er die wichtigsten Papiere herausgesucht, die jetzt in ordentlich aufgereihten Schachteln neben seinem Schreibtisch lagen. In einem dieser Kästen fand Inga die Briefe von Frauen, die mein Vater vor meiner Mutter gekannt hatte. Später las ich Wort für Wort, was sie ihm geschrieben hatten, dieses Trio vorehelicher Liebschaften – eine Margaret, eine June und eine Lenore, die gewandte, aber leidenschaftslose Briefe verfassten und mit «Alles Liebe», «Herzliche Grüße» oder «Bis bald» schlossen.
Ingas Hände zitterten, als sie die Bündel fand. Diesen Tremor kannte ich schon seit meiner Kindheit, er war nicht durch eine Krankheit bedingt, sondern meine Schwester machte ihr «Nervenkostüm» dafür verantwortlich. Sie wusste nie, wann der nächste Ausbruch kam. Ich hatte sie mit ruhigen Händen öffentliche Vorträge halten sehen, und ich hatte auch gesehen, wie sie die Hände dabei hinter dem Rücken verstecken musste, weil sie so heftig zitterten. Nachdem sie die drei Päckchen mit den Briefen der längst entschwundenen, doch einst begehrten Margaret, June und Lenore herausgenommen hatte, zog sie ein einzelnes Blatt hervor, sah es verwirrt an und reichte es mir wortlos.
Der Brief war vom 27. Juni 1937. Unter dem Datum stand in einer großen Kinderschrift: «Lieber Lars, ich weiß, Du wirst nie ein Sterbenswörtchen darüber sagen, was passiert ist. Wir haben es auf die BIBEL geschworen. Es spielt ja jetzt keine Rolle mehr, wo sie im Himmel ist, und für die anderen hier auf Erden auch nicht. Ich glaube an Dein Versprechen. Lisa.»
«Er wollte, dass wir das finden», sagte Inga. «Sonst hätte er den Brief vernichtet. Ich habe dir die Tagebücher mit den herausgerissenen Seiten gezeigt.» Sie schwieg kurz. «Hast du je von einer Lisa gehört?»
«Nein», sagte ich. «Wir könnten Mamma fragen.»
Inga antwortete auf Norwegisch, als dürften wir über unsere Mutter nur in deren erster Sprache reden. «Nei, jeg vil ikke forstyrre henne med dette.» (Nein, damit will ich sie nicht behelligen.) «Ich hatte immer das Gefühl», fuhr sie fort, «dass Pappa manches vor Mamma und uns geheim gehalten hat, vor allem, wenn es seine Kindheit betraf. Er war damals fünfzehn. Ich glaube, da hatten sie schon die vierzig Acres der Farm verloren, und wenn ich mich nicht irre, hatte Grandpa ein Jahr vorher erfahren, dass sein Bruder David tot war.» Meine Schwester schaute auf das blassbraune Blatt Papier. «‹Es spielt ja jetzt keine Rolle mehr, wo sie im Himmel ist, und für die anderen hier auf Erden auch nicht.› Jemand ist gestorben.» Sie schluckte hörbar. «Armer Pappa, er musste auf die Bibel schwören.»
Nachdem Inga, Sonia und ich elf Pakete mit Dokumenten nach New York City abgeschickt hatten, die meisten davon an meine Adresse in Brooklyn, und wieder in unseren jeweiligen Alltag zurückgekehrt waren, saß ich eines Sonntagnachmittags in meinem Arbeitszimmer und hatte die Aufzeichnungen, die Briefe und ein kleines ledergebundenes Tagebuch meines Vaters vor mir auf dem Schreibtisch. Da fiel mir ein, was Auguste Comte über das Gehirn geschrieben hatte. Er nannte es «eine Vorrichtung, mit der die Toten auf die Lebenden einwirken». Als ich Dums Gehirn zum ersten Mal in der Hand hielt, staunte ich erst über dessen Gewicht und dann darüber, was ich verdrängt hatte – die Ahnung vom Bewusstsein eines einst lebendigen Mannes, eines stämmigen Siebzigjährigen, der an einem Herzleiden verstorben war. Als der Mann noch lebte, dachte ich, war alles hier drin – innere Bilder und Worte, Erinnerungen an die Toten und die Lebenden.
Vielleicht dreißig Sekunden später schaute ich aus dem Fenster, und da sah ich Miranda und Eglantine zum ersten Mal. Sie gingen mit dem Immobilienmakler über die Straße, und ich wusste sofort, dass das meine künftigen Mieter waren. Die beiden Frauen aus der Gartenwohnung im Erdgeschoss hatten in New Jersey etwas Größeres gefunden, und ich musste die Wohnung neu vermieten. Das Haus schien nach meiner Scheidung gewachsen zu sein. Genie hatte sich ziemlich ausgebreitet, und ihr Spaniel Elmer, ihr Papagei Rufus und Carlysle, ihre Katze, hatten auch Platz gebraucht. Eine Zeitlang gab es auch Fische. Nachdem Genie mich verlassen hatte, nutzte ich die drei Stockwerke für meine Bücher, Tausende von Bänden, von denen ich mich nicht trennen konnte. Meine Exfrau bezeichnete unser Haus immer ärgerlich als ein Bibliothekarium. Ich hatte die kleine Brownstone-Stadtvilla vor meiner Ehe während einer Flaute auf dem Immobilienmarkt als sogenanntes Heimwerker-Schnäppchen erworben und bin noch immer dabei, sie instandzusetzen. Die Leidenschaft für das Arbeiten mit Holz habe ich von meinem Vater geerbt, der mir beigebracht hat, wie man fast alles bauen und reparieren kann. Jahrelang hatte ich mich in einem Teil des Hauses verkrochen und phasenweise an dem Rest gearbeitet. Meine Praxis nimmt mich so in Anspruch, dass mir fast keine Freizeit bleibt, was einer der Gründe für meinen Eintritt in das große Heer von Bewohnern der westlichen Welt war, das den Namen «die Geschiedenen» trägt.
Die junge Frau und das kleine Mädchen blieben mit Laney Buscovich vom Maklerbüro Homer Realtors auf dem Bürgersteig stehen. Das Gesicht der Frau konnte ich nicht sehen, aber ihre Körperhaltung war auffallend schön. Die kurzgeschnittenen Haare lagen dicht am Kopf an. Selbst aus der Entfernung gefiel mir ihr schlanker Hals, und obwohl sie einen langen Mantel trug, löste der Anblick des Stoffs über ihrem Busen eine jähe Vorstellung von ihrer nackten Gestalt und damit eine Welle der Erregung aus. Die sexuelle Einsamkeit, die mich seit längerem plagte und mitunter zu den voyeuristischen Vergnügungen der Pornos im Kabelfernsehen trieb, war nach der Trauerfeier für meinen Vater noch stärker geworden und stieg in mir auf wie ein heulender Sturm; bei dieser postmortalen Libidoattacke kam ich mir wieder vor wie ein sabbernder, pubertärer Onanist, der große, dürre, praktisch unbehaarte Wichserkönig der Blooming Field Junior High School.
Um dieser Phantasie ein Ende zu setzen, schaute ich mir das Mädchen an. Das spindeldürre kleine Ding trug einen unförmigen purpurroten Mantel, war auf den Rand der Vortreppe geklettert und balancierte jetzt dort herum, ein dünnes Bein vor sich ausgestreckt. Unter dem Mantel trug sie anscheinend so etwas wie ein Tutu, ein rosa Gebilde aus Tüll und Netzgewebe über dicken schwarzen, an den Knien ausgebeulten Strumpfhosen. Doch das Auffälligste an ihr waren die Haare, ein hellbrauner Schopf weicher Locken, die das kleine Köpfchen umrahmten wie ein riesiger Glorienschein. Die Haut der Mutter war dunkler als die des Kindes. Wenn das Mutter und Tochter waren, befand ich, könnte der Vater des Mädchens ein Weißer sein. Ich hielt den Atem an, als ich die Kleine von der Mauer springen sah, doch sie landete mühelos und mit einem kleinen Federn in den Knien auf dem Boden. Wie die Fee aus Peter Pan, dachte ich.
Wenn ich auf unsere Anfänge zurückblicke, staune ich wohl am meisten darüber, wie klein unser Haus war, schrieb mein Vater. Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer im Erdgeschoss beliefen sich auf knapp 45 Quadratmeter. Zwei Dachkammern im ersten Stock, die als Schlafzimmer genutzt wurden, ergaben noch einmal so viel Bodenfläche. Es gab keinerlei Komfort. Unsere sanitären Anlagen bestanden aus einer Außentoilette und einer handbetriebenen Pumpe, jede für sich über 20 Meter vom Haus entfernt. Ein Teekessel sowie ein Behälter neben dem Küchenherd versorgten uns mit heißem Wasser. Im Gegensatz zu besser ausgestatteten Farmen hatten wir keine unterirdische Zisterne zum Speichern von Regenwasser, aber immerhin einen großen Tank aus Metall, der im Sommer den Regen auffing. Im Winter schmolzen wir Schnee. Für das Licht gab es Petroleumlampen. Obwohl in den dreißiger Jahren die Elektrifizierung auch auf dem Land einsetzte, wurden wir erst 1949 «angeschlossen». Es gab keine Heizung. Die Küche wurde von einem holzbefeuerten Herd erwärmt und das Wohnzimmer von einem Heizofen. Wir hatten Vorsatzfenster, ansonsten war das Haus nicht isoliert. Das Feuer im Heizofen durfte nur in der kältesten Zeit über Nacht weiterbrennen. Morgens war das Wasser im Teekessel oft gefroren. Vater stand als Erster auf. Er machte Feuer, sodass die Kälte nicht mehr ganz so schlimm war, wenn wir aus dem Bett krochen. Aber auch so schlotterten wir und drängten uns beim Anziehen um die Öfen. Anfang der dreißiger Jahre ging uns im Winter einmal das Feuerholz aus. Wir hatten von vornherein nicht genug eingelagert. Wenn man mit grünem Holz heizen muss, fährt man mit Esche und Ahorn am besten.
Während ich das las, wartete ich ständig auf ein Wort über Lisa, aber sie tauchte nirgends auf. Mein Vater schrieb über die Finessen des Stapelns «eines ehrlichen Klafters Holz», über das Pflügen mit Belle und Maud, den hauseigenen Pferden, über das Säubern der Felder von gefürchteten Unkräutern wie Kanadische Distel und Ackerquecke, über landwirtschaftliche Fertigkeiten wie Eggen, Säen, Quereggen, Getreideanbau und Getreideernte, Heuen, das gemeinschaftliche Dreschen, das Beschicken eines Silos und das Fangen von Taschenratten. Als kleiner Junge hatte mein Vater gegen Bezahlung Taschenratten getötet, und im Nachhinein sah er das Komische an dieser Tätigkeit. Ein Abschnitt begann mit dem Satz: Wer sich nicht für Taschenratten und deren Fang interessiert, sollte diesen Absatz überspringen.
Alle biografischen Aufzeichnungen sind lückenhaft. Es liegt auf der Hand, dass man manche Geschichten nicht erzählen kann, ohne anderen oder sich selbst wehzutun, dass jede Autobiografie Fragen der Perspektive, der Selbsterkenntnis, der Verdrängung und glatten Täuschung aufwirft. Es überraschte mich nicht, dass die geheimnisvolle Lisa, die meinen Vater Geheimhaltung schwören ließ, in diesen Aufzeichnungen fehlte. Ich selbst würde in meiner Geschichte bestimmt auch vieles weglassen. Lars Davidsen war ein rigoros ehrlicher und tieffühlender Mensch, aber es stimmte, was Inga über seine ersten Jahre gesagt hatte. Vieles blieb im Verborgenen. Zwischen Wir hatten von vornherein nicht genug eingelagert und fährt man mit Esche und Ahorn am besten lag eine unerzählte Geschichte.
Ich habe Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass meine Großeltern zwar immer arm waren, aber durch die Große Depression vollständig ruiniert wurden. Das armselige kleine Haus, das mein Vater beschrieb, steht immer noch, und die verbliebenen zwanzig Acres der einstigen Farm sind jetzt an einen anderen Farmer verpachtet, der noch weitere Hunderte und Aberhunderte Acres besitzt. Mein Vater konnte sich nie von diesem Ort trennen. Als seine Krankheit schlimmer wurde, verkaufte er bereitwillig das Haus, in dem er mit meiner Mutter und uns gewohnt hatte, einen herrlichen Bau, der zum Teil aus Holz von Bäumen bestand, die mein Vater selbst gefällt hatte. Aber das Farmhaus seiner Kindheit schenkte er mir, seinem Sohn, dem aus der Art geschlagenen und in New York City lebenden Arzt, Psychiater und Psychoanalytiker.
Meinen Großvater kannte ich zumeist schweigend. Er saß in einem Polstersessel in dem kleinen Wohnzimmer mit dem Holzfeuerofen. Neben dem Sessel stand ein wackeliger Tisch mit einem Aschenbecher darauf. Als Junge war ich von diesem Gegenstand fasziniert, weil ich ihn anstößig fand. Es war eine schwarze Minitoilette mit einer goldenen Brille, das einzige Spülklosett, das meine Großeltern je besitzen sollten. Das Haus roch immer stark nach Moder und im Winter nach verbranntem Holz. Wir gingen selten nach oben, aber ich glaube nicht, dass man es uns je verboten hat. Die enge Treppe führte zu drei winzigen Zimmern, von denen eines meinem Großvater gehörte. Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber ich kann nicht älter als acht Jahre gewesen sein. Ich schlich mich die Treppe hinauf und ging in das Zimmer meines Großvaters. Durch das kleine Fenster fiel fahles Licht herein, und ich sah zu, wie die Staubkörnchen in der Sonne tanzten. Mit einer Art dumpfer Ehrfurcht betrachtete ich das schmale Bett, die hohen Stapel vergilbender Zeitungen, die zerschlissene Tapete, die wenigen verstaubten Bücher auf einer ramponierten Frisierkommode, die Tabaksbeutel und den Kleiderhaufen in einer Ecke. Ich glaube, ich hatte eine vage Vorstellung von dem einsamen Dasein dieses Mannes und das Gefühl, hier sei etwas verlorengegangen – aber ich wusste nicht, was. In der Erinnerung höre ich meine Mutter hinter mir sagen, ich solle nicht in diesem Zimmer sein. Meine Mutter schien alles zu wissen und zu spüren, was andere Menschen nicht spürten. Ihr Ton war überhaupt nicht scharf, aber vielleicht hat ihre Rüge mir das Erlebnis unvergesslich gemacht. Ich fragte mich, ob es irgendwo in dem Zimmer etwas gab, das ich nicht hätte sehen sollen.
Mein Großvater war freundlich zu uns, und ich mochte seine Hände, sogar die rechte, an der drei Finger fehlten, die er 1921 an einer Kreissäge verloren hatte. Er tätschelte mich gern oder legte mir eine Hand auf die Schulter und ließ sie dort, bis er sich wieder seiner Zeitung und dem Spucknapf zuwandte – einer Kaffeebüchse, auf der «Folgers» stand. Seine Eltern waren hier eingewandert und hatten acht Kinder: Anna, Brita, Solveig, Ingeborg, noch eine Ingeborg, David, Ivar (mein Großvater) und Olaf. Anna und Brita blieben am Leben und wurden erwachsen, aber bei meiner Geburt waren sie bereits tot. Solveig starb 1907 an Tuberkulose. Die erste Ingeborg starb am 19. August 1884. Sie wurde sechzehn Monate alt. Unser Vater hat mir erzählt, diese Ingeborg sei kurz nach der Geburt gestorben und so winzig gewesen, dass eine Zigarrenkiste als Sarg diente. Wahrscheinlich hat unser Vater Ingeborgs Tod mit einer anderen Geschichte aus der Gegend durcheinandergebracht. Auch die zweite Ingeborg erkrankte an Tuberkulose und kam ins Sanatorium in Mineral Springs, wurde aber geheilt. David bekam 1925 Tuberkulose. Er verbrachte das ganze Jahr 1926 in dem Sanatorium. Als er wieder gesund war, verschwand er. Er wurde erst 1936 gefunden, und da war er bereits tot. Olaf starb 1914 an Tuberkulose. Die Geister der Geschwister.
Meine Großmutter, ebenfalls Tochter norwegischer Einwanderer, wuchs mit zwei gesunden Brüdern auf und erbte Geld von ihrem Vater. Mit ihrem hitzigen Temperament war sie ganz das Gegenteil von ihrem Mann, und ich war ihr besonderer Liebling. Wir hatten ein bestimmtes Ritual, wenn ich ins Haus kam. Ich stieß die Fliegentür auf, rannte hinein und brüllte: «Oma, mein Schwert!» Auf dieses Stichwort hin holte sie hinter dem Küchenschrank ein Kantholz hervor, an das mein Onkel Fredrik ein kurzes Querstück genagelt hatte. Dann lachte sie immer, ein lautes Gackern, das manchmal in Husten überging. Sie war dick, aber auch kräftig, eine Frau, die schwere Wassereimer schleppte und einen Haufen Äpfel in ihrem aufgespannten Rock tragen konnte, beim Kartoffelschälen das Messer mit wildem Grimm schwang und jedes Lebensmittel zerkochte, das ihr in die Hände fiel. Sie war launisch; an manchen Tagen lächelte sie, schwatzte und erzählte Geschichten, an anderen brütete sie düster vor sich hin, murmelte halblaute Bemerkungen und tat mit kreischender Stimme dubiose Ansichten über Bankiers, reiche Leute und allerlei andere Verbrecher kund. An ihren schlimmsten Tagen sagte sie etwas Schreckliches: Ich hätte Ivar nie heiraten sollen. Mein Vater erstarrte, wenn seine Mutter so wetterte, mein Großvater schwieg, meine Mutter versuchte es mit Humor und gutem Zureden, und Inga, die auf jeden emotionalen Wetterwechsel sensibel reagierte und bei der bloßen Andeutung eines Konflikts schmerzlich das Gesicht verzog, ließ den Kopf hängen. Jedes Heben der Stimme, jedes Widerwort, jede mürrische Miene, jedes gereizte Wort traf sie wie ein Nadelstich. Dann verspannte sich ihr Mund, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Wie oft hatte ich mir damals gewünscht, sie würde sich ein etwas dickeres Fell zulegen.
Trotz der gelegentlichen Ausbrüche meiner Großmutter gefiel es uns «da draußen, wo ich zu Hause bin», wie mein Vater sagte, vor allem im Sommer, wenn die weiten, ebenen Felder mit dem wachsenden Mais bis zum Horizont reichten. Ein rostiger, von Unkraut überwucherter Traktor, ein für alle Zeiten geparkter Ford Modell A, die alte Pumpe und die steinernen Grundmauern einer einstigen Scheune waren feste Bestandteile unserer Spiele. Außer dem Wind, der durch das Gras und die Bäume strich, den Lauten der Vögel und ab und zu einem vorbeifahrenden Auto auf der Straße war wenig zu hören. Es kam mir nie in den Sinn, dass meine Schwester und ich in einer erstarrten Welt herumkletterten, -rannten und uns Geschichten von schiffbrüchigen Waisenkindern ausdachten, doch die Welt meiner Großeltern, jener Einwanderer der zweiten Generation, war irgendwann zum Stillstand gekommen. Jetzt weiß ich, dass dieser Ort eine Narbe über einer alten Wunde ist. Es ist seltsam, dass alte Schmerzen immer zu uns zurückkehren, aber inzwischen halte ich das für eine allgemeingültige Wahrheit. Was einmal war, lässt uns nicht mehr los. Als mein Urgroßvater, Olaf Davidsen, der jüngste von sechs Söhnen, im Frühjahr 1868 von dem winzigen Hof hoch oben auf einem Berg in Voss, Norwegen, fortging, konnte er bereits Englisch und Deutsch und war ausgebildeter Lehrer. Er schrieb Gedichte. Mein Großvater verließ die Schule nach der fünften Klasse.
Das Tagebuch war so ein kleiner Fünfjahresband, wo für jeden Tag nur ein paar Zeilen zur Verfügung stehen. Mein Vater führte es von 1937 bis 1940, und auch für 1942 finden sich sporadische Einträge. Nach 1937 hatte sich Lars Davidsens Stil radikal verändert, und ich zerbrach mir den Kopf über seinen eigentümlichen Gebrauch des Verbs sein und seine schwankenden Präpositionen. Manche Einträge besagten einfach nur War auf der Schule. Ich brauchte ein paar Minuten, um zu erkennen, dass es sich bei dieser seltsamen Formulierung um eine freie Übersetzung des norwegischen var på skolen handelte, wörtlich: war auf Schule. Seine Syntax und einige Präpositionen waren die englische Version der ersten Sprache der Familie. Vermutlich hatte er das Tagebuch zu Weihnachten bekommen und am 1. Januar mit den Eintragungen begonnen. Er vermerkte Besuche von und bei Nachbarn: Masers kamen zum Abendessen. Neil war auch dabei. Die Jungen von Jacobsen waren am Nachmittag da. War heute zu Brekkes. War auf Fest bei Bakkethuns. Wetterverhältnisse: Heute war Schneesturm. Es bläst heftiger Wind. Wetter war schön, es hat getaut. Heute war starker Schneesturm. Von morgens bis jetzt. Vor dem Haus ist eine meterhohe Schneewehe. Winterkrankheiten: Lotte und Fredrik waren nicht in der Schule, aber Fredrik ist heute aufgestanden. Den ganzen Tag im Bett für Husten. Probleme mit Tieren: Daddy und ich waren zu Clarence Brekke. Er hatte Pech. 4 Stück Vieh waren tot. Daddy war bei Clarence und hat ihm geholfen, die siebte Kuh abzuhäuten. 4 Färsen, 1 Ochse, 1 Kuh und ein Kalb sind ihm in einer Woche gestorben. Tardy, das Pferd von Jacobsen, ist tot. Embers Hund ist übergefahren. Am 28. Januar stand etwas über David. Heute ist ein Jahr her seit Vater in der Stadt war, um Onkel David zu identifizieren, nachdem er erfahren hat, dass er tot ist. Im Frühjahr gab es mehrere Eintragungen über Taschenratten: Heute hab ich 6 Taschenratten gefangen. Vier Ratten gefangen. Ich hab insgesamt 7 Ratten in Otterness gefangen. Am 1. Juni schrieb mein Vater: Heute gab es Streit zwischen Harry und Daddy. Am 3. Juni fand ich die erste Erwähnung der Welt jenseits dieser kleinen ländlichen Gemeinde. Ich hab heute gepflügt und geeggt. King Edward und Mrs. Wallis Simpson. Am Fünfzehnten desselben Monats verzeichnete mein Vater eine Gefühlsregung. Ich hab den ganzen Tag Kartoffeln gehackt. Pete Bramvold war hier und wollte mich einstellen. Ich bin verdammt sauer, weil ich nicht gehen darf. An dem Tag bevor Lisa meinem Vater den Brief schickte, dem 26. Juni, fand ich diesen Eintrag: Wir haben die Kartoffeln untergepflügt. Daddy war zur Stadt. Harry ist ins Gefängnis gekommen.
Wer war Harry? Inga sagte auf meine Frage, sie habe keine Ahnung. Ich erklärte mich bereit, Onkel Fredrik zu schreiben und ihn zu fragen. An Tante Lotte konnte man sich nicht mehr wenden. Sie hatte Alzheimer und war in einem Pflegeheim.
Als Erstes sagte Eglantine zu mir: «Guck mal, Mommy, ein Riese.» Ich hatte meinen neuen Mietern die Tür geöffnet, und als ich Miranda nun zum zweiten Mal sah, konnte ich ihr zu meiner Erleichterung die Hand geben, ohne aus der Fassung zu geraten. Sie hatte ungewöhnliche Augen – groß, mandelförmig, haselnussbraun und etwas schräg stehend, als gäbe es einen asiatischen Zweig in der Familie. Vor allem aber faszinierte mich in diesen ersten Sekunden ihr eindringlicher Blick. Dann richtete sie diese ungewöhnlichen Augen auf ihre Tochter und sagte: «Nein, Eggy, das ist kein Riese. Das ist ein großer Mann.»
Ich sah zu dem Kind hinunter und sagte: «Na ja, ich bin zwar fast so groß wie ein Riese, aber ich bin nicht wie die in den Märchen.» Ich beugte mich vor und lächelte aufmunternd, doch die Kleine lächelte nicht zurück. Sie schaute mich an, ohne zu zwinkern, und kniff dann die Augen zusammen, als müsste sie über meine Bemerkung sehr ernsthaft nachgrübeln. Ihre nachdenkliche Miene machte mich noch befangener ob meiner Körpergröße. Ich bin eins fünfundneunzig. Inga misst eins zweiundachtzig, und mein Vater hatte die eins neunzig nur um Haaresbreite verpasst. Meine Mutter ist mit ihren eins fünfundsiebzig ein Knirps dagegen. Die ganze Familie Davidsen wie auch die Nodelands auf der väterlichen Seite meiner Mutter waren dünn und hochgewachsen. Was bei dieser genetischen Kombination herauskommen würde, war leicht abzusehen. Inga und ich hörten gar nicht auf zu wachsen. Unser Leben lang mussten wir uns Witze über Bohnenstangen, scherzhafte Fragen nach «dem Wetter da oben» und falsche Vermutungen über unsere Hochleistungen im Basketball anhören. Nie wurde ein Sitz in einem Kino, Theater, Flugzeug oder U-Bahn-Zug, eine öffentliche Toilette oder ein Waschbecken, eine Couch oder ein Sessel in einem Foyer oder Wartezimmer, ein Schreibtisch in einer einzigen Bibliothek dieser Welt für einen Menschen wie mich konstruiert. Jahrelang meinte ich in einer Welt zu leben, die ein paar Nummern zu klein für mich ist, nur in meinem eigenen Haus habe ich alle Arbeitsplatten erhöht und große Schränke eingebaut, die «genau richtig» sind, wie Goldlöckchen sagen würde.
Als wir an meinem Küchentisch saßen, spürte ich bei Miranda Casaubon eine starke Zurückhaltung, eine stolze Distanz, die meine Bewunderung fand, die Unterhaltung aber schwierig machte. Miranda konnte ebenso gut fünfundzwanzig wie fünfunddreißig sein und war konservativ gekleidet; die einzige Ausnahme waren die hohen Stiefel, die vorne geschnürt waren und die Form der Waden nachzeichneten. Wie ich von Laney wusste, hatte sie «einen guten Job» als Buchgestalterin bei einem großen Verlag, konnte die Miete bezahlen und wollte unbedingt in Park Slope wohnen, damit ihre Tochter hier auf die Grundschule P.S. 321 gehen konnte. Von einem Vater war keine Rede. Miranda erzählte mir, sie sei in Jamaika aufgewachsen und mit dreizehn mit ihrer Familie von dort fortgezogen. Ihr Akzent hatte sich abgeschliffen, aber das Musikalische des karibischen Englisch klang noch durch. Die Eltern und die drei Schwestern wohnten jetzt alle in Brooklyn. Miranda hatte beim Sprechen die Hände übereinander auf den Tisch gelegt. Es waren schlanke Hände mit langen Fingern, und mir fiel auf, dass keine Spannung in ihnen war und im übrigen Körper auch nicht. Sie war ruhig, entspannt und wach.
Wenn Eggy nicht gewesen wäre, hätte ich nichts weiter erfahren. Sie hatte seit unserer Begrüßung nicht mehr gesprochen. Als wir uns setzten, umklammerte sie den Arm ihrer Mutter, vergrub das Gesicht an ihrer Schulter, und dann begann ein Spiel mit der Stuhllehne. Sie hielt sich mit einer Hand an der Lehne fest, beugte sich nach hinten, so weit es ging, und zog sich dann wieder nach vorn. Nach dieser Gymnastikvorstellung hüpfte sie plötzlich davon und tanzte mit ausgestreckten Armen im Zimmer herum, dass die hellbraunen Locken nur so flogen. Sie hopste zu den Bücherregalen und sang: «Buch, bücher, am büchersten, und immer meeehr Büchereeehr! Buch-a-Buch, Buch-a-Buch. Ich kann schon lesen.»
Ich fragte Miranda: «Kann sie lesen?»
Miranda lächelte zum ersten Mal, und ich sah ihre gleichmäßigen weißen Zähne, die ein ganz klein wenig vorstanden. Der Überbiss ließ mich erschauern, und ich wandte den Blick ab. «Ein bisschen. Sie geht in den Kindergarten und lernt es dort.»
Eggy beugte den Kopf zurück, breitete die Arme aus und begann, auf dem Boden herumzuwirbeln.
«Nicht so wild», sagte Miranda zu ihr. «Beruhige dich.»
«Ich mag aber gerne wild sein!» Sie lachte uns an. Der aufgerissene Mund schien die ganze untere Hälfte ihres kleinen Gesichts einzunehmen und verlieh ihr einen Moment lang ein koboldhaftes Aussehen.
«Ich meine es ernst», sagte Miranda.
Das Mädchen schaute die Mutter an und drehte sich dann weiter, allerdings langsamer. Nachdem sie kurz und rebellisch mit dem Fuß aufgestampft hatte, schüttelte sie die Locken und hüpfte zu mir, wobei sie ihrer Mutter einen leicht grollenden Blick zuwarf. Sie drängte sich ganz nah an mich heran und fragte verschwörerisch: «Willst du ein Geheimnis wissen?»
Ich sah Miranda an.
«Doktor Davidsen möchte das vielleicht nicht hören», sagte Miranda.
«Erik», sagte ich.
Miranda warf mir einen Blick zu, sagte aber nichts.
«Ich würde es gern hören, wenn deine Mutter nichts dagegen hat», versuchte ich es mit einem Kompromiss.
Eggy schaute ihre Mutter böse an. Miranda seufzte und nickte, dann spürte ich die Hand der Kleinen an meinem Kopf, während sie mein Ohr an ihren Mund zog. Mit lautem, aufgeregtem Flüstern, das mein Trommelfell wie ein Windstoß traf, sagte sie: «Mein Daddy war in einer großen Kiste, und dann ist es da drin ganz stickig und nass geworden, und da ist er ver… » – sie zögerte – «… verschwindet. Er kann nämlich zaubern.»
Ich war mir nicht sicher, ob Eggy glaubte, ihre Mutter könne das nicht hören, aber ich sah, wie Miranda kurz das Gesicht verzog und die Augenlider schloss. Dann sagte ich zu Eggy: «Ich sag’s nicht weiter. Versprochen.»
Die kleine Eglantine lächelte mich kokett an. «Du musst sagen: Ich schwöre und will des Todes sein.»
«Ich schwöre und will des Todes sein», sagte ich.
Das schien sie zu freuen. Sie strahlte mich an, schloss die Augen und atmete laut durch die Nase aus, als wären keine Worte, sondern Gerüche zwischen uns hin- und hergegangen.
Als ich mich wieder Miranda zuwandte, sah ich, dass sie mich scharf beobachtete, als wollte sie mein tiefstes Inneres ergründen. Ich habe eine Schwäche für kluge Frauen, darum lächelte ich ihr zu. Sie lächelte zurück, doch dann stand sie auf und beendete so das Gespräch. Diese abrupte Geste löste in mir eine jähe Begierde aus, ihre Geschichte zu erfahren, alles über diese Frau, ihre fünfjährige Tochter und den geheimnisvollen Vater herauszufinden, den sein Kind in eine Kiste verwiesen hatte.
Zum Abschied sagte ich: «Bitte melden Sie sich, wenn Sie etwas brauchen oder wenn ich vor dem Einzug noch etwas für Sie tun kann.»
Ich sah ihnen nach, wie sie die Treppe hinuntergingen, drehte mich im Flur um und hörte mich sagen: «Ich bin so einsam.» Das erschütterte mich, denn dieser Satz hatte sich zu einem unwillkürlichen verbalen Tic entwickelt. Mir wurde nur selten bewusst, dass ich das sagte; vielleicht merkte ich auch gar nicht, wenn ich es laut aussprach. Ich kannte dieses ungebetene Mantra schon aus der Zeit meiner Ehe; ich murmelte es vor dem Einschlafen, im Badezimmer und selbst beim Einkaufen vor mich hin, aber im vergangenen Jahr war es schlimmer geworden. Bei meinem Vater war es der Name meiner Mutter. Wenn er allein in einem Sessel saß, bevor er ein Nickerchen machte, und später in seinem Zimmer im Pflegeheim wiederholte er immer wieder Marit. Manchmal war sie in Hörweite und reagierte darauf. Dann wusste er anscheinend nicht, dass er etwas gesagt hatte. Das ist das Seltsame an der Sprache: Sie geht über die Grenzen des Körpers hinaus, ist innen und außen zugleich, und manchmal merken wir gar nicht, dass die Schwelle überschritten wird.
Als Witwe und geschiedener Mann fanden Inga und ich eine gemeinsame Ebene in unserer beiderseitigen Einsamkeit. Nachdem Genie mich verlassen hatte, stellte ich fest, dass wir meist Einladungen zu Essen, Partys und Veranstaltungen gefolgt waren, die von ihrer Seite kamen und nicht von meiner. Die Ärzte von der Payne-Whitney-Klinik, wo ich damals arbeitete, und meine Psychoanalytikerkollegen langweilten sie. Auch Inga hatte Freunde verloren; manch einer hatte sich vom Glanz ihres berühmten Mannes angezogen gefühlt und sie als seine charmante Begleiterin akzeptiert, war dann aber verschwunden, nachdem Max tot war. Obwohl sie auf viele dieser Leute von Anfang an wenig Wert gelegt hatte, gab es auch andere, deren plötzliches Fernbleiben sie tief kränkte. Doch sie lief keinem hinterher.
Inga hatte Max während ihres Philosophiestudiums an der Columbia University kennengelernt. Er war zu einer Lesung gekommen, und meine Schwester saß in der ersten Reihe. Inga war eine fünfundzwanzigjährige blonde Schönheit, brillant, von glühendem Eifer besessen und sich ihrer Verführungskraft bewusst. Sie hatte Max Blausteins fünften Roman auf dem Schoß und lauschte mit gespannter Aufmerksamkeit auf jedes Wort. Am Ende der Lesung stellte sie ihm eine lange, komplizierte Frage zur Erzählstruktur, und er bemühte sich redlich, sie zu beantworten. Als sie ihm dann ihr Buch zum Signieren vorlegte, schrieb er auf das Titelblatt: «Ich kapituliere. Gehen Sie nicht fort.» Max war 1981 siebenundvierzig Jahre alt und hatte zwei Ehen hinter sich. Er galt nicht nur als bedeutender Schriftsteller, sondern stand auch im Ruf eines ausschweifenden Verführers junger Frauen und wilden Zechers, der zu viel trank, zu viel rauchte und überhaupt in allem maßlos war, und Inga wusste das. Sie ging nicht fort. Sie blieb. Sie blieb, bis er 1998 mit vierundsechzig Jahren an Magenkrebs starb.
Nur einen Monat nach ihrer Promotion über Kierkegaards Entweder – Oder war Inga schwanger. Obwohl Max aus seinen früheren Ehen keine Kinder hatte und meinte, ihm fehle das «Elterngen», wurde er ein fast lächerlich begeisterter Vater. Er ließ Sonia auf den Knien reiten und sang ihr mit seiner krächzenden, völlig unmelodischen Stimme Lieder vor. Er nahm ihre ersten Laute auf, fotografierte und filmte sie in jedem Stadium des Wachstums, brachte ihr das Baseballspielen bei, nahm gewissenhaft an Elternversammlungen, Schulkonzerten und Theateraufführungen teil und prahlte schamlos mit ihren Gedichten, den verbalen Glanzstücken seines «Wunderkindes». Dennoch war Inga für die meisten Alltagsarbeiten zuständig, für das Füttern, Trösten und Anziehen und zum großen Teil auch für das Vorlesen von Gutenachtgeschichten. Ich sah eine Bindung zwischen Mutter und Tochter, die mich an die Beziehung zwischen Inga und unserer Mutter erinnerte, eine unausgesprochene körperliche Nähe, die ich als Überlappung bezeichne. Ich habe bei meinen Patienten viele Versionen der Eltern-Kind-Beziehung kennengelernt; sie leiden unter den Komplikationen einer Geschichte, die sie nicht erzählen können. Max’ Tod warf Inga und Sonia aus der Bahn. Meine Nichte war zwölf, ein heikles Alter, eine Zeit innerer und äußerer Umwälzungen, und eine Zeitlang flüchtete sich Sonia in zwanghaftes Ordnungsstreben. Während meine Schwester in sich versank und sich weinend durch den Tag schleppte, begann Sonia zu putzen, zu räumen und bis spät in der Nacht zu lernen. Genau wie die Etiketten und Ordner meines Vaters waren Sonias perfekt zusammengelegte und nach Farben geordnete Pullover, ihre glänzenden Zeugnisse und bisweilen spröden Reaktionen auf den Kummer ihrer Mutter Säulen in einer Architektur der Bedürftigkeit, Konstruktionen zur Abwehr der hässlichen Wahrheiten von Chaos, Tod und Verfall.
Max war am Ende völlig ausgezehrt. Als er, schon nicht mehr bei Bewusstsein, in seinem Krankenhausbett lag, sah sein Kopf aus wie ein Schädelknochen mit einer dünnen Schicht Grau darauf, und der reglos auf der Decke liegende Arm erinnerte mich an einen Zweig. Das Morphium hatte ihn bereits in einen Dämmerzustand versetzt, der den Sterbenden vorbehalten ist. Ich hatte nach den vorausgegangenen Qualen jede Hoffnung aufgegeben. Das Bild, wie Inga den Infusionsschlauch anhebt und zu ihm ins Bett kriecht, verfolgt mich noch immer. Sie schmiegte sich an ihn und legte den Kopf an seine Schulter. «O mein Liebling, mein Liebling, mein Herzallerliebster», wiederholte sie ohne Ende. Ich musste mich abwenden und in den Flur hinausgehen, wo meine Tränen so hemmungslos flossen wie seit langem nicht mehr.
Erst nach Max’ Tod wurde ich wirklich zu Onkel Erik, dem Helfer in allen Lebenslagen, der bei Referaten zur Seite stand, schnell mal die Töpfe abwusch und Inga und Sonia ganz allgemein Trost und Rat spendete, im Großen wie im Kleinen. Als Ehemann hatte ich versagt, aber ich war ein guter Onkel. Inga musste über Max reden – musste mir von seinem grausamen Tagespensum als Schriftsteller erzählen, das ihn schlapp und erschöpft machte, von seinen nächtlichen Sitzungen mit einer Whiskeyflasche, Camel-Zigaretten und alten Fernsehfilmen, seinem Jähzorn, auf den Reuebekenntnisse und Liebeserklärungen folgten. Sie musste auch über den Krebs sprechen. Wieder und wieder erzählte sie mir von dem Morgen, als Max sich unaufhörlich übergab, und schilderte dann, bleich und zitternd, wie er nach ihr gerufen hatte. «Die Toilette war voller Blut. Die Brille blutbespritzt und das ganze Becken voll, überall Blut, Blut und noch mehr Blut. Er wusste, dass er starb, Erik. Ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Aber später sagte er zu mir, als er sah, was da aus ihm herauskam, wusste er Bescheid, und er dachte sich: ‹Ich habe viel geleistet. Jetzt kann ich gehen.›»
Ich hatte immer gespürt, dass ihre Ehe leidenschaftlich, aber nicht einfach war. Sie waren beide voneinander abhängig, gefangen in einer langen Liebesgeschichte, die nie zur Ruhe kam, sondern schäumte und kochte, bis sie schließlich abrupt abgeschnitten wurde. «Es gab zwei Maxe», sagte Inga gern. «Meinen Max und den in der öffentlichen Arena, die Ware auf dem literarischen Markt: das Genie vom Dienst.» Es gibt alle möglichen Arten von Schriftstellern, aber Max Blaustein verkörperte das kulturelle Ideal des eleganten Romanciers. Er sah gut aus, wenn auch nicht im üblichen Sinn. Er hatte hagere, feingeschnittene Gesichtszüge, volles Haar, das schon früh gleichmäßig weiß geworden war, und als besonderes Markenzeichen eine Nickelbrille, die ihm in Ingas Augen das Aussehen eines russischen Nihilisten verlieh. Der öffentliche Max Blaustein, der Autor von fünfzehn Romanen, vier Theaterstücken und einem Essayband, wurde von seinen Lesern verehrt und fanatisch geliebt, was sich mitunter zu regelrechter Hysterie steigerte. 1995 wäre er bei einer Lesung in London von einer aufgeputschten Menschenmenge fast zu Tode getrampelt worden, als alle nach vorn stürmten, um ihrem Idol näher zu sein. Die Trauerfeier hatte Hunderte von weinenden Anhängern angelockt, die sich trotz ihres zur Schau gestellten Kummers unter allgemeinem Geschubse und Gerempel in den Saal drängten. «Diese Anbetung», sagte Inga, «war manchmal schon krankhaft. Max schien das immer zu verwirren, aber ich glaube, seine Geschichten rührten an eine dunkle, verborgene Seite der Menschen. Ich weiß nicht, ob es eine Erklärung dafür gibt oder geben kann, und Max konnte es ganz bestimmt nicht erklären, aber mir hat das manchmal Angst gemacht – was da in ihm steckte.» An diese Sätze erinnerte ich mich, weil Ingas Stimme dabei überschnappte und ich das Gefühl hatte, es stecke noch mehr dahinter. Später wünschte ich, ich hätte sie gefragt, wie sie das meinte, aber damals sträubte sich etwas in mir dagegen. Ich weiß, was ich Zurückhaltung oder Rücksichtnahme nenne, kann auch eine Form von Angst sein – man will lieber nicht hören, was dann kommt.
Um die Hypothek auf sein Land abzulösen, sägte mein Großvater Schnittholz für einen Mann namens Rune Carlsen zu: Für je zweieinhalb Ster bekam er einen Dollar. Jeder Umzug auf einen neuen Platz brachte viel schwere Arbeit mit sich, aber keinen Lohn. Das Gleiche galt, wenn die Maschine kaputtging, und das kam häufig vor. Die Gerätschaften waren alt. Von vier bis sechs Uhr früh und von abends um sieben bis zum Einbruch der Dunkelheit arbeitete unser Vater auf dem Feld. Der amerikanische Glaubenssatz, dass harte Arbeit Erfolg garantiert, erwies sich in diesem Fall als krasse Lüge. Nachdem das einige Jahre so gegangen war und sich gerade eine Besserung abzeichnete, kam die Zwangsvollstreckung.
Den Verlust dieser vierzig Acres hat mein Vater nie verschmerzt. Dem entgangenen Land trauerte er nicht nach, aber das Bemühen, es zu erhalten, hatte seinen Vater gebrochen. Obwohl er das nie so gesagt hat, glaube ich inzwischen, dass es so war. Eine Depression, schrieb er, bringt nicht nur wirtschaftliches Elend mit sich, nicht nur die Notwendigkeit, mit weniger auszukommen. Das ist vielleicht noch das Geringste. Menschen, die ihren Stolz haben, werden von einem Schicksal getroffen, an dem sie keine Schuld tragen; doch eben weil sie ihren Stolz haben, fühlen sie sich durch und durch als Versager. Geldeintreiber verdienen ihren Lebensunterhalt damit, Menschen, die ihren Stolz haben, zu erniedrigen und zu demütigen. Es ist ihre stärkste Waffe. Menschen mit Charakter werden machtlos. Wenn man keine Macht hat, ist alles Gerede von Gerechtigkeit nur leeres Geschwätz. Der tröstliche Spruch, es säßen alle «im selben Boot», war nur zum Teil richtig. Farmer, die schuldenfrei in die Depression gegangen waren, konnten ihr Vermögen womöglich sogar vergrößern, indem sie billiges Land aufkauften und Landmaschinen zu Dumpingpreisen erwarben. Zu dieser Zeit stiegen Farmer entweder auf oder gingen unter. Wir gingen unter. Diese Geldeintreiber hatten auch ein Gesicht. Vielleicht gab es einen Mann, der sich ein besonderes Vergnügen daraus machte, Ivar Davidsen vor den Augen seines ältesten Sohns zu beschämen. Vielleicht musste Lars mit ansehen, wie der Mann immer wieder Geld von seinem Vater forderte, das dieser nicht hatte, und vielleicht wartete Lars darauf, dass sein Vater die Fäuste ballte, dem Kerl mit der Linken einen Kinnhaken versetzte und gleich noch eine schnelle Rechte in die Magengrube hinterher. Zu diesen Schlägen sollte es nicht kommen, damals nicht und überhaupt nie.
Es dauerte keine Woche, bis Onkel Fredriks Antwort auf meinen Brief eintraf. Seine Mutter habe von Lisa gesprochen, schrieb er. Sie sei nicht von einer der umliegenden Farmen gekommen, sondern aus Blue Wing angereist, um bei den Brekkes auszuhelfen, als deren Sohn nach einer Blinddarmentzündung eine Zeitlang das Bett habe hüten müssen. Dann sei das Mädchen verschwunden, und seine Mutter habe sich Sorgen gemacht, ihr könnte etwas zugestoßen sein. Danach wiederholte er die Geschichte von dem verlorenen Land.
Mein Großvater Olaf hatte sich vor der Wirtschaftskrise von Rune Carlsen Geld geliehen und vierzig Acres Land als Sicherheit gegeben. Während der Depression machte Rune seine Forderung geltend, und Dad, der das Land von seinem Vater gekauft hatte, musste es an Rune abtreten. Der Verlust hat Dad seelisch belastet, er hatte in dieser Zeit oft Albträume. Dann schickte Mutter entweder Lottie oder mich, um ihn aufzuwecken.
Rune schnitt auf den vierzig Acres Holz zu und stellte Dad dafür an. Das war demütigend für ihn. Auch Harry Dahl arbeitete für Rune. Eines Tages ging die Sägemaschine kaputt, und Harry wurde nach Cannon Falls geschickt, um Ersatzteile zu besorgen. Er kam erst spät und betrunken zurück und wurde im Werk von aufgebrachten Männern empfangen. Ich erinnere mich, wie Dad mit Mutter darüber sprach. Er war wütend und hatte zu Harry gesagt, er solle machen, dass er wegkomme. Ich weiß nicht mehr, wie lange Harry im Gefängnis saß. Es wurde aber viel darüber geredet, dass Chester Haugen in Blue Wing wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde. Er hätte nur freundlicher zu der Polizei zu sein brauchen, dann hätten sie ihn nicht dreißig Tage eingebuchtet. Während der Haft hat er uns allen sehr gefehlt, und als er entlassen wurde, haben wir ihn mit einem Fest empfangen, bei dem es auch kleine Geschenke gab.
Mit herzlichen Grüßen, Fredrik
Während ich den sorgfältig geschriebenen Brief zusammenfaltete und in den Umschlag zurücksteckte, stellte ich mir den achtjährigen Fredrik in dem winzigen Zimmer mit dem schmalen Bett vor. Ich sah, wie er sich über seinen Vater beugte, um ihn aus den Träumen zu rütteln, die ihn in der Nacht aufschreien ließen.
Wenn ich abends aus meiner Praxis nach Hause kam, ging ich nach dem Essen die Notizen über meine Patienten durch. Das hatte ich mir nach meiner Scheidung angewöhnt, um die länger werdenden Stunden zu Hause auszufüllen. Bei der Durchsicht der Aufzeichnungen, die ich mir während der Sitzungen gemacht hatte, stellten sich manchmal von selbst neue Erkenntnisse ein, und ich notierte mir zusätzliche Bemerkungen oder Fragen für einen Kollegen, den ich möglicherweise zu Rate ziehen musste. Nach dem Tod meines Vaters legte ich ein neues Heft an, in dem ich Bruchstücke von während des Tages geführten Gesprächen festhielt, meine Ängste wegen des offenbar bevorstehenden Einmarschs in den Irak, Träume, an die ich mich erinnerte, und auch unverhofft aus den hinteren Winkeln des Gehirns auftauchende Assoziationen. Ich weiß, der Auslöser für dieses Bedürfnis nach Selbstdokumentation war die Abwesenheit meines Vaters, doch während mein Stift über die Seiten glitt, wurde mir noch etwas anderes klar: Ich wollte mit eigenen Worten auf das antworten, was mein Vater geschrieben hatte. Ich führte ein Gespräch mit einem Toten. In diesen Stunden am Esszimmertisch hörte ich oft Eggys schrille, hohe Stimme und die viel leisere von Miranda, auch wenn ich nur selten verstand, was sie sagten. Ich konnte ihr Abendessen riechen, hörte das Klingeln ihres Telefons, ihre Musik und manchmal quäkende Stimmen, wenn sie sich im Fernsehen Zeichentrickfilme anschauten. Diese einsamen Winterabende waren offenbar ein fruchtbarer Boden für Phantasien. Einige davon schrieb ich auf. Andere fanden nie Eingang in das schwarz-weiße Tagebuch, das meinen persönlichen Gedanken vorbehalten war, aber irgendwann trat Miranda als Figur in diesem ungeordneten Protokoll meines Lebens auf. Ihre Arbeitszeiten waren anders als meine, und ich sah sie nur selten. Wenn wir uns begegneten, war sie höflich, zurückhaltend und schenkte mir ein paar freundliche Worte, mehr nicht, aber ich begann davon zu träumen, dass ich eines Tages ihre kühle Förmlichkeit aufbrechen würde. Ihr distanzierter Blick, ihre nicht ganz perfekten Zähne, ihr unter Lagen warmer Kleidung verborgener Körper waren Bestandteile eines Lebens geworden, nach dem ich mich sehnte.
Eines Abends kam ich recht spät von einem Essen mit einem Kollegen zurück und bemerkte, dass vor dem mittleren Fenster der Gartenwohnung ein Fensterladen aufgegangen war. Innen brannte Licht, und ich sah Miranda an einem Tisch im vorderen Zimmer sitzen. Sie trug einen Bademantel, der am Hals offen stand, und als sie sich über einen großen Bogen Papier beugte, konnte ich die Wölbung ihres Busens und ihre Handbewegungen beim Zeichnen sehen. Neben ihr waren Stifte, eine Schere, Tintengläser und Kreide. Zuerst dachte ich, sie arbeite an einem Buchumschlag, doch als ich auf das Blatt hinuntersah, erkannte ich eine große weibliche Gestalt mit weit aufgerissenem Mund und scharfen Wolfszähnen. Es gab auch noch andere, kleinere Figuren, aber die konnte ich nicht erkennen. Aus Angst, beim Spionieren ertappt zu werden, ging ich weiter, aber dieser kurze Blick auf die bestialische Frau ließ mich nicht mehr los. An dem Abend erinnerte ich mich an meine erste Begegnung mit Los Caprichos; mir war von den Bildern übel geworden, während ich zwischen Faszination und Abscheu schwankte. Nach diesem einen Blick auf Mirandas Bild musste ich an Goya und an Monster im Allgemeinen denken. Das Erschreckende an ihnen ist nicht ihre Fremdheit, sondern dass sie uns so vertraut sind. Wir kennen diese menschlichen und tierischen Formen, die so verzerrt, entstellt, überdehnt oder miteinander vermengt wurden, bis wir nicht mehr wissen, ob sie Mensch oder Tier sind. Monster sprengen jede Kategorie. Beim Einschlafen dachte ich an Mr. T., einen alten Patienten, der von den schrillen Stimmen berühmter und berüchtigter männlicher wie weiblicher Verstorbener besessen war, und an den armen Daniel Paul Schreber, über den Freud einen Aufsatz schrieb, nachdem er dessen Buch gelesen hatte. Der Mann wurde von göttlichen, mit Himmelskörpern verbundenen Strahlen gepeinigt und litt unter «Brüllwundern» und «Wollustnerven», die ihn von Kopf bis Fuß durchdrangen und allmählich in eine Frau verwandelten.
Als meine Schwester noch klein war, hatte sie Anfälle. Ihr Blick wurde verschwommen, und dann war sie einen Moment lang geistig abwesend. Nur einmal hielt das so lange an, dass es mir Angst machte. Wir spielten im Wald hinter unserem Haus. Ich war ein Pirat, der sie gefangen genommen und mit imaginären Stricken an einen Baum gebunden hatte, und sie flehte um ihr Leben. Ich wollte mich gerade erweichen lassen und ihr erlauben, ein Piratenmädchen zu werden, da öffnete sie den Mund, wie um etwas zu sagen, und hielt dann plötzlich inne. Ich sah ihre Augenlider ganz merkwürdig flattern, von ihrer Unterlippe tropfte ein dünner Speichelfaden. Während ich sie anschaute, fiel ein Sonnenstrahl auf den Speichelfaden, und er glänzte wie Silber. Ich weiß noch, dass das Laub über uns in Bewegung geriet und dass ich das Wasser im Bach rauschen hörte, aber ansonsten schien alles mit Inga innezuhalten. Wie lange das dauerte, weiß ich nicht, bestimmt nur Sekunden, aber diese sieben oder acht Wimpernschläge des Wartens und Zuschauens erschreckten mich zu Tode. Ich bildete mir ein, unser Spiel habe meiner Schwester geschadet und meine schurkische Phantasie habe sie gelähmt. Nach einer unerträglichen Stille schrie ich ihren Namen und warf mich in ihre Arme. Und plötzlich tröstete sie mich. «Erik, was ist denn? Hast du dir wehgetan?»
Heute bin ich überzeugt, dass das Absencen waren, die man früher als Petit mal bezeichnete. Sie verschwanden von selbst, als Inga älter wurde. Geblieben sind ihre Migräneanfälle mit der vorausgehenden Aura und eine zarte Konstitution. Mir war schon als Junge klar, dass Inga etwas an sich hatte, das sie von anderen Kindern absonderte, und dass es meine Aufgabe war, mich nach Kräften um sie zu kümmern. Innerhalb der Familie war sie in Sicherheit, doch sobald wir in den Schulbus stiegen, machte ihre Verletzlichkeit sie zu einer Zielscheibe des Spotts. Ich habe noch vor Augen, wie sie durch den Bus zu ihrem Platz ging. Sie drückte ihre Bücher an die Brust, der lange blonde Zopf baumelte bis zum Rücken hinunter, sie trug eine braune Brille und versuchte so zu tun, als hörte sie nicht, was ihr an Gemeinheiten nachgeflüstert wurde: «Da kommt die Verrückte» und «Inga-dinga-dieist-gaga». Sie zitterte. Das war ihr Verhängnis. Ihr Schaudern war eine Ermunterung zu weiteren verbalen Angriffen, und weil sie schon früh beschlossen hatte, ein Leben der Reinheit und Güte zu führen, wehrte sie sich nie gegen ihre Peiniger. Das verschaffte ihr ein Gefühl innerer Überlegenheit, trug aber wenig dazu bei, ihr die Busfahrten oder das Leiden in der Schulpause zu erleichtern.
Neurologische Schwächezustände haben immer einen substantiellen Gehalt; die exakten Wissenschaften erkennen das nur widerstrebend an, genau wie die Psychoanalyse oft über die physiologische Seite verschiedener mentaler Erkrankungen hinwegsieht. Den Stoff für die Aura und die Anfälle in Ingas Kindheit lieferte unsere religiöse Erziehung. Zwar war weder meine Mutter noch mein Vater besonders fromm, doch dort, im Herzen Amerikas, ging so gut wie jeder in irgendeine Kirche. Wir besuchten eine lutherische Kirche, und die Sonntagsschullehrer fütterten uns mit Geschichten von Gott und Jesus und jener dritten und höchst verstörenden Gottheit – dem Heiligen Geist. Weil ich den Eindruck hatte, meine Eltern sähen das Gottesproblem entspannt, und anders als Inga nicht dazu neigte, mich «sonderbar erhoben» zu fühlen oder «Lichtblitze» zu sehen, war mein Verhältnis zum Göttlichen eher abstrakt. Mich beunruhigte, dass ein unsichtbarer Gott in meinen Kopf hineinschauen und meine Gedanken belauschen konnte. Manchmal nahm ich vor dem Einschlafen meinen Penis in die Hand und meinte, Gottes barsche Stimme an meinem Ohr zu hören; er sagte dann Worte wie «Nein» oder «Tu’s nicht». Meine Schwester jedoch hatte Engel in sich. Sie hörte Flügel an ihrem Ohr rascheln und spürte Flammenhände, die sie am Kopf berührten, sich in ihrem Brustkorb einnisteten und sie gen Himmel zogen, und bisweilen sprachen sie in rhythmischen Versen zu ihr. Diese Liebesdienste gefielen ihr gar nicht. Manchmal kam sie zu mir, wenn die Seraphim ihr einen nächtlichen Besuch abstatteten. Wenn ich nicht fest schlief, hörte ich ein leises Klopfen an meiner Tür und dann Ingas Stimme: «Erik, Erik, bist du wach?» Etwas lauter: «Erik?» Manchmal war es schon spät, und ich spürte im Tiefschlaf, wie sie mir an die Schulter tippte. «Erik, ich hab Angst. Die Engel.» Dann drehte ich mich um und hielt eine Weile ihre Hand oder ließ mich von ihr umarmen, bis sie die Kraft hatte, wieder in ihr Zimmer zurückzugehen. Manchmal verließ sie der Mut, und ich fand sie morgens zusammengerollt am Fußende meines Bettes.
Ab und zu weckten Ingas kleine Schreie oder das Geräusch ihrer ängstlich durch den Flur tappenden Füße meine Mutter, und die stand auf, führte sie in ihr Zimmer zurück und blieb an ihrem Bett sitzen, beruhigte sie oder sang sie in den Schlaf. Danach kam sie immer leise in mein Zimmer und legte mir die Hand auf die Stirn. Ich stellte mich schlafend, aber das konnte meine Mutter nicht täuschen. Sie sagte meist: «Jetzt ist alles gut. Schlaf.» Inga und ich sprachen nur dann über diese Visitationen, wenn wieder eine stattgefunden hatte, und es kam mir nie in den Sinn, dass meine Schwester krank oder verrückt sein könnte. Mit der Zeit begann Inga zu zweifeln, und sie gab zu, es könnte auch an ihrem Nervensystem liegen, wenn die Geister gerufen wurden. Dennoch sind diese Erlebnisse ein Teil ihres Wesens, und ihr Einfluss lässt sich nicht leugnen. In einem anderen Zeitalter wäre ich womöglich der Bruder einer Heiligen oder Hexe gewesen.
Ein paar Tage nachdem ich Miranda im Fenster gesehen hatte, bemerkte ich gleich hinter der Innentür, die meinen Teil des Hauses von der Mietwohnung trennt, eine Büroklammer mit einem Gummiband daran. Ich dachte mir nichts weiter dabei, bis am nächsten Abend ein mit einem roten Faden umwickeltes Wattestäbchen unter der Tür durchgesteckt wurde und am dritten ein Stück grünes Bastelpapier, auf dem vier große, schiefe Buchstaben standen: ein S, ein O, ein G und ein N. Nach dieser kryptischen Botschaft war mir klar, dass die Gaben von Eglantine stammten. Als ich am vierten Abend vor meinen aufgeschlagenen Notizbüchern saß, hörte ich ein kratzendes Geräusch im Flur. Ich ging ihm nach und sah, wie ein Schlüssel mit einem Stück Garn daran unter der Tür durchgeschoben wurde.
«Ein Schlüssel», sagte ich. «So eine Überraschung. Wo diese Geschenke wohl herkommen?»
Auf der anderen Seite der Tür hörte ich das Kind laut atmen und dann Mirandas Stimme. «Eggy, was machst du da oben? Zeit zum Schlafengehen.»
An jenem Samstag sah ich Mutter und Tochter Hand in Hand auf der Seventh Avenue, wo ich in einem Haushaltswarengeschäft Nägel für das Bücherregal gekauft hatte, das ich gerade baute. Ich beschleunigte meinen Schritt und rief nach den beiden.
Miranda nickte mir zu. Dann lächelte sie. Das Lächeln machte mich auf absurde Weise glücklich.
Eggy starrte mich an. «Mommy sagt, du bist ein Sorgendoktor.»
«Ja», sagte ich. «Ich habe studiert, um Doktor zu werden, und ich helfe Leuten, wenn sie Sorgen oder Probleme haben.»
«Ich hab Sorgen», sagte sie.
«Eggy», mahnte Miranda. «Jeder hat Sorgen.»
Das wollte Eggy nicht hören. Sie sah ihre Mutter stirnrunzelnd an. «Ich rede mit Doktor Erik.»
Ihr war eingefallen, dass ich ihre Mutter gebeten hatte, mich Erik zu nennen. «Weißt du, Eggy», sagte ich, «du darfst ruhig bei mir anklopfen und mich besuchen. Ich bekomme gern Geschenke, aber ich rede auch gern.»
Ich hörte Miranda seufzen. In diesem Seufzer steckte eine ganze Welt. Ich dachte an ihren langen Arbeitstag und an die Abende allein mit ihrer energiegeladenen Fünfjährigen. Dann fiel mir ein, dass ich sie noch nie mit einem Mann gesehen hatte. Als ich mich zu Miranda umdrehte, sah sie mir kurz in die Augen, presste die Lippen zusammen und schaute dann auf den Bürgersteig hinunter. Ich wusste nicht, wie ich das interpretieren sollte. Eine Sekunde lang sah ich wieder die grausame Zeichnung vor mir.
«Gehen Sie nach Hause?», fragte ich.
Sie blickte auf und hatte sich offenbar von dem kleinen Anfall erholt, den ich eben beobachtet hatte. «Ja, wir waren im Park und haben dann ein paar Einkäufe erledigt.» Sie hob die Tasche in ihrer Hand hoch.
Nur wenige Minuten später fanden wir die Fotos. Es waren vier, die bei unserer Rückkehr auf der Vortreppe lagen. Zuerst hielt ich sie für Werbezettel oder Speisekarten, wie sie regelmäßig vor den Häusern in Brooklyn liegen. Ich