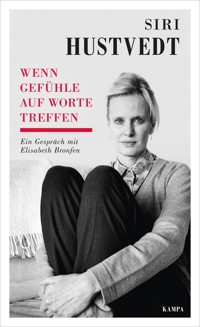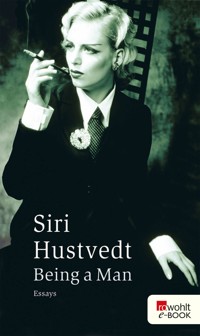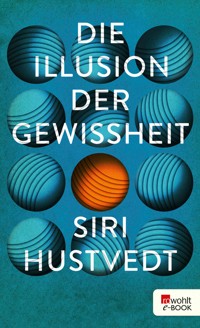
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
In diesem Essay geht Siri Hustvedt der Grundfrage menschlicher Existenz nach: Wie ist die Beziehung zwischen Geist und Körper? Was ist der Verstand? Wie unterscheidet er sich vom Körper? Kann der Verstand auf Neuronen im Gehirn reduziert werden oder nicht? In ihrem Essay nimmt sich Siri Hustvedt das uralte, noch immer nicht gelöste Geist-Körper-Problem vor und macht deutlich, dass die unterschiedlichen Antworten auf diese Frage eine tiefgreifende Bedeutung für unser Verständnis von uns selbst haben. Mit ihrem multidisziplinären Zugang zeigt Hustvedt, wie sehr ungerechtfertigte Annahmen über Körper und Geist das Denken der Neurowissenschaftler, Genetiker, Psychiater, Evolutionspsychologen und der Forscher zur Künstlichen Intelligenz verzerrt und verwirrt haben. Siri Hustvedt führt den Leser in verschiedene körperintegrierende Theorien von Bewusstsein ein, die die aktuelle Debatte über Verstand und Körper verändern. Gleichzeitig betont sie, dass keine Idee unantastbar ist. «Der Zweifel», schreibt sie, «ist nicht nur eine Tugend der Intelligenz, er ist ihre notwendige Voraussetzung.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Siri Hustvedt
Die Illusion der Gewissheit
Essay
Über dieses Buch
In diesem Essay geht Siri Hustvedt der Grundfrage menschlicher Existenz nach: Wie ist die Beziehung zwischen Geist und Körper?
Was ist der Verstand? Wie unterscheidet er sich vom Körper? Kann der Verstand auf Neuronen im Gehirn reduziert werden oder nicht? In ihrem Essay nimmt sich Siri Hustvedt das uralte, noch immer nicht gelöste Geist-Körper-Problem vor und macht deutlich, dass die unterschiedlichen Antworten auf diese Frage eine tiefgreifende Bedeutung für unser Verständnis von uns selbst haben.
Mit ihrem multidisziplinären Zugang zeigt Hustvedt, wie sehr ungerechtfertigte Annahmen über Körper und Geist das Denken der Neurowissenschaftler, Genetiker, Psychiater, Evolutionspsychologen und der Forscher zur Künstlichen Intelligenz verzerrt und verwirrt haben. Siri Hustvedt führt den Leser in verschiedene körperintegrierende Theorien von Bewusstsein ein, die die aktuelle Debatte über Verstand und Körper verändern. Gleichzeitig betont sie, dass keine Idee unantastbar ist.
«Der Zweifel», schreibt sie, «ist nicht nur eine Tugend der Intelligenz, er ist ihre notwendige Voraussetzung.»
Vita
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sieben Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Die gleißende Welt» und «Damals». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Leben, Denken, Schauen», «Nicht hier, nicht dort», «Being a Man» und «Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen» vor.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel «The Delusions of Certainty» in dem Essayband «A Woman Looking at Men Looking at Women» bei Simon & Schuster, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Delusions of Certainty / A Woman Looking at Men Looking at Women» Copyright © 2016 by Siri Hustvedt
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Reproduktionsrechts im Ganzen oder in Teilen in jeder Form.
Redaktion Kristian Wachinger
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München, nach der Originalausgabe von Simon & Schuster, New York; Gestaltung Christopher Lin
ISBN 978-3-644-00178-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Hinein und Hinaus
Von Schlafröcken, Dreiecken, Automaten, vom Geist in der Materie und von Riesen
Eine unwissenschaftliche Stichprobenerhebung darüber, was Menschen über den Geist denken (Eine Bemerkung in Klammern, warum ich dieses Buch schreibe), und ein kleiner Abstecher in Alfred North Whiteheads Geist
Vorgefasste Ideen und M
Woraus sind wir? Nature/Nurture: Fest und Formbar
Gehirne – fest oder formbar?
Nature/Nurture: Geist und Populärkultur
Vererbbarkeit und Zwillingsmärchen
Ein Abstecher ins Leben von Johnny und Jimmy und zu einer Wissenschaftlerin namens Myrtle McGraw
Zahlengewissheiten?
Von alten und neuen Abenteuern in Harvard, Testosteron, Placebo, Scheinschwangerschaften und Ängsten und Wünschen, die wahr werden
Ein Moment für Froschopfer und Aristoteles’ Biologie
Frauen können keine Physik
Eine Vermählung der Geister: Evolutionspsychologie
Darwin – verschärfen oder entschärfen?
Überlebensgeschichten
Geist als Computer – im Wortsinn?
Das feuchte Gehirn
Unnatürliche Wunder
Neuronen und Psychonen
GOFAI vs. Know-how
Maschinen, Gefühle und Körper
Eine Nebenbemerkung zu Niels Bohr und Søren Kierkegaard
Feucht oder trocken?
Land der Phantasie in einer ernstgemeinten und einer ironischen Lesart
Der denkende Körper
Einfühlung, Einbildungskraft und Babys
Erinnerung, Placebo und sonderbare Körpersymbolik
Arbeit und Liebe
Coda
Hinein und Hinaus
Allen euphorischen Prognosen zum Trotz, der technologische Fortschritt werde bald zu künstlichen Gebärmüttern und zur Unsterblichkeit führen, gilt nach wie vor, dass jeder Mensch aus dem Körper seiner Mutter geboren wird und jeder Mensch einmal stirbt. Niemand trifft die Wahl, geboren zu werden, und auch wenn sich manche Menschen fürs Sterben entscheiden, wollten es viele von uns lieber nicht. Anfang und Ende, Leben und Tod sind keine einfachen Konzepte. Wann «das Leben» beginnt, ist seit jeher eine philosophische Frage und Schauplatz erbitterter politischer Auseinandersetzungen. Was den «Tod» ausmacht, ist ebenfalls ungewiss, auch wenn jeder Zweifel schwindet, sobald ein Leichnam zu verwesen beginnt. Gleichwohl nimmt jedes Säugetier seinen Anfang im mütterlichen Raum. Und dennoch spielt der offenkundige Umstand, dass der Fötus, der jeder von uns einmal war, körperlich mit seiner Mutter verbunden ist und ohne sie nicht überleben kann, kaum eine Rolle im Mainstream der philosophischen und naturwissenschaftlichen Debatten, die sich mit der Frage beschäftigen, was der Mensch ist.
Unzählige Bücher wurden darüber geschrieben, weshalb und wie sich die Vorstellung vom selbstbestimmten Menschen, der, seinem freien Willen folgend, sein Schicksal in die Hand nimmt, in der Geschichte des Abendlands entwickelte. Viele dieser Bücher befassen sich mit der Frage, wie historische Ideen das kollektive Bewusstsein ganzer Nationen formten und bis heute beeinflussen, und damit, ob das humanistische Ideal – dessen Herausbildung gemeinhin mit der Renaissance (die ihren Namen natürlich nachträglich erhielt) einsetzte und das seinen Höhepunkt in der Aufklärung fand – gut oder schlecht oder ein bisschen von beidem ist. Mit der Biologie haben diese Arbeiten in der Regel wenig oder gar nichts am Hut. Biologische Realitäten werden zwar unterstellt – wie könnte man sich auch von einer Idee beeinflussen lassen, ohne einen Körper und Geist, der sie aufnimmt? –, aber die materiellen Feinheiten des lebendigen Organismus werden zumeist ausgespart.
Doch auch die Biologie stützt sich auf Konzepte, auf bestimmte Vorstellungen von Leben und Tod, von Anfang und Ende und von den Grenzen eines Lebewesens. Beim Menschen, der aus Milliarden von Zellen besteht, stellt die ihn umgebende Haut eine solche Grenze dar. Ein Bakterium ist hingegen ein mikroskopisch kleiner Einzeller, der, Nährstoffe aufnehmend, sich zu einer Kolonie mit einer eigenen Morphologie (Form und Struktur) und Bewegungsart zusammenschließt. In der Wissenschaft geht es darum, zuverlässige Modelle zu bilden und Grenzen zu ziehen, um die Natur in verständliche Teilstücke zu gliedern, die klassifiziert, benannt und erforscht werden können. Manchmal verlieren Klassifikationen und Benennungen an Relevanz, dann werden neue Modelle und andere Bezeichnungen übernommen, die zweckdienlicher sind. Unterscheidungen einzuführen, ist unerlässlich, aber manchmal ist es schwierig, die Einheiten voneinander zu trennen. Manchmal sind die Grenzen nicht eindeutig. In diesem Zusammenhang ist es zum Beispiel erstaunlich, wie wenig erforscht die Plazenta ist, die in den vergangenen Jahren abwechselnd als kaum verstandenes, wenig beachtetes oder sogar als «übersehenes neuroendokrines Organ» bezeichnet wurde.[1] Wenn eine Person, ein Umstand oder auch ein Körperorgan den Status «zu Unrecht übergangen» erhält, weist das in der Regel darauf hin, dass sich die Wahrnehmung verändert hat. Die Plazenta ist ein Organ an der Grenze zwischen Mutter und Fötus. Als Mischstruktur, die sich aus dem Gewebe der Mutter und dem des Embryos entwickelt, wird sie bisweilen auch «fetomaternales» Organ genannt. Innerhalb des mütterlichen Raums nimmt sie eine Zwischenposition ein.
Die Plazenta liefert dem Fötus Sauerstoff und Nährstoffe, beseitigt seine Ausscheidungen, sorgt für seinen Immunschutz, produziert das Hormon Progesteron und enthält zwei Blutkreisläufe – den der Mutter und den des Fötus. Aufgrund dieser Funktionsvielfalt wurde sie von einem Embryologen auch als das «dritte Gehirn» in der Schwangerschaft bezeichnet.[2] Für den menschlichen Magen-Darm-Trakt, das enterische Nervensystem aus Magen, Speiseröhre, Dünndarm und Dickdarm, hat sich der Ausdruck «zweites Gehirn» etabliert – Gehirne, die an der einen oder anderen Stelle des Körpers auftauchen, sind zurzeit wohl en vogue. Die Plazenta, die sich nur bei Frauen, und nur bei schwangeren Frauen entwickelt, ist ein Übergangsorgan. Wenn sie nach der Geburt des Kindes ihre Funktion erfüllt hat, wird sie aus dem Körper der Frau ausgestoßen – daher der Begriff «Nachgeburt».
Seit der Revolution durch die Naturwissenschaft ist «teile und herrsche» der Weg zur Erkenntnis, entscheidend dabei ist jedoch, wie diese Aufteilungen aussehen. In einer medizinischen Vorlesung über «Die Physiologie normal verlaufender Geburtswehen und Entbindungen» stieß ich auf folgenden interessanten Hinweis: «Die Aufteilung der mechanischen Schritte, die ein Baby bei der Geburt durchläuft, ist beliebig; im klinischen Alltag werden sie zum Zwecke der besseren Verständigung auf sechs, höchstens acht Schritte reduziert. Aber man sollte sich im Klaren sein, dass dies willkürliche Unterteilungen eines natürlichen Kontinuums sind.»[3] Der Mediziner formuliert also zunächst, etwas unsauber, die Vorgänge während der Wehen und Geburt als mechanische Schritte, doch dann unterläuft er seine eigene Aussage mit dem Hinweis, dass genau diese Schritte eine beliebige Unterteilung sind. Wenn die Unterteilung aber beliebig ist und das natürliche Kontinuum nicht wirklichkeitsgetreu abbildet, das sich als solches ohnehin der Vorstellung von «Schritten», ganz gleich, welcher Art, entzieht, dann ist auch die Formulierung «mechanische Schritte» am Anfang des Satzes nicht angebracht. Bei diesen «Schritten» geht es um Zweckmäßigkeit, sie dienen dazu, einen unteilbaren Prozess zu zergliedern, um sich leichter darüber zu verständigen. In unsauberen Formulierungen hat man sich schnell verheddert, doch mir scheint, die Sprache des Verfassers verweist hier nicht nur auf seinen Zwiespalt, wo die Grenzen zwischen einem Ding, oder einem «Schritt», und dem nächsten zu ziehen sind, sondern sie verrät auch sein Bedürfnis, den Studierenden klarzumachen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den in der Medizin gebräuchlichen Kategorisierungen und den dynamischen Prozessen, auf die sie sich beziehen – in dem Fall den Geburtsvorgang.
Auf die Sprache kommt es an, und die Sprache erzeugt fortwährend Bilder. Zum Beispiel: Inwiefern gleicht die Plazenta einem dritten Gehirn? Samuel Yen, von dem der Vergleich stammt, beschreibt sie als komplexe Mittlerinstanz zwischen dem mütterlichen Gehirn und dem noch nicht ausgereiften des Fötus, ein kurzlebiges Zwischenhirn also mit erstaunlich differenzierten Fähigkeiten zur Regulierung der fetalen Umwelt. Die Sprache, mit der beschrieben wird, was eine Plazenta leistet, umfasst Begriffe, die auch für Funktionen des «ersten Gehirns» und anderer Körperorgane verwendet werden: Botschaften, Signale, Information und Kommunikation. Die Frage, an welchem Punkt «der Geist» in diesem Signalwerk des Körpers ins Spiel kommt, ist keineswegs absurd. Es wäre abwegig, ein Organ wie die Plazenta mit dem menschlichen Geist zu vergleichen – viel weniger abwegig ist jedoch, sie als etwas dem Gehirn Ähnlichen zu veranschaulichen, als ein ebenso ausgefeiltes, hochkomplexes, noch weitgehend unerforschtes Organ des Körpers. Wenn mein Gehirn seine Funktion nicht mehr erfüllt, selbst wenn das Herz noch schlägt und die Lungen arbeiten, geht dann nicht auch mein Geist dahin? Bin ich dann tot? Oder muss erst alle «Kommunikation», müssen alle biologischen Abläufe beendet sein und die Verwesung einsetzen, bevor ein Mensch wirklich tot ist?
Wie wichtig ist denn die Tatsache, dass Säugetiere in einem anderen Körper heranwachsen, für den Geist? Welche Auswirkung hat diese biologische Realität auf die Entwicklung der Säuger? Wir werden aus einem anderen Menschen geboren, aber wir sterben nicht zu zweit. Wir sterben allein, obwohl Ehegatten, Partner oder enge Freunde einem geliebten Menschen manchmal schnell ins Grab folgen. Früher sagte man dann «vor Gram sterben». Wir Menschen kommen aus dem Körper unserer Mutter auf die Welt, und wir verlassen diese Welt, wenn unser eigener Körper auf die eine oder andere Weise aufgibt. Nehmen der Geist und ein damit einhergehendes Bewusstsein bei der Geburt ihren Anfang und enden mit dem Tod? Wo genau ist der Geist im Körper verortet? Kann allein das Gehirn denken, oder können andere Organe das in gewisser Weise auch? Was ist Denken? Warum glauben manche Wissenschaftler heute, man könne den Tod durch einen künstlichen Geist überwinden, und zwar nicht in einem paradiesischen Jenseits, sondern hier auf Erden? Das sind sehr alte Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt, und sie führen mich zurück ins 17. Jahrhundert, zu einigen berühmten und ein paar weniger berühmten Philosophen und Philosophinnen jener Zeit, die sich intensiv mit der Frage befassten, was der Geist ist und in welcher Beziehung er zu unserem Körper steht.
Von Schlafröcken, Dreiecken, Automaten, vom Geist in der Materie und von Riesen
Seit ich vor vierzig Jahren René Descartes’ Meditationen zum ersten Mal gelesen habe, sehe ich ihn vor mir im Schlafrock aus Brokatsamt mit Nachthaube, zurückgelehnt im Sessel, Pantoffeln an den Füßen und eine Brille auf der Nase – die er getragen haben mag oder auch nicht, immerhin gehen einige Entdeckungen in der Optik auf ihn zurück, was vielleicht erklärt, warum sie Teil meines geistigen Bildes ist. Ich stelle ihn mir aber nicht als eine Figur aus Fleisch und Blut vor, sondern als eine Zeichnung in der Art, wie sie zwei Jahrhunderte später «Phiz», Dickens’ Illustrator, gemalt hat. Mein Bild von Descartes ist eine Karikatur, die mir immer dann in den Sinn kommt, wenn ich über den radikalen Zweifel nachdenke. In der Ersten Meditation stellt er die Frage, ob es möglich ist, Gewissheit über irgendetwas zu erlangen. Es sei doch, schreibt er, wohl kein Zweifel möglich darüber, «dass ich jetzt hier bin, beim Feuer sitze, mit einem Winterschlafrock bekleidet bin, dieses Papier mit meinen Händen berühre».[1] Doch der Philosoph ist sich keineswegs gewiss, dass er dort beim Feuer sitzt. Hatte er nicht schon solche Träume gehabt, fragt er, in denen er im Schlafrock beim Feuer saß, und war ihm das nicht als Wirklichkeit erschienen? Wie Platon vor ihm, misstraute Descartes jeder Erkenntnis, die aus den Sinnen hervorgeht.
Indem er eine Haltung des absoluten Zweifels an seiner Existenz und all den Dingen um sich herum einnimmt, begleitet er seine Leser durch eine Argumentationsfolge, die ihn schließlich zur Gewissheit führt, zu Wahrheiten, die sich ihm durch einen Prozess rein rationalen Denkens erschlossen haben. Auch für diese kartesianische Gewissheit habe ich ein geistiges Bild im Kopf, eines, das der Philosoph selbst liefert: ein Dreieck, jene geometrische Form, die Platon als Beispiel für seine Formenlehre diente. Mein Dreieck ist schwerelos, reglos und schwebt in der Luft. Zweifelsohne habe ich das so vor meinem geistigen Auge gesehen, als ich zum ersten Mal auf das Dreieck des Philosophen stieß, das für seine ontologische Beweisführung der Existenz Gottes eine Rolle spielt: «Wenn ich mir zum Beispiel ein Dreieck vorstelle, so ist seine Natur, sein Wesen oder auch seine Form sicherlich eine ganz bestimmte, unveränderliche, ewige, die weder von mir selbst ausgebildet ist, noch von meinem Geist abhängt, auch wenn vielleicht eine solche Figur nirgendwo außerhalb meines Denkens existiert, und auch niemals existiert hat.»[2] Für Descartes sind Mathematik, Logik und Metaphysik universell, unveränderlich und also körperlos. Der Geist oder die Seele besitzen a priori gegebene, angeborene Vorstellungen, die nicht von ihnen hervorgebracht werden. Für den Philosophen des 17. Jahrhunderts sind logisches Denken und Gott aneinander gebunden. Mathematik ist im transzendenten Raum verortet, ohne den Makel des sinnlichen, sterblichen Körpers, der Schlafröcke trägt und die Füße am Feuer wärmt. Aus meinem geistigen Bilderkatalog rufe ich das schwerelose Dreieck auf, wann immer ich mir eine unwandelbare, zeit- und körperlose Wahrheit vorstelle. Die Idee, dass Zahlen für die Wahrheit stehen, ist älter als Descartes und älter als Platon. Bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. lehrten die Pythagoreer, dass Zahlen das Universum beherrschen.
Sinneswahrnehmung und Phantasie haben in Descartes’ Philosophie zwar einen Platz, doch wir verstehen nur mit Hilfe des Verstands, was wir sehen, fühlen, berühren, schmecken, riechen, hören und uns vorstellen. Der Körper mit seinen Erinnerungen, Einbildungen und Leidenschaften spielt mit Geist und Verstand zusammen, aber sie sind aus unterschiedlichem Stoff. Diese Trennung von Psyche und Soma bleibt ein bis in die Gegenwartskultur hineinwirkender Gemeinplatz. «It’s all in your mind – Das bildest du dir nur ein!» lautet die Kurzform, um anzudeuten, der Freund oder die Freundin habe ein «psychologisches», ein «mentales» Problem. Ein gebrochenes Bein dagegen ist ein handfestes «physisches» Problem, man kann es richten und eingipsen. Woraus aber bestehen Gedanken? Und woher kommen sie, wenn nicht aus unserem Körper? Als Kind, wenn mir die Welt und ich mir selbst auf einmal fremd erschien, machte ich mir manchmal Gedanken über das Denken. Was, wenn ich nicht Siri bin? Was wäre, wenn ich nur im Traum einer anderen Person existierte? Und wenn die Welt eine Welt in einer anderen Welt in einer anderen Welt wäre? Wer sind wir, und wie können wir wissen, wer wir sind? Wie kann es sein, dass wir im Kopf mit uns selbst sprechen können? Was sind Wörter?
Für Descartes kann «cogito ergo sum» – ich denke, also bin ich – nur für den Menschen gelten. Tiere denken nicht. Es sind Wesen ohne Seele, sie bestehen aus reiner Materie und sind bloße Automaten. Dem Philosophen zufolge muss alle Materie eine Ausdehnung haben, Gedanken jedoch haben keine. Materie ist raumgreifend und besteht aus winzigen Teilchen, den «Korpuskeln», die als Elementarpartikel den Atomen zwar ähnlich und doch keine Atome sind. Wie viele Denker jener Zeit war Descartes vom klassischen Atomismus in der Tradition von Epikur und Demokrit beeinflusst, für die die Welt aus festen, materiellen Teilchen, den Atomen, bestand, die sich im leeren Raum bewegten. Von diesem altertümlichen Atomismus musste sich Descartes abheben; ein leerer Raum war für ihn unannehmbar, weil dort für den christlichen Gott, für den Geist und die unsterbliche Seele kein Platz war. 1630, in einem Schriftwechsel mit Pater Mersenne, beschreibt er seine Korpuskeln so: «Man darf sie sich aber weder als Atome vorstellen, noch als ob sie irgendeine Härte besäßen, sondern wie einen äußerst flüssigen und feinen Stoff».[3] Anders als die Atome der Antike sind Korpuskeln weich und formbar. Atome blieben uns erhalten, in veränderter Form, aber es ist erstaunlich, wie sehr sich das Bild des modernen Atoms gewandelt hat, seit ich in der Schule Atommodelle mit ihren Neutronen und kreisenden Elektronen bestaunte, die mich stark an ein anderes Modell erinnerten, das wir im Unterricht durchnahmen: das Sonnensystem.
Bis heute knüpfen viele Denker an Descartes’ Vermächtnis an. Die von ihm aufgeworfenen Fragen, aus welchem Stoff wir sind, nach unserem Weltverhältnis, danach, was angeboren und was über die Sinne und gelebte Erfahrung erworben ist, und ob es zeitlose, übergeordnete Wahrheiten gibt, treiben die westliche Kultur noch immer um. Die meisten Menschen beurteilen den Körper intuitiv anders als das Denken. In der wissenschaftlichen wie in der populären Literatur wird immer wieder zwischen psychologischer und physiologischer Wirklichkeit getrennt. Sind beide verschieden? Oder sind sie ein und dasselbe? In welcher Beziehung steht ein Gedanke zu den Neuronen im Gehirn? Hat die Form des Dreiecks dort draußen im Universum nur darauf gewartet, von einem Menschen entdeckt zu werden? Die einen glauben bis heute an die Wahrheit des Dreiecks und verfechten die These, dass logisches Denken und Mathematik über den menschlichen Geist hinausweisen, andere tun das nicht.
Descartes’ Zeitgenosse Thomas Hobbes trat für ein rein atomistisches, materialistisches, mechanistisches Modell des Menschen und der Natur ein. Der Kosmos und wir sind aus demselben atomaren Stoff und gehorchen denselben Bewegungsgesetzen, was auch heißt, dass die Welt uns nur über unsere Sinne gegeben ist. Hobbes’ Materialismus setzte einen ersten Beweger voraus – die scheppernde Maschinerie der Natur wurde von Gott angekurbelt, was aber das göttliche Wesen für Hobbes darüber hinaus bedeutete, ist unklar. Für ihn war der menschliche Körper ein Automat und alle Gedanken und Empfindungen maschinenartige Bewegungen des Gehirns. Im fünften Kapitel des Leviathan mit dem Titel «Von Vernunft und Wissenschaft» beschreibt Hobbes die menschliche Vernunft als eine Folge von Berechnungen: «Kurz: Wo Addition und Subtraktion am Platze sind, da ist auch Vernunft am Platze, und wo sie nicht am Platze sind, hat Vernunft überhaupt nichts zu suchen.»[4] Anders als angeborene Sinne, Gedächtnis oder durch Erfahrung Erlerntes scheint Vernunft «durch Fleiß» zu entstehen, als Ergebnis der Verknüpfung eines «Elements, dem Namen», mit einem anderen. Weil diese Namen-Elemente für das Denken so entscheidend sind, beharrt Hobbes darauf, die Sprache müsse «geputzt und von allen Zweideutigkeiten gereinigt» werden.[5] Sprachbilder sind deshalb besonders gefährlich, weil sie den vernünftig urteilenden Menschen zu allerlei Widersinn verleiten.
Wie Descartes war auch Hobbes in hohem Maß durch den Philosophen und Wissenschaftler Galilei beeinflusst. Von ihm übernahm Hobbes die Wertschätzung der Geometrie als einzig wahre Methode, die Welt der Natur abzubilden. Vernunft war für ihn ein schrittweise erfolgendes Berechnen, über das man zu einem Verständnis gelangt, wie die Dinge miteinander durch Ursache und Wirkung zusammenhängen, und dieser Zusammenhang ermöglicht auch Voraussagen:
Während Empfindung und Erinnerung nur Kenntnis von Tatsachen ist, das heißt von etwas Vergangenem und Unwiderruflichem, ist Wissenschaft die Kenntnis dessen, was aus einer Tatsache für eine andere folgt und wie die eine von einer anderen abhängt. […] Denn sehen wir, durch welche Ursachen und auf welche Weise etwas zustande kommt, so sehen wir auch, wie wir die gleichen Ursachen veranlassen können, die gleichen Wirkungen hervorzubringen, wenn sie in unsere Gewalt kommen.[6]
Margaret Cavendish, die Herzogin von Newcastle, war vertraut mit dem Denken von Descartes und Hobbes, denn beide gehörten zum intellektuellen Zirkel ihres Mannes William und ihres Schwagers Charles. Als Royalisten im französischen Exil verfolgten der Herzog und die Herzogin hochinteressiert die Debatten, die nichts Geringeres zum Thema hatten als die Frage, woraus der Mensch, das Tier, die Welt an sich beschaffen seien. Die Herzogin war Descartes persönlich begegnet und mit Hobbes bekannt. Der englische Philosoph hatte es jedoch abgelehnt, sich mit ihr auf Gespräche oder einen Briefwechsel einzulassen. Zu ihren Lebzeiten blieben Cavendishs Ideen weitgehend unbeachtet, obwohl sie dreiundzwanzig Bücher verfasste, unter anderem Theaterstücke, Gedichte, Phantasieerzählungen, den utopischen Roman Die gleißende Welt, eine Biographie ihres Ehemanns, autobiographische Schriften, Briefwechsel und naturphilosophische Betrachtungen. Im Kontext der aktuellen Debatten über Körper und Geist erfuhr ihr umfängliches Werk in den vergangenen Jahrzehnten eine Neubewertung. Cavendishs Naturphilosophie ist nicht nur das Gegenstück zu Descartes’ Dualismus, zur These, Geist und Körper seien aus unterschiedlichem Stoff, sie wendet sich auch gegen den mechanistischen Atomismus von Hobbes und vertritt eine monistisch-organizistische Theorie (wir sind zwar reine Materie, aber keine Automaten) – dabei unterscheidet sie durchaus zwischen «belebter» und «unbelebter» Materie.
Mittels dieser zwei Stoffarten begründet Cavendish, warum Menschen und Steine dieselbe Materialität teilen und warum der Geist nicht als eigenständige Substanz existiert, sondern Bestandteil der Welt ist. Belebte und unbelebte Materie sind nicht voneinander getrennt, sondern verschmelzen vollständig: «Die Vermengung von belebter und unbelebter Stofflichkeit ist dergestalt, dass kein Partikel in der Natur je ersonnen und zu denken wäre, der nicht zugleich aus belebtem und aus unbelebtem Stoffe verfasst ist.»[7] Ihr Pan-Organizismus vermischt sich hier mit einer ungewöhnlichen Form des Panpsychismus – der Geist ist nicht allein dem Menschen eigen, sondern erstreckt sich auf alles im Universum. Der Panpsychismus besitzt eine lange Tradition, und viele namhafte Denker haben sich ihm in der einen oder anderen Spielart verschrieben.[8] Die Frage «Woraus ist der Mensch beschaffen?» beschäftigt uns bis heute. Für Cavendish gibt es im Kosmos nur Materie, doch die setzt sich nicht aus partikelförmigen Atomen zusammen und funktioniert keineswegs mechanistisch. Ihre Bewegungen sind nicht vorab festgelegt, sie ist keine Maschine. «Die Natur ist ein sich selbst bewegender, sich selbst belebender, selbsterkennender und unendlicher Organismus».[9] Bei Cavendish ist der Mensch mit den anderen Arten, mit Blumen und Pflanzen grundsätzlich und auf erstaunlich fließende Art und Weise in einer dynamischen Einheit verbunden:
Weder kann ich den alleinigen Anspruch des Menschen auf die Vernunft einsehen, noch den des Tieres auf die Sinneswelt, ist doch Sinn und Verstand auch in andren Wesen, gleich Mensch und Tier. So in Kräutern, Pflanzen, Mineralen, die, des Schneidens, Zerstoßens oder Aufgießens nicht mächtig wie der Mensch, doch auf den Menschen wirken, in ihrer Weise recht gewitzt, fähig und vernunftbeseelt das Reinigen, Erbrechen und Ausspeien vollführen, ganz wie der Mensch das Zerhacken, Vermahlen und Herstellen einer Tinktur; denn nähren Pflanzen nicht den Menschen auf gleichsam vernünftige Art wie der Mensch die Pflanzen nährt?[10]
Cavendishs Philosophie steht klar im Gegensatz zu Descartes’ radikaler Trennung zwischen Mensch und Tier. Für Descartes ist es allein der Geist, der den Menschen davor bewahrt, als Automat zu leben wie die «Viecher».
Im Jahr 1769, knapp achtzig Jahre nach Margaret Cavendish, arbeitete ein anderer leidenschaftlicher Materialist, nämlich Denis Diderot, an D’Alemberts Traum, einer klugen, wild phantasierenden Abhandlung über die Beschaffenheit der Welt und das Leben, in welcher sein träumender Denker-Held sagt: «Jedes Tier ist mehr oder weniger Mensch, jedes Mineral mehr oder weniger eine Pflanze, jede Pflanze mehr oder weniger Tier. Es gibt keine scharfe Abgrenzung in der Natur.»[11] Der Traum steckt voller Metaphern, die vielleicht unvergesslichste ist die, dass der menschliche Organismus nicht mehr Recht hat, als Einzelidentität wahrgenommen zu werden, als ein Bienenschwarm. Der Mensch ist eine Ansammlung unterschiedlicher Organe, die zusammenarbeiten. Auch hier klingen aktuelle Debatten an. So mancher Wissenschaftler und Philosoph bestreitet ja, dass der Mensch über eine feststehende Identität, ein festes Selbst verfügt.
Dabei misstraute Diderot, der geniale Metaphernschmied, den sprachlichen Bildern: «Aber ich lasse diese Bildersprache sein», schreibt er in Brief über die Taubstummen, «die ich höchstens anwenden würde, um den flatterhaften Geist eines Kindes zu ergötzen und zu fesseln, und komme wieder zum Ton der Philosophie, für die immer Gründe und nicht Vergleiche notwendig sind.»[12] Cavendish betrachtete Metaphern, Gefühle und Phantasie keineswegs als Verunreinigung des Denkens. Für sie gab es ein Kontinuum verschiedener Arten des Verstehens, das sowohl Vernunft als auch Phantasie oder Einbildungskraft einschloss, und die Grenzen zwischen ihnen waren nicht starr, sondern fließend.
Nur wenige Denker wollen wie Descartes ganz von vorn anfangen und alle vorgefassten Ideen hinwegfegen, obwohl ich diesen Wunsch stets anregend fand und noch finde. In den aktuellen Debatten der unterschiedlichsten Disziplinen leben Positionen, die Geist und Materie entweder als zwei verschiedene Dinge oder als Einheit betrachten, die den menschlichen Körper als Maschine oder als organische, weniger berechenbare Form begreifen, bis heute fort. Descartes suchte Gewissheit, und er fand sie in seiner Hirnschale, in der Abgeschiedenheit seines denkenden Geists. Ein Mann sitzt allein in einem Raum und denkt. Dieses Bild spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte des modernen westlichen Denkens. Wie dieser Mann dort hingelangte, ist meist nicht Bestandteil des Bildes. Er muss geboren worden sein, muss eine Kindheit gehabt haben, doch der Philosoph ist per Definition immer schon erwachsen. Bis heute handelt es sich fast ausschließlich um einen Er, nicht um eine Sie. Der einsame Grübler auf der Suche nach der Wahrheit hat keine Geschichte, die es zu erzählen gilt, er scheint der zeitlichen Dimension enthoben. Ein ausgewachsener Mann sitzt also in einem Raum, um über den Inhalt eines anderen Raums nachzudenken – des geistigen Raums in seinem Kopf.
Elisabeth von der Pfalz begann einen Briefwechsel mit Descartes und bat um Klärung, wie denn wohl eine immaterielle Substanz wie der Geist auf eine materielle Substanz wie den Körper einwirken könne. Sie schrieb: «[D]ies konnte ich jedoch nie anders begreifen als eine Negation der Materie, die keinen Austausch mit der Materie haben kann. […] Es wäre mir einfacher, der Seele Materie und Ausdehnung zuzusprechen, als einem immateriellen Wesen die Fähigkeit, einen Körper zu bewegen und von ihm bewegt zu werden.»[13] Auch merkte sie durchaus vernünftig an, dass der Zustand des Körpers die Fähigkeit zu denken beeinflusst, dass selbst wenn ein Mensch «das Vermögen und die Gewohnheit des richtigen Denkens gehabt hatte, [er] das alles durch einige Schwindelanfälle verlieren kann».[14] Sie drängte Descartes, die Problematik der Emotionen – der Leidenschaften – in sein Körper-Geist-Modell einzubeziehen, und dem kam er schließlich nach.
Gefühle stellen die Naturwissenschaft und Philosophie beharrlich vor Probleme. Ihr Stellenwert im Leben von Mensch und Tier hängt davon ab, wie man den Geist betrachtet. Elisabeth von der Pfalz war, anders als Hobbes und Cavendish, nicht geneigt, den menschlichen Geist auf den Körper zu reduzieren, doch in ihren Briefen klingen Zweifel an, ob der Geist ganz und gar unabhängig von zeitlichen und körperlichen Umständen funktionieren kann. Obwohl die Sprache ihrer Briefe von Ehrerbietung dem großen Denker gegenüber geprägt ist und sie ihre eigene Schwäche und Unterlegenheit betont, sind die Einwände gegen die Ansichten ihres Brieffreunds höchst anregend und scharfsinnig. Der Dualismus hat heute kaum mehr explizite Verfechter, doch Descartes’ Vorstellung eines rationalen Geistes, der sich zu universellen Wahrheiten empordenken kann, lebt in den Naturwissenschaften und in der angelsächsischen Tradition der analytischen Philosophie munter fort, auch wenn die Auseinandersetzungen über die Definition von Geist oft hitzig, wenn nicht gar quälend sind.
In direktem Widerspruch zu Descartes’ einflussreicher Denkschule steht der Gelehrte Giambattista Vico (1668–1744), Historiker und Professor an der Universität von Neapel, der Rhetorik, Kultur und Geschichte durch die Kraft sprachlicher Bilder und der Erinnerung energisch verteidigte, die, so seine Überzeugung, in unseren körperlich-sinnlichen Erfahrungen wurzeln. In der Neuen Wissenschaft vertritt er die Ansicht, dass «folgende Wahrheit […] auf keine Weise in Zweifel gezogen werden kann: dass diese politische Welt sicherlich von den Menschen gemacht worden ist, deswegen können (denn sie müssen) ihre Prinzipien innerhalb der Modifikationen unseres eigenen menschlichen Geistes gefunden werden».[15] Während Descartes unverrückbare, universelle Wahrheiten suchte, entdeckte Vico, dass die Wahrheit den Gebrauch der Sprache und geschichtlichen Wandel mit einschloss.
Vico zufolge hatte das menschliche Bewusstsein eine eigene Geschichte. Die menschliche Wirklichkeit ihrer Entwicklungsgeschichte zu entheben, erschien ihm widersinnig. Ich las Vico zum ersten Mal um etwa dieselbe Zeit herum wie Descartes – im Alter von ungefähr zwanzig. Von dem neapolitanischen Denker blieb mir wenig im Gedächtnis, bis auf eine eindrucksvolle Ausnahme: seine Riesen. In meiner Vorstellung trotteten diese Giganten, aschfarben und faltig, aber aufrecht, durch eine Landschaft aus graubrauner Erde. Als Beleg, dass es diese ausgestorbenen Spezies einst wirklich gegeben hatte, dienten Vico die «Patagonier» und die Zyklopen Homers, Kreaturen so «ungeschlacht wie äußerst wild».[16] Trotz ihrer primitiven Natur, behauptete Vico, hatten selbst diese umherstapfenden Gesellen eine «Vorstellung von Gott», eine Vorstellung, die ihre Entwicklung von der impulsgeleiteten, von Leidenschaften getriebenen, eigennützigen Kreatur hin zum denkenden, zivilisierten Menschen anstieß.
Auch wenn mich Vicos Anthropologie an manch ausschweifende Geschichte des griechischen Historikers Herodot denken lässt, liefert sein Volk der Riesen doch eine Verständnishilfe, wie sich der menschliche Geist von einem vor-reflexiven zu einem reflexiven entwickelte. An einer Stelle schildert er beeindruckend, wie unfähig seine noch primitiven giganti sind, ihr eigenes Spiegelbild zu erkennen. Die Fähigkeit, sich selbst im Spiegel zu erkennen, gilt als Wendepunkt in der kindlichen Entwicklung. Sobald sich ein Kind mit seinem Spiegelbild identifiziert, ist es in der Lage, sich so zu sehen, wie es von außen, von anderen gesehen wird. Es erlangt eine Form von Selbst-Bewusstsein, das es zuvor nicht hatte. Menschen können das mit etwa achtzehn Monaten. Mittlerweile weiß man, dass andere Spezies ebenfalls über Formen der Selbstwahrnehmung verfügen – Menschenaffen, Elefanten, manche Delfinarten und viele Vögel. Vico schreibt: «Denn, Kindern gleich, die versuchen, ihr eigenes Spiegelbild zu erhaschen, so glaubten auch die ersten Menschen, eine andere, sich ständig wandelnde Gestalt im Wasser zu erblicken, wenn sie sahen, wie es die eigenen Züge und Bewegungen veränderte.»[17] Vico zufolge hat die Entwicklung der Fähigkeit, über sich selbst und die Welt nachzudenken, eine individuelle und eine gattungsgeschichtliche Dimension.
Kindererziehung war eines von Vicos Hauptanliegen. Er befürchtete, dass Kinder, wenn man sie im Sinne Descartes’ nur logisches Denken und Geometrie lehrte, in ihrer sprachlichen und menschlichen Entwicklung behindert würden. Diese Debatte ist bis heute nicht abgeschlossen. In den USA werden Mathematik und Naturwissenschaften in der Bildung generell für wichtiger gehalten als die geisteswissenschaftlichen Fächer und die Künste. Mathematik und Naturwissenschaften besitzen den Nimbus des Seriösen, der strengen Disziplin, was den Geisteswissenschaften und den Künsten abgesprochen wird. Hobbes erhob die Vernunft ins Reich der Addition und Subtraktion, und da ist sie bis heute verblieben. Vico ging es ums Bewahren der klassischen Bildung. Im kartesianischen Programm, so fürchtete er, würde sie verlorengehen. Er sah die Zersplitterung von Wissen in immer kleinere Einheiten durch die zunehmende Spezialisierung an den Universitäten voraus, die nun so weit geht, dass sich einzelne Fachgebiete untereinander nicht mehr verständigen können.
Das 17. Jahrhundert in Europa war eine Zeit der blutigen Religionskriege und Geisteskrisen. Kaum verwunderlich ist, dass die wenigen, denen Bildung, Zeit und Mittel noch vergönnt waren, nach Gewissheit suchten in einer Welt, in der alle Wahrheiten zerbröckelten. Niemand wird als Philosoph geboren. Descartes’ Name wird zwar im Pantheon der «großen Denker» bewahrt, dennoch ist es gut, sich vor Augen zu führen, dass auch er einst ein Kind war, und ein schwächliches dazu. Seine Mutter starb im Wochenbett, als er ein Jahr alt war. Er war aber fest überzeugt, dass er ihren Tod verursacht und seine schwache Gesundheit von ihr geerbt hatte. Auch Philosophen haben ihre Geschichten. Eine davon erzählt Descartes in einem Brief an Königin Christine von Schweden. Sie handelt von einem schielenden Mädchen, in das er als Junge so sehr verliebt war, dass er noch Jahre später «dazu neigte», sich in Frauen «zu verlieben, nur weil sie diesen kleinen Fehler hatten». Als er sich den vernunftwidrigen Zusammenhang einmal klargemacht hatte, habe das aufgehört.[18] Es wird kaum jemanden überraschen, dass der Erfinder der analytischen Geometrie schon als Schüler in Mathematik brillierte.
Die sprachlichen Formen unserer Ideen sind infektiös. Worte stecken Menschen an, werden vom einen auf den anderen übertragen, und wir alle laufen ständig Gefahr, uns Ideen einzufangen, Infektionen, die ein Leben lang anhalten können. Menschen sind die einzigen Tiere, die für Ideen töten, deshalb ist es ratsam, Ideen ernst zu nehmen, ratsam, die Frage zu stellen, woraus sie sind und wie sie zustande kommen. Jede Idee ist auf die eine oder andere Art eine vorgefasste Idee. Selbst Denker, die wir für originell halten, mussten erst die Gedanken anderer – meist in Form von Büchern – aufnehmen, um ihre eigenen zu entwickeln. Es gibt keinen noch nie da gewesenen Gedanken. Trotz des Bestrebens, seinen Geist von allen vorgefassten Ideen zu reinigen, brachte auch Descartes zuvor erworbene Kenntnisse mit. Zu verschiedenen Zeiten herrschen unterschiedliche Ideen vor, aber manche überdauern länger als andere, und manche sind so etabliert, dass sie uns gar nicht mehr bewusst sind. Sie liegen den Auseinandersetzungen über das Wesen des Menschen unausgesprochen zugrunde. Versteckt in Metaphern, Phrasen und Vorurteilen verschiedenster Art, erkennen wir sie häufig nicht und stellen sie deshalb nicht auf den Prüfstand.
Ein weiteres Problem sind die oft völlig widersprüchlichen Grundüberzeugungen in den unterschiedlichen Disziplinen; Disziplinen, die ihre eigene Sprache fabrizieren, in der ihre Vertreter bestimmte Annahmen über die Welt vermitteln, sodass kaum Anlass besteht, zu hinterfragen, wovon alle längst überzeugt sind. Vicos Kritik an der Akademie und der Vereinzelung der Fachbereiche war vorausblickend. In akademischen Kreisen kommt es regelmäßig zu Auseinandersetzungen darüber, was Freud als «Narzissmus des kleinen Unterschieds» bezeichnet. Man streitet sich dabei nicht um die erste Frage, sondern um die dreihunderteinundvierzigste. In fast allen Disziplinen gibt es die stillen, oft blinden Übereinkünfte.
In diesem Buch möchte ich der Gewissheit nachforschen und für den Zweifel und die Vieldeutigkeit plädieren, und zwar nicht etwa, weil wir nichts wissen können, sondern weil wir unsere Überzeugungen stets prüfen sollten und hinterfragen, woher sie kommen. Zweifel sind fruchtbar, denn sie schließen unser Denken auf für fremde Ideen. Der Zweifel ist ein Fragen-Erzeuger. So erfrischend Descartes’ ursprüngliche Frage danach war, was in unserer Existenz gewiss ist und was nicht, so unbefriedigend erscheint sein Lösungsvorschlag – nicht nur mir, sondern auch vielen anderen. Wenn es um Ideen geht, gibt es kaum Universalien außer der, dass Fragen gewöhnlich besser sind als Antworten. Was aber bedeutet es für den menschlichen Geist, sich selbst zu erforschen? Das hängt davon ab, wie man den Geist versteht. Wenn er etwas Fehlbares, Materielles ist, sind die von ihm erzeugten Gedanken zwangsläufig endlich und wandeln sich mit den Zeiten. Wenn er jedoch etwas anderes ist, wenn der menschliche Geist Zugang zu den Wahrheiten des Universums eröffnet, Wahrheiten, die unveränderlich und tief in die Wirklichkeit eingewoben sind, dann wird auch der Blick auf Erfahrung ein anderer sein. Nicht nur Hannah Arendt war der Ansicht, dass als Mensch das Wesen des Menschen zu erkennen, so schwer sei, wie «über unseren eigenen Schatten [zu] springen».[19] Wir werden es dennoch weiterhin versuchen. Die Frage ist viel zu spannend, als dass wir sie auf sich beruhen lassen dürften.
Eine unwissenschaftliche Stichprobenerhebung darüber, was Menschen über den Geist denken (Eine Bemerkung in Klammern, warum ich dieses Buch schreibe), und ein kleiner Abstecher in Alfred North Whiteheads Geist
Während der Vorarbeiten zu diesem Essay habe ich vielen Leuten dieselbe Frage gestellt: Was ist der Geist Ihrer Ansicht nach? Ich richtete sie an Menschen, die ich nie zuvor gesehen hatte, und an Bekannte. Immer habe ich hinzugefügt, dass die Frage offen sei. Es ging mir nicht um die «richtige» Antwort, sondern ich war wirklich neugierig, was er oder sie zu sagen hatte. Meine Gesprächspartner waren gebildete Menschen aus den USA und Europa, von denen aber keiner vorher jahrelang theoretische Überlegungen zu Fragen des Geistes angestellt hatte. Die meisten waren unsicher, wie Geist zu definieren sei. Einige waren angesichts der Frage tatsächlich perplex. Obwohl wir nämlich «Geistesgegenwart beweisen» oder «geistreich sein» und sogar «im Geiste etwas sehen» können, ist der Geist ein schwer fassbarer Begriff. Um ihnen auf die Sprünge zu helfen, stellte ich eine weitere Frage: Glauben Sie, der Geist unterscheidet sich vom Körper? Fast alle trafen die übliche Unterscheidung zwischen physisch und psychisch. Der Geist denkt. Der Körper tut es nicht. Genau an diesen Dualismus glaubte Descartes: Der denkende Geist und der fühlende Körper waren bei ihm aus unterschiedlichem Stoff, doch irgendwie spielten sie zusammen. Als Nächstes fragte ich, ob Gehirn und Geist dasselbe sind oder ob sie sich unterscheiden. Hier gingen die Meinungen stark auseinander. Die einen waren der Ansicht, Gehirn und Geist seien identisch, andere glaubten das nicht. Man sieht, wie schnell diese einfachen Fragen zu vertrackten Problemen hinsichtlich des Wesens des menschlichen Geistes führen.
Glaubt man, dass der Geist etwas anderes ist als das Gehirn, stellt sich sofort die Frage: Woraus besteht er, was hat er, was das Hirn nicht hat? Was muss man über die graue Substanz hinaus in Betracht ziehen, um den Geist zu begreifen? Ist der Geist immateriell? Ein Mann, der während eines Abendessens neben mir saß und strikt zwischen Geistigem und Körperlichem trennte, reagierte ganz aufgebracht, als ich ihn fragte, woraus das Geistige bestehe? War es Gott, die Seele oder mathematische Wahrheit? Entschieden verbat er sich jede Erwähnung von Theologie, und das war so ziemlich das Ende unseres Gesprächs. Er wusste zwar, dass Körper und Geist zwei verschiedene Dinge waren, darüber reden, was sie sein könnten, wollte er aber nicht.
Wenn hingegen der Geist das Gehirn ist und das Gehirn ein Körperorgan wie jedes andere, ein Organ wie das Herz oder die Leber oder die kurzlebige Plazenta, warum ist der Geist dann höhergestellt als andere Körperteile? Auch diese Frage war manchen unangenehm. Viele von uns verorten das Wesen unseres Selbst im Kopf, in unserem denkenden Geist. Wenn mein Geist dahingeht, gehe ich mit ihm. Wenn mir ein Bein abhandenkommt, bin ich trotzdem noch da. Mein Bein macht mich nicht auf dieselbe Weise aus wie mein Denken, obwohl beide zu mir gehören. Natürlich ist es erlaubt, zu fragen: Warum sollte sich jemand Gedanken darüber machen, was der Geist ist? Viele Menschen werden alt, ohne deshalb je eine schlaflose Minute zu verbringen. Ich meine aber, die Frage ist wichtig, weil es Auswirkungen auf viele Wissensbereiche hat, je nachdem, wie das Problem gelöst wird, auch wenn diese Folgen nicht gleich ins Auge springen. Ein Beispiel: Wenn mentale Probleme Erkrankungen des Hirns und nicht Erkrankungen des Geistes sind, warum gibt es dann die Psychiatrie zur Behandlung der Seele und die Neurologie zur Behandlung des Gehirns? Warum nicht nur ein Fachgebiet, das sich mit Hirnkrankheiten befasst? Jeden Tag erreichen uns neue Meldungen aus noch unbekannten Gefilden der Hirnforschung, der Genetik und der künstlichen Intelligenz, deren Inhalte abhängig davon sind, wie einzelne Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das Körper-Geist-Problem auffassen.
Mir ist klargeworden, wie entscheidend die jeweilige Betrachtungsweise von Geist für viele Forschungen ist. Ein Einzelbeispiel reicht aus: Depression ist eine noch ungenügend verstandene Krankheit. Niemand weiß genau, wie gewöhnliche Traurigkeit und Depression zusammenhängen. Eine gängige und wirksame Behandlungsmethode von Depression ist die Kognitive Verhaltenstherapie, kurz KVT. In vielen Fachaufsätzen, Vorträgen und auch Werbeanzeigen formulieren KVT-Befürworter eine Variante der folgenden Aussage: «negative Denkmuster sind dysfunktional und haben Auswirkungen auf Stimmung, Selbstbild, Verhalten und sogar körperliche Befindlichkeit eines Menschen».[1] Indem negative Bewusstseinsinhalte in positive verwandelt werden, können Betroffene sich «besser» denken, so die Grundannahme in der KVT. Bei diesem Ansatz werden «Gedanken» – das, was ein Patient bewusst denkt – von seinem körperlichen Zustand getrennt. Die Gedanken wirken auf den Körper zurück. In der KVT werden Gedanken somit als etwas vom Körper Verschiedenes betrachtet, das ihn aber auf rätselhafte Weise manipulieren kann. Dies ist ein philosophisches Problem, denn die Gedanken scheinen immateriell zu sein, aus Nichts bestehend.
Der Epiphänomenalismus ist die Lehre davon, dass Bewusstseinserfahrungen nicht ursächlich auf den Körper zurückwirken. Auch wenn die meisten von uns ziemlich sicher sind, dass unser Verhalten durch unser Denken beeinflusst wird, bleibt es ein Rätsel, wie dies vonstattengeht. Elisabeth von der Pfalz klingt in den Worten des US-amerikanischen Sprachphilosophen John Searle nach, der das Dilemma so formuliert: «Doch wenn unsere Gedanken und Gefühle wahrhaft geistig sind, wie können sie sich dann auf irgendetwas Materielles auswirken? Wie könnte sich aus etwas Geistigem eine materielle Veränderung ergeben? Sollen wir annehmen, dass unsere Gedanken und Gefühle irgendwie chemische Wirkungen auf unser Hirn und das restliche Nervensystem hervorbringen?»[2] Wie Probleme im Kontext von Depression und ihrer Behandlung gelöst werden, hängt von der jeweils zugrundeliegenden Theorie des Geistes ab. KVT übernimmt den kartesianischen Dualismus, aber mit seinen Rätseln wollen sich ihre Vertreter nicht befassen. Viele Studien belegen die Wirksamkeit der KVT bei Depressionen. Dass eine Methode anschlägt, bedeutet aber noch nicht, dass sie aus den Gründen, die ihre Verfechter anführen, funktioniert.
Das Körper-Geist-Dilemma wird schnell zum Mensch-Umwelt-Problem. Wie gelangt etwas außerhalb des menschlichen Körper-Geists Liegendes ins Innere desselben? Wo nehmen Wörter ihren Anfang? Im Außen, in der gemeinsam verwendeten Sprache, oder im Innern des Körpers, bei der angeborenen Fähigkeit, Sprache zu erwerben? Mäuse sprechen nicht so wie wir. Wenn die Persönlichkeit oder der Charakter eines Menschen genetisch weitgehend festgelegt ist, erscheinen die Bedingungen der äußeren Welt weniger wichtig als Manipulationen am Genom. Vielleicht ist die Neigung zur Depression angeboren. Wenn der Geist nun dasselbe ist wie das Gehirn und nichts anderes, und dieses Gehirn als eine Maschine verstanden wird mit unterschiedlichen Teilen für unterschiedliche Aufgaben, die man auseinandernehmen und wieder zusammensetzen kann, dann hat diese Vorstellung Auswirkungen darauf, wie wir über depressive Menschen denken.
Wenn der Geist eine Hobbes’sche Maschine ist, dann können wir auch eine neue konstruieren, die nie depressiv wird, und bald tummeln sich allzeit glückliche Androiden unter uns. Wenn wir, wie Descartes und vor ihm Pythagoras, an einen immateriellen Geist glauben, an die ewige Wahrheit der Zahlen und daran, dass das Universum von unwandelbaren mathematischen Gesetzmäßigkeiten beherrscht wird, dann werden es diese Prinzipien sein, die unsere Vorstellungen von Gehirn, Geist und Körper leiten, und nicht die Sorge um die organischen Tatsachen aus Fleisch und Blut. Falls man sich überhaupt noch Gedanken über Depressionen macht, wird man sie in Begriffe fassen, die mit dem Körper nichts mehr zu tun haben. Geht man hingegen davon aus, dass Geist und Gehirn eine dynamische, fließende Einheit bilden, dass auch Tiere einen Geist besitzen, dass also der Gehirn-Geist eher dem von Vico als dem von Hobbes beschriebenen gleicht und dass dieser sich in Verbindung mit der Erfahrung verändert, dann muss man den Blick auch auf die Beziehungen eines depressiv Erkrankten zu den Menschen in seinem Leben richten, um wenigstens ein paar Hinweise auf die Frage, was schiefgelaufen ist, zu erhalten.
Tatsache ist, man ist sich nicht einig über den Geist. Es gibt keine einheitliche Theorie darüber, was er ist. Es herrscht Verwirrung, und nicht nur bei jenen, die sich selten Gedanken über das Körper-Geist-Dilemma machen. Naturwissenschaftler, Philosophen und Gelehrte aus allen Bereichen geraten bei diesem Problem oft aneinander. Die Kämpfe werden unter verschiedenen Namen ausgetragen, etliche drehen sich um das Bewusstsein – was darunter zu verstehen ist und warum wir überhaupt eines haben. Das ist bemerkenswert, denn wer würde heute noch Einwände gegen Kopernikus vorbringen? Wir sind uns einig, dass die Erde um die Sonne kreist. Niemand würde behaupten, William Harveys Beschreibung der Herzfunktion sei ein Irrtum. Einsteins Relativitätstheorie ist heute ebenso allgemein anerkannt wie die Quantenmechanik, auch wenn sich die beiden nicht in einer übergeordneten Theorie der Physik zusammenführen lassen. Die gegenwärtigen, unter verschiedenen Bannern geführten Gefechte über «den Geist» indes verlaufen kaum anders als im 17. Jahrhundert. Die verschiedenen Spielarten des Dualismus und Monismus haben Falten bekommen, aber sie sind bis heute aktuell.
In seinem Buch Wissenschaft und moderne Welt fasst Alfred North Whitehead die Auseinandersetzungen über Körper und Geist, Geist und Materie folgendermaßen zusammen:
Das siebzehnte Jahrhundert hatte schließlich ein Schema des wissenschaftlichen Denkens hervorgebracht, das von Mathematikern für Mathematiker geschaffen war. Die wichtige Eigenschaft des mathematischen Geistes ist seine Fähigkeit, mit Abstraktionen zu arbeiten und aus ihnen klar umrissene beweiskräftige Gedankenketten zu ziehen, die so lange völlig hinreichend sind, wie man eben nur über genau diese Abstraktionen nachdenken will. Der gewaltige Erfolg der wissenschaftlichen Abstraktionen, die einerseits der Materie mit ihrer einfachen Lokalisierung in Raum und Zeit, andererseits dem wahrnehmenden, leidenden, denkenden, aber nicht eingreifenden Geist Rechnung tragen, hat der Philosophie die Aufgabe zugeschoben, sie als die konkreteste Darstellung des Tatsächlichen anzuerkennen.
Das war der Ruin der modernen Philosophie. Sie hat auf komplexe Art zwischen drei Extremen geschwankt. Da sind die Dualisten, die Materie und Geist als gleichbegründet anerkennen, und die beiden Spielarten von Monisten: Jene, die den Geist in die Materie stecken, und jene, die die Materie in den Geist verlegen. Aber dieses Jonglieren mit Abstraktionen kann niemals die innere Verwirrung überwinden, die dadurch aufkam, daß man dem wissenschaftlichen Schema des siebzehnten Jahrhunderts die unzutreffende Konkretheit zugeschrieben hat.[3]
Whitehead war Mathematiker, Logiker, Physiker und Philosoph. Gemeinsam mit Bertrand Russell veröffentlichte er Principia Mathematica, ein Meilenstein in der Logik und Mathematik bis zum heutigen Tag, auch wenn Kurt Gödels Unvollständigkeitssatz später bewies, dass die Principia nicht widerspruchsfrei und vollständig zugleich sein konnten. Unter dem Einfluss der radikalen Umwälzungen durch die Quantenmechanik lehnte Whitehead materialistische Ansätze und die Vorstellung einer raum-zeitlichen Gebundenheit von Materie ab. Stattdessen entwickelte er eine Metaphysik von Prozess, Werden und Bewegung. Sein Denken wird häufig als eine Form des Panpsychismus beschrieben, und seine metaphysischen Ausführungen sind bisweilen schwer zu durchdringen, doch seine Analyse der Wissenschaftsgeschichte in Wissenschaft und moderne Welt ist scharfsichtig und gut verständlich, unabhängig davon, ob man seine Kritik teilt oder nicht. Er war ungemein sensibilisiert dafür, was auf dem Spiel stand: «Soll die Wissenschaft nicht zu einem Mischmasch von ad hoc-Hypothesen verkommen, dann muss sie philosophisch werden und in eine tiefgreifende Kritik ihrer eigenen Grundlagen eintreten.»[4] Diese Grundlagen, so argumentiert Whitehead, wurden im 17. Jahrhundert gelegt.
Warum habe ich mir Descartes, Hobbes, Cavendish und Vico ausgesucht, wo es doch viele weitere spannende Philosophen und Philosophinnen gibt, die sich mit diesen Fragen beschäftigt und zahlreiche interessante Lösungsvorschläge erdacht haben? Die vier dienen mir lediglich als philosophische Richtgrößen. Jeder von ihnen steht für eine bestimmte Auffassung vom denkenden Menschen in seinem Verhältnis zur Welt. Sie verfolgen ihren je eigenen dualistischen oder monistischen Ansatz. Sie alle komponierten ihre eigene Melodie des Denkens, und diesen Melodien lauscht man noch heute, sie werden immer wieder angestimmt, auch von jenen, die keine Ahnung haben, wer diese Weisen einst verfasst hat. Zwei von ihnen, Descartes und Hobbes, übten einen großen und nachhaltigen Einfluss auf Philosophie, Naturwissenschaft und viele andere Disziplinen aus. Die beiden anderen, Cavendish und Vico, spielen in der vorherrschenden Tradition nur am Rand eine Rolle, doch auch sie hatten und haben einen Einfluss, den man als subversiv bezeichnen kann.
Das Modell der mathematischen Abstraktion, das Whitehead zugrunde legt, ist deshalb wichtig, weil in einem solchen Modell, das sich auf die Wahrheit der Zahlen oder die Wahrheit des Dreiecks beruft, die Phantasie entweder außen vor bleibt oder die Rolle der Dienerin der Vernunft spielt. Whitehead erkannte, zutreffend, wie ich meine, dass allem, auch dem wissenschaftlichen Denken, eine Portion Phantasie innewohnt: «Jede Philosophie bezieht ihre Farbe von der geheimen Lichtquelle eines Vorstellungshintergrunds, der niemals ausdrücklich in ihren Gedankenketten auftaucht.»[5] Die vorstellende Imagination und Phantasie, heute oft als Synonym von «Kreativität» verstanden, diente in der Philosophie traditionell zur Beschreibung der geistigen Bilderwelt in Abgrenzung zur sinnlichen Wahrnehmung. Während ich an meinem Schreibtisch schreibe, sehe ich die Kaffeetasse neben mir, Papierbogen und aufgeschlagene Bücher, die auf dem Tisch verstreut sind, und eine kleine schwarz-rote Uhr. Wenn ich aus dem Zimmer gehe, kann ich ein Bild meines chaotischen Schreibtischs aufrufen, allerdings ein unvollständiges. Die Phantasie besteht aus dem Erblickten, den Klängen, Gerüchen und Gefühlen, die wir von einer Begebenheit oder einem Ort in Erinnerung behalten, auch von einem herbeiphantasierten Ereignis, das nie stattgefunden hat, oder von einem imaginären Ort, an dem wir nie gewesen sind. Hätte ich nie etwas mit den Sinnen erfasst, könnte ich mir weder eine Vorstellung von etwas machen, noch mich an Dinge erinnern. Für Hobbes waren schrittweise vollzogene Schlussfolgerungen der Vorstellungskraft weit überlegen, die er als eine Art des Erinnerns, als «faulen Sinn» und matten Abglanz der echten sinnlichen Wahrnehmung betrachtete. Descartes passte die fantaisie als Bereich zwischen unmittelbar sinnlicher Empfindung (als rein körperliche Erfahrung) und logischem Urteilsvermögen (als rein geistige Erfahrung) ins Konzept. Er sah darin eine Erklärungsmöglichkeit, wie Körper und Geist zusammenspielten. Für Cavendish waren Phantasie (fancy) und Gefühl im Bund mit der Vernunft unverzichtbar für jede Form der Erkenntnis. Vico war der Ansicht, dass Vorstellung und Phantasie, Erinnerungen und Metaphern aus dem Körper und seinen Sinnen hervorgingen und notwendig zur Geschichte des Denkens gehörten.
(Dies ist ein persönlicher Essay, eine Arbeit, mit der ich versuche, etwas zu verstehen, was nicht leicht zu verstehen ist. Es ist weder eine Bestandsaufnahme der westlichen Philosophie noch eine tiefgehende Auseinandersetzung mit meinen vier philosophischen Richtgrößen. Gleichwohl leitet mich ein Gefühl der Dringlichkeit, zum Teil weil die ungeklärten Fragen hinsichtlich Körper und Geist oft abgehandelt werden, als hätten wir das hinter uns, nicht nur in den Medien, die stets für Sensationsmeldungen und einfache Antworten anfällig sind, sondern auch in der Naturwissenschaft und in der Philosophie selbst. Ständig stoße ich auf Bücher, Aufsätze, Zeitschriftenartikel und Blogeinträge, in denen uns fröhlich erklärt wird, wie der Geist oder das Geist-Gehirn funktioniert, und somit auch bestimmte Annahmen über das Wesen des Menschen vermittelt werden. Die zugrundeliegenden Annahmen bleiben dabei jedoch meist verborgen, selbst denjenigen, die die Thesen aufstellen.
In der Hoffnung, einige dieser Grundannahmen und verworrenen Prämissen aufzuhebeln, stelle ich Fragen, auf die es keine schnellen Antworten gibt. Ich werde bestimmte Themen aufrollen – bekannte und weniger bekannte –, die zumindest vor Augen führen, dass vieles noch ungeklärt ist, was den menschlichen Geist und sein Verhältnis zu Körper und Welt betrifft. Ich will nicht verhehlen, dass ich auch in der Mission unterwegs bin, mit bestimmten Allgemeinplätzen aufzuräumen, die mich seit Jahren von allen Seiten anspringen, Allgemeinplätze die Nature/Nurture-Debatte betreffend, Gene, Zwillingsstudien und «vorprogrammierte» Strukturen im Gehirn. Ich bin die selbstgefälligen Annahmen über hormonell oder psychologisch bedingte Geschlechterunterschiede leid, die schlicht unausgegorenen Behauptungen der Evolutionspsychologie, und so manche Phantastereien, die in der Künstliche-Intelligenz-Forschung großgeschrieben werden. Andererseits greife ich Themen wie den Placebo-Effekt, Scheinschwangerschaft, Hysterie und dissoziative Identitätsstörung auf, weil diese Erkrankungen und körperlichen Zustände auf Wissenslücken in den aktuellen Debatten über den Geist-Gehirn-Komplex verweisen. Auch die phänomenologische Forschung wird eine Rolle spielen, die Bewusstseinszustände aus der Erlebensperspektive der ersten Person analysiert, denn möglicherweise stellt sich das Problem des menschlichen Geists im Lichte phänomenologischer Erkenntnisse anders dar. Ich hätte noch viele weitere Themen aufgreifen und auf meine Fragestellung hin erörtern können. Mein Interesse gilt jedoch weniger einer spezifischen Problematik als vielmehr der Frage, wie sehr die alten Dilemmata von Monismus und Dualismus, Körper und Geist, Innen und Außen die akademische Forschung und Wissenschaft bis heute umtreiben.
Und noch etwas finde ich faszinierend: den von Whitehead erwähnten Aspekt der Phantasie als Vorstellungshintergrund. Sie tönt jede philosophische, naturwissenschaftliche, akademische Abhandlung, auch wenn das nicht eingestanden wird. Träume von Reinheit und Macht und Kontrolle und einer besseren Welt, aber auch Ängste vor Verunreinigung, Chaos, Abhängigkeit und Ohnmacht geben selbst den rigidesten Denkgebäuden eine Färbung. Manchmal besteht der Vorstellungshintergrund aus einem Meer von Farben, und manchmal ist es nur ein blasser Pastellton, doch stets findet er seinen Niederschlag, auch wenn er in den «Gedankenketten» nicht ausdrücklich vorkommt. Ich bin nicht der Ansicht, dass diese Einfärbung durch den Vorstellungshintergrund schlecht ist. Ich bin vielmehr der Ansicht, dass der Versuch, das Denken von seinem Vorstellungshintergrund, sei er schillernd leuchtend oder nur blass erkennbar, zu säubern, ein Fehler ist. Mit Bedacht, nicht unbewusst, habe ich hier die von Whitehead benutzte Metaphorik weiter ausgeschmückt, um aus dem Hintergrund eine Leinwand zu machen. Denn wie Vico denke auch ich, dass Metaphern nicht nur unumgänglich sind, sondern das Wesen des Denkens ausmachen.)
Doch zurück zu meiner informellen Umfrage: Gab es Antworten, die ich besonders erhellend fand? Ich erinnere mich an zwei. Ein kluger Mann sagte, der Geist, das seien die vom Gehirn produzierten Gedanken. Und eine kluge Frau meinte, der Geist sei das Bewusstsein und das Gehirn das dazugehörige Organ. Philosophen sind beide nicht. Der Mann ist Schriftsteller und die Frau Schauspielerin, doch sie haben sich ihre Gedanken zu Fragen des Geistes gemacht. Die innerliche Erfahrung von Denken und Bewusstsein, so deute ich die Antworten, geht wohl nicht auf im bloßen Entschlüsseln der Funktionsweisen des Gehirns, auch wenn das Gehirn für Denken und Bewusstsein unentbehrlich ist.
Vorgefasste Ideen und M
V