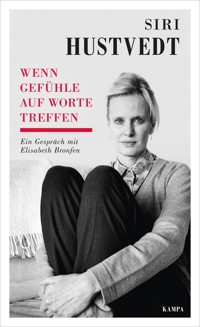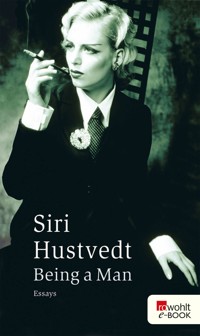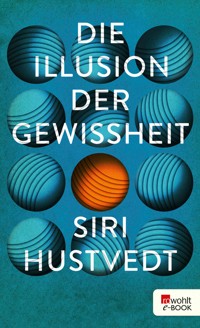9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«Siri Hustvedt, eine unserer herausragenden Schriftstellerinnen, gehört seit langem zu den brillantesten Erforschern von Gehirn und Geist. Kürzlich jedoch wandte sie ihr Forschungsinteresse sich selbst zu: Knapp drei Jahre nach dem Tod ihres Vaters, während einer Gedenkrede auf ihn, fand sie sich plötzlich von Konvulsionen geschüttelt. War das Hysterie, eine Übertragung, ein zufälliger epileptischer Anfall? Die zitternde Frau – provokant und amüsant, umfassend und niemals abgehoben – erzählt von ihren Bemühungen um eine Antwort darauf. So entsteht eine außergewöhnliche Doppelgeschichte: zum einen die ihrer verschlungenen Erkenntnissuche, zum anderen die der großen Fragen, die sich der Neuropsychiatrie heute stellen. Siri Hustvedts kluges Buch verstärkt unser Erstaunen über das Zusammenspiel von Körper und Geist.» Oliver Sacks «Siri Hustvedt beweist trotz oder gerade angesichts des autobiographischen Themas einmal mehr, was für eine großartige Erzählerin sie ist.» Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Siri Hustvedt
Die zitternde Frau
Eine Geschichte meiner Nerven
Über dieses Buch
«Siri Hustvedt, eine unserer herausragenden Schriftstellerinnen, gehört seit langem zu den brillantesten Erforschern von Gehirn und Geist. Kürzlich jedoch wandte sie ihr Forschungsinteresse sich selbst zu: Knapp drei Jahre nach dem Tod ihres Vaters, während einer Gedenkrede auf ihn, fand sie sich plötzlich von Konvulsionen geschüttelt. War das Hysterie, eine Übertragung, ein zufälliger epileptischer Anfall?
Die zitternde Frau – provokant und amüsant, umfassend und niemals abgehoben – erzählt von ihren Bemühungen um eine Antwort darauf. So entsteht eine außergewöhnliche Doppelgeschichte: zum einen die ihrer verschlungenen Erkenntnissuche, zum anderen die der großen Fragen, die sich der Neuropsychiatrie heute stellen. Siri Hustvedts kluges Buch verstärkt unser Erstaunen über das Zusammenspiel von Körper und Geist.» Oliver Sacks
«Siri Hustvedt beweist trotz oder gerade angesichts des autobiographischen Themas einmal mehr, was für eine großartige Erzählerin sie ist.» Süddeutsche Zeitung
Vita
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sieben Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Der Sommer ohne Männer» und «Die gleißende Welt». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Leben, Denken, Schauen», «Nicht hier, nicht dort», «Being a Man» und «Die Illusion der Gewissheit» vor.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel «The Shaking Woman or A History of My Nerves» bei Henry Holt and Company, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2020
Copyright © 2010 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © 2010 by Siri Hustvedt
Uli Aumüller übersetzte die Seiten 5–111,
Grete Osterwald die Seiten 112–236.
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München,
nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Marion Ettlinger
ISBN 978-3-644-00478-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
I felt a Cleaving in my Mind
As if my Brain had split
I tried to match it – Seam by Seam
But could not make it fit
Ich fühlt’ den Spalt in meinem Geist,
als wär’ mein Hirn zerteilt;
Zusammennähen wollt’ ich es,
doch blieb es ungeheilt.
Emily Dickinson
Als mein Vater starb, war ich zu Hause in Brooklyn, hatte aber nur wenige Tage zuvor in einem Pflegeheim in Northfield, Minnesota, an seinem Bett gesessen. Obwohl körperlich geschwächt, war er geistig ganz auf der Höhe gewesen, und ich erinnere mich, dass wir viel geredet und sogar gelacht haben, wenngleich ich mich an den Inhalt unseres letzten Gesprächs nicht entsinnen kann. Das Zimmer, in dem er am Ende seines Lebens wohnte, sehe ich jedoch deutlich vor mir. Meine drei Schwestern, meine Mutter und ich hatten Bilder aufgehängt und eine blassgrüne Tagesdecke gekauft, damit der Raum nicht so kahl wirkte. Auf dem Fensterbrett stand eine Blumenvase. Mein Vater hatte ein Lungenemphysem, und wir wussten, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Meine Schwester Liv, die in Minnesota wohnt, war an seinem letzten Tag als einzige seiner Töchter bei ihm. Seine Lunge war zum zweiten Mal kollabiert, und dem Arzt war klar, dass er einen weiteren Eingriff nicht überstehen würde. Als er noch bei Bewusstsein, aber nicht mehr in der Lage war zu sprechen, rief meine Mutter nacheinander ihre drei Töchter in New York an, sodass wir mit ihm telefonieren konnten. Ich erinnere mich deutlich, dass ich eine Weile darüber nachdachte, was ich ihm sagen sollte. Ich hatte den kuriosen Gedanken, ich dürfe in so einem Augenblick nicht irgendetwas Dummes von mir geben, müsse meine Worte sorgfältig wählen. Ich wollte etwas Unvergessliches sagen – eine absurde Idee, weil das Gedächtnis meines Vaters wie alles andere bald ausgelöscht sein würde. Doch als meine Mutter ihm den Hörer ans Ohr legte, war alles, was ich herauswürgen konnte: «Ich hab dich ja so lieb.» Später sagte mir meine Mutter, er habe, als er meine Stimme hörte, gelächelt.
In jener Nacht träumte ich, ich wäre bei ihm, und er streckte die Arme nach mir aus, ich beugte mich ihm entgegen, und dann, bevor er mich umarmen konnte, wachte ich auf. Am nächsten Morgen rief meine Schwester Liv an und teilte mir mit, unser Vater sei gestorben. Unmittelbar nach diesem Gespräch stand ich auf, ging nach oben in mein Arbeitszimmer und setzte mich an meinen Schreibtisch, um eine Grabrede auf ihn zu schreiben. Darum hatte mein Vater mich gebeten. Einige Wochen zuvor, als ich in dem Pflegeheim neben ihm saß, hatte er «drei Punkte» erwähnt, die ich mir aufschreiben sollte. Er sagte nicht: «Ich möchte, dass sie in dem Text vorkommen, den du für meine Beerdigung schreibst.» Das brauchte er nicht. Es verstand sich von selbst. Als es so weit war, weinte ich nicht. Bei der Beerdigung hielt ich meine Rede mit fester Stimme, ohne Tränen.
Zweieinhalb Jahre später hielt ich eine weitere Rede zu Ehren meines Vaters. Ich war wieder in Minnesota, stand unter einem blauen Maihimmel auf dem Campus des St. Olaf College in meiner Heimatstadt, oberhalb des alten Gebäudes der Norwegischen Abteilung, an der mein Vater fast vierzig Jahre lang Professor gewesen war. Der Fachbereich hatte zu seinem Gedenken eine Nordische Fichte gepflanzt und darunter eine kleine Tafel angebracht, auf der stand: Lloyd Hustvedt (1922–2004). Beim Verfassen dieses zweiten Textes hatte ich das starke Gefühl, die Stimme meines Vaters zu hören. Er selbst schrieb ausgezeichnete und oft sehr witzige Reden, und ich bildete mir beim Schreiben ein, ich hätte etwas von seinem Humor in meinen Sätzen eingefangen. Ich gebrauchte sogar die Phrase: «Wäre mein Vater heute hier, würde er vielleicht sagen …» Selbstsicher und mit Karteikarten versehen, blickte ich über die etwa fünfzig Freunde und Kollegen, die sich rund um die Fichte versammelt hatten, öffnete den Mund zu meinem ersten Satz und begann vom Hals an abwärts zu zittern. Meine Arme zuckten. Die Knie knickten ein. Ich zitterte so stark, als hätte ich einen Krampfanfall. Komischerweise war meine Stimme nicht betroffen. Sie veränderte sich überhaupt nicht. Verblüfft von dem, was mir geschah, und in Angst und Schrecken, ich könnte umkippen, gelang es mir, das Gleichgewicht zu wahren und weiterzureden, obwohl die Karten, die ich in der Hand hielt, vor mir hin und her wackelten. Als die Rede zu Ende war, hörte das Zittern auf. Ich sah auf meine Beine hinunter. Sie waren dunkelrot angelaufen und schimmerten bläulich.
Meine Mutter und meine Schwestern waren bestürzt über die mysteriöse körperliche Verwandlung, die in mir stattgefunden hatte. Sie hatten mich viele Male öffentlich sprechen sehen, mitunter vor Hunderten von Menschen. Liv sagte später, sie wäre gern nach vorne gegangen und hätte die Arme um mich gelegt, um mich zu stützen. Meine Mutter sagte, sie hätte den Eindruck gehabt, einer Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl beizuwohnen. Es schien, als hätte irgendeine unbekannte Macht plötzlich meinen Körper übernommen und entschieden, er müsse einmal ordentlich und anhaltend durchgerüttelt werden. Schon einmal, im Sommer 1982, hatte ich das Gefühl gehabt, von einer höheren Macht gepackt und umhergeschleudert zu werden, als wäre ich eine Puppe. In einer Pariser Galerie zuckte mein linker Arm plötzlich nach oben, und ich knallte rückwärts gegen die Wand. Das Ganze dauerte höchstens ein paar Sekunden. Kurz darauf fühlte ich mich euphorisch, von übernatürlicher Freude erfüllt, und dann kam die brutale Migräne, die fast ein Jahr lang anhalten sollte, das Jahr von Fiorenol, Inderal, Cafergot, Elavil, Tofranil, Mellaril und einem Schlafmittelcocktail, den ich im Sprechzimmer eines Arztes in der Hoffnung schluckte, kopfschmerzfrei wieder aufzuwachen. Aber leider war mir kein solches Glück beschieden. Schließlich wies mich derselbe Neurologe ins Krankenhaus ein und setzte mich unter die antipsychotische Droge Megaphen. Jene benebelten acht Tage in der neurologischen Abteilung mit meiner alten, aber erstaunlich agilen Zimmergenossin, einer Schlaganfallpatientin, die jeden Abend mit einer herzigerweise Posey genannten Vorrichtung an ihr Bett gefesselt wurde und jede Nacht den Schwestern trotzte, indem sie sich von ihren Fesseln befreite und über den Korridor floh, jene seltsamen Tage unter Drogen, unterbrochen von Visiten junger Männer in weißen Kitteln, die mir Stifte vor die Nase hielten, die ich erkennen musste, mich nach dem Datum und dem Jahr und dem Namen des Präsidenten fragten, mich mit kleinen Nadeln stachen – «Spüren Sie das?» – und durch die halboffene Tür das seltene Winken des Kopfschmerzpapstes persönlich, Dr. C., ein Mann, der mich meistens übersah und gereizt zu sein schien, dass ich nicht mitmachte und gesund wurde – jene Tage sind mir als eine Zeit der schwärzesten aller schwarzen Komödien in Erinnerung geblieben. Niemand wusste wirklich, was mir fehlte. Mein Arzt gab dem einen Namen – vaskuläres Migränesyndrom – , aber wieso ich ein erbrechender, jammervoller, flachgelegter, verängstigter UNGEHEURER Kopfschmerz geworden war, ein Humpty Dumpty nach seinem Sturz von der Mauer, konnte niemand sagen.
Meine Ausflüge in die Welten der Neurologie, Psychiatrie und Psychoanalyse hatten schon lange vor meinem Aufenthalt im Mount Sinai Medical Center begonnen. Seit meiner Kindheit leide ich unter Migräne, und meine Kopfschmerzen, meine Schwindelanfälle, meine himmlischen Gefühle von Levitation, die Sterne, das Schwarzwerden vor den Augen und meine einzige visuelle Halluzination von einem rosa Männchen und einem rosa Ochsen auf dem Fußboden meines Schlafzimmers erregen seit langem meine Neugier. Ich hatte schon viele Jahre über diese Geheimnisse gelesen, ehe ich an jenem Nachmittag in Northfield meinen Zitteranfall bekam. Meine Recherchen nahmen sogar noch zu, nachdem ich beschlossen hatte, einen Roman zu schreiben, worin ich einen Psychiater und Psychoanalytiker darstellen musste, einen Mann, den ich mit der Zeit als meinen imaginären Bruder betrachtete: Erik Davidsen. In Minnesota bei Eltern aufgewachsen, die den meinen sehr ähnlich waren, war er der Junge, der in der Familie Hustvedt nie geboren wurde. Als Erik stürzte ich mich in die Windungen psychiatrischer Diagnostik und die unzähligen Geistesstörungen, von denen Menschen befallen werden. Ich arbeitete mich in die Pharmakologie ein und machte mich mit den verschiedenen Gruppen von Medikamenten vertraut. Ich kaufte mir ein Buch mit Mustertests für die psychiatrischen Behörden des Staates New York und übte mich darin, sie auszufüllen. Ich las noch mehr psychoanalytische Literatur und zahllose Fallgeschichten psychischer Erkrankungen. Ich war fasziniert von den Neurowissenschaften und hörte eine Vorlesung über Hirnforschung, die einmal im Monat am New York Psychoanalytic Institute gehalten wurde; ich wurde eingeladen, Mitglied einer Diskussionsgruppe über ein neues Gebiet, die Neuropsychoanalyse, zu werden.
In dieser Gruppe suchten Neurowissenschaftler, Psychiater und Psychoanalytiker eine gemeinsame Basis, auf der die analytischen Erkenntnisse mit den Ergebnissen der neuesten Hirnforschung zusammengeführt werden könnten. Ich kaufte mir ein Gehirnmodell, machte mich mit seinen vielen Teilen vertraut, hörte aufmerksam zu und las noch mehr. Tatsächlich las ich wie eine Besessene, wie mein Mann mir immer wieder sagte. Er fand sogar, mein gieriges Lesen habe Ähnlichkeit mit einer Sucht. Dann meldete ich mich als ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Payne Whitney Psychiatric Clinic und gab den Patienten einmal in der Woche Unterricht im Schreiben. In der Klinik kam ich einzelnen, an komplexen Krankheiten leidenden Menschen nahe, die mitunter wenig Ähnlichkeit mit den im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (gewöhnlich DSM genannt) katalogisierten Beschreibungen hatten. Zu dem Zeitpunkt, als ich vor dem Baum meines Vaters stand und zitterte, war ich seit Jahren tief in die Welt von Gehirn und Geist eingestiegen. Was aus Wissbegier über die Mysterien meines eigenen Nervensystems begann, hatte sich zu einer großen Leidenschaft entwickelt. Intellektuelle Wissbegier über die eigene Krankheit entsteht mit Sicherheit aus dem Wunsch nach deren Beherrschung. Wenn ich mich nicht heilen konnte, konnte ich wenigstens anfangen, mich selbst zu verstehen.
Jede Krankheit hat etwas Fremdes, etwas von einer Invasion und einem Kontrollverlust, was sich in der Sprache offenbart, die wir in dem Zusammenhang benutzen. Kein Mensch sagt «Ich bin Krebs» oder «Ich bin kanzerös», obwohl keine Viren oder Bakterien in ihn eingedrungen, sondern die eigenen Körperzellen Amok gelaufen sind. Man hat Krebs. Bei neurologischen und psychiatrischen Krankheiten ist das anders, weil sie oft den Ursprung dessen angreifen, was man sich als das eigene Selbst vorstellt. «Er ist Epileptiker» hört sich für uns nicht seltsam an. In der Psychiatrie sagen die Patienten häufig: «Ja, wissen Sie, ich bin manisch-depressiv», oder: «Ich bin schizophren.» Die Krankheit und das Selbst werden in diesen Sätzen vollständig gleichgesetzt. Die zitternde Frau fühlte sich wie ich an und zugleich nicht wie ich. Vom Kinn an aufwärts war ich mein vertrautes Selbst. Vom Hals an abwärts war ich eine geschüttelte Fremde. Was auch immer mit mir geschehen war, was für ein Name meinen Beschwerden auch zugeschrieben werden würde, mein seltsamer Anfall musste eine emotionale Komponente gehabt haben, die irgendwie mit meinem Vater zu tun hatte. Das Problem war, dass ich mich nicht so gefühlt hatte. Ich hatte mich vollkommen ruhig und bei klarem Verstand gefühlt. Irgendetwas schien da mit mir schiefgegangen zu sein, aber was genau? Ich beschloss, mich auf die Suche nach der zitternden Frau zu machen.
Die Mediziner zerbrechen sich seit Jahrhunderten über Schüttelkrämpfe wie meine den Kopf. Viele Krankheiten sind mit Zittern verbunden, aber es ist nicht immer einfach, sie voneinander zu unterscheiden. Seit Hippokrates bedeutet eine Diagnose stellen, einen Haufen Symptome unter einem Namen in einen Topf zu werfen. Epilepsie ist die berühmteste Schüttelkrankheit. Wäre ich eine Patientin des griechischen Arztes Galen gewesen, der Kaiser Marc Aurel behandelte und dessen umfangreiche Schriften die Medizingeschichte jahrhundertelang beeinflussten, hätte er bei mir Krämpfe diagnostiziert, Epilepsie aber ausgeschlossen. Für Galen verursachte Epilepsie nicht nur Krämpfe des ganzen Körpers, sie unterbrach auch die «Leitfunktionen» – Bewusstsein und Sprechen[1]. Obwohl es bei den Griechen einen Volksglauben gab, Götter und Geister könnten das Zittern verursachen, betrachteten die meisten Ärzte das Phänomen als Naturforscher. Erst mit der Verbreitung des Christentums wurden Zuckungen und das Übernatürliche verwirrend innig miteinander verbunden. Die Natur, Gott und der Teufel konnten den Körper eines Menschen zerstören, und die medizinischen Fachleute hatten Mühe, zwischen den Ursachen zu unterscheiden. Wie konnte man einen natürlichen Vorgang, einen göttlichen Eingriff oder das Besessensein von Dämonen auseinanderhalten? Teresa von Ávilas anfallartige Todesqualen und Ohnmachten, ihre Visionen und Entrückungen waren mystische Fluchten zu Gott hin, aber die Mädchen von Salem, die sich wanden und schüttelten, waren Opfer von Hexen. In A Modest Inquiry into the Nature of Witchcraft beschreibt John Hale die Anfälle der gepeinigten Kinder und fügt dann betont hinzu, ihre extremen Leiden gingen «über die Gewalt hinaus, die jegliche epileptische Anfälle oder natürliche Krankheiten verursachen könnten»[2]. Wäre mein Zitteranfall während des Hexenwahns in Salem eingetreten, hätte er böse Folgen haben können. Ich hätte mit Sicherheit wie eine Besessene gewirkt. Schlimmer noch: Wäre ich selbst von den damaligen Glaubensvorstellungen durchdrungen gewesen – und das wäre ich höchstwahrscheinlich – , hätte das unheimliche Gefühl, irgendeine äußere Macht wäre in meinen Körper gefahren und hätte das Zittern ausgelöst, vermutlich ausgereicht, um mich davon zu überzeugen, dass ich verhext sei.
Im New York des Jahres 2006 hätte mich kein zurechnungsfähiger Arzt zu einem Exorzisten geschickt, und doch herrscht bei der Diagnose allgemeine Verwirrung. Die Koordinaten für eine Begutachtung von Krämpfen mochten sich geändert haben, aber zu verstehen, was mit mir geschehen war, würde nicht einfach sein. Ich konnte zu einem Neurologen gehen, um herauszufinden, ob ich an Epilepsie litt, obwohl ich seit meiner Erfahrung im Mount Sinai Hospital vor Ärzten auf der Hut war, die das Nervensystem untersuchen. Ich wusste, dass ich für eine solche Diagnose mindestens zwei Anfälle gehabt haben musste. Ich glaubte, vor meiner hartnäckigen Migräne einen echten Anfall gehabt zu haben. Der zweite sah mir verdächtig aus. Unkontrolliertes Zittern kann bei manchen Krampfanfällen vorkommen. Mein Zittern war beidseitig – und ich hatte während des ganzen Anfalls geredet. Wie viele Menschen reden während eines Anfalls? Außerdem hatte ich keine Aura gehabt, keine Vorwarnung, dass ein neurologisches Ereignis sich anbahnte, wie es oft bei meiner Migräne vorkommt, und der Anfall war mit der Rede über meinen toten Vater vorbei gewesen. Wegen meiner Vorgeschichte wusste ich, dass ein sorgfältiger Neurologe ein Elektroenzephalogramm machen würde. Ich würde eine ganze Weile mit glibberigen Elektroden am Schädel herumsitzen müssen, und vermutlich fände der Arzt am Ende nichts. Natürlich haben viele Menschen Krampfleiden, die nicht durch die üblichen Untersuchungen ermittelt werden können; dann müsste der Mediziner noch weitere Untersuchungen vornehmen. Und wenn ich nicht weiterzitterte, käme die Diagnose vielleicht nicht voran. Ich geriete in die Grauzone einer unbekannten Krankheit.
Ich hatte mir eine Zeitlang den Kopf über mein Zittern zerbrochen, als sich eine mögliche Antwort ankündigte. Sie schälte sich nicht langsam heraus, sondern kam ganz plötzlich wie eine Erleuchtung. Ich saß auf meinem gewohnten Platz in der monatlichen neurowissenschaftlichen Vorlesung und dachte an ein kurzes Gespräch mit einer Psychiaterin zurück, die bei einem früheren Vortrag hinter mir gesessen hatte. Ich hatte sie gefragt, wo sie arbeite und was sie mache, und sie hatte mir erzählt, sie sei in einem Krankenhaus angestellt, wo sie hauptsächlich «Patienten mit Konversionsstörungen» betreue. «Die Neurologen wissen nicht, was sie mit ihnen anfangen sollen», hatte sie gesagt, «also schicken sie sie zu mir.» Das könnte es sein!, dachte ich. Mein Anfall war hysterisch gewesen. Dieses altertümliche Wort ist aus dem derzeitigen medizinischen Diskurs weitgehend verschwunden und durch Konversionsstörung ersetzt, aber unter dem neueren Begriff spukt der alte wie ein Gespenst umher.
Fast jedes Mal, wenn heutzutage das Wort Hysterie in Zeitungen oder Zeitschriften gebraucht wird, erläutert der Verfasser, dass es seine Wurzel in dem griechischen Wort für «Gebärmutter» hat. Sein Ursprung als ein mit den Fortpflanzungsorganen zusammenhängendes, rein weibliches Problem soll den Leser warnen, dass das Wort als solches ein uraltes Vorurteil widerspiegelt, doch ist seine Geschichte weitaus komplexer als Misogynie. Galen glaubte, Hysterie wäre eine Krankheit, von der unverheiratete und verwitwete Frauen ohne Geschlechtsverkehr geplagt werden, aber kein Wahnsinn, da sie nicht zwangsläufig psychische Beeinträchtigungen mit sich brachte. Die Ärzte der Antike waren sich wohl bewusst, dass epileptische und hysterische Anfälle gleich aussehen konnten und dass es wesentlich war, sie auseinanderzuhalten. Wie sich zeigt, dauert die Verwirrung an. Im 15. Jahrhundert glaubte der Mediziner Antonius Guainerius, von der Gebärmutter aufsteigende Vapeurs verursachten die Hysterie, und Hysterie wäre von Epilepsie unterscheidbar, weil die hysterische Person sich an alles erinnern konnte, was während des Anfalls geschehen war.[3] Der große englische Arzt des 17. Jahrhunderts, Thomas Willis, räumte mit der Gebärmutter als dem ursächlichen Organ auf und lokalisierte sowohl Hysterie als auch Epilepsie im Gehirn. Aber Willis’ Gedanke setzte sich nicht durch. Es gab jene, die glaubten, beide seien bloß verschiedene Erscheinungsformen desselben Leidens. Der Schweizer Arzt Samuel Auguste David Tissot (1728 – 1797), der vor allem wegen seines weit verbreiteten Traktats über die Gefahren des Masturbierens in die Medizingeschichte eingegangen ist, behauptete, die beiden Krankheiten unterschieden sich, obwohl es Epilepsien gäbe, die in der Gebärmutter entstünden.[4] Von der Antike bis ins 18. Jahrhundert wurde Hysterie als ein Krampfleiden betrachtet, das irgendwo im Körper entsteht – in der Gebärmutter, im Gehirn oder in einem Körperglied – , und die darunter litten, wurden nicht als geistesgestört angesehen. Man kann mit Sicherheit sagen, wenn einer der oben erwähnten Ärzte Zeuge meiner konvulsivischen Rede gewesen wäre, hätte er mich als hysterisch diagnostiziert. Meine geistigen Funktionen waren nicht unterbrochen, ich erinnerte mich an alles im Zusammenhang mit meinem Anfall, und natürlich war ich eine Frau mit einer potentiell vaporösen oder gestörten Gebärmutter.
Die Frage, wann Hysterie eine ausschließlich mit dem Geist assoziierte Krankheit wurde, ist interessant. Im normalen Sprachgebrauch bezeichnen wir mit dem Wort Hysterie die Erregbarkeit oder überschießende Emotion eines Menschen. Es beschwört eine schreiende, außer Kontrolle geratene Person herauf, gewöhnlich eine Frau. Was auch immer mit meinen Armen, Beinen und meinem Rumpf passiert war – mein Geist hatte gut funktioniert, und ich hatte ruhig gesprochen. In diesem Sinn war ich also nicht hysterisch. Heutzutage werden Konversionsstörungen als psychische, nicht als neurologische Krankheiten klassifiziert, was erklärt, weshalb wir sie mit mentalen Problemen verbinden. Im DSM, inzwischen in der vierten Ausgabe, fallen Konversionsstörungen in den Bereich der somatoformen Dissoziation – körperliche Störungen und gestörte Körperempfindungen.[5] Aber in den letzten vierzig Jahren haben sich die Bezeichnung und die Klassifikation der Krankheit mehrmals geändert. Im ersten DSM von 1952 wurde sie Konversionsreaktion genannt. Das DSM-II (1968) rechnete sie den dissoziativen Störungen zu und bezeichnete sie als hysterische Neurose vom Konversionstypus. 1968 war den Autoren offensichtlich daran gelegen, die Wurzeln der Krankheit wieder freizulegen, indem sie auf das Wort Hysterie zurückgriffen. Dissoziation ist ein sehr weitgefasster Terminus, der auf verschiedene Arten gebraucht wird, um irgendeine Form der Entfernung vom normalen Selbstsein oder dessen Zusammenbruch zu kennzeichnen. Wenn jemand zum Beispiel eine außerkörperliche Erfahrung macht, heißt es von ihm, er sei in einem dissoziativen Zustand; jemand, der von dem Gefühl gequält wird, er oder die Welt wäre nicht real, würde ebenfalls dissoziativ genannt werden. Als dann 1980 das DSM-III herauskam, war das Wort hysterisch wieder verschwunden und durch den Begriff Konversionsstörung, ein somatoformes Problem, ersetzt, der unverändert in das DSM-IV übernommen wurde. Im aktuellen Handbuch der Weltgesundheitsorganisation, dem ICD-10, heißt es jedoch anders: Dort wird es dissoziative Störung (Konversionsstörung) genannt. Das klingt nicht nur verwirrend, es ist auch so. Die Verfasser psychiatrischer Diagnosen waren offenbar verunsichert, was sie mit der Hysterie machen sollten.
Einiges ist jedoch allgemeingültig. Konversionssymptome ahmen oft neurologische Symptome nach: Lähmungen; Krampfanfälle; Schwierigkeiten beim Gehen, Schlucken oder Sprechen; Blindheit und Taubheit. Doch bei einer neurologischen Untersuchung findet sich nichts, was normalerweise solche Probleme verursachen würde. Wenn zum Beispiel ein zufällig vorbeikommender Neurologe ein EEG von mir gemacht hätte, während ich geschüttelt vor dem Baum stand, hätte das Gerät keine hysterischen Konvulsionen aufgezeichnet, epileptische Zuckungen aber womöglich doch. Dabei sind Hysteriker keine Simulanten. Sie können nichts für das, was mit ihnen geschieht, und täuschen ihre Krankheiten nicht vor. Auch können die Symptome häufig von selbst verschwinden. Allerdings empfiehlt es sich dringend, wie die Autoren des DSM anmerken, «Vorsicht walten zu lassen»[6]. Anders ausgedrückt, wäre ich zu einem Psychiater gegangen, hätte er besonders sorgfältig mit mir umgehen müssen. Eine nicht identifizierte, auch bei entsprechenden Tests nicht erkennbare neurologische Krankheit hätte sich unter meinen Symptomen verbergen können. Er hätte überzeugt davon sein müssen, dass mein Gezittere für Epilepsie zu eigenartig war, ehe er eine Diagnose stellte. Und dieses Problem besteht in beide Richtungen. Carl Bazil, Pharmakologe an der Columbia University, berichtet von einem Patienten, der mit ansah, wie sein Arbeitsplatz niederbrannte, und «plötzlich rechtsseitig gelähmt war, als hätte er einen Schlaganfall»[7]. Tatsächlich hatte der Mann eine «Konversionsreaktion», die wieder verschwand, als der Schock nachließ. Das Problem wird noch dadurch erschwert, dass Epileptiker viel häufiger zu hysterischen Anfällen neigen als Gesunde. In einem Aufsatz, den ich las, erklären die Autoren, zwischen 10 und 60 Prozent der Patienten mit psychogenen nichtepileptischen Anfällen (PNES) hätten komorbide Epilepsie.[8] Dieses gegenwärtige Identifikationsdilemma klingt sehr nach den Schwierigkeiten, die Ärzte zu allen Zeiten hatten, Epilepsie und Hysterie auseinanderzuhalten. Die Frage lautete immer: Eine Frau zittert. Warum?
Im späten 20. Jahrhundert warfen die Mediziner jahrelang unbekümmert mit dem Ausdruck «keine organische Ursache» um sich. Hysterie war eine psychische Krankheit ohne organische Ursache. Man war plötzlich gelähmt, blind und von Zuckungen befallen, ohne irgendeine organische Ursache? Wie war das möglich? Wenn man nicht an Geister, Gespenster oder Dämonen glaubte, die vom Himmel fallen oder aus der Hölle hervorschießen, um die Kontrolle über jemandes Körper zu übernehmen, wie konnte man da behaupten, dies wäre kein organisches, körperliches Phänomen? Selbst die aktuelle Ausgabe des DSM erkennt das Problem mit der Feststellung an, der Unterschied zwischen psychisch und physisch sei «ein reduktionistischer, anachronistischer Körper-Geist-Dualismus»[9]. Diese Spaltung kennen wir im Abendland mindestens seit Plato. Die Vorstellung, dass wir aus zwei Stoffen, nicht einem, gemacht seien, dass Geist keine Materie sei, existiert weiterhin in der Weltauffassung vieler Menschen. Natürlich hat die Erfahrung, in meinem eigenen Kopf zu leben, etwas Magisches. Wie sehe, fühle und denke ich, und was genau ist meine Seele? Ist mein Geist dasselbe wie mein Gehirn? Wie kann menschliche Erfahrung in weiß-grauer Materie entstehen? Was ist organisch und was nicht?
Voriges Jahr hörte ich im Radio einen Mann über das Leben mit seinem schizophrenen Sohn sprechen. Wie viele andere Patienten auch hatte der Sohn Probleme, seine Pillen pünktlich einzunehmen. Wenn er nach Krankenhausaufenthalten nach Hause kam, hörte er regelmäßig auf, die verschriebenen Medikamente zu nehmen, und erlitt dann erneut einen Zusammenbruch. Diese Geschichte habe ich oft von den Patienten gehört, die ich im Krankenhaus unterrichte, aber jeder hat andere Gründe, die Medikamente abzusetzen. Ein Patient wurde von einem Neuroleptikum furchtbar dick, und das machte ihn unglücklich; ein anderer fühlte sich innerlich tot; eine Dritte war wütend auf ihre Mutter und nahm aus Trotz ihre Medikamente nicht mehr ein. Der Vater im Radio betonte demonstrativ: «Schizophrenie ist eine organische Erkrankung des Gehirns.» Ich verstand, wieso er das sagte. Wahrscheinlich hatten die Ärzte seines Sohnes es so bezeichnet, oder er hatte Artikel gelesen, in denen die Krankheit so beschrieben wurde, und es tröstete ihn, gab ihm das Gefühl, dass er als Vater nicht für die Krankheit seines Kindes verantwortlich sei, dass die Umgebung des Jungen keine Rolle gespielt habe. Vielleicht wird das genetische Geheimnis der Schizophrenie ja eines Tages gelöst, aber vorläufig ist es unbekannt. Wenn ein eineiiger Zwilling daran leidet, besteht eine fünfzigprozentige Wahrscheinlichkeit, dass der andere auch daran erkrankt. Das ist ein hoher, aber kein determinierender Prozentsatz. Es müssen noch andere Faktoren am Werk sein, Umweltfaktoren, alles Mögliche von der Luftverschmutzung bis zur Vernachlässigung durch die Eltern. Allzu oft hört man lieber einfache Antworten. Im derzeitigen kulturellen Klima klingt organische Erkrankung des Gehirns irgendwie beruhigend. Mein Sohn ist nicht verrückt; mit seinem Gehirn ist etwas nicht in Ordnung.
Aber so schnell kommt man aus der Psyche/Soma-Falle nicht heraus. Der bekannte Psychoanalyseforscher Peter Rudnytsky beschäftigt sich mit Otto Rank, einem Psychoanalytiker aus dem Freud’schen Zirkel, der wahrscheinlich manisch-depressiv war. Da die manisch-depressive Erkrankung eine «organische» Krankheit sei, argumentiert Rudnytsky, könnten Ranks Stimmungsschwankungen ihm nicht als «Charakterfehler» angekreidet werden.[10] Manisch-depressive Erkrankungen, auch bekannt als bipolare Störungen, liegen in der Familie, und der genetische Anteil scheint erheblich höher zu sein als bei Schizophrenie. Und doch unterstellt Rudnytsky, es gäbe nichtorganische Zustände, die auf Charakterfehler zurückzuführen seien. Daraus ergibt sich die Frage: Was ist Charakter? Ist der Charakter nicht die Summe unserer Teile, und sind diese Teile nicht organisch? Und wenn nicht, was ist psychisch, und was ist somatisch?
Das Problem ist, dass der Ausdruck organische Erkrankung des Gehirns nicht viel zu bedeuten hat. Im Hirngewebe Schizophrener oder Manisch-Depressiver sind keine Verletzungen oder Löcher, kein Virus nagt an ihrer Hirnrinde. Es gibt Unterschiede in der Gehirnaktivität, die mit den neuen technologischen Mitteln der Kernspintomographie erkannt werden können. Andererseits entstehen auch dann, wenn wir traurig, glücklich oder sexuell erregt sind, Veränderungen im Gehirn. Und all diese menschlichen Zustände sind physisch. Und was ist überhaupt eine Erkrankung? In Campbell’s Psychiatric Dictionary fand ich folgendes Zitat aus Philosophy in Medicine von Culver und Gert: «Störung und Erkrankung hängen eng zusammen, aber Erkrankungen sind ontologisch robuster als bloße Störungen.»[11] Anders ausgedrückt, zeigt eine Erkrankung mehr «Präsenz», hat ein stärkeres «Wesen» als eine Störung. Vor kurzem zeigte mir ein Freund ein Buch mit dem Titel Living Well with Migraine Disease and Headaches. Ich war erstaunt. Während meiner früheren Odyssee von einem Neurologen zum anderen war Migräne nie als Krankheit bezeichnet worden. Offensichtlich hatte sie seit 1982 einen neuen Stellenwert erlangt, eine stärkere Daseinsberechtigung bekommen. Sind Konversionsstörungen, anders als Schizophrenie oder manisch-depressive Erkrankungen, ein psychisches Phänomen? Ist die Psyche etwas anderes als das Gehirn?
Sigmund Freud war der Erste, der das Wort Konversion in seinem 1895 mit Josef Breuer veröffentlichten Werk Studien über Hysterie gebrauchte: «Der Kürze halber [wählen wir] die Bezeichnung ‹Konversion› für die Umsetzung psychischer Erregung in körperliche Dauersymptome, welche die Hysterie auszeichnet.»[12] Was meinte Freud damit? Glaubte er, psychische Erregung wäre eine nichtbiologische Entität? Freud war durchdrungen von der Philosophie und der Wissenschaft seiner Zeit. Als Student arbeitete er auf sein Medizinexamen hin, studierte aber zusätzlich Philosophie und Zoologie. Im Frühjahr 1876 bekam er ein Stipendium an der Zoologischen Versuchsstation in Triest, wo er seine Zeit mit der Sektion von Aalen verbrachte, ihre histologische Struktur erkundete und nach ihren Hoden suchte, die bis dahin von niemandem gefunden worden waren. Die Geschlechtsorgane des Aals scheinen den interessierten Kennern der Materie seit Aristoteles Kopfzerbrechen bereitet zu haben. Freuds Ergebnisse waren nicht eindeutig, aber seine Forschung war eine Etappe des Weges, der schließlich eine Antwort auf die Frage liefern sollte. Nach dreijährigem Medizinstudium spezialisierte er sich auf Neurologie und beschäftigte sich am Physiologischen Institut von Ernst Wilhelm von Brücke mit Nervenzellen. Er konzentrierte sich auf das sichtbare Material des Nervensystems. Das erste Buch, das Freud veröffentlichte, hieß Zur Auffassung der Aphasien. Eine kritische Studie. Aphasie – das griechische Wort für «sprachlos» – bezieht sich auf Sprachverluste bei hirngeschädigten Patienten. Jeder Aspekt von Sprache kann betroffen sein. Manche Patienten verstehen die Wörter, können sie aber nicht sprechen. Manche verstehen nicht, was zu ihnen gesagt wird, oder können keine ganzen Sätze erfassen. Andere wissen, was sie sagen wollen, können aber die Phoneme nicht abrufen, um es auszusprechen. Obwohl Freuds Buch damals keine große Beachtung fand, bleibt vieles von dem, was er darin vorbringt, weiterhin gültig. Er behauptete nachdrücklich, dass Prozesse im Gehirn, obwohl sie lokalisiert werden können – bestimmte Hirnregionen sind für verschiedene menschliche Tätigkeiten wie etwa das Sprechen zuständig – , nicht statisch seien, sondern dynamische, bewegliche Pfade im Gehirn. Das ist ohne Frage richtig. Freuds Auffassung über den Zusammenhang zwischen Geist und Materie war differenziert. Er war weder Reduktionist noch Dualist: «Das Psychische ist somit ein Parallelvorgang des Physiologischen.»[13] Freud blieb sein Leben lang Materialist. Mit nebulösen Vorstellungen von Seelen, Geistern oder Ähnlichem, die losgelöst von physischen Prozessen wären, wollte er nichts zu tun haben. Das eine hing vom anderen ab. Gleichzeitig hielt er es mit Kant und glaubte nicht, dass es möglich wäre, Dinge an sich zu kennen. Unser Zugang zur Welt erschließe sich nur über unsere Wahrnehmungen von ihr, argumentierte er. Und trotzdem stoße ich dauernd mit Menschen zusammen, die Freud fast wie einen Mystiker behandeln, einen Mann, dessen Ideen keine Verbindung zu physischen Realitäten hatten, wie eine Art Ungeheuer, das die Moderne behinderte, indem es eine gutgläubige Zuhörerschaft mit allem möglichen Unsinn fütterte, bis sein Denken schließlich von einer neuen, auf die Wunder der Pharmakologie gegründeten wissenschaftlichen Psychiatrie zunichtegemacht wurde. Wie konnte ein Wissenschaftler zu solch einem Ruf kommen?
Nicht lange nachdem er mit Breuer die Studien über Hysterie veröffentlicht hatte, nahm Freud seinen Entwurf einer Psychologie für die Neurologen in Angriff – ein Versuch, seine Erkenntnisse über die psychischen Vorgänge mit seinen neurologischen Kenntnissen zu verknüpfen und ein auf Hirngewebe – Neuronen – beruhendes biologisches Modell zu erschaffen. Nachdem er eine Zeitlang fieberhaft geschrieben hatte, wurde ihm klar, dass nicht genug über die neuralen Prozesse bekannt war, um eine derartige Abbildung zu erstellen, und er legte seinen Entwurf beiseite. Dann machte der Vater der Psychoanalyse seine schicksalhafte Wendung hin zu einer rein psychologischen Erklärung des Geistes, wenngleich er den Gedanken nie aufgab, irgendwann in der Zukunft würden Wissenschaftler in der Lage sein, seine Ideen mit neuen Erkenntnissen über Hirnfunktionen zu begründen. In Revolution in Mind formuliert George Makari, vor welchem Problem Freud und viele andere Vertreter der Neurologie, Psychologie oder Biophysik standen: «Man konnte nicht einfach so sagen, ein Nerv beherberge ein Wort oder eine Idee.»[14] Freud hatte zwar Vorstellungen davon, wie diese Verbindung funktionierte, konnte sie aber nicht einmal im Ansatz beweisen.
Sagen wir, dass ich nach meinem unergiebigen imaginären Besuch bei dem Neurologen beschlossen hätte, einen Psychologen aufzusuchen. Obwohl die amerikanische Psychiatrie früher stark von der Psychoanalyse beeinflusst war, haben sich die beiden Disziplinen, vor allem seit den 1970er Jahren, weiter und weiter auseinanderentwickelt. Viele Psychiater wissen wenig oder nichts über Psychoanalyse, die in unserer Kultur zunehmend marginalisiert wurde. Eine große Zahl amerikanischer Psychiater überlässt das Reden lieber Sozialarbeitern und hält sich an das Verschreiben von Rezepten. Die medikamentöse Behandlung überwiegt. Dennoch, weltweit praktizieren noch immer viele Psychoanalytiker, und es ist eine Disziplin, die mich fasziniert, seit ich mit sechzehn zum ersten Mal Freud las. Ich habe nie eine Analyse gemacht, aber in einigen kritischen Augenblicken meines Lebens habe ich mit dem Gedanken gespielt, Analytikerin zu werden, und dazu hätte ich eine Lehranalyse machen müssen. Einmal habe ich mich auf eine Psychotherapie eingelassen, nur kurz, und sie hat mir sehr geholfen, doch allmählich wurde mir klar, dass irgendetwas in mir Angst vor einer Analyse hat. Diese Angst ist schwer zu beschreiben, weil ich mir nicht sicher bin, woher sie kommt. Ein unbestimmtes Gefühl sagt mir, dass ich mich sträube, in verborgene Schlupfwinkel meiner Persönlichkeit einzudringen. Vielleicht hat dieser Teil von mir gezittert. Auch das Intime des Dialogs zwischen Analytiker und Patient ist ziemlich beängstigend. Ehrlich gesagt hört es sich schrecklich an, alles auszusprechen, was einem durch den Kopf geht. Mein imaginärer Analytiker ist ein Mann. Ich wähle einen Mann, weil er eine väterliche Gestalt wäre, ein Echo meines Vaters, der das irgendwie hinter meinem Zittern stehende Gespenst ist.
Nachdem er sich meine Geschichte angehört hätte, würde mein Analytiker bestimmt etwas über den Tod meines Vaters und mein Verhältnis zu ihm herausfinden wollen. Meine Mutter würde ebenfalls ins Spiel kommen und zweifellos auch mein Mann, meine Tochter, meine Schwestern und alle Menschen, die wichtig für mich sind. Wir würden sprechen und hoffen, über den Austausch zwischen uns beiden zu entdecken, warum mich eine Rede, die ich vor einer Fichte hielt, in ein schlotterndes Wrack verwandelte. Natürlich müsste berücksichtigt werden, dass Reden nicht mein Problem ist. Selbst als mich diese Sache gepackt hatte, sprach ich flüssig. Das Pathologische lag bei mir anderswo, unter oder neben der Sprache, je nach der räumlichen Metapher. Das psychoanalytische Wort für meine Schwierigkeit könnte Verdrängung sein. Ich hatte etwas verdrängt, was dann als hysterisches Symptom aus meinem Unbewussten hervorgebrochen war. In der Tat wäre mein Dilemma für einen Freudianer ein klassischer Fall. Ich würde meinem Phantom-Analytiker natürlich erzählen, dass ich einen Neurologen aufgesucht hatte und keine Epileptikerin war, und von dem Moment an würde er sich um mein Gehirn keine großen Sorgen mehr machen. Obwohl Freud von Neuronen fasziniert war, würde mein Analytiker sie vergessen und mir stattdessen helfen, tief in meine Geschichte einzudringen, und miteinander würden wir eine Art finden, sie neu zu erzählen, um mich von meinen Symptomen zu heilen. Auf dem Weg dorthin würde ich mich in meinen Analytiker verlieben. Ich würde eine Übertragung durchleben. Über diese Liebe, die sich auch in Hass, Gleichgültigkeit oder Angst verwandeln könnte, würde ich die Gefühle, die ich für meinen Vater, meine Mutter oder meine Schwestern empfand oder empfinde, auf ihn übertragen, und er würde mit einer von seiner eigenen persönlichen Geschichte geprägten Gegenübertragung reagieren. Ideen und Emotionen hätten uns im Griff. Am Ende – es ist ein Ende vorgesehen – hätten wir eine Geschichte zu meinen Pseudoschüttelkrämpfen, und ich wäre geheilt. Das zumindest ist die ideale Erzählung einer Analyse, die eine eigentümliche Form des Geschichtenerzählens ist. Freud verweist in Studien über Hysterie selbst auf das Sonderbare an dem Unternehmen: