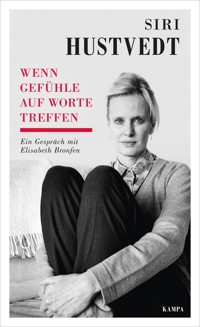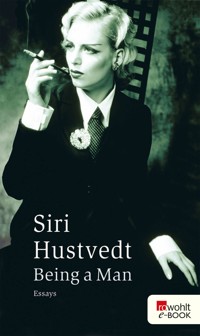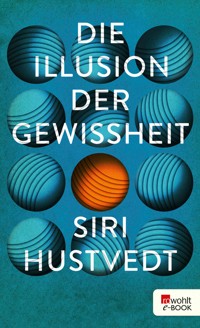9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Romantisch, gefühlvoll und zugleich verstörend unheimlich" (Salman Rushdie) Zwei befreundete Künstlerfamilien im New Yorker Stadtteil SoHo, zwischen 1975 und der Jahrtausendwende: Siri Hustvedt erzählt vom Aufbrechen und Ankommen, von Idealen und Lebensentwürfen, von Eltern und Kindern – und davon, wie ein tragischer Unfall ein sorgsam geplantes Glück jäh zerstört. "Was ich liebte" ist ein Buch über das Erwachen aus der selbst verschuldeten Naivität und über das Ende der Träume einer Generation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Siri Hustvedt
Was ich liebte
Roman
Über dieses Buch
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sechs Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Der Sommer ohne Männer» und «Die gleißende Welt». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Leben, Denken, Schauen», «Nicht hier, nicht dort», «Being a Man» und «Die Illusion der Gewissheit» vor.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel «What I Loved» bei Henry Holt and Company, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg bei Reinbek, April 2019
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg bei Reinbek
«What I Loved» Copyright © 2003 by Siri Hustvedt
Umschlaggestaltung any.way, Hamburg
Umschlagabbildung the inge morath foundation/Magnum Photos/Agentur Focus
ISBN 978-3-644-00269-2
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Paul Auster
Eins
Gestern fand ich Violets Briefe an Bill. Sie fielen zwischen den Seiten eines seiner Bücher heraus und flatterten zu Boden. Ich wusste seit Jahren von diesen Briefen, doch weder Bill noch Violet hatten mir je erzählt, was darin stand. Sie hatten mir nur erzählt, Bill habe, unmittelbar nachdem er den fünften und letzten gelesen hatte, sich seine Ehe mit Lucille noch einmal durch den Kopf gehen lassen, die Haustür in der Greene Street hinter sich zugeschlagen und sei schnurstracks zu Violets Wohnung im East Village gegangen. Als ich die Briefe in der Hand hielt, spürte ich das nachhaltige Gewicht jener Dinge, die verzaubert sind, weil man immer wieder Geschichten darüber gehört hat. Meine Augen sind schlecht geworden, und ich brauchte eine ganze Weile, um die Briefe zu lesen, doch es gelang mir, jedes Wort zu entziffern. Als ich sie aus der Hand legte, wusste ich, dass ich heute anfangen würde, dieses Buch zu schreiben.
«Während ich im Atelier auf dem Fußboden lag», schrieb Violet im vierten Brief, «habe ich dich beobachtet, wie du mich maltest. Ich betrachtete deine Arme, deine Schultern und vor allem deine Hände, die die Leinwand bearbeiteten. Ich wollte, du hättest dich umgedreht, wärst zu mir gekommen und hättest meine Haut so gerieben, wie du das Gemälde riebst. Ich wollte, du hättest deinen Daumen so fest gegen mich gepresst wie gegen das Bild, und ich dachte, ich würde verrückt, wenn du es nicht tätest, aber ich wurde nicht verrückt, und du hast mich nicht berührt, kein einziges Mal. Du hast mir nicht einmal die Hand gegeben.»
Das Gemälde, von dem Violet sprach, sah ich zum ersten Mal vor ungefähr fünfundzwanzig Jahren in einer Galerie in der Prince Street in SoHo. Damals kannte ich weder Bill noch Violet. Die meisten Bilder der Gruppenausstellung waren blutleere minimalistische Arbeiten, die mich nicht interessierten. Bills Gemälde hing allein an einer Wand. Ein großes Format, eins achtzig mal zwei fünfzig. Mit einer auf dem Boden eines leeren Raumes liegenden jungen Frau. Sie stützte sich auf einen Ellbogen und schien etwas außerhalb des Bildes zu betrachten. Von dort strömte helles Licht in den Raum und beleuchtete ihr Gesicht und ihre Brust. Ihre rechte Hand lag auf dem Schambein, und als ich näher trat, sah ich, dass sie ein kleines Taxi in der Hand hielt – eine Miniaturausgabe des allgegenwärtigen Yellow Cab, das die Straßen von New York hinauf- und hinunterfährt.
Es dauerte eine Weile, bis mir bewusst wurde, dass sich in Wirklichkeit drei Personen auf dem Bild befanden. Ganz weit rechts, wo die Leinwand dunkel war, bemerkte ich eine aus dem Gemälde heraustretende Frau. Innerhalb des Rahmens waren nur ihr Fuß und ihr Knöchel zu sehen, doch der Slipper, den sie trug, war mit ungeheurer Sorgfalt wiedergegeben, und als ich ihn erst entdeckt hatte, musste ich immer wieder hinsehen. Die unsichtbare Frau wurde genauso wichtig wie die, die das Bild beherrschte. Die dritte Person war nur ein Schatten. Einen Augenblick hielt ich diesen Schatten für meinen eigenen, doch dann begriff ich, dass der Künstler ihn hineingemalt hatte. Die schöne Frau, die nur ein Männer-T-Shirt trug, wurde von jemandem außerhalb des Bildes angesehen, einem Betrachter, der genau dort zu stehen schien, wo ich stand, als ich das Dunkel bemerkte, das über ihren Bauch und ihre Schenkel fiel.
Rechts von dem Gemälde las ich auf dem kleinen getippten Pappschild: Selbstporträt von William Wechsler. Zuerst dachte ich, das sei ein Scherz des Künstlers, doch dann besann ich mich anders. War der Titel, im Zusammenhang mit einem Männernamen, ein Hinweis auf etwas Weibliches in ihm oder auf eine Dreigespaltenheit? Vielleicht hatte die versteckte Erzählung von zwei Frauen und einem Betrachter unmittelbar mit dem Künstler zu tun, oder der Titel bezog sich gar nicht auf den Inhalt des Bildes, sondern auf seine Form. In einigen Teilen des Gemäldes versteckte sich die malende Hand, in anderen machte sie auf sich aufmerksam. Sie verschwand in der fotografisch genauen Illusion des Gesichts der Frau, in dem Licht, das durch das unsichtbare Fenster hereinströmte, und im Hyperrealismus des Schuhs. Das lange Haar der Frau jedoch war ein Gewirr pastoser Farben mit kraftvollen Tupfern Rot, Grün und Blau. Um den Schuh und den Knöchel fielen mir dicke Streifen Schwarz, Grau und Weiß auf, die wohl mit einem Spachtel aufgetragen waren, und in diesen dichten Pigmentstrichen sah ich Spuren, die der Daumen eines Menschen hinterlassen hatte. Anscheinend war sein Gestus jäh, ja ungestüm gewesen.
Dieses Bild hängt nun hier bei mir, in diesem Zimmer. Wenn ich den Kopf drehe, sehe ich es, obwohl es sich durch mein schwächer werdendes Sehvermögen verändert hat. Etwa eine Woche nachdem ich es erblickt hatte, kaufte ich es für zweitausendfünfhundert Dollar. Erica stand nur wenige Schritte von dort entfernt, wo ich jetzt sitze, als sie sich das Gemälde zum ersten Mal ansah. Sie studierte es in aller Ruhe und sagte: «Es ist, als betrachtete man den Traum eines anderen, findest du nicht?»
Als ich mich dem Bild zuwandte, bemerkte ich, dass seine Stilmischung und sein veränderliches Zentrum tatsächlich an die Verzerrungen in Träumen erinnerten. Der Mund der Frau war leicht geöffnet, und ihre Schneidezähne standen etwas vor. Der Künstler hatte sie strahlend weiß und ein bisschen zu lang gemalt, fast wie die eines Tieres. Dann bemerkte ich die Prellung direkt unter ihrem Knie. Ich hatte sie schon vorher gesehen, doch in jenem Augenblick wurden meine Augen von ihrer violetten, am Rand gelbgrünen Färbung angezogen, so als wäre diese kleine Blessur das eigentliche Thema des Gemäldes. Ich ging hin, legte meinen Finger auf die Leinwand und zog den Umriss des blauen Flecks nach. Die Geste erregte mich. Ich drehte mich um und sah Erica an. Es war ein warmer Septembertag, sie hatte bloße Arme. Ich beugte mich über sie und küsste die Sommersprossen auf ihren Schultern, dann hob ich ihr Haar an und küsste die zarte Haut auf ihrem Hals. Ich kniete mich vor sie, schob ihren Rock hoch, fuhr mit den Fingern und dann mit der Zunge über ihre Schenkel. Ihre Knie gaben etwas nach. Sie zog ihren Slip aus, warf ihn lächelnd aufs Sofa und drückte mich sanft nach hinten auf den Boden. Sie setzte sich rittlings auf mich, und als sie mich küsste, fiel ihr Haar über mein Gesicht. Dann lehnte sie sich zurück und zog T-Shirt und BH aus. Ich liebte es, meine Frau in dieser Stellung zu sehen. Ich berührte ihren Busen und zeichnete mit dem Finger ein vollkommen rundes Muttermal auf ihrer linken Brust nach, ehe sie sich wieder über mich beugte. Sie küsste mich auf die Stirn, die Wangen, das Kinn und nestelte dann am Reißverschluss meiner Hose.
Zu jener Zeit lebten Erica und ich in einem Zustand fast ständiger sexueller Erregung. Nahezu alles konnte eine wilde Orgie auf dem Bett, dem Fußboden auslösen, einmal sogar auf dem Esszimmertisch. Seit der High School waren in meinem Leben Freundinnen gekommen und gegangen. Ich hatte kurze und längere Beziehungen gehabt, doch immer waren lange Pausen dazwischen gewesen – Durststrecken ohne Frauen und Sex. Erica meinte, die Entbehrung habe einen besseren Liebhaber aus mir gemacht, ich hielte den Körper einer Frau nicht für selbstverständlich. An jenem Nachmittag liebten wir uns jedenfalls wegen des Bildes. Ich habe seither oft darüber nachgedacht, warum die Darstellung einer Wunde an einem Frauenkörper erotisch auf mich gewirkt haben mochte. Später sagte Erica, sie glaube, meine Reaktion habe etwas mit dem Wunsch zu tun, auf dem Körper des anderen ein Mal zurückzulassen. «Haut ist zart», sagte sie. «Sie lässt sich leicht schneiden und quetschen. Sie sieht nicht so aus, als wäre sie geschlagen worden oder so. Es ist ein gewöhnlicher kleiner blauer Fleck, doch durch die Art, wie er gemalt ist, fällt er auf. Sieht so aus, als hätte der Maler es gern getan; als hätte er dort eine kleine Verletzung anbringen wollen, die ewig bleibt.»
Erica war damals vierunddreißig. Ich war elf Jahre älter, und wir hatten ein Jahr zuvor geheiratet. Wir waren in der Butler Library der Columbia University buchstäblich übereinander gestolpert. Es war an einem späten Samstagvormittag im Oktober, und die Gänge zwischen den Bücherregalen waren größtenteils leer. Ich hatte ihre Schritte gehört, hatte ihre Gegenwart hinter den verschwommenen Buchreihen gespürt, die von einem leise brummenden Timer-Licht trübe beleuchtet wurden. Ich fand das gesuchte Buch und ging zum Aufzug. Außer dem Summen hörte ich nichts. Ich bog um die Ecke und stolperte über Erica, die am Kopfende des Regals auf dem Boden saß. Es gelang mir, auf den Füßen zu bleiben, doch meine Brille fiel herunter. Sie hob sie auf, und im selben Augenblick, als ich mich bückte, um sie entgegenzunehmen, stand Erica auf und stieß mit dem Kopf gegen mein Kinn. Sie sah mich lächelnd an. «Wenn das so weitergeht, können wir zusammen in einer Slapstick-Nummer auftreten.»
Ich war über eine hübsche Frau gestolpert. Sie hatte einen großen Mund und kinnlanges, dichtes dunkles Haar. Ihr enger Rock war bei unserem Zusammenstoß hochgerutscht, und als sie ihn hinunterzog, warf ich einen flüchtigen Blick auf ihre Schenkel. Nachdem sie den Rock zurechtgezupft hatte, sah sie zu mir auf und lächelte wieder. Bei diesem zweiten Lächeln zitterte ihre Unterlippe sekundenlang, und ich hielt dieses kleine Anzeichen von Nervosität oder Verlegenheit für ein Indiz, dass sie nichts gegen eine Einladung haben würde. Ich bin mir ganz sicher, dass ich mich ohne dieses Lächeln schlicht entschuldigt hätte und gegangen wäre. Doch das flüchtige Zittern ihrer Lippe enthüllte etwas Weiches in ihrem Charakter und ließ aufblitzen, was ich für ihre sorgsam gehütete Sinnlichkeit hielt. Ich fragte sie, ob sie einen Kaffee mit mir trinken gehen würde. Aus dem Kaffee wurde ein Mittagessen, daraus ein Abendessen, und am nächsten Morgen erwachte ich im Bett meiner alten Wohnung am Riverside Drive neben Erica Stein. Sie schlief noch. Durch das Fenster fiel Licht auf ihr Gesicht und ihr Haar. Sehr behutsam legte ich ihr die Hand auf den Kopf. Ich ließ sie mehrere Minuten dort liegen, während ich Erica ansah und hoffte, sie würde bleiben.
Inzwischen hatten wir stundenlang geredet. Es stellte sich heraus, dass Erica und ich derselben Welt entstammten. Ihre Eltern waren deutsche Juden, die Berlin 1933 als Teenager verlassen hatten. Ihr Vater wurde ein bekannter Psychoanalytiker, ihre Mutter Sprecherzieherin an der Juilliard School. Sie waren beide tot. Sie starben im Abstand von wenigen Monaten im Jahr bevor ich Erica traf, im Jahr, in dem auch meine Mutter starb: 1973. Ich bin in Berlin geboren und lebte dort bis zu meinem fünften Lebensjahr. Meine Erinnerungen an die Stadt sind bruchstückhaft; einige mögen falsch sein, Bilder und Geschichten, die ich mir nach dem zusammenreimte, was meine Mutter mir über meine frühe Kindheit erzählte. Erica wurde auf der Upper West Side geboren, wo auch ich mit meinen Eltern nach drei Jahren in einer Wohnung im Londoner Stadtteil Hampstead landete. Erst Erica brachte mich dazu, die West Side und meine gemütliche Wohnung nahe der Columbia University zu verlassen. Ehe wir heirateten, sagte sie mir, sie wolle «emigrieren». Als ich sie fragte, was sie damit meine, sagte sie, es sei an der Zeit, die Wohnung ihrer Eltern in der West 82nd Street zu verkaufen und die lange U-Bahn-Fahrt nach Downtown anzutreten. «Hier oben rieche ich den Tod», sagte sie, «Antiseptisches, Krankenhäuser und altbackene Sachertorte. Ich muss hier weg.» Erica und ich verließen das vertraute Terrain unserer Kindheit und steckten weiter südlich unter den Künstlern und Bohemiens ein neues Revier ab. Mit dem Geld, das wir von unseren Eltern geerbt hatten, kauften und bezogen wir einen Loft in der Greene Street zwischen Canal und Grand.
Das neue Viertel mit seinen leeren Straßen, niedrigen Gebäuden und jungen Mietern befreite mich von Fesseln, die ich bis dahin gar nicht als beengend empfunden hatte. Mein Vater starb 1947, im Alter von nur dreiundvierzig Jahren, doch meine Mutter lebte weiter. Ich war ihr einziges Kind, und nach dem Tod meines Vaters lebten meine Mutter und ich mit seinem Geist zusammen. Meine Mutter wurde alt und arthritisch, mein Vater jedoch blieb jung, brillant und viel versprechend – ein Arzt, der alles Mögliche hätte erreichen können. Aus diesen Möglichkeiten wurden für meine Mutter Tatsachen. Sechsundzwanzig Jahre lang lebte sie mit meines Vaters verlorener Zukunft in derselben Wohnung in der 84th Street zwischen Broadway und Riverside Drive. In meiner Anfangszeit als Hochschullehrer redete mich hin und wieder ein Student mit «Dr. Hertzberg» statt mit «Herr Professor» an, und ich musste unweigerlich an meinen Vater denken. In Soho zu leben löschte meine Vergangenheit nicht aus und führte kein Vergessen herbei, doch wenn ich um eine Ecke bog oder eine Straße überquerte, war da nichts, was mich an meine Kindheit und Jugend als Vertriebener erinnerte. Erica und ich waren die Kinder von Emigranten aus einer untergegangenen Welt. Unsere Eltern waren assimilierte Mittelschichtjuden, für die das Judentum eine Religion war, die ihre Urgroßeltern praktiziert hatten. Vor 1933 hatten sie sich als «jüdische Deutsche» betrachtet, ein Terminus, der heute in keiner Sprache mehr so richtig existiert.
Als wir uns kennen lernten, war Erica Dozentin für Englisch an der Rutgers University, und ich lehrte bereits seit zwölf Jahren im Fachbereich Kunstgeschichte der Columbia University. Ich hatte in Harvard promoviert, sie an der Columbia, was erklärte, weshalb sie an jenem Samstagmorgen mit einem Ehemaligenausweis in der Bibliothek herumlief. Ich war schon öfter verliebt gewesen, doch fast immer hatte ich irgendwann einen Punkt des Überdrusses und der Langeweile erreicht. Erica langweilte mich nie. Sie ärgerte und reizte mich manchmal, aber sie langweilte mich nie. Ericas Kommentar zu Bills Selbstbildnis war typisch für sie – einfach, direkt und scharfsinnig. Ich habe nie auf Erica herabgesehen.
Ich war viele Male an der Bowery 89 vorbeigegangen, ohne je stehen zu bleiben und mir das Haus anzusehen. Der heruntergekommene vierstöckige Klinkerbau zwischen Hester und Canal Street war nie mehr als das schlichte Quartier eines Großhandelsgeschäfts gewesen, doch als ich dorthin kam, um William Wechsler zu besuchen, waren jene Tage bescheidener Achtbarkeit längst vorbei. Die Fenster der einstigen Ladenfassade waren mit Brettern zugenagelt, und die schwere Eisentür war so zerkratzt und verbeult, als hätte jemand sie mit einem Hammer bearbeitet. Ein bärtiger Mann mit irgendetwas Alkoholischem in einer Tüte lag auf der einzigen Treppenstufe herum. Er grunzte mich an, als ich ihn bat, beiseite zu rücken, und entfernte sich dann halb rollend, halb rutschend von der Treppe.
Mein erster Eindruck von Menschen wird oft von dem überlagert, was ich später erfahre, doch bei Bill ist mir während unserer ganzen Freundschaft zumindest eine Erinnerung an diese ersten Sekunden geblieben. Bill hatte Ausstrahlung – jene geheimnisvolle Anziehungskraft, die Fremde verführt. Als er mir die Tür öffnete, sah er fast genauso verlottert aus wie der Mann auf der Treppe. Er hatte einen Zweitagebart. Das dichte schwarze Haar auf seinem Kopf stand oben und seitlich wild ab, und seine Kleidung starrte vor Schmutz und Farbflecken. Doch als er mich ansah, fühlte ich mich zu ihm hingezogen. Sein Teint war für einen Weißen sehr dunkel, und seine schräg stehenden, klaren grünen Augen hatten etwas Asiatisches. Er hatte einen eckigen Kiefer und ein kantiges Kinn, breite Schultern und kräftige Arme. Mit seinen eins fünfundachtzig schien er mich weit zu überragen, obwohl ich selbst nur ein paar Zentimeter kleiner bin. Später entschied ich, dass seine fast magische Anziehungskraft etwas mit seinen Augen zu tun haben musste. Als er mich ansah, tat er es direkt und unbefangen, und doch spürte ich zugleich seine Verinnerlichung, seine Abgelenktheit. Obwohl seine Neugier auf mich ungespielt wirkte, spürte ich auch, dass er nichts von mir wollte. Bill verströmte etwas so vollständig Autonomes, dass er unwiderstehlich war.
«Ich habe es wegen des Lichts gemietet», sagte er, als wir das Atelier im dritten Stock betraten. Durch drei lange Fenster am hinteren Ende des einzigen Raumes schien die Nachmittagssonne. Das Gebäude war abgesackt, der hintere Teil des Lofts lag erheblich niedriger als der vordere. Der Fußboden hatte sich ebenfalls verzogen, und als ich zu den Fenstern hinübersah, bemerkte ich Verwerfungen in den Dielen wie flache Wellen auf einem See. Die höher gelegene Seite des Lofts war karg möbliert mit einem Hocker, einem Tisch aus zwei Sägeböcken mit einer alten Tür darauf und einer Stereoanlage, umgeben von Hunderten von Schallplatten und Tonbändern in Plastikmilchkästen. Reihen von Leinwänden standen an die Wand gelehnt. Der Raum roch stark nach Farbe, Terpentin und Moder.
Alles Lebensnotwendige war auf der tiefer gelegenen Seite zusammengedrängt. Ein über eine alte Badewanne mit Löwenfüßen gebauter Tisch. Daneben ein Doppelbett, nicht weit von einem Waschbecken, und der Herd ragte aus einer Lücke eines mit Büchern voll gestopften Regals. Auch daneben auf dem Fußboden stapelten sich Bücher, und Dutzende mehr auf einem Sessel, der so aussah, als hätte seit Jahren niemand darin gesessen. Das Durcheinander in der Wohnecke des Lofts offenbarte nicht nur Bills Armut, sondern auch sein Desinteresse an Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Mit der Zeit sollte er wohlhabender werden, doch seine Gleichgültigkeit gegenüber solchen Dingen änderte sich nie. Er blieb seltsam unverbunden mit den Wohnungen, in denen er lebte, und blind für die Details ihrer Einrichtung.
Schon an jenem ersten Tag spürte ich Bills Askese, seinen fast brutalen Wunsch nach Reinheit und seine Kompromisslosigkeit. Das Gefühl rührte sowohl von dem her, was er sagte, als auch von seiner physischen Präsenz. Er war ruhig, sprach leise, war etwas verhalten in seinen Bewegungen, und dennoch entströmte ihm eine raumgreifende Intensität. Anders als andere große Persönlichkeiten war Bill nicht laut, arrogant oder ungewöhnlich charmant. Dennoch fühlte ich mich, als ich neben ihm stand und mir die Bilder ansah, wie ein Zwerg, der gerade einem Riesen vorgestellt worden ist. Dieses Gefühl machte meine Kommentare scharfsinniger und gedankenreicher. Ich kämpfte um Raum.
Er zeigte mir an jenem Nachmittag sechs Bilder. Drei waren fertig. Die drei anderen hatte er gerade angefangen – skizzenhafte Linien und große Farbfelder. Mein Gemälde gehörte auch zu dieser Serie, lauter Porträts der dunkelhaarigen Frau; doch von einer Arbeit zur anderen änderte sich ihr Leibesumfang. Auf der ersten Leinwand war sie dick, ein Berg blassen Fleisches in engen Nylonshorts und einem T-Shirt – ein Bild von so gewaltiger Verfressenheit und Selbstaufgabe, dass ihr Körper wie in den Rahmen gequetscht schien. Mit ihrer fetten Faust umklammerte sie eine Babyrassel. Der längliche Schatten eines Mannes fiel über ihre rechte Brust und ihren riesigen Bauch und schrumpfte auf ihren Hüften zu einer bloßen Linie. Auf der zweiten war die Frau viel dünner. Sie lag in Unterwäsche auf einer Matratze und sah mit einem Ausdruck, der zugleich selbstverliebt und selbstkritisch schien, an sich hinunter. In der Hand hielt sie einen Füllfederhalter, der ungefähr doppelt so groß war wie ein normaler Füller. Auf dem dritten Bild hatte die Frau ein paar Pfunde mehr, war aber nicht so füllig wie die Person auf dem Gemälde, das ich gekauft hatte. Sie trug ein zerschlissenes Flanellnachthemd und saß mit lässig gespreizten Oberschenkeln auf der Bettkante. Ein Paar rote Kniestrümpfe lagen zu ihren Füßen. Als ich mir ihre Beine ansah, bemerkte ich direkt unter den Knien eine schwache rote Linie vom Gummiband der Strümpfe.
«Das erinnert mich an Jan Steens Gemälde der Frau bei der Morgentoilette, die ihren Strumpf auszieht», sagte ich. «Das kleine Bild, das im Rijksmuseum hängt.»
Bill lächelte mich zum ersten Mal an. «Ich habe das Bild mit dreiundzwanzig in Amsterdam gesehen, und es brachte mich dazu, über Haut nachzudenken. Ich interessiere mich eigentlich nicht für Akte. Sie sind zu gewollt, aber für Haut interessiere ich mich wirklich.»
Wir sprachen eine Weile über Haut in der Malerei. Ich erwähnte die schönen roten Wundmale auf der Hand von Zurbaráns heiligem Franziskus. Bill sprach über die Hautfarbe von Grünewalds totem Christus und die rosa Haut von Bouchers Nackten, die er als «Softpornodämchen» bezeichnete. Wir diskutierten die wechselnden Konventionen in der Darstellung von Kreuzigungen, Pietàs und Grablegungen. Ich sagte, Pontormos Manierismus habe mich immer interessiert, und Bill erwähnte Robert Crumb. «Mir gefällt seine Grobheit», sagte er. «Die mutige Hässlichkeit seines Werkes.» Ich fragte ihn nach George Grosz, und Bill nickte.
«Ein Verwandter. Die beiden sind ganz bestimmt künstlerisch verwandt. Haben Sie mal Crumbs Serie ‹Tales from the Land of Genitalia› gesehen? Penisse, die in Stiefeln herumlaufen?»
«Wie in ‹Die Nase› von Gogol», sagte ich.
Dann zeigte Bill mir medizinische Zeichnungen, ein Gebiet, über das ich wenig wusste. Er zog aus seinen Regalen Dutzende Bücher mit Illustrationen aus verschiedenen Perioden – mittelalterliche Schaubilder von Körpersäften, anatomische Bilder aus dem 18. Jahrhundert, ein Bild aus dem 19. Jahrhundert vom Kopf eines Mannes mit phrenologischen Beulen und eines von weiblichen Genitalien aus derselben Zeit. Es war eine kuriose Zeichnung der Sicht zwischen die gespreizten Oberschenkel einer Frau. Wir standen nebeneinander und starrten auf die akribische Wiedergabe von Vulva, Klitoris, Schamlippen und dem kleinen schwarzen Loch der Vaginaöffnung. Die Linien waren hart und peinlich genau.
«Sieht aus wie das Schaubild einer Maschine», sagte ich.
«Ja», sagte er. «So habe ich es noch nie betrachtet.» Er blickte auf das Bild. «Es ist ein gemeines Bild. Alles ist am richtigen Platz, aber es ist eine garstige Karikatur. Der Künstler hielt es natürlich für Wissenschaft.»
«Ich glaube, nichts ist jemals einfach nur Wissenschaft», sagte ich.
Er nickte. «Das ist das Problem mit dem Sehen von Dingen. Nichts ist klar. Gefühle, Ideen formen das, was man vor sich hat. Cézanne wollte die Welt nackt, aber die Welt ist nie nackt. Ich möchte in meinen Arbeiten Zweifel wecken.» Er hielt inne und lächelte mich an. «Deren sind wir uns nämlich sicher.»
«Haben Sie Ihre Frauengestalt deshalb mal dick, mal dünn oder mittel gemalt?», sagte ich.
«Ehrlich gesagt, war es eher ein Bedürfnis als etwas Reflektiertes.»
«Und die Stilmischung?», sagte ich.
Bill ging zum Fenster und zündete sich eine Zigarette an. Er inhalierte und ließ die Asche auf den Boden fallen. Er musterte mich. Seine großen Augen waren so durchdringend, dass ich wegschauen wollte, doch ich tat es nicht. «Ich bin einunddreißig Jahre alt, und Sie sind der erste Mensch, meine Mutter nicht mitgezählt, der eines meiner Bilder gekauft hat. Ich arbeite seit zehn Jahren. Kunsthändler haben meine Arbeiten hundertmal abgelehnt.»
«De Kooning hatte auch erst mit vierzig seine erste Einzelausstellung», sagte ich.
«Sie missverstehen mich», sagte er langsam. «Ich verlange nicht, dass sich irgendwer dafür interessiert. Warum auch? Ich frage mich, warum Sie sich dafür interessieren.»
Ich erklärte es ihm. Wir setzten uns auf den Boden, die Bilder standen vor uns, und ich sagte, mir gefalle seine Zweideutigkeit, mir gefalle, nicht zu wissen, wohin ich auf seinen Gemälden schauen solle, und vieles in der modernen figurativen Malerei langweile mich, seine Bilder jedoch nicht. Wir sprachen über de Kooning, vor allem über ein kleines Werk, das Bill anregend fand, «Selbstporträt mit imaginärem Bruder». Wir sprachen über das Befremdliche bei Hopper und über Duchamp. Bill nannte ihn «das Messer, das die Kunst in Stücke schnitt». Ich dachte, er meine das abfällig, doch er fügte hinzu: «Er war ein großer Schwindler. Ich verehre ihn.»
Als ich auf die zarten Stoppeln vom Rasieren hinwies, die er auf die Beine der dünnen Frau gemalt hatte, sagte er, seine Augen würden, wenn er mit einem anderen Menschen zu tun habe, oft von einem Detail angezogen – einem abgebrochenen Zahn, einem Pflaster auf einem Finger, einer Vene, einer Schnittwunde, einem Ausschlag, einem Muttermal –, und dieses einzelne Merkmal beherrsche dann einen Augenblick sein ganzes Sehen. Diese Sekunden wolle er in seinem Werk wiedergeben. «Sehen ist fließend», sagte er. Ich sprach ihn auf die verborgenen Erzählungen in seiner Arbeit an, und er sagte, für ihn seien Geschichten wie durch einen Körper fließendes Blut – Pfade eines Lebens. Das war eine aufschlussreiche Metapher, und ich vergaß sie nie. Als Künstler war Bill hinter dem Nichtsichtbaren im Sichtbaren her. Das Paradoxe daran war, dass er sich entschieden hatte, diese unsichtbare Bewegung in gegenständlicher Malerei darzustellen, die nichts ist als gefrorener Schein – eine Oberfläche.
Bill erzählte mir, er sei in der Vorstadt aufgewachsen, in New Jersey, wo sein Vater mit großem Erfolg einen Handel mit Pappkartons aufgebaut habe. Seine Mutter leistete ehrenamtliche Arbeit bei jüdischen Wohlfahrtsvereinen, war Betreuerin für die jüngsten Pfadfinder und hatte am Ende eine Konzession als Immobilienmaklerin bekommen. Seine Eltern hatten nicht studiert, und es gab wenig Bücher im Haus. Ich stellte mir den grünen Rasen und die ruhigen Häuser von South Orange vor – Fahrräder in Einfahrten, die Straßenschilder, die Doppelgaragen. «Ich konnte gut zeichnen», sagte er, «aber Baseball war mir lange wichtiger als Kunst.»
Ich erzählte ihm, dass ich im Sport an der Fieldston School gelitten hatte. Dünn und kurzsichtig, wie ich war, hatte ich im Außenfeld gestanden und gehofft, niemand würde mir den Ball zuschlagen. «Jede Sportart, zu der man ein Gerät brauchte, war für mich tabu. Ich konnte laufen und schwimmen, aber sobald man mir etwas in die Hand gab, ließ ich es fallen.»
Während der Zeit an der High School begann Bill ins Metropolitan Museum, ins Museum of Modern Art, in die Frick Collection und in Galerien zu pilgern und, wie er sich ausdrückte, «auf der Straße herumzulungern». «Ich liebte Straßen genauso wie Museen und lief stundenlang in der Stadt herum und atmete den Müllgeruch ein.» Als er in der dritten Klasse der High School war, ließen sich seine Eltern scheiden. Im selben Jahr verließ er das Jogging-, das Basketball- und das Baseballteam. «Ich hörte mit dem Muskeltraining auf», sagte er. «Ich wurde dünn.» Bill studierte in Yale, belegte Malerei, Kunstgeschichte und Literatur. Dort lernte er Lucille Alcott kennen, deren Vater Jura-Professor war. «Wir haben vor drei Jahren geheiratet», sagte er. Ich merkte, dass ich mich nach Spuren einer weiblichen Gegenwart umsah, doch ich entdeckte keine. «Arbeitet sie?», fragte ich.
«Sie ist Dichterin. Sie hat ein paar Straßen weiter ein kleines Zimmer gemietet. Dort schreibt sie. Sie arbeitet auch als freie Lektorin. Sie redigiert. Ich mache Maler- und Verputzarbeiten für Baufirmen. Wir kommen zurecht.»
Ein mitfühlender Arzt bewahrte Bill vor Vietnam. In seiner Kindheit und Jugend hatte er schwere Allergien gehabt. Sein Gesicht schwoll an, und er musste so stark niesen, dass er Nackenschmerzen bekam. Ehe er sich beim Musterungsausschuss in Newark meldete, fügte der Arzt zu dem Wort «Allergien» die Worte «mit einer Neigung zu Asthma» hinzu. Einige Jahre später hätte eine bloße Neigung Bill wohl nicht mehr untauglich gemacht, doch das war 1966, und die geballte Wucht des Widerstands gegen den Vietnamkrieg lag noch in der Zukunft. Nach dem Studium arbeitete er ein Jahr als Barkeeper in New Jersey. Er wohnte bei seiner Mutter, sparte seinen ganzen Lohn und reiste für zwei Jahre nach Europa. Er verbrachte sie in Rom, Amsterdam und Paris. Um sich über Wasser zu halten, nahm er alle möglichen Jobs an. Er arbeitete am Empfang der Redaktion einer englischen Zeitschrift in Amsterdam, als Führer in den römischen Katakomben und in Paris bei einem alten Mann als Vorleser englischer Romane. «Beim Vorlesen musste ich auf dem Sofa liegen. Das war ihm sehr wichtig. Ich musste die Schuhe ausziehen. Er wollte unbedingt meine Socken genau sehen können. Ich verdiente gutes Geld, deshalb spielte ich eine Woche lang mit. Dann kündigte ich. Ich nahm meine dreihundert Francs und ging. Mehr als dieses Geld besaß ich nicht. Ich kam unten auf der Straße an. Es war gegen elf Uhr abends, und da stand so ein abgezehrter Alter mit ausgestreckter Hand auf dem Bürgersteig. Ich schenkte ihm das Geld.»
«Warum?», fragte ich.
Bill wandte sich mir zu. «Ich weiß nicht. Mir war einfach danach. Es war dumm, aber ich habe es nie bereut. Danach fühlte ich mich frei. Ich habe zwei Tage lang nichts gegessen.»
«Ein Bravourakt», sagte ich.
Er sah mich an und sagte: «Eine Unabhängigkeitserklärung.»
«Wo war Lucille?»
«Sie lebte in New Haven bei ihren Eltern. Es ging ihr damals nicht so gut. Wir schrieben uns.»
Ich fragte nicht nach Lucilles Krankheit. Bei deren Erwähnung hatte er weggeschaut, und ich sah, dass sich seine Augen schmerzlich verengten.
Ich wechselte das Thema. «Warum haben Sie das Bild, das ich gekauft habe, Selbstporträt genannt?»
«Das hier sind alles Selbstporträts», sagte er. «Während der Arbeit mit Violet wurde mir klar, dass ich ein Terrain in mir selbst vermaß, das ich vorher nicht gesehen hatte, oder vielleicht ein Terrain zwischen ihr und mir. Der Titel fiel mir einfach so ein, und ich benutzte ihn. Selbstporträt klang richtig.»
«Wer ist Violet? », sagte ich.
«Violet Blom. Sie promoviert an der N.Y. U. Sie hat mir diese Zeichnung geschenkt, die ich Ihnen gezeigt habe – die aussieht wie eine Maschine.»
«Was studiert sie?»
«Geschichte. Sie schreibt über Hysterie in Frankreich um die Jahrhundertwende.» Bill zündete sich noch eine Zigarette an und blickte zur Decke. «Sie ist ein sehr kluges Mädchen – ungewöhnlich.» Er blies den Rauch nach oben, und ich beobachtete, wie sich die dünnen Ringe im Licht am Fenster mit Staubpartikeln füllten.
«Die meisten Männer würden sich, glaube ich, nicht als Frau porträtieren. Sie haben sich Violet ausgeborgt, um sich selbst zu zeigen. Wie findet sie das?»
Er lachte kurz auf und sagte dann: «Es gefällt ihr. Sie sagt, es sei subversiv, vor allem weil ich Frauen liebe und nicht Männer.»
«Und der Schatten?», sagte ich.
«Das ist meiner.»
«Schade», sagte ich. «Ich dachte, es wäre meiner.»
Bill warf mir einen Blick zu. «Es kann auch Ihrer sein.» Er packte mich am Unterarm und schüttelte ihn. Diese plötzliche Geste der Kameradschaft, ja Zuneigung, machte mich ungewöhnlich glücklich. Ich habe oft darüber nachgedacht, weil dieser kleine Austausch über Schatten den Lauf meines Lebens veränderte. Die Geste kennzeichnet den Augenblick, in dem ein Gespräch zweier Männer über dies und jenes sich unwiderruflich zu einer Freundschaft hin entwickelte.
«Sie schwebte beim Tanzen», sagte Bill eine Woche später bei einer Tasse Kaffee zu mir. «Sie schien nicht zu wissen, wie hübsch sie war. Ich bin ihr jahrelang nachgelaufen. Mal waren wir zusammen, mal getrennt. Irgendwas zog mich immer wieder zu ihr hin.» In den folgenden Wochen erwähnte Bill nie wieder Lucilles Krankheit, doch wegen der Art, wie er über seine Frau sprach, hielt ich sie für zerbrechlich, für eine Frau, die Schutz vor etwas brauchte, worüber er nicht sprechen wollte.
Als ich Lucille Alcott zum ersten Mal sah, stand sie in der Tür des Lofts in der Bowery, und sie erinnerte mich an eine Frau in einem flämischen Gemälde. Sie hatte blasse Haut, hinten zusammengebundenes hellbraunes Haar und große, fast wimpernlose blaue Augen. Erica und ich waren zum Abendessen in die Bowery eingeladen. Es regnete an jenem Novemberabend, und beim Essen hörten wir den Regen über uns aufs Dach trommeln. Jemand hatte wegen unseres Besuchs Staub, Asche und Kippen weggefegt, und jemand hatte ein großes weißes Tuch auf Bills Arbeitstisch gelegt und acht Kerzen darauf gestellt. Lucille rechnete es sich als Verdienst an, das Essen gekocht zu haben, einen geschmacklosen braunen Mischmasch unkenntlicher Gemüsesorten. Als Erica sich höflich nach dem Namen des Gerichts erkundigte, blickte Lucille auf ihren Teller und sagte in perfektem Französisch: «Flageolets aux légumes.» Sie hielt inne, blickte auf und lächelte: «Aber die Flageolets scheinen inkognito unterwegs zu sein.» Nach einem kurzen Augenblick fuhr sie fort: «Ich wünschte, ich würde beim Kochen besser aufpassen. Eigentlich gehört Petersilie dazu.» Sie inspizierte ihren Teller. «Ich habe die Petersilie weggelassen. Bill würde lieber Fleisch essen. Er hat früher massenhaft Fleisch gegessen, aber er weiß, es gibt bei mir kein Fleisch, weil ich mich davon überzeugt habe, dass es nicht gut für uns ist. Ich verstehe nicht, warum ich mit Kochrezepten so auf dem Kriegsfuß stehe. Beim Schreiben bin ich sehr pingelig. Ich quäle mich immer mit den Verben rum.»
«Ihre Verben sind toll», sagte Bill und goss Erica Wein nach.
Lucille sah ihren Mann an und lächelte etwas steif. Ich verstand das Unbehagen in ihrem Lächeln nicht, denn Bills Bemerkung war ohne Ironie gesprochen. Er hatte mir schon mehrmals gesagt, wie sehr er ihre Gedichte bewunderte, und hatte versprochen, mir Kopien davon zu geben.
Hinter Lucille sah ich das fettleibige Bildnis von Violet Blom und überlegte, ob sich Bills Gelüste nach Fleisch auf diesen gewaltigen Frauenkörper übertragen hatten, aber meine Theorie erwies sich später als falsch. Wenn wir zusammen Mittag aßen, sah ich Bill oft glücklich Corned-Beef-Sandwiches, Hamburger und Bagels mit Schinken verschlingen.
«Ich stelle mir Regeln auf», sagte Lucille über ihre Gedichte. «Nicht die üblichen metrischen Regeln, sondern eine Struktur, die ich erst aussuche und dann zergliedere. Zahlen sind nützlich dabei. Sie sind klar, unwiderlegbar. Einige Zeilen sind nummeriert.» Alles, was Lucille sagte, war von der gleichen unbeugsamen Direktheit. Sie schien keinerlei Zugeständnisse an artige Konversation oder Small Talk zu machen. Zugleich hörte ich aus nahezu jeder ihrer Bemerkungen einen humorigen Unterton heraus. Sie redete so, als beobachtete sie ihre eigenen Sätze, als sähe sie sich von weitem an und beurteilte ihren Klang und ihre Formen, schon während sie aus ihrem Mund kamen. Jedes Wort, das sie sprach, klang ehrlich, und doch war diese Ernsthaftigkeit mit Ironie gepaart. Lucille hatte Spaß daran, zwei Positionen zugleich einzunehmen. Sie war Subjekt und Objekt ihrer eigenen Aussagen.
Ich glaube nicht, dass Erica Lucilles Bemerkung über Regeln mitbekam. Sie sprach mit Bill über Romane. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bill sie hörte, doch sie kamen nun ihrerseits auf Regeln zu sprechen. Erica beugte sich zu Bill und grinste: «Du findest also auch, dass der Roman ein Sack ist, in dem alles Mögliche stecken kann?»
«Tristram Shandy, viertes Kapitel, über Horaz’ ab ovo», sagte Bill und deutete mit dem Zeigefinger zur Decke hinauf. Er zitierte, als vernähme er zu seiner Rechten eine unhörbare Stimme: «‹Horaz, ich weiß es wohl, empfiehlt diese Methode nicht so eigentlich. Doch der gute Herr spricht auch nur von einem Heldengedicht oder einem Trauerspiel (von welchem, habe ich vergessen) – überdies, wenn es nicht so wäre, bäte ich Herrn Horaz um Verzeihung –, und bei meiner vorliegenden Schrift werde ich mich so wenig an seine Regeln kehren wie an die Regeln irgendeines anderen Menschen, der jemals gelebt hat.›» Bei den letzten Worten schwoll Bills Stimme an, und Erica warf den Kopf zurück und lachte. Als sich herausstellte, dass Bill Romane in rauen Mengen verschlang, kamen sie von Henry James über Beckett auf Céline. Das war der Beginn einer Freundschaft zwischen ihnen, die mit mir wenig zu tun hatte. Als das Dessert aufgetragen wurde – ein schlaff aussehender Obstsalat –, lud Erica ihn gerade ein, an der Rutgers University vor ihren Studenten zu sprechen. Zuerst zögerte Bill, dann willigte er ein.
Erica war zu höflich, um Lucille, die neben ihr saß, links liegen zu lassen. Nachdem sie Bill gebeten hatte, in eines ihrer Seminare zu kommen, konzentrierte sie sich ganz auf Lucille. Meine Frau nickte, wenn sie Lucille zuhörte, und wenn sie redete, war ihr Gesicht eine Landkarte wechselnder Emotionen und Gedanken. Im Gegensatz dazu verriet Lucilles unbewegte Miene fast kein Gefühl. Im Lauf des Abends fanden ihre eigentümlichen Bemerkungen zu einer Art philosophischem Rhythmus und zum knappen Ton einer verquälten Logik, die mich ein wenig an meine Lektüre von Wittgensteins Tractatus erinnerten. Als Erica Lucille sagte, sie habe vom Ruf ihres Vaters gehört, erwiderte Lucille: «Ja, sein Ruf als Jura-Professor ist ausgezeichnet.» Nach einer Pause fügte sie hinzu: «Ich hätte so gern Jura studiert, aber ich konnte es nicht. Ich habe immer wieder versucht, die juristischen Bücher in der Bibliothek meines Vaters zu lesen. Da war ich elf. Ich wusste, dass ein Satz zum nächsten führt, aber wenn ich beim zweiten Satz angekommen war, hatte ich den ersten vergessen, und beim dritten vergaß ich den zweiten.»
«Du warst erst elf», sagte Erica.
«Nein, es lag nicht an meinem Alter. Ich bin immer noch vergesslich.»
«Vergessen ist wahrscheinlich ebenso ein Teil des Lebens wie Erinnern», sagte ich. «Wir leiden alle unter Amnesie.»
«Aber wenn wir vergessen haben», sagte Lucille und wandte sich mir zu, «erinnern wir uns nicht immer daran, dass wir vergessen haben; das heißt, sich daran zu erinnern, dass wir vergessen haben, ist eigentlich nicht Vergessen, oder?»
Ich lächelte sie an und sagte: «Ich freue mich darauf, deine Arbeiten zu lesen. Bill spricht mit großer Bewunderung davon.»
Bill hob sein Glas. «Auf unsere Arbeit», sagte er laut. «Auf das Schreiben und das Malen.» Er hatte sich gehen lassen, und ich merkte, dass er ein bisschen betrunken war. Bei dem Wort Malen schnappte seine Stimme über. Ich fand seine gehobene Stimmung einnehmend, doch als ich mich mit zum Toast erhobenem Glas Lucille zuwandte, lächelte sie zum zweiten Mal so angespannt und gezwungen. Es war schwer zu sagen, ob dieser Ausdruck mit ihrem Mann zusammenhing oder nur auf ihre eigene Gehemmtheit zurückzuführen war.
Ehe wir gingen, gab Lucille mir zwei schmale Zeitschriften, in denen ihre Gedichte erschienen waren. Beim Abschied war ihr Händedruck schlaff. Ich drückte ihre Hand, was ihr nichts auszumachen schien. Bill umarmte mich, und er umarmte und küsste Erica. Seine Augen glänzten vom Wein, und er roch nach Zigaretten. Im Eingang legte er den Arm um Lucilles Schulter und zog sie fest an sich. Neben ihrem Mann schien sie sehr klein und sehr befangen.
Es regnete noch immer, als wir auf die Straße traten.
Nachdem ich unseren Regenschirm aufgespannt hatte, sagte Erica: «Hast du bemerkt, dass sie diese Slipper anhatte?»
«Was meinst du damit?», sagte ich.
«Lucille trug die Schuhe oder vielmehr den Schuh von unserem Bild. Sie ist die Frau, die fortgeht.»
Ich sah Erica an und ließ ihre Feststellung auf mich wirken. «Ich glaube, ich habe gar nicht auf ihre Füße geachtet.»
«Das überrascht mich aber. Alles andere an ihr hast du dir doch ziemlich genau angeschaut.» Erica grinste und ich merkte, dass sie mich neckte. «Findest du das mit dem Schuh nicht viel sagend, Leo? Und dann war da diese andere Frau. Immer wenn ich aufblickte, sah ich sie – dieses magere Mädchen, das auf seinen Slip hinunterschaut, ein bisschen gierig und erregt. Sie wirkte so lebendig. So, als hätten sie auf dem Tisch ein Gedeck für sie auflegen sollen.»
Mit meiner freien Hand zog ich Erica an mich, hielt den Schirm über uns und küsste sie. Danach legte sie den Arm um meine Taille, und wir gingen Richtung Canal Street. «Ich bin ja mal gespannt, wie ihre Gedichte sind.»
Alle drei von Lucilles veröffentlichten Gedichten waren ähnlich – Werke von obsessiver analytischer Selbsterforschung, irgendwo zwischen lustig und traurig schwebend. Ich erinnere mich nur an zwei Zeilen, weil sie ungewöhnlich ergreifend waren und ich sie mir vorsagte: «Eine Frau sitzt am Fenster. Sie denkt / Und während sie denkt, verzweifelt sie / Sie verzweifelt, weil sie ist, wer sie ist / Und niemand anders.»
Die Ärzte versichern mir, dass ich nicht erblinden werde. Ich habe eine Krankheit namens Makuladegeneration – Wolken vor den Augen. Ich bin seit meinem achten Lebensjahr kurzsichtig. Verschwommene Wahrnehmung ist für mich also nichts Neues, aber mit Brille habe ich immer tadellos gesehen. Peripher sehe ich noch gut, doch direkt vor mir ist ständig ein ausgefranster grauer Fleck, der größer wird. Meine Bilder aus der Vergangenheit sind allerdings noch lebendig. Betroffen ist die Gegenwart, und die Menschen aus meiner Vergangenheit, mit denen ich noch zusammenkomme, haben sich in wolkenverhangene Wesen verwandelt. Anfangs beängstigte mich das, doch habe ich von Leidensgenossen und von meinen Ärzten erfahren, dass das, was ich erlebe, ganz normal ist. Laszlo Finkelman zum Beispiel, der mir mehrmals in der Woche vorliest, hat etwas an Schärfe verloren, und weder meine Erinnerung an ihn aus der Zeit, ehe meine Augen nachließen, noch mein peripheres Sehen reichen aus, für ein klares Bild zu sorgen. Ich kann sagen, wie Laszlo aussieht, weil ich mich noch an die Worte erinnere, mit denen ich ihn mir immer beschrieb: schmales, blasses Gesicht, ein hoher Busch blonden Haares, das senkrecht nach oben steht, eine dunkle Brille mit breitem Gestell vor kleinen grauen Augen. Doch wenn ich ihn heute direkt ansehe, wird sein Gesicht einfach nicht scharf, und die Worte, die ich früher benutzte, hängen in der Luft. Der Mensch, den sie beschreiben sollen, ist die verschwommene Version eines früheren Bildes, das ich mir nicht mehr vollständig ins Gedächtnis rufen kann, weil meine Augen zu müde sind, als dass sie ihn ständig von der Seite mustern könnten. Ich verlasse mich mehr und mehr auf Laszlos Stimme. In dem gleich bleibenden, ruhigen Ton, in dem er mir vorliest, habe ich neue Seiten seiner kryptischen Persönlichkeit entdeckt – Echos von Gefühlen, die ich nie auf seinem Gesicht gesehen habe.
Obwohl meine Augen entscheidend für meine Arbeit waren, ist schlechtes Sehen noch immer besser als Senilität. Ich sehe nicht mehr gut genug, um durch Galerien zu streifen oder in die Museen zurückzukehren, um mir Werke anzusehen, die ich in- und auswendig kenne. Doch habe ich einen Katalog erinnerter Gemälde im Kopf, in dem ich blättern kann und gewöhnlich das benötigte Werk finde. In den Vorlesungen habe ich den Gebrauch des Lichtzeigestocks bei Dias aufgegeben, und statt auf Einzelheiten zu zeigen, weise ich auf sie hin. Mein derzeitiges Mittel gegen Schlaflosigkeit ist die Suche nach dem geistigen Abbild eines Gemäldes und das Bemühen, es wieder so klar wie möglich zu sehen. Seit kurzem rufe ich Piero della Francesca auf. Vor über vierzig Jahren habe ich meine Dissertation über sein De prospectiva pingendi geschrieben. Indem ich mich auf die strenge Geometrie seiner Gemälde konzentriere, die ich einst so genau analysiert habe, schütze ich mich vor anderen Bildern, die aufsteigen, um mich zu quälen und wach zu halten. Ich vertreibe damit die Straßengeräusche ebenso wie den Eindringling, den ich mir auf der Feuerleiter draußen vor meinem Zimmer lauernd vorstelle. Die Methode funktioniert. Gestern Nacht begannen die Holztafeln von Urbino in meine Halbschlafträume überzugehen, und kurz darauf schwand mir das Bewusstsein.
Seit einiger Zeit muss ich gegen Ängste ankämpfen, wenn ich allein im Bett liege und einzuschlafen versuche. Mein Geist ist eher gewachsen, doch mein Körper fühlt sich kleiner an als früher, so als würde ich stetig schrumpfen. Mein phantasiertes Kleinerwerden hängt vermutlich damit zusammen, dass ich älter und verwundbarer werde. Der Lebenskreis beginnt sich zu schließen, und ich denke häufiger an meine frühe Kindheit – an das, woran ich mich aus der Mommsenstraße 11 in Berlin noch erinnere. Nicht, dass mir noch alle Teile unserer Wohnung präsent wären, doch ich kann im Geiste die zwei Treppenfluchten hinaufgehen, vorbei an der geschliffenen Flurglasscheibe, zu unserer Wohnungstür. Drinnen weiß ich dann, dass die Praxis meines Vaters links liegt und die Repräsentationszimmer geradeaus. Obwohl ich nur wenige Details der Einrichtung behalten habe, habe ich eine allgemeine Erinnerung an die Weitläufigkeit der Wohnung – die großen Räume, die hohen Decken und das wechselnde Licht. Mein Zimmer lag am Ende eines kleinen Flurs hinter dem größten Raum der Wohnung. In diesem spielte mein Vater am dritten Donnerstag jedes Monats mit drei anderen musikalischen Ärzten Cello, und ich erinnere mich daran, dass meine Mutter stets die Tür zu meinem Zimmer öffnete, damit ich sie vom Bett aus hören konnte. Ich kann noch immer in mein Zimmer gehen und aufs Fensterbrett klettern. Ich klettere, weil ich in meiner Erinnerung so klein bin wie damals. Unten kann ich den Hof bei Nacht sehen, kann die Linien der geklinkerten Wege und die Schwärze der Büsche ausmachen. Gehe ich diesen Weg, ist die Wohnung immer leer. Ich bewege mich hindurch wie ein Gespenst, und ich habe angefangen, mich zu fragen, was in unserem Gehirn eigentlich vorgeht, wenn wir an halb vergessene Orte zurückkehren. Wie sieht die Perspektive der Erinnerung aus? Revidiert der Erwachsene die Sicht des Knaben, oder ist das Eingeprägte relativ statisch – ein Rudiment von etwas einst sehr Vertrautem?
Ciceros Redner geht durch weiträumige, hell beleuchtete Zimmer, an die er sich erinnert, und legt Wörter auf Tische und Stühle, wo sie leicht wieder zu finden sind. Zweifellos habe ich der Architektur meiner ersten fünf Lebensjahre ein Vokabular zugeordnet – ein durch das Denken eines Mannes vermitteltes Vokabular, der von dem Schrecklichen weiß, das kommen sollte, nachdem der kleine Junge die Wohnung verlassen hatte. In unserem letzten Jahr in Berlin ließ meine Mutter im Vestibül Licht brennen, um mich vor dem Einschlafen zu beruhigen. Ich hatte Albträume und wachte oft von einer würgenden Angst und meinen eigenen Schreien auf. «Nervös» war das Wort, das mein Vater benutzte: «Das Kind ist nervös.» Meine Eltern sprachen nicht mit mir über die Nazis, nur über unsere Umzugsvorbereitungen, und es ist schwer zu sagen, in welchem Maße meine kindlichen Ängste mit der Angst zusammenhingen, die damals jeder Jude in Deutschland empfunden haben muss. So, wie meine Mutter es erzählte, war sie völlig unvorbereitet gewesen. Eine Partei, deren Programm absurd und verachtenswert erschien, hatte sich plötzlich und unerklärlicherweise im Lande breit gemacht. Sie und mein Vater waren Patrioten und betrachteten den Nationalsozialismus als etwas ausgesprochen Undeutsches.
Am 13. August 1935 fuhren meine Eltern und ich nach Paris ab. Von dort reisten wir nach London weiter. Für die Zugfahrt hatte meine Mutter Butterbrote eingepackt – Schwarzbrot mit Wurst. Ich erinnere mich an das Butterbrot auf meinem Schoß, weil daneben, auf einem zerknitterten rechteckigen Stück Wachspapier, ein Mohrenkopf lag, gefüllt mit Vanillecreme und mit Schokolade bestreut. Ich habe keine Erinnerung daran, wie ich ihn esse, aber ich kann mich genau an meine Freude bei dem Gedanken erinnern, dass er gleich mein sein würde. Der Mohrenkopf ist lebendig. Ich sehe ihn im Licht des Abteilfensters. Ich sehe meine nackten Knie und den Saum meiner marineblauen kurzen Hose. Das ist alles, was mir von unserem Exodus in Erinnerung geblieben ist. Rings um den Mohrenkopf ist Leere, die mit den Geschichten anderer, mit historischen Zeugnissen, Zahlen und Fakten aufgefüllt werden kann. Erst ab dem Alter von sechs Jahren habe ich so etwas wie eine kontinuierliche Erinnerung, und da lebte ich schon in Hampstead. Nur wenige Wochen nach jener Zugreise wurden die Nürnberger Gesetze verabschiedet. Juden waren keine Bürger des Reiches mehr, und die Möglichkeiten, das Land zu verlassen, verringerten sich. Meine Großmutter, mein Onkel und meine Tante und ihre Zwillinge Anna und Ruth blieben da. Wir lebten schon in New York, als mein Vater herausfand, dass seine Familie im Juni 1944 nach Auschwitz deportiert worden war. Alle wurden umgebracht. Ich habe Fotos von ihnen in meiner Schublade. Meine Großmutter mit einem eleganten Hut mit Feder neben meinem Großvater, der 1917 in Flandern fallen sollte. Ich habe das offizielle Hochzeitsporträt von Onkel David und Tante Marta und ein Bild von den Zwillingen in kurzen Wollmänteln mit einem Band im Haar. Marta hatte auf den weißen Rand des Fotos unter jedes der Mädchen den Namen geschrieben, damit sie nicht verwechselt werden konnten. Anna links, Ruth rechts. Die schwarzweißen Gestalten auf den Fotos mussten mir die Erinnerungen ersetzen, und doch hatte ich immer das Gefühl, ihre anonymen Gräber seien ein Teil von mir. Das damals Ungeschriebene ist in mein Ich eingeschrieben. Je länger ich lebe, umso überzeugter bin ich, dass ich mit «ich» eigentlich «wir» meine.
Auf Bills letztem vollendetem Porträt von Violet Blom war sie nackt und abgezehrt. Der riesige Schatten eines sie überragenden unsichtbaren Betrachters verdunkelte ihren ganzen Körper. Als ich ganz nah an die Leinwand trat, bemerkte ich, dass Teile ihres Körpers mit Härchen bedeckt waren. Bill nannte sie «Lanugo-Behaarung» und sagte, verhungernde Körper entwickelten oft zum Schutz Härchen. Er hatte stundenlang medizinische und Dokumentarfotos studiert, um sie richtig hinzubekommen. Es war eine Qual, Violets skelettartigen Körper anzusehen; ihre großen Augen brannten wie im Fieber. Bill hatte ihren abgemagerten Körper farbig gemalt, hatte sie dabei zuerst sorgfältig realistisch wiedergegeben und war dann mit kühnen, expressionistischen Strichen darüber gefahren, Blau und Grün und rote Tupfer auf den Schenkeln und am Hals. Der schwarzweiße Hintergrund ähnelte alten Fotos wie denen, die ich in meiner Schublade aufbewahre. Hinter Violet, auf dem Fußboden, standen mehrere Paar Schuhe, in Grautönen gemalte Männer-, Frauen- und Kinderschuhe. Als ich Bill fragte, ob sich dieses Porträt auf die Todeslager beziehe, bejahte er. Wir sprachen länger als eine Stunde über Adorno und seinen Satz «Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch».
Ich hatte Bernie Weeks über Jack Newman kennen gelernt, einen Kollegen an der Columbia University. Die Weeks Gallery am West Broadway ging gut, weil Bernie eine Nase für viel versprechende Künstler hatte, und er hatte Beziehungen. Er war einer von denen in New York, die angeblich «jeden kennen». «Jeden kennen» heißt aber nicht, dass man Beziehungen zu vielen Leuten hat, sondern Beziehungen zu wenigen Leuten, die als wichtig und mächtig gelten. Als ich Bernie und Bill miteinander bekannt machte, war Bernie vermutlich fünfundvierzig, doch sein Alter wurde von seinem jugendlichen Habitus übertüncht. Er trug tadellose hochmoderne Anzüge zu Turnschuhen in leuchtenden Farben. Die Freizeitschuhe gaben ihm etwas leicht Exzentrisches, das in der Kunstwelt immer gut ankommt, trugen aber auch zu dem bei, was ich im Stillen Bernies Hüpfen nannte. Er war ständig in Bewegung. Er rannte Treppen hinauf, sprang in Fahrstühle, schaukelte auf den Absätzen vor und zurück, wenn er ein Kunstwerk studierte, und wackelte bei den meisten Gesprächen mit den Knien. Indem er die Aufmerksamkeit auf seine Füße lenkte, warnte er die Welt vor seinem unermüdlichen Aktivismus und seiner Nonstopjagd auf Neues. Mit seinem Hüpfen ging atemloses Reden einher, das, obwohl manchmal abgehackt, nie dumm war. Ich drängte Bernie, sich Bills Arbeiten anzusehen, und ließ Jack auch bei Bernie anrufen. Jack war schon in Bills Atelier gewesen und ebenfalls zum Fan der von ihm so genannten «schwellenden und schrumpfenden Violets» geworden.
Ich war nicht in der Bowery, als Bernie sich Bills Werke ansehen kam, doch es endete so, wie ich gehofft hatte. Im folgenden Herbst wurden die Bilder ausgestellt: «Sie sind verrückt», sagte Bernie zu mir. «Angenehm verrückt. Ich denke, diese Dick/Dünn-Geschichte wird ein Renner. Du meine Güte, jeder ist doch heutzutage auf Diät, und dann diese Sache mit dem Selbstporträt! Die ist gut. Es ist zwar ein bisschen riskant, jetzt neue gegenständliche Arbeiten zu zeigen, aber er hat was. Und die Zitate gefallen mir. Vermeer, de Kooning und Guston nach seiner Revolution.»
Als die Ausstellung dann eröffnet wurde, war Violet Blom schon in Paris. Bevor sie abreiste, begegnete ich ihr ein einziges Mal – im Treppenhaus der Bowery 89. Ich kam. Sie ging. Ich erkannte sie, stellte mich vor, und sie machte auf den Stufen Halt. Violet war schöner als auf Bills Bildern. Sie hatte große grüne Augen mit dunklen Wimpern, die ihr rundes Gesicht beherrschten. Lockiges braunes Haar fiel ihr bis auf die Schultern, und obwohl ihr Körper unter einem langen Mantel versteckt war, kam ich zu dem Schluss, dass sie nicht dünn war, aber auch nicht mollig genannt werden konnte. Sie schüttelte mir herzlich die Hand, sagte, sie habe alles über mich gehört, und fügte hinzu: «Mir gefällt die Dicke mit dem Taxi am besten.» Dann sagte sie, es tue ihr Leid, aber sie müsse los, und rannte die Treppe hinunter. Im Hinaufsteigen hörte ich sie meinen Namen rufen. Als ich mich umdrehte, sah ich sie schon an der Tür stehen. «Sie haben doch nichts dagegen, dass ich Sie Leo nenne, oder?» Ich schüttelte den Kopf.
Sie sprang die Treppe wieder hinauf, blieb einige Stufen unter mir stehen und sagte: «Bill mag Sie wirklich.» Sie zögerte. «Ich gehe fort, wissen Sie. Ich würde gerne denken, dass Sie für ihn da sind.»
Ich nickte. Sie stieg noch ein paar Stufen hinauf, legte mir die Hand auf die Schulter und drückte sie, als wollte sie bestätigen, dass sie das wirklich ernst gemeint hatte. Dann stand sie ganz still da und blickte mich mehrere Sekunden lang unverwandt an. «Sie haben ein nettes Gesicht», sagte sie. «Vor allem die Nase. Sie haben eine schöne Nase.» Ehe ich auf dieses Kompliment antworten konnte, hatte sie sich umgedreht und lief die Treppe hinunter. Die Tür fiel hinter ihr zu.
An jenem Abend beim Zähneputzen – und an vielen Abenden danach – begutachtete ich meine Nase im Spiegel. Ich drehte den Kopf von einer Seite zur anderen und versuchte, einen Blick auf mein Profil zu erhaschen. Ich hatte mich nie länger mit meiner Nase beschäftigt, hatte sie eher gering geschätzt als bewundert, und ich kann nicht sagen, dass ich sie besonders attraktiv fand; doch nun war diese Form in der Mitte meines Gesichts für immer verändert, verwandelt durch die Worte einer schönen jungen Frau, deren Bild ich täglich an meiner Wand sah.
Bill bat mich, für die Ausstellung einen Essay zu schreiben. Ich hatte noch nie über einen lebenden Künstler geschrieben, und über Bill war noch nie geschrieben worden. Der kleine Aufsatz, den ich «Multiple Ichs» nannte, ist seither nachgedruckt und in mehrere Sprachen übersetzt worden, doch damals betrachtete ich die zwölf Seiten als Akt der Bewunderung und Freundschaft. Es gab keinen Katalog. Der Essay wurde bei der Vernissage in gehefteter Form verteilt. Ich schrieb ihn in einem Zeitraum von drei Monaten zwischen dem Korrigieren von Seminararbeiten, Ausschusssitzungen und Studentensprechstunden, indem ich einfach meine Gedanken so notierte, wie sie mir nach den Vorlesungen und in der U-Bahn einfielen. Bernie war klar, dass Bill Unterstützung durch die Kritik brauchte, wenn er zu einem Zeitpunkt, da in den meisten Galerien der Minimalismus herrschte, mit seinem Werk «ungeschoren davonkommen» wollte.
Meine These war, dass Bills Kunst sich auf die Geschichte der abendländischen Kunst bezog, deren Voraussetzungen aber auf den Kopf stellte, und zwar auf eine Weise, die sich grundsätzlich von der früherer Modernisten unterschied. Indem er jedem Gemälde den Schatten eines Betrachters einverleibte, lenkte Bill die Aufmerksamkeit auf den Raum zwischen Betrachter und Gemälde, wo die wahre Aktion jeder Malerei stattfindet – ein Bild verwirklicht sich erst in dem Augenblick, da es gesehen wird. Doch der Raum, den der Betrachter einnimmt, gehört auch dem Maler. Der Betrachter steht an der gleichen Stelle wie der Maler und schaut ein Selbstporträt an, doch was er oder sie sieht, ist nicht das Bild des Mannes, der das Gemälde unten rechts signiert hat, sondern das von jemand anderem: einer Frau. Frauen auf Gemälden anzuschauen ist eine altvertraute erotische Konvention, die im Prinzip jeden Betrachter in einen von sexueller Eroberung träumenden Mann verwandelt. Unzählige bedeutende Maler haben Bilder von Frauen gemalt, die die Phantasie anregen – Giorgione, Rubens, Vermeer, Manet –, doch soweit ich weiß, hat noch kein einziger männlicher Maler dem Betrachter jemals kundgetan, dass er selbst die Frau sei. Ebendiesen Punkt führte Erica eines Abends aus: «In Wahrheit haben wir doch alle einen Mann und eine Frau in uns», sagte sie. «Schließlich sind wir aus einer Mutter und einem Vater entstanden. Wenn ich mir das Bild einer schönen Frau mit Sexappeal anschaue, bin ich immer zugleich sie und die Person, die sie anschaut. Man muss beides sein, sonst passiert nichts.»
Erica saß im Bett und las das unlesbare Werk von Jacques Lacan, als sie diese Feststellung traf. Sie trug ein tief ausgeschnittenes, ärmelloses Baumwollnachthemd und hatte ihr Haar hinten zusammengebunden, sodass ich ihre weichen Ohrläppchen sehen konnte. «Danke, Frau Dr. Stein», sagte ich und legte die Hand auf ihren Bauch. «Ist da wirklich jemand drin?» Erica legte ihr Buch beiseite und küsste mich auf die Stirn. Sie war im dritten Monat, und es war noch unser Geheimnis. Die Erschöpfung und Übelkeit der ersten zwei Monate waren überstanden, doch Erica hatte sich verändert. An manchen Tagen strahlte sie vor Glück, an anderen schien sie kurz davor, in Tränen auszubrechen. Erica war nie ausgeglichen gewesen, doch jetzt wurden ihre Launen noch wechselhafter. Eines Morgens beim Frühstück schluchzte sie geräuschvoll über einen Artikel zum Thema Pflegekinder in New York City, in dem es um einen vierjährigen Jungen namens Joey ging, der aus einem Heim nach dem anderen geflogen war. Eines Nachts wachte sie weinend aus einem Traum auf, in dem sie ihr Neugeborenes auf einem Schiff zurückgelassen hatte; das Schiff fuhr davon, und sie stand am Pier. Einmal fand ich sie nachmittags tränenüberströmt auf dem Sofa sitzen. Als ich sie fragte, was los sei, schniefte sie und sagte: «Das Leben ist so traurig, Leo. Ich habe hier gesessen und darüber nachgedacht, wie traurig alles ist.»
Diese Veränderungen in meinem Leben, sowohl physisch wie emotional, wirkten sich auch auf meinen Essay über Bill aus. Violets Körper, der auf den Leinwänden dicker wurde und schrumpfte, ging über eine bloße Andeutung auf die Fruchtbarkeit und die Veränderungen, die sie bewirkt, hinaus. Eine der Phantasien zwischen dem Betrachter/Maler und dem weiblichen Objekt musste die Schwängerung sein. Schließlich ist Empfängnis Pluralität – zwei in einem –, das Männliche und das Weibliche. Nach der Lektüre des Textes grinste Bill. Er schüttelte den Kopf und betastete sein unrasiertes Gesicht, ehe er ein Wort sagte. Trotz meiner Kompetenz fühlte ich mich beklommen. «Das ist gut», sagte er. «Sehr gut. Natürlich ist mir die Hälfte davon nie in den Sinn gekommen.» Bill schwieg etwa eine Minute. Er zögerte, schien sprechen zu wollen, schwieg weiter. Schließlich sagte er: «Wir haben noch niemand davon erzählt, aber Lucille ist im dritten Monat. Wir haben es über ein Jahr lang probiert. Die ganze Zeit, als ich mit Violet gearbeitet habe, hofften wir, wir würden ein Kind bekommen.» Nachdem ich Bill von Ericas Schwangerschaft erzählt hatte, sagte er: «Ich wollte immer Kinder, Leo, eine Menge Kinder. Jahrelang hatte ich diesen Tagtraum, dass ich um die Welt reise und die Erde bevölkere. Es macht mir Spaß, mich mir als Vater von Hunderten, von Tausenden Kindern vorzustellen.» Ich lachte, doch ich vergaß diese Phantasie von außergewöhnlicher Potenz und Vermehrung nie. Bill träumte davon, sich über die ganze Erde zu verstreuen.
U