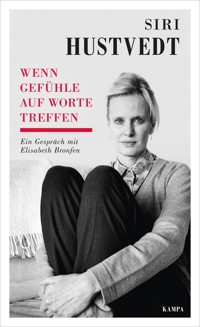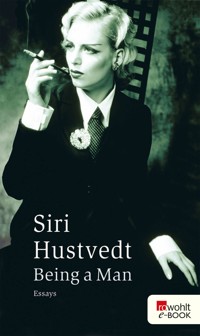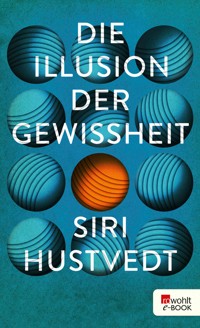9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nächtliche Blicke in ein erleuchtetes Fenster: Ein halbnackter, muskulöser Mann malt selbstvergessen und schweißgebadet an einem Ölbild. Die junge Lily Dahl, die ihn aus ihrem Fenster jenseits der Straße beobachtet, ist fasziniert. Abend für Abend schaut sie ihm zu, und eines Nachts schaltet sie ihr eigenes Licht an und zieht sich für ihn aus ... Mit großem erzählerischem Raffinement inszeniert Siri Hustvedt ein Verwirrspiel von Fiktion und Wirklichkeit, von Albtraum und Wahn, in dem die wagemutige Lily zum Opfer männlicher Fetischphantasien wird. «Die Verzauberung der Lily Dahl» ist ein erotischer Psychothriller, ein Roman über die Abgründe der menschlichen Sexualität und über die seltsame, verstörende Macht der Kunst. «Ein seltsamer Zauber liegt über diesem Buch.» «Die Zeit»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Siri Hustvedt
Die Verzauberung der Lily Dahl
Roman
Über dieses Buch
Nächtliche Blicke in ein erleuchtetes Fenster: Ein halbnackter, muskulöser Mann malt selbstvergessen und schweißgebadet an einem Ölbild. Die junge Lily Dahl, die ihn aus ihrem Fenster jenseits der Straße beobachtet, ist fasziniert. Abend für Abend schaut sie ihm zu, und eines Nachts schaltet sie ihr eigenes Licht an und zieht sich für ihn aus ...
Mit großem erzählerischem Raffinement inszeniert Siri Hustvedt ein Verwirrspiel von Fiktion und Wirklichkeit, von Albtraum und Wahn, in dem die wagemutige Lily zum Opfer männlicher Fetischphantasien wird. «Die Verzauberung der Lily Dahl» ist ein erotischer Psychothriller, ein Roman über die Abgründe der menschlichen Sexualität und über die seltsame, verstörende Macht der Kunst.
«Ein seltsamer Zauber liegt über diesem Buch.» Die Zeit
Vita
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sechs Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Der Sommer ohne Männer» und «Die gleißende Welt». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Leben, Denken, Schauen», «Nicht hier, nicht dort», «Being a Man» und «Die Illusion der Gewissheit» vor.
Impressum
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel «The Enchantment of Lily Dahl» 1996 bei Henry Holt and Company, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2023
Copyright © 1997 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg // «The Enchantment of Lily Dahl» Copyright © 1996 by Siri Hustvedt
Covergestaltung any.way, Hamburg
Coverabbildung G + J. Photonica/Keyvan Behpour
ISBN 978-3-644-00480-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Liv, Astrid und Ingrid Hustvedt
Eins
SIE beobachtete ihn seit drei Wochen. Seit Anfang Mai war sie jeden Morgen ans Fenster gegangen, um nach ihm zu schauen. Es war immer früh, kurz vor der Dämmerung, und soviel sie wußte, hatte er sie nie gesehen. Beim ersten Mal hatte Lily morgens die Augen geöffnet und einen Lichtschein entdeckt, der aus einem Fenster im Stuart Hotel gegenüber kam. Als sie näher hingegangen war, hatte sie ihn in dem leuchtenden Rechteck gesehen: einen schönen Mann vor einer großen Leinwand. Bei der Hitze nur im Slip, stand er eine Minute lang so still, daß er ihr unwirklich vorgekommen war. Aber dann hatte er angefangen, sich zu bewegen, hatte seinen ganzen Körper eingesetzt, um zu malen, und Lily hatte beobachtet, wie er sich streckte, sich bückte, nach vorn stieß und sogar vor der Leinwand niederkniete. Sie hatte beobachtet, wie er hin- und herlief, sich mit den Händen fest das Gesicht rieb und rauchte. Der Mann rauchte Zigarillos, die er sich, sobald er eine Pause machte, um nachzudenken, zwischen die Zähne klemmte. Und manchmal, wenn er einfach nur rauchte, nickte er dem Gemälde zu, als spräche er mit ihm. Lily hatte die Linien seiner Muskeln studiert, das helle Braun seiner Haut und wie sie im Licht schimmerte, aber sie hatte nicht gesehen, was er malte. Die Vorderseite der Leinwand war immer unsichtbar für siegewesen.
Die Division Street war breit und baumlos. Das Zimmer des Mannes lag mindestens zwanzig Meter von Lilys Zimmer entfernt, und sie hatte ihn noch nie von näherem gesehen. Was genau sie davon erwartete, daß sie ihn beobachtete, wußte sie nicht, aber es spielte kaum eine Rolle. In Wahrheit konnte sie sich an dem Mann nicht satt sehen, und an den Tagen, wo er nicht ins Bett ging, sondern aufblieb und bis nach Tagesanbruch arbeitete, hatte sie sich zwingen müssen, ihre Vorhänge zuzuziehen und vom Fenster wegzugehen.
An diesem Morgen regnete es jedoch stark, und Lily konnte ihn nicht richtig sehen. Sie streckte den Kopf aus dem Fenster und schaute blinzelnd in seine Richtung. Regen prasselte ihr ins Gesicht, und Wasser floß in Schlieren an seinem geschlossenen Fenster hinunter, so daß sie nur einen verschwommenen, sich hin- und herbewegenden Körper ausmachen konnte. Und dann, bevor sie begriff, was geschah, ging der Mann zu seinem Fenster, riß es auf und lehnte sich in den Regen hinaus. Lily tauchte unter das Fensterbrett und kauerte sich auf den Boden. Mit klopfendem Herzen und erhitzten Wangen lauschte sie dem Rauschen des Wassers in der Dachrinne. Sie war ein furchtbares Risiko eingegangen, als sie sich derart hinauslehnte. Vorher hatte sie immer ein bißchen mit sich geschimpft, daß sie ihn bespitzelte, aber der Gedanke, nun dabei ertappt worden zu sein, erfüllte sie mit plötzlicher, brennender Scham. Sonst war sie so vorsichtig gewesen, hatte sich, nur die Augen über dem Fensterbrett, neben ihr Fenster geduckt, hatte darauf geachtet, daß im Zimmer kein Licht brannte, und wenn sie es anmachte, um zu duschen oder sich anzuziehen, hatte sie ihre Vorhänge fest geschlossen gehalten.
Lily wußte, daß der Mann Edward Shapiro hieß. Obwohl sie noch nie ein Wort gewechselt hatten, hatte sie einige Fakten über ihn erfahren und eine Menge Klatsch über ihn gehört. Sie wußte zuverlässig, daß Edward Shapiro ein Jahr als «Gastkünstler» am Courtland College verbracht hatte. Sie wußte, daß er am Ende seines letzten Semesters, statt nach New York zurückzukehren, beschlossen hatte, in Webster zu bleiben, und daraufhin ein Zimmer im Stuart Hotel gemietet hatte. Daß seine Frau, die mit ihm auf dem Campus gewohnt hatte, irgendwann im März ihre Sachen gepackt und ihn verlassen hatte, hielt sie auch für eine Tatsache. Alles übrige war Gerede. Eine Menge Leute wollten wissen, was er in einer Absteige wie dem Stuart machte, einem so schäbigen Hotel, daß es nicht einmal Frauen aufnahm. Die fünf oder sechs alten Knacker, die dort wohnten, waren ein trauriger Haufen; Lily kannte die meisten von ihnen. Das Hotelrestaurant war geschlossen gewesen, solange sie zurückdenken konnte, obwohl man das entsprechende Schild nie entfernt hatte, und fast jeden Morgen schlurften die Männer einer nach dem anderen über die Straße, um im Ideal Café zu frühstücken, wo Lily sie sechs Tage in der Woche bediente. Sie hatte gehört, Edward Shapiro sei arm, er habe sein Einkommen am College beim Baseball verwettet, und sie hatte gehört, er sei reich, aber zu knauserig, um ein anständiges Zimmer zu mieten. Sie hatte gehört, seine Frau habe ihn verlassen, weil er spielte, und sie hatte gehört, sie habe ihn verlassen, weil, wie Lester Underberg es kaum eine Woche zuvor im Café ausgedrückt hatte, «er seinen Schwanz nicht in der Hose lassen konnte». Lester wußte «aus sicherer Quelle», daß Shapiro eine schöne rothaarige Studentin in seinem Büro «genagelt» hatte, während mit voller Lautstärke Verdi lief. Lester zufolge war Shapiro während seiner Zeit am College in seinem Büro von Dutzenden junger Opernliebhaberinnen besucht worden, aber in Wirklichkeit konnte man Lester nicht trauen. Er sammelte Schmutz über alle und jeden, und Lily hatte ihn schon mehrmals bei den faustdicksten Lügen ertappt. Mit Edward Shapiros Vorliebe für Opern hatte Lester allerdings recht. In den letzten Wochen hatte sie in manchen Nächten Musik aus seinem Zimmer kommen hören, und zweimal waren die Stimmen so laut gewesen, daß sie davon aus dem Tiefschlaf aufgewacht war. Trotzdem ging ihr die Geschichte mit der Rothaarigen nicht aus dem Kopf, und sie fügte ihr dauernd Einzelheiten hinzu, die Lester ausgelassen hatte. Sie stellte sich Shapiro und das Mädchen vor, sah es mit gespreizten Beinen, den Rock bis zur Taille hochgeschoben, auf einem Schreibtisch liegen und den Mann, bis auf den offenen Reißverschluß vollständig bekleidet, über ihr. Wieder und wieder hatte sie die Szene im Geist zu Ende gespielt, hatte Papiere durcheinandergeraten und Bücher vom Schreibtisch fallen sehen, während der Mann es mit seiner Studentin trieb. Sie hatte auch im Fenster des Mannes nach Frauen Ausschau gehalten, aber falls ihn welche besuchten, blieben sie nie über Nacht. Das schmale Eisenbett, das in der hinteren rechten Ecke seines Zimmers stand, war morgens zweiundzwanzigmal hintereinander leer gewesen,
Lily hatte Angst, sich zu rühren, aber dann spähte sie doch ganz vorsichtig über das Fensterbrett. Shapiros Fenster war dunkel, und sie spürte, daß ihre Schultern erleichtert herabsanken. Als sie die Vorhänge zuzog, hörte sie in der Wohnung nebenan Schritte. Mabel ist auf, dachte sie. Mabel Wasley schlief sehr wenig, und die Wand zwischen den zwei Räumen war nicht dick genug, um auch nur das leiseste Geräusch zu dämpfen. Tag für Tag hörte Lily die alte Frau herumgehen, mit Papier rascheln, Kommoden und Schränke öffnen und schließen, mit Geschirr klappern, husten, murmeln, die Wasserspülung bedienen, und den ganzen Nachmittag bis tief in die Nacht hörte sie Mabel tippen. Was genau sie schrieb, war Lily nie klargeworden, obwohl die Frau es ihr einmal erklärt hatte. Das ungeheuer dicke Manuskript war eine Art Autobiographie, in der es auch um Träume und ihr Einwirken auf den Alltag ging, aber immer wenn Mabel über das Buch sprach, fand sie kein Ende und gebrauchte Wörter, die Lily nicht verstand, und manchmal, wenn sie besonders aufgeregt war, wurde ihre Stimme sehr laut, bis sie fast schrie, weshalb Lily das Thema ungern ansprach. Neun Monate lang hatte Lily allein über dem Ideal Café gewohnt. Sie hatte das Zimmer ein paar Tage nach ihrem High-School-Abschluß gemietet, und als Mabel Anfang März einzog, hatte Lily sich über die Gesellschaft gefreut, obwohl sie hin und wieder den Eindruck hatte, daß Mabel etwas verbarg. Niemand wußte viel über sie, dabei hatte sie zwanzig Jahre am Courtland College gelehrt. Gerüchte besagten, sie sei mehrmals verheiratet gewesen, bevor sie nach Minnesota kam, aber Mabel hatte nie einen Ehemann erwähnt, und obwohl sie sehr nett war, war sie auch förmlich, und diese Förmlichkeit verbot jedes Aushorchen.
Lily setzte sich an den Tisch, an dem sie aß und sich schminkte und alles andere tat, wobei man sitzen muß. Darüber hatte sie ihren Spiegel gehängt, und nun sah sie darin ihr eigenes müdes Gesicht und das von Marilyn Monroe auf dem Poster, das sie hinter sich an die Wand geheftet hatte. Boomer Wee hatte einmal gesagt, sie sehe aus wie Marilyn, nur dunkelhaarig, und obwohl Lily wußte, daß es nicht stimmte, gefiel ihr die Vorstellung. Sie beugte sich zum Spiegel vor, senkte die Augenlider, Öffnete leicht die Lippen und drückte ihren Busen zusammen, so daß über ihrem weißen BH ein langer Spalt entstand. Sie sah wieder zu Marilyn hin, und dann hörte sie es klopfen.
«Es ist offen», sagte sie mit vom Schlaf heiserer Stimme.
Ohne sich umzudrehen, sah sie im Spiegel Mabel eintreten. Die alte Frau ging schnell, ihr langer Morgenmantel schleifte über den Boden. Sie blieb neben dem Stuhl stehen.
«Tut mir leid, wenn ich störe, aber ich wollte dich noch vor der Arbeit erwischen und dich fragen, wie es mit dem Theaterstück läuft, und dir sagen, daß ich dir helfen könnte, falls du immer noch Probleme mit der Rolle hast. Du weißt ja, ich hab den ‹Sommernachtstraum› fast dreißig Jahre lang gelehrt, und heute nacht ist mir eingefallen, daß ich ihn mit dir einüben könnte. Hermia ist wirklich eine wunderbare Rolle, und du bist die perfekte Besetzung. Was meinst du?» Mabel trug diese Rede schnell und kurzatmig vor und richtete sie an Lilys Spiegelbild, wobei sie ostentativ mit den Händen fuchtelte, und einmal streiften ihre Finger über Lilys Kopf. Dann ließ sie die Hände sinken und legte sie leicht auf Lilys Schultern. Eine Weile waren beide still, und Lily starrte auf ihre Gesichter im Spiegel, auf das von Marilyn zwischen ihnen und fand, daß sie drei zusammen eigentümlich aussahen. Mabels herzförmiges kleines Gesicht mit den tiefen Falten auf der Stirn und um Augen und Mund hatte einen intensiven Ausdruck, der sowohl Verachtung wie Konzentration bedeuten konnte. Marilyn lächelte ebensowenig, aber ihre Lippen waren geöffnet, damit man ihre Zähne sah, und ihre Finger drückten das Fleisch ihrer rechten Brust ein. Etwas war zu vollkommen daran, wie sie drei in dem Spiegel gerahmt waren, und das störte Lily. Es rief den ärgerlichen Eindruck einer Reglosigkeit hervor, die sie unversehens an Lebendes und Totes denken ließ, und sie zuckte mit den Schultern, um sich von Mabels Berührung zu befreien.
«Montag nach der Arbeit wäre gut. Ich brauche Hilfe. Ich kann meinen Text, aber oft weiß ich nicht, was er bedeutet.»
Die Frau ergriff ihre Hände. «Vorher trinken wir Tee.»
Mabels Freude irritierte Lily aus irgendeinem Grund, und sie sagte nichts mehr.
Mabel ging. Statt sich zu verabschieden, rezitierte sie einige Verse aus Lilys Rolle in dem Stück: «Die Nacht, die uns der Augen Dienst entzieht». Lily sah, wie Mabel einen Finger an ihr Ohr legte. «Macht, daß dem Ohr kein leiser Laut entflieht./Was dem Gesicht an Schärfe wird benommen,/Muß doppelt dem Gehör zugute kommen.»
Die Stimme der Frau klang dünn und alt, aber ihr Vortrag zeugte von einer Einfühlung und einem Verständnis, die Lily, wie sie wußte, völlig fehlten. Deshalb hat sie das gemacht, dachte sie, um mir zu zeigen, wie natürlich und gut sie ist. Hatte Mrs. Wright ihr nicht gerade das bei der Probe gesagt? «Sprich einfach mit deiner normalen Stimme», und Lily hatte gedacht: Was ist denn meine normale Stimme?
DIE frühen Gäste, die im Ideal Café eintrudelten, waren lauter Männer, lauter Stammgäste, und keiner von ihnen hatte viel zu sagen. Zwischen fünf und sechs war es im Lokal ziemlich still. Die Männer, die in dieser ersten Stunde kamen, hatten keine Frauen oder Freundinnen; jeder einzelne hätte, wenn er gewollt hätte, eine Geschichte erzählen können, von einem Unfall, Tod, Pech oder einer Marotte, die ihn zu dem gemacht hatten, was er jetzt war: ein einsamer Mensch, der bei Tagesanbruch ankam, um in einem Raum voll anderer einsamer Menschen, die allein vor ihrem Frühstück saßen, allein zu frühstücken.
Als erster kam gewöhnlich Pete Lund, nachdem er auf seiner großen Farm östlich der Stadt schon einiges erledigt hatte. Petes Frau war ein paar Jahre zuvor an Brustkrebs gestorben, und er hatte sich angewöhnt, im Lokal zu essen. Als Lily vor einem Jahr angefangen hatte zu arbeiten, hatte er seine Bestellung laut aufgegeben, und sie galt noch immer: eine Tasse schwarzen Kaffee, Rühreier und drei Scheiben helles Toastbrot mit Erdbeermarmelade, ja kein Traubengelee. Seither hatte er sich nicht mehr die Mühe gemacht zu sprechen. Als Lily an seinen Tisch kam, nickte er ihr zu, und sie schrieb die Bestellung auf. Harold Hrdlicka, der die alte Muus-Farm gekauft hatte, nahm Spiegeleier mit Bratkartoffeln, und Earl Butenhoff aus dem Stuart Hotel aß vor seinen Eiern – einmal kurz gewendet – eine Schüssel Cornflakes und genehmigte sich zum Abschluß eine dicke, gewöhnlich schon halb aufgerauchte billige Zigarre, die er in seiner Hemdtasche hatte. An diesem Morgen waren um halb sechs alle da, jeder saß in seiner Nische und wartete auf das Frühstück. Pete glotzte auf Vinces Sammlung halbwegs antiker Blechspielzeuge. Harold las den «Webster Chronicle», und Earl musterte die Tischplatte, unterbrochen von wiederholtem Räuspern, bei dem er gelben Schleim in ein riesiges schmutziges Taschentuch spuckte, das er jedesmal aus der Hosentasche zog. In der Küche konnte Lily Vince leise «Anything Goes» singen hören. Sie hörte den Regen draußen und roch Schinken und Wurst auf dem Grill, und von der Straße kam der Geruch von nassem Pflaster, Gras und von etwas, was sie für Würmer hielt, die über den Bürgersteig krochen, und während sie mit ihrer Kaffeekanne von Tisch zu Tisch ging, fühlte sie sich glücklich und summte leise mit Vince mit.
Martin Petersen kam gegen sechs ins Café, setzte sich an seinen üblichen Platz in der Nische am Fenster und begann Lily anzustarren. Jedesmal wenn er zum Frühstück kam, starrte er sie an. Sie war das gewohnt, nicht nur von Martin, sondern von vielen Leuten. Sie hatte Zahnspangen, Brüste, die nicht wachsen wollten, und einen Ruf als Wildfang überlebt, aber als sie vierzehn wurde, hatte sich das alles geändert, und jetzt, fünf Jahre später, hatte sie sich an ihr Aussehen und das damit verbundene Angestarrtwerden gewöhnt. Manchmal mochte sie es und manchmal nicht, aber sie hatte gelernt, so zu tun, als bemerke sie es nicht. Doch Martin war anders. Er musterte sie immer so ruhig und ostentativ, als wäre es sein Job, sie anzusehen, und weil sie nicht dahinterkam, was diese langen, starren Blicke zu bedeuten hatten, bereiteten sie ihr ein wenig Unbehagen. Gleichzeitig fühlte sie sich seltsam zu Martin hingezogen. Er war geheimnisvoll. Sie hatte das Gerücht gehört, er sei schwul, und das Gerücht, er sei gar nicht interessiert an Sex. Im Konfirmationsunterricht hatte ihr Linda Haugen einmal zugeflüstert, Martin sei «als beides geboren», und die Mädchenhälfte habe man entfernt. Aber das war bestimmt Unsinn. Martins Geheimnis lag nicht in seinem Körper, aber es lag auch nicht in seinem Geist. Etwas Eigenartiges ging von ihm aus – die Aura eines verborgenen Wissens oder sechsten Sinns, die Lily manchmal das Gefühl vermittelte, er sähe sie aus großer Entfernung an, obwohl sie nur Zentimeter von ihm entfernt war.
Lily konnte sich an keine Zeit erinnern, in der sie Martin Petersen nicht gekannt hatte. Das Haus, in dem er aufgewachsen war und noch immer lebte, lag nicht weit weg von Lilys eigenem Elternhaus am Stadtrand, und sie und Martin hatten manchmal im Wald oder am Bach zusammen gespielt. Damals hatte er noch schlimmer gestottert als heute. Ein paarmal hatte sie ihn zum Spielen zu sich nach Hause mitgenommen, aber Martins Haus hatte sie nie betreten. Mit seinem Vater hatte irgend etwas nicht gestimmt, und was immer es war, es hatte Lilys Mutter nervös genug gemacht, daß sie sich niemals dazu äußerte. Als Lily acht Jahre alt war, hatte Martins Vater, Rufus Petersen, seinen Hund getötet, eine hochträchtige Hündin. Er hatte sie erschossen und den Kadaver unten am Bach liegenlassen, wo Lilys Vater die arme Kreatur gefunden und samt ihren ungeborenen Welpen begraben hatte. Lily erinnerte sich an das Blut der Hündin auf dem Hemd ihres Vaters, und sie erinnerte sich daran, daß er Rufus Petersen ungewohnt heftig verflucht hatte. Danach hatte sie seltener mit Martin gespielt, aber er fuhr mit demselben Schulbus, und sie erinnerte sich, daß er wegen seines Stotterns erbarmungslos gehänselt wurde. Einmal hatten Andy Feenie und Pete Borum ihn hinter der Longfellow School verprügelt, und sie erinnerte sich, daß er heulend um den Klinkerbau herumgekommen und aus seiner Nase Blut auf sein Hemd getropft war. In der High-School hatte Martin sich meistens abgesondert, und er und Lily hatten nicht viel miteinander geredet, aber sie hatte sich ihm irgendwie verbunden gefühlt, und manchmal waren sie sich zufällig am Bach begegnet, wohin Martin seinem Zuhause entfloh, um zu lesen und allein zu sein. Inzwischen hatte sein Vater die Familie verlassen, seine junge Mutter, die nicht mehr jung aussah, hatte Leukämie, und seine beiden älteren Geschwister sorgten für sich selbst und verwilderten, wie manche sagten. Mrs. Petersen starb, als Martin in der letzten Klasse der Junior-High-School war, und es hatte irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Jugendamt gegeben. Harte Schläge, dachte Lily, einer nach dem anderen. Die Geschwister waren weggezogen, aber Martin war im Elternhaus geblieben und lebte von gelegentlichen Handwerksarbeiten. Es hieß, er mache das sehr gut. Zuverlässig und ehrlich, sagten die Leute und riefen ihn dauernd, um dies oder das zu reparieren, um etwas anzustreichen oder zu zimmern, und Lily hatte den Eindruck, daß das Leben jetzt, da er erwachsen war, besser für ihn lief,
Martin wollte immer das gleiche Frühstück – verlorene Eier auf Toast –, aber im Gegensatz zu Lilys anderen frühen Gästen gab er sich nicht mit wortkargen Gesten zufrieden. Es genügte nicht, «Das Übliche?» zu sagen und ihn nicken zu lassen. Martin wollte sich austauschen. Doch anstatt eine Bestellung zu stammeln und nervös zu werden, trommelte er mit den Fingern rhythmisch auf die Tischplatte – rat-ta-ta-tat –, und Lily antwortete ihrerseits mit zweimaligem Klopfen: tat-tat. Die Trommelei hatte angefangen, kurz nachdem Lily im Café zu arbeiten begonnen hatte, und in gewisser Weise waren sie dadurch wieder Freunde geworden. Niemand sonst war eingeweiht. Die Trommelzeichen waren ihre ganz eigenen kleinen Zeichen, und Martin schien so glücklich, sein Frühstück in einem Code zu bestellen, daß Lily ebenfalls glücklich darüber war.
Auch an diesem Morgen hielten sie sich an ihr Ritual. Martin trommelte auf den Tisch.
Lily klopfte mit dem Zeigefinger zweimal auf die Tischkante und sagte: «Kommt sofort, Spinnweb.»
Martin hatte die kleine Rolle des Spinnweb im «Sommernachtstraum» ergattert, und Lily fand es nett, darauf anzuspielen, obwohl sie sich fragte, ob Mrs. Wright es mit der Nächstenliebe nicht ein bißchen zu weit getrieben habe, indem sie eine wenn auch noch so kleine Rolle mit Martin besetzte, Lily hatte noch nie mit Martin zusammen geprobt. Bisher war nur mit den Hauptdarstellern gearbeitet worden, doch konnte man sich Martin schwer in irgendeiner Rolle vorstellen, geschweige denn als Elfen.
Als sie seine Bestellung in der Küche an Vince weitergab, beugte sich der dicke Mann über den Herd und sagte: «Wo ist die Beerdigung? Es ist so still da drin, daß man denken könnte, ich würde für einen Haufen Leichen kochen.»
Lily grinste und schüttelte den Kopf. «Das sagst du jeden Morgen, Vince. In einer Stunde wird es lauter. Das weißt du doch.»
«Das ist vielleicht ein totes Nest hier, Puppe. Das Aufregendste, was hier passieren kann, ist doch, daß einer von diesen alten Lutheranern einen Furz läßt.»
Lily lächelte Vince an. Er hatte an diesem Morgen gute Laune, und sie war dankbar dafür. «Warum gehst du dann nicht zurück nach Philadelphia, wenn es da so ideal ist», sagte sie und nahm den Teller arme Ritter für Mike Fox mit. «Muß toll sein – Leute, die sich auf der Straße abknallen, Überfälle, Taschendiebstahl. Ich lese Zeitung, Vince. Klingt paradiesisch.» Sie ging rückwärts durch die halbhohe Schwingtür.
Vince zeigte mit seinem Spatel auf sie. «Wenigstens sprechen die Leute da mit einem, bevor sie einen abknallen!»
Mit Mikes Teller in der Hand blieb Lily hinter der Theke stehen. Sie spürte, daß Martin sie beobachtete, und schaute kurz zu ihm hinüber. Sein ruhiges Gesicht war aufmerksam auf sie gerichtet. Vielleicht hat er etwas für mich, dachte sie und stellte Mikes Teller auf die Theke neben die sechs Zigaretten, die er schon vor sich auf dem Resopal aufgereiht hatte.
«Dein Frühstück ist da, wenn du fertig bist, Mike», sagte sie.
Mike blickte zu ihr auf und schob sich eine lange blonde Haarsträhne hinters Ohr, bevor er sich eine neue Zigarette zwischen die Zähne steckte. Lily beobachtete, wie er sie anzündete. Seit einem Jahr, sechs Tage in der Woche, sah sie Mike das gleiche Ritual absolvieren. Die Aufgabe erforderte ein ganzes Päckchen Kent, und wenn er fertig war, fand Lily jedesmal eine Reihe von zwanzig Zigaretten auf der Theke, eine immer eine Haarbreite kürzer geraucht als die vorherige. Sie sah Mike an und war sich sicher, daß er seine Züge zählte, aber sie wußte, daß er auch nicht zu stark ziehen durfte, weil sonst der Glimmstengel zu schnell abbrannte. Er senkte die Zigarette in den schwarzen Aschenbecher und begann sie mit einer leichten Drehung von Handgelenk und Fingern auszudrücken. Als Mike diese vollkommen abgeschrägte Reihe von Kents zum erstenmal auf der Theke zurückgelassen hatte, hatte Lily sich gescheut, sie wegzuwerfen. Aber Bert hatte gesagt: «Wenn er fertig ist, liegt ihm nichts mehr dran. Du kannst das Meisterwerk einfach in den Müll werfen. Morgen macht er ein neues.»
Lily ging in die Küche, um Martins Frühstück zu holen, und Vince redete da weiter, wo er aufgehört hatte. «Und weil in dieser Scheißstadt nicht geredet wird, gibt es auch keinen richtigen Sex. Schon mal drüber nachgedacht, Puppe? Sieh dir doch die Frauen in dem Kaff an, kaum eine mit einem Fünkchen Cha-Cha-Cha. Im Winter sind alle in diese grausigen Daunenjacken gehüllt, und im Sommer tragen sie Sackkleider. Lippenstift ist Sünde. Schmuck ist Sünde.» Das Gesicht des Mannes war gerötet. Er hatte Hängebacken, die bebten, wenn er den Kopf bewegte.
Lily schnappte sich Martins Teller. «Es gibt eine Menge Sex in dieser Stadt, Vince. Sei nicht albern.»
«Ja, aber keinen, der Spaß macht. Das ist ein großer Unterschied.»
Lily seufzte. «Ach, komm.»
«Du kennst dich eben nicht aus, Baby. Ich will dir mal was sagen.» Er streckte die Arme zur Seite und schob seine gewaltigen Hüften vor und zurück. «Sex ist Schmusen in einer schummrigen Bar mit einer Jazzband und einem Mädchen, dem man ansieht, daß es ihm Spaß macht. O Süße, die Nächte, in denen ich von Sandra Martinez träume!» seufzte er.
«Was du nicht weißt, du Großstadtpflanze», sagte Lily, «ist, daß es in einem Maisfeld genauso heiß hergehen kann wie in einem Jazzclub. Du kennst dich eben nicht aus.» Sie rollte kokett die Schulter.
Vince öffnete den Mund und tat so, als sei er schockiert. «Na aber, Lily Dahl», sagte er, «du kleiner Satansbraten.»
«Erzähl mir bloß nie, ich hätte keinen Cha-Cha-Cha», sagte Lily im Hinausgehen und hörte Vince etwas vor sich hin brummen.
Der Regen hatte aufgehört, und die Division Street sah heller aus. Als sie den Teller vor Martin abstellte, blickte er mit seinem ernsten Gesicht aus großen Augen zu ihr auf, und sie entsann sich wieder, wie hell seine Iris war, blaßblau, eine Farbe, die ihr das Gefühl gab, sie könne durch sie hindurchsehen. Im Weggehen spürte sie einen dumpfen Krampf im Unterleib. Sie hörte die Fliegendrahttür aufgehen, und als sie sich nach dem Geräusch umdrehte, sah sie die Bodler-Brüder ins Café schlurfen. Sie seufzte, aber nicht so laut, daß sie es hören konnten, und beobachtete, wie sie zu der Nische hinten gingen, direkt vor der Toilette mit dem von Vince aufgehängten Schild, auf dem ENTWEDER/ODER stand. Wenn sie bloß nicht so schmutzig wären, dachte Lily, während sie auf die Dreckspur blickte, die die Männer auf dem Fußboden hinterließen. Wenn nur ihre Stiefel schmutzig wären und nicht ihre Arme und Beine, Köpfe und Hintern und jeder Quadratzentimeter an ihnen. Sie blieb vor dem Tisch der Bodlers stehen und zog ihren Bestellblock heraus. Sie schaute von Filthy Frank zu Dirty Dick und wieder zu Filthy Frank. Die alten Ferkel waren dreckig wie immer, nur feuchter. Lily konnte Wasserspuren auf ihren Wangen sehen, wo es draufgeregnet hatte. Sie trommelte mit der Fußspitze und wartete. Frank würde bestellen. Er bestellte immer. Dick sagte nie ein Wort. Die Bodlers waren eineiige Zwillinge, die sich im Laufe vieler Jahre unterschiedlich entwickelt hatten. Niemand hatte das geringste Problem, sie auseinanderzuhalten. Dicks Körper ähnelte Franks, wiederholte ihn aber nicht. Schwächer, kahler und formloser, war Dick eine verwässerte Kopie seines Bruders.
Alles, was sie anfaßten, wurde schwarz. Lily warf einen Blick auf Franks Hände. Sie sah schon die Schmutzflecken auf dem weißen Tisch.
«Na, was darf′s sein?» sagte sie.
Keiner der beiden Männer regte sich oder zuckte auch nur mit der Wimper.
Sie beugte sich näher zu Frank und zog die Augenbrauen hoch. Er roch nach Erde.
Der Mann öffnete den Mund und entblößte lückenhafte braune Zähne. Dann kam ein gutturales Knurren: «Zweimal Rühreier, Schinken, Toast, Kaffee.»
«Kommt sofort.» Lily drehte sich um und sah über Martins Kopf hinweg auf die Straße. Das Wetter hellte sich stetig auf. Martin las jetzt. Er brachte meistens ein Buch mit und las eine Weile, bevor er ging. Soweit Lily feststellen konnte, las Martin, was immer ihm in die Finger kam. Er schien historische Bücher zu mögen, besonders über den Zweiten Weltkrieg, aber auch Romane – schlechte und anspruchsvolle –, Science-fiction und Ratgeber. Sie erinnerte sich, daß er mehrere Wochen lang «Anna Karenina» im Café gelesen hatte und gleich, als er damit fertig war, ein Buch über «Hundert Arten, auf dem Land Geld zu verdienen» angefangen hatte. Trotzdem stellte Lily sich vor, daß dieses viele Lesen sich positiv auswirken mußte. Er ist vermutlich gar nicht so dumm, dachte sie, und auf dem Weg in die Küche setzte sie sich mit der Tatsache auseinander, daß Martin einundzwanzig geworden und höchstwahrscheinlich noch Jungfrau war. Dieser Gedanke, diese Vorstellung von Unschuld bei einem jungen Mann, gefiel ihr. Zugleich tat Martin ihr leid.
Nur wenige Minuten später, als Lily den Bodlers ihr Frühstück brachte und ihnen Kaffee nachgoß, bemerkte sie die braune Einkaufstüte, die neben Frank auf der Bank stand, und fragte sich, was die Schmuddelzwillinge da wohl mit sich herumtrugen. Dann beobachtete sie, wie Frank nach seiner Tasse griff, und sah sich seinen Daumennagel an – eine dicke gelbe Schote –, und während sie den fetten, schmutzigen Nagel betrachtete, fiel ihr Helen Bodler ein.
Niemand zweifelte mehr daran, daß der alte Bodler seine Frau 1932 lebendig begraben hatte. Damals aber hatten die Leute gedacht, sie habe ihn und die Zwillinge verlassen. Bodler trank. Seine kleine Farm lief, wie viele andere, sehr schlecht, und es wurde vermutet, daß die Belastung ihn zum Wahnsinn getrieben habe. Lily erinnerte sich daran, daß ihre Großmutter ihr die Geschichte erzählt hatte, erinnerte sich, wie die Großmutter sich über das Wachstuch auf dem Küchentisch gebeugt und mit nervöser, aber fester Stimme gesagt hatte: «Helen hätte die beiden kleinen Buben nie im Stich gelassen und wäre nicht ohne ein Wort zu jemand davongelaufen. So war sie nicht. Ich kannte sie, und so eine war sie nicht. War auch eine ziemlich hübsche Frau. Die Leute meinten, sie wäre mit Ira Cohen, dem Hausierer, durchgebrannt. So ein Quatsch. Cohen hatte eine Frau und sechs Kinder in St. Paul. Wo hätte er sie denn hintun sollen? Hinten auf seinen Karren? Die ganze Sache stank von Anfang an zum Himmel.»
1950 wurde Helens Leiche gefunden. Die Zwillinge und ein anderer Mann, Jacob Hiner, gruben die alte Außentoilette auf dem Grundstück aus und stießen in der Nähe auf ihr Skelett. Da war Bodler schon seit elf Jahren tot. Seine beiden Söhne hatten in Europa gekämpft, waren heimgekehrt und hatten ihren Altwarenhandel angefangen. Lily wußte nicht genau, wann sie aufgehört hatten, sich zu waschen. Das Militär zwang zu Sauberkeit, also mußte es irgendwann nach 1945 gewesen sein, daß die Bodler-Zwillinge zu Filthy Frank und Dirty Dick geworden waren. Hätten sie geheiratet, wäre die grausige Geschichte ihrer Eltern vielleicht schneller in der Versenkung verschwunden, wäre mit Kindern und Enkeln in größere Ferne gerückt. Aber es gab keine neuen Bodlers. Was die Brüder empfunden hatten, als sie auf die in Panik erstarrten Gebeine ihrer Mutter gestoßen waren, deren Haltung davon zeugte, daß sie versucht hatte, sich aus ihrem Grab hinauszuscharren, wußten die Götter, Undurchdringlich wie Stein liefen die beiden herum, aßen und beschränkten ihr gegrunzten Äußerungen auf das Nötigste.
Als Lily aufblickte, sah sie Edward Shapiro auf der Treppe des Stuart Hotels stehen. Selbst aus dieser Entfernung konnte sie sehen, daß er zerknittert aussah, als wäre er gerade aus dem Bett gestiegen. Sie ging zum Fenster und blieb dort stehen. Sie beobachtete, wie der Mann sich am Bein kratzte, und sah zugleich aus dem Augenwinkel, daß Bert ins Café gefegt kam und die Fliegentür hinter sich zuschlagen ließ. Nachdem sie sich eine Schürze um die Taille gebunden hatte, schlenderte sie zu Lily herüber und sagte: «Na, wie läuft die Fron heute morgen?» Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ sie den Blick über die Tische schweifen, nickte den Zwillingen zu und stöhnte theatralisch.
Lily nickte und drehte den Kopf nach rechts, damit sie den Mann auf der Treppe nicht aus den Augen verlor. Bert folgte ihrem Blick, und die zwei Frauen beobachteten ihn gemeinsam.
«Ein todsicherer Grund zum Seitensprung, wenn ich je einen gesehen habe.» Bert ließ ihren Kaugummi knallen. «Es passiert nicht oft, daß ich versucht bin, den alten Rog zu betrügen, aber bei dem da …», und ohne sich die Mühe zu machen, den Satz zu beenden, schüttelte sie den Kopf. Dann drehte sie sich zu Lily um und stieß einen Pfiff aus. «Der arme Hank kann sich ja auf was gefaßt machen.»
«Ich bin nicht mit Hank verheiratet, Bert.»
«Ach nein? Ich dachte, ihr wärt verlobt.»
«Nicht wirklich», sagte Lily und streckte ihre linke Hand aus. «Kein Ring, siehst du. Überhaupt, wer sagt denn, daß ich bei so einem Typ eine Chance hätte. Er muß mindestens dreißig sein, er ist Künstler und …»
«Schätzchen», fiel Bert ihr ins Wort, «mit einem Körper wie deinem hast du bei allem eine Chance, was männlich ist und lebt.» Sie machte eine Pause. «Sieh mal einer an, der große, dunkle Geheimnisvolle kommt zu uns.»
«Nein», sagte Lily. «Er kommt nie hierher.»
Aber Edward Shapiro schlenderte über die Straße auf sie zu, und Lily nahm die Kaffeekanne von der Heizplatte und goß Kaffee in Clarence Sogns Tasse, obwohl sie noch fast voll war, und danach wischte sie sich grundlos die Hände an ihrer Schürze ab, spürte ihr Herz schlagen und beschwor sich, nicht so blöd zu sein. Sie sah ihn nicht, aber sie hörte ihn zur Tür hereinkommen, und bei dem Geräusch straffte sie den Rücken und zog den Bauch ein. Gerade als sie sich umdrehte und ihn an der Theke sitzen sah, spürte sie etwas Träges, Warmes zwischen den Beinen und wußte, es war Blut. Scheiße, dachte sie. Ich kann′s mir nie merken. Sie starrte Edward Shapiro von hinten an. Er saß vorgebeugt, und der Stoff seines blauen Arbeitshemds lag gespannt über seinen Schulterblättern. Sie ließ ihre Augen die hintere Naht seiner Jeans hinunterwandern, die im roten Bezug des Hockers verschwand, und sie konnte sein Gewicht beinahe spüren. Der Mann war schlank, aber die Vorstellung seiner Schwere erregte sie. Selbst wenn er mich gesehen hat, erkennt er mich nie wieder, sagte sie sich und beobachtete, wie Bert ihm eine Tasse Kaffee eingoß. Sie wünschte, sie wäre mit der Kaffeekanne auf der anderen Seite der Theke. Sie wünschte, sie müßte nicht wegen eines Tampons nach oben in ihr Zimmer laufen. Sie winkte Bert zu, verzog den Mund zu dem Wort «Tage», rannte nach hinten und durch die Tür zum Treppenhaus.
Als sie in ihrer Wohnung auf der Toilette saß, fand sie es wohltuend, die Beine ausruhen zu können. Ihre Jeans und ihre Unterhose lagen auf dem Boden, und sie blickte auf den Blutfleck im weißen Stoff der Unterhose, sein glänzendes Rot über dem Denim und dem stumpfen Blau der Fliesen. Sie wollte sich nicht bewegen, aber nach einigen Sekunden griff sie nach ihren Tampons, wickelte einen aus und schob ihn hinein. Sie sah hinunter auf den blauen Faden zwischen ihren Beinen, auf ihre bloßen Knie und die Linien der Knochen und hatte dieses plötzliche seltsame Gefühl, mehr Fühlen als Denken und Kindern vertrauter als Erwachsenen, daß sie nicht wirklich in dem Raum war, daß sie aus ihrem eigenen Kopf irgendwo anders hin versprengt worden war und daß alle Dinge, die sie ansah, nicht mehr sie selbst waren, sondern eine Art seelenloser Schwindel. Sie stand auf, um das Gefühl loszuwerden, und zog dann eine frische Unterhose und Jeans an.
Langsam öffnete sie die Hintertür des Cafés. Sie wollte von dort aus Edward Shapiro an der Theke betrachten, aber er war weg. Statt dessen sah sie Martin einen guten Meter vor sich neben dem Tisch der Bodlers stehen und in ebendiesem Augenblick Filthy Frank zwei Zwanzigdollarscheine geben. Eine halbe Minute später, und sie hätte die ganze Transaktion verpaßt. Frank nahm das Geld, fummelte an seiner schmierigen Hemdtasche herum und steckte die Scheine hinein. Dann gab er Martin die Tüte. Die Art, wie dieser die Tüte nahm, erschreckte Lily. Als er die Hand danach ausstreckte, zitterten seine Finger vor Erwartung, und er verdrehte die Augen nach oben, so daß seine Pupillen einen Moment lang verschwanden und sie nur noch das Weiße sah. Seine Lippen öffneten sich, und Lily hörte ihn ausatmen. Sie wußte nicht, was sie da beobachtet hatte, aber was immer in der schmutzigen Einkaufstüte war, es hatte Martin in einer Weise berührt, die sie verlegen machte. Sie litt für ihn, für seine Verschrobenheit, dafür, daß er sich nicht zu verhalten wußte, für diesen schrecklichen Gesichtsausdruck, der für ein Café viel zu intim war. Sie drückte die Tür auf, und in ihrer Eile, an ihm vorbeizukommen, streifte sie seinen Ellbogen. Verdammt, sagte sie sich, als sie sich vergewisserte, daß Shapiro wirklich und wahrhaftig verschwunden war. Sie spürte eine leichte Berührung auf ihrer Schulter, drehte sich um und sah Martin, der sie anstarrte. Er stotterte ihren Namen und sagte dann: «Ich lasse was für dich auf dem Tisch liegen.»
Sie schaute auf die Tüte, die Martin in der linken Hand hielt. «Ein Geschenk für mich?» Sie wußte genau, daß es das nicht war. Die Verärgerung über ihn hatte sie zu der Frage veranlaßt, und sie hörte einen scharfen Ton in ihrer Stimme.
Er schüttelte den Kopf, und sie wandte sich ab, um ihm nicht ins Gesicht sehen zu müssen.
Sie eilte zu Bert und sagte: «Na, wie ist er?»
Bert blickte auf. «Von wem sprichst du?» säuselte sie.
«Ach, hör auf. Erzähl mir Einzelheiten.»
«Er ist rein und raus wie der Blitz, aber nach der Minute, die er hier war, würde ich sagen, er ist wirklich Klasse, wirklich neu und überhaupt nicht eingebildet.»
«So?» sagte Lily. Sie glitt hinter die Theke und goß Matt Halvorsen Kaffee nach. «Habt ihr über irgendwas gesprochen?»
«Er hat gesagt, er nähme einen Doughnut.»
«Das ist tiefsinnig», sagte Lily.
«Ich sagte: ‹Welchen?› und zeigte auf den Kasten. Darauf meinte er, in New York dürfe man ihn sich nicht aussuchen, und ich sagte: ‹Tja, wir sind eben nicht in New York›, und er sagte, daß er das wüßte und daß er den ohne Loch nehmen würde, das sei mehr fürs Geld. Er hat seinen Kaffee in Null Komma nichts runtergekippt, hat sich den Doughnut geschnappt und ist zur Tür rausgerannt.»
Lily preßte die Lippen zusammen. «Seine Augen sind irgendwie ungewöhnlich, findest du nicht? Sie sind ein bißchen schräg. Ist dir das aufgefallen?»
Bert nickte. «Mandelförmig, Das ist was Besonderes, zumindest hier in der Gegend.»
«Was Besonderes ist der allerdings.»
Lily und Bert drehten den Kopf, um die Lauscherin ausfindig zu machen.
Ida Bodine kam mit ihrer Kaffeetasse in der Hand auf sie zu. Die winzige Frau trug ihr Haar zu einem Bienenkorb aufgetürmt, um die fehlenden Zentimeter auszugleichen.
«Feind hört mit», sagte Bert leise zu Lily.
«In seinem Zimmer geht irgendwas vor», sagte Ida. «Ich hab da Sachen gehört.»
«Was für Sachen?» sagte Lily.
«Rumsen, Quietschen. Schon mehr als einmal hab ich ihm sagen müssen, er soll weniger Krach machen – da dröhnt immer die Opernmusik, daß einem glatt das Trommelfell platzt. Es ist mein Job als Nachtmanagerin, darauf zu achten, daß alles ruhig läuft, und dieser Mensch macht mir die Arbeit richtig zur Hölle.»
Nachtportier, meinst du wohl, dachte Lily. «So schlimm hört sich das für mich aber nicht an», sagte sie laut. «So ein bißchen Lärm.»
Den Blick auf Lily gerichtet, schlürfte Ida ihren Kaffee. «Das ist längst nicht alles. Ich hab Leute zu ihm reingehen sehen, wenn ich um sechs anfange zu arbeiten, und die kommen nicht etwa durch die Vordertür, sie gehen hinten auf der Flußseite rein und bleiben stundenlang bei ihm. Und sie sind nicht gerade das, was man nette Leute nennt.» Ida nickte.
«Ich finde, jeder Mensch hat das Recht, Besuch zu bekommen, von wem er mag», sagte Bert.
Ida sah Bert in die Augen, legte den Kopf schief und lächelte mit falscher Liebenswürdigkeit. «Auch von Tex?» sagte sie.
Lily musterte Ida, die ihre Tasse abgestellt und die Arme über der Brust verschränkt hatte. Es klang unwahrscheinlich. Sie rief sich das Bild des Hünen in Erinnerung – 1,95 groß, mit langen roten Koteletten, einer von zu vielen Schlägereien krummen Nase und einem dicken Bierbauch, der ihm über die Hose hing. Vince hatte ihm, einige Jahre bevor Lily als Kellnerin anfing, den Zutritt zum Ideal verboten, und sie begegnete ihm selten, aber Hank kannte ihn aus dem Stadtgefängnis, wo Tex manchmal in einer der zwei Zellen die Nacht verbrachte. Hanks Sommerjob als Telefonist bei der Polizei und Feuerwehr von Webster hatte ihn zum Experten für die Fehltritte des großen Rothaarigen gemacht. Seine Vergehen liefen zwar gewöhnlich auf nicht mehr als Ruhestörung hinaus, aber er störte die Ruhe ziemlich regelmäßig und trieb die Polizisten zum Wahnsinn. Tex′ letztes Delikt hatte am vergangenen Donnerstag stattgefunden, als er draußen am Highway 19 durch die Tür des Gemeindehauses der Zeugen Jehovas getorkelt und mit Tarzangebrüll und nichts als einem getigerten Slip, einem Cowboyhut und -stiefeln bekleidet durch den Gang gewankt war.
«Ich würde sagen, Tex hat diesen Shapiro bestimmt acht- oder neunmal besucht, und das letzte Mal, daß ich ihn gesehen hab, kam er aus dem Zimmer und knöpfte sich das Hemd zu.»
Idas Gesicht zuckte vor Abscheu.
Bert starrte sie mit gespieltem Entsetzen an. «Also, Ida Bodine», sagte sie. «Wenn der Mann eine Schwuchtel ist, bin ich ′ne fünfäugige Außerirdische aus der nächsten Galaxis.»
Ida schnaubte. «Ich sag nur, was ich gesehen hab, sonst nichts.»
«Ach komm, Ida», sagte Lily. «Edward Shapiro hat am Courtland College gelehrt. Er hatte da eine gute Stelle –»
Ida unterbrach sie. «Seine Frau hat ihn verlassen, oder? Sie lassen sich scheiden.» Sie zischte das letzte Wort. «Und sag mir doch mal, wenn er so ein feiner Pinkel ist, ′n bedeutender Professor und so, was macht er dann im Stuart Hotel?»
Lily sah Bert an, dann wieder Ida. «Ich denke, er malt.» Ihr Ton war heftiger als beabsichtigt.
Ida zog die Augenbrauen hoch. «Du weißt ja, was über seine Bilder erzählt wird, oder? Es sind welche von Webster, und sie zeigen nicht gerade die Sehenswürdigkeiten. Ich glaub, er hat den Getreidesilo, die Bahngleise und die Müllhalde gemalt und sie richtig häßlich gemacht, um uns allen hier zu zeigen, daß wir ein Haufen Hinterwäldler sind.»
Lily hatte nur die Rückseite von Shapiros Gemälden gesehen, aber sie fragte sich, warum er Pleinair-Motive im Haus malen sollte.
«Wo hast du denn das her?» sagte Bert.
«Von hier und da», sagte Ida und kniff die Augen zusammen.
Lily beugte sich über die Theke zu Ida vor. «Und welches Gesetz besagt, daß er nicht malen kann, was er verdammt noch mal will?»
Ida zog den Kopf ein. «Na, wir tragen die Nase heute aber hoch», sagte sie. «Ich hoffe, du nimmst es nicht persönlich.» Die Frau zog ein Kleenex aus ihrer Handtasche und betupfte beide Mundwinkel damit. Es war eine Geste von absurder, übertriebener Weiblichkeit, bei der Lily am liebsten losgelacht hätte. Ida ließ das Taschentuch sinken und nahm es in beide Hände. «Was ich gern wissen möchte, Lily Dahl, ist, was du an diesem New Yorker Juden findest?»
Lily starrte Ida wütend an, sagte aber nichts. Bert warf ihr einen besorgten Blick zu. Dann knäulte Ida das Taschentuch in der Faust zusammen, nahm ihre Kaffeetasse von der Theke und ging an ihren Tisch zurück.
«Schwätzerin», sagte Bert.
«Er ist Jude», stellte Lily laut fest.
«Shapiro», sagte Bert. «Das ist ein jüdischer Name.»
«Ach», sagte Lily. Sie spürte, daß sie rot wurde, und fragte sich, warum Bert solche Sachen wußte und sie nicht. Sie sah auf die Uhr. Es ging auf sieben zu. Bald würde es einen weiteren Ansturm geben, wenn die Geschäftsleute auf einen Happen hereinkamen, bevor sie ihre Läden aufmachten. Lily ließ den Blick durchs Lokal schweifen. Sie hatte den Abgang der Bodlers verpaßt. «Lieber Gott, Bert, du hast den Ekeltisch saubergemacht?»
«Du bist mir also was schuldig.» Bert hob einen Stapel Teller hoch, dann deutete sie mit einer Kopfbewegung zur Tür.
Hank Farmer kam herein und lächelte Lily zu. Sein Gesicht sah ein wenig geschwollen aus, aber schließlich würde eine ganze Nacht auf dem Polizeirevier jeden fertigmachen. Ergab Lily einen schnellen Kuß auf die Wange, und Statt sich aufzurichten, behielt er den Kopf auf gleicher Höhe mit ihrem und sagte: «Ich geh jetzt zum Schlafen nach Hause, aber ich würde dich später gern sehen. Einverstanden?»
Lily schaute in sein hübsches Gesicht. Es war so nah, daß sie die schwachen Narben der Pubertätsakne sehen konnte. Eine dunkelblonde Haarsträhne war ihm in die Stirn gefallen. Sie antwortete nicht, sondern sah an seiner Wange vorbei auf Martins leere Nische und betrachtete die spiegelverkehrten Buchstaben der Neonreklame im Fenster. Sie trat ein wenig zurück. «Ruf mich an», sagte sie. «Ich fühle mich nicht ganz wohl. Hab meine Tage.»
Hank nickte und küßte sie noch einmal. Sie beobachtete, wie er aus der Tür und über die Straße eilte. Er bewegte sich schön, und sie dachte, daß er von weitem besser aussah. Sie starrte durchs Fenster und spielte mit dem Bestellblock in ihrer Schürzentasche.
Bert sagte zu ihrem Rücken: «Ich weiß, daß du hier rechts und links mit Liebesdingen jonglierst, Lil, aber du solltest deinen Hintern lieber wieder zur Arbeit bewegen.»
Lily drehte sich gar nicht erst um. Sie wackelte mit den Hüften und sagte zu Bert: «Es ist sieben. Ich lasse mal eine Platte laufen, bevor du weißt schon wer uns zuvorkommt.» Sie blickte über die Schulter zur Jukebox und sah Boomer Wee aus der Küche kommen.
«Schneid ihm den Weg ab!» schrie Bert und versuchte, Boomer mit dem Arm aufzuhalten.
Lily sprang auf die Jukebox zu, aber Boomer war zu schnell für sie, und als sie hinkam, stand er schon über die Wähltasten gebeugt. Sein T-Shirt war am Rücken hochgerutscht und entblößte seine weiße Haut und seine knochige Wirbelsäule. «Wag es ja nicht, diesen Song zu spielen. Geh zurück zu deinem Abwasch!» zischte sie ihn an und versuchte ihn mit dem Ellbogen von der Jukebox wegzuschieben. «Du bringst mich um damit.» Aber Boomer sperrte sich, sie hörte das Klappern der Vierteldollars, das Klicken der Maschine, und dann begann Elvis «Blue Suede Shoes» zu singen.
«Du kleines Stinktier», sagte Lily zu Boomer, der schon auf dem Rückweg in die Küche war und unschuldig lächelte. Ich mochte es auch, bevor ich es sechstausendvierhundertachtundfünfzigmal gehört habe, dachte sie und ging in Martins Nische, um den Tisch abzuräumen.
Das schmutzige Gedeck und die Tasse waren aufeinandergestapelt und zur Seite geschoben worden, aber ordentlich in der Mitte lag eine weiße Serviette, und darauf stand in großen schrägen Buchstaben das Wort «Mund». Das war alles. Mund? dachte Lily. Ein dünner Sonnenstrahl lugte durch ein Loch in der Wolkendecke und fiel diagonal auf den Tisch. Lily nahm die Serviette und starrte sie an. Konnte dies das sein, wovon er gesprochen hatte, das, was er für sie auf dem Tisch liegenlassen wollte? Wie sonderbar. Die Tinte war in dem weichen Papier zerlaufen. Lily schüttelte den Kopf, und dann, ohne zu wissen warum, blickte sie sich um, um festzustellen, ob jemand mitbekommen hatte, wie sie die Serviette las. Niemand zeigte das geringste Interesse. Sie zerknüllte die Papierserviette zwischen den Händen und steckte sie schnell in die hintere Tasche ihrer Jeans. Dann nahm sie den Stapel Geschirr vom Tisch und ging in die Küche.
LILY sagte Hank, er solle abends nicht kommen. Als sie ihm die Enttäuschung anhörte, fühlte sie sich mies, aber im Abendprogramm lief «Manche mögen′s heiß», und sie wollte sich Marilyn allein ansehen. Hank hatte sie wegen Marilyn geneckt, hatte gesagt, sie sei besessen von ihr, und einmal, als sie versucht hatte, ihm ihre Gefühle für die Monroe zu beschreiben, hatte Hank während der ganzen Erklärung gegrinst. Danach hatte sie aufgehört, mit ihm oder sonst jemandem über Marilyn zu sprechen. Die Sache mit Marilyn hatte mit «Bus Stop» angefangen. Damals hatte Lily noch bei ihren Eltern gelebt. Es war vor der Krebsoperation ihres Vaters gewesen, bevor ihre Eltern nach Florida gezogen waren, um den Wintern zu entgehen, und sie war bis zwei Uhr morgens aufgeblieben, um sich den Film anzusehen. Die Jacke in der allerletzten Szene hatte den Ausschlag gegeben. Der Cowboy hatte sie ausgezogen und sie Marilyn um die Schultern gelegt, und als sie sich hineinkuschelte, hatte ihr ganzer Oberkörper sich bewegt und gebebt, als würde sie auf Wangen, Hals und Schultern geküßt, und als Lily Marilyns Gesicht auf dem Bildschirm betrachtet hatte, hatte sie das Gefühl gehabt, ein wunderbares und gefährliches Glück zu sehen, das so intensiv war, daß es fast weh tat. Die Szene hatte in ihr den sehnlichen Wunsch ausgelöst, Theater zu spielen, und am nächsten Morgen hatte sie ihren Eltern mitgeteilt, sie wolle Schauspielerin werden. Die hatten nicht viel dazu gesagt. Ihre Mutter hatte sie freundlich darauf aufmerksam gemacht, daß Schulaufführungen und wirkliches Theater ganz verschiedene Dinge seien, und ihr Vater hatte gesagt, als Magister der schönen Künste könne man alles werden. Aber dank Marilyn hatte Lily die Schauspielerei mit anderen Augen gesehen, und sie hatte sich gefragt, ob man damit dem Wesen der Dinge nicht ganz nahe kommen könne, ob schauspielern einen der Welt nicht eher näherbringe als von ihr entferne.
Nach «Bus Stop» stieß Lily überall auf Marilyn Monroe: in Zeitschriften, Boulevardzeitungen, Comic-Heften, auf T-Shirts und Aufklebern, auf Postern und Fahnen. Sie entdeckte kleine Keramik-, Metall- und Gummifiguren von ihr und sah ihr Gesicht und ihren Körper als Verzierung auf Aschenbechern, Tassen, Stiften und Uhren. Aber für Lily waren diese Ikonen nicht mehr als grobe Annäherungen an die Person auf dem Bildschirm, billige, anzügliche Darstellungen von etwas Intimem, fast Heiligem, und sie mied sie. Ihr Poster hatte sie sich sorgfältig in einem Geschäft in Minneapolis ausgesucht, wobei sie sich gegen das berühmte Foto aus «Das verflixte siebente Jahr», auf dem Marilyn über dem U-Bahn-Schacht steht und ihr das Kleid über den Schenkeln hochfliegt, und für ein weniger bekanntes entschieden hatte. Sie hatte sich damals auch eine Biographie gekauft und begierig angefangen zu lesen, um unter den Einzelheiten aus Norma Jeans Leben das Geheimnis zu finden, das sie in dem Film erspäht hatte, aber nach etwa hundert Seiten war ihr klargeworden, daß es nicht drinstand, und sie hatte aufgehört zu lesen.
Als Lily abends im Bett lag und sich «Manche mögen′s heiß» ansah, lachte sie laut über die als Frauen verkleideten Männer und lauschte Marilyns Stimme, ihrem zögernden Sprach- und Atemrhythmus, und gegen Ende betrachtete sie eingehend das Kleid, das Marilyn trug. Es war wie ein Teil ihres Körpers, entschied sie, eigentlich gar kein Kleid, sondern eine magische Filmrobe, wie Lily sich vorstellte, selbst eine zu tragen, nicht in Webster natürlich, sondern in einer fernen Stadt wie Los Angeles, New York oder Paris, wo Frauen mit so gut wie nichts an aufreizend in Clubs und Bars schreiten. Sie lächelte vor sich hin und biß in das Milky Way, das sie sich eigens für den Film gekauft hatte.