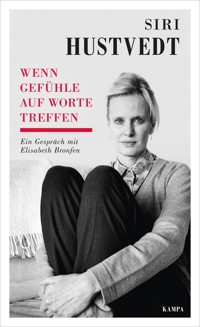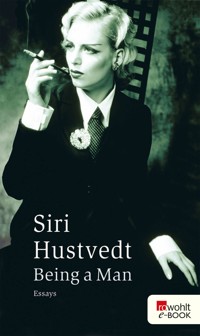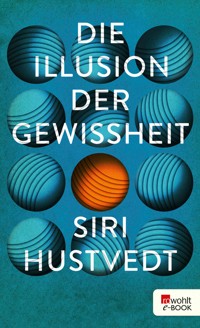11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Siri Hustvedt, die Autorin solcher internationaler Bestseller wie "Was ich liebte" und "Der Sommer ohne Männer", war schon immer fasziniert von der Biologie und der Theorie der menschlichen Wahrnehmung. Sie liebt die Kunst, die Geistes- und die Naturwissenschaften gleichermaßen. Sie ist Romanautorin und Feministin. Die im vorliegenden Band versammelten, ebenso klarsichtigen wie radikalen Essays legen eindrucksvoll Zeugnis von ihren vielfältigen Talenten ab. Der erste Teil untersucht die Fragen, die mitbeeinflussen, wie wir Kunst und die Welt im Allgemeinen sehen und beurteilen: Fragen der Wahrnehmung, Fragen des Geschlechts. Grundlagen dieser Diskussion sind etwa Werke von Picasso, de Kooning, Jeff Koons, Louise Bourgeois, Anselm Kiefer, Robert Mapplethorpe, Susan Sontag und Karl Ove Knausgard. Der zweite Teil befasst sich mit neurologischen Störungen und, unter anderem, mit den Rätseln von Hysterie und Synästhesie sowie mit der Selbsttötung. In letzter Zeit wird oft gefordert, man müsste eine neue, stabile Brücke zwischen Geistes- und Naturwissenschaften bauen. Im Moment existiert nur eine behelfsmäßige, aber Siri Hustvedt fühlt sich ermutigt von den Reisenden, die sie in beide Richtungen überquert haben. "Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen" ist eine einsichts- und eindrucksvolle Bestandsaufnahme dieser Reisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Siri Hustvedt
Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen
Essays über Kunst, Geschlecht und Geist
Über dieses Buch
Siri Hustvedt, die Autorin solcher internationaler Bestseller wie «Was ich liebte» und «Der Sommer ohne Männer», war schon immer fasziniert von der Biologie und der Theorie der menschlichen Wahrnehmung. Sie liebt die Kunst, die Geistes- und die Naturwissenschaften gleichermaßen. Sie ist Romanautorin und Feministin. Die im vorliegenden Band versammelten, ebenso klarsichtigen wie radikalen Essays legen eindrucksvoll Zeugnis von ihren vielfältigen Talenten ab. Der erste Teil untersucht die Fragen, die mitbeeinflussen, wie wir Kunst und die Welt im Allgemeinen sehen und beurteilen: Fragen der Wahrnehmung, Fragen des Geschlechts. Grundlagen dieser Diskussion sind etwa Werke von Picasso, de Kooning, Jeff Koons, Louise Bourgeois, Anselm Kiefer, Robert Mapplethorpe, Susan Sontag und Karl Ove Knausgård. Der zweite Teil befasst sich mit neurologischen Störungen und, unter anderem, mit den Rätseln von Hysterie und Synästhesie sowie mit der Selbsttötung. In letzter Zeit wird oft gefordert, man müsste eine neue, stabile Brücke zwischen Geistes- und Naturwissenschaften bauen. Im Moment existiert nur eine behelfsmäßige, aber Siri Hustvedt fühlt sich ermutigt von den Reisenden, die sie in beide Richtungen überquert haben. «Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen» ist eine einsichts- und eindrucksvolle Bestandsaufnahme dieser Reisen.
Vita
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sechs Romane publiziert, mit Was ich liebte hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen Der Sommer ohne Männer und Die gleißende Welt. Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände Leben, Denken, Schauen; Nicht hier, nicht dort; Being a Man; Die Illusion der Gewissheit und Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen vor.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel A Woman Looking at Men Looking at Women bei Simon & Schuster, New York
Die vorliegende deutsche Ausgabe ist um den Teil II der US-Ausgabe gekürzt, der 2018 unter dem Titel Die Illusion der Gewissheit als selbständiges Buch bei Rowohlt veröffentlicht wurde.
Uli Aumüller übersetzte Teil I, Grete Osterwald Teil II
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg bei Reinbek, März 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg bei Reinbek
«A Woman Looking at Men Looking at Women» Copyright © 2016 by Siri Hustvedt
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-00045-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Einführung
I Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen
Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen
Sie schluchzt
Die Geschichte der Mädchen
Die Kriegsgeschichte
Die grausame Liebesgeschichte
Die Große Erzählung der Moderne und ihrer Macken
Warum Briefe an eine Malerin?
Ballonzauber
Meine Louise Bourgeois
Anselm Kiefer: Die Wahrheit ist immer grau
Mapplethorpe/Almodóvar: Punkte und Kontrapunkte
Wim Wenders’ Pina: Tanzen um des Tanzes Willen
Haarspaltereien über Haare
Sontag über Pornos: Fünfzig Jahre später
«Keine Konkurrenz»
Das schreibende Selbst und der Patient in der Psychiatrie
Im Raum
II Was sind wir?
Grenzgebiete: Abenteuer der ersten, zweiten und dritten Person in sich kreuzenden Disziplinen
Andere werden
Warum diese Geschichte und nicht eine andere?
Ich weinte vier Jahre lang, und als ich aufhörte, war ich blind
Selbstmord und das Drama des Selbst-Bewusstseins
Konjunktivische Flüge: Denken durch die verkörperte Realität imaginärer Welten
Erinnern in der Kunst: das Horizontale und das Vertikale
Wie wichtig ist Philosophie in Sachen Gehirn?
Kierkegaards Pseudonyme und die Wahrheiten der Fiktion
Einleitung
Teil A. Autobiographische Brocken oder Smuler, plus ein Krümel, der Pessoa gehört
Teil B. Weitere Rätselhaftigkeiten der ersten Person oder der Souffleur des Souffleurs
Nachschrift
Einführung
Im Jahr 1959 hielt C.P. Snow, ein englischer Physiker, der ein beliebter Romanautor geworden war, die jährliche Rede Lecture im Senatshaus der University of Cambridge. In seinem Vortrag «Die zwei Kulturen» beklagte er die «Kluft wechselseitigen Nichtverstehens», die sich zwischen «Naturwissenschaftlern und Technikern» und «literarischen Intellektuellen» aufgetan hatte. Obwohl Snow einräumte, dass es belesene Naturwissenschaftler gebe, behauptete er, sie seien selten. «Wenn man nachfragte, welche Bücher sie denn gelesen hätten, pflegten sie bescheiden zu gestehen: ‹Nun ja, ich habe mal ein bisschen in Dickens hineingeschaut›, als wäre Dickens ein höchst esoterischer, verworrener Schriftsteller mit zweifelhaftem Gewinn, etwa so wie Rainer Maria Rilke.» Zur Klarstellung, ich finde Snows leicht dahingesagte Bemerkung, Dickens’ Werk sei transparent und Rilkes zu opak, um Vergnügen zu bereiten, die, wie er unterstellt, eine allgemeingültige literarische Beurteilung wiedergibt, höchst dubios. Doch der Mann wollte auf etwas Bestimmtes hinaus. Obwohl er die fehlenden literarischen Kenntnisse der Naturwissenschaftler als eine Form der Selbstverarmung ansah, irritierten ihn die Figuren auf der anderen Seite der Kluft weitaus mehr. Er gestand, dass er «ein- oder zweimal» in einem Anflug von Gereiztheit jene blasierten Vertreter der von ihm so genannten «traditionellen Kultur» gebeten habe, den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu beschreiben, eine Frage, die er für gleichwertig mit «Haben Sie ein Werk von Shakespeare gelesen?» hielt. Versanken die Verteidiger der Tradition vor Scham im Boden, oder wurden sie rot? Nein; er berichtete, ihre Reaktion sei «kalt» und «negativ» gewesen.
Snow forderte eine Revision des Bildungssystems, um das Problem in den Griff zu bekommen. Er kritisierte die in England übliche Fixierung auf klassische Bildung – Griechisch und Latein waren Hauptfächer –, weil er davon überzeugt war, die Naturwissenschaften seien der Schlüssel zur Rettung der Welt, insbesondere zur Minderung des Elends der Armen. Snows klingender Titel sowie die Tatsache, dass seine Rede eine hässliche, ins Persönliche gehende Erwiderung von F.R. Leavis auslöste, einem seinerzeit bekannten Literaturkritiker, scheinen seinen Worten einen bleibenden Platz in der angloamerikanischen Sozialgeschichte gesichert zu haben. Ich muss sagen, dass ich, als ich unlängst Snows Vorlesung und dann deren erweiterte Version las, schwer enttäuscht war. Obwohl er ein Problem beim Namen nennt, das in den letzten fünfzig Jahren nur noch dringlicher geworden ist, fand ich seine Auseinandersetzung damit langatmig, blass und ein wenig naiv.
Heutzutage verspüren wenige Naturwissenschaftler das Bedürfnis, wie Snow vor hochnäsigen «literarischen Intellektuellen» beschützt zu werden, weil die Naturwissenschaften in der Kultur eine Position einnehmen, die nur als Ort der Wahrheit beschrieben werden kann. Doch trotz spektakulärer technologischer Fortschritte seit 1959 erwies sich Snows unerschütterlicher Glaube, die Naturwissenschaften würden bald die Probleme der Welt lösen, als irrig. Die Fragmentierung von Wissen ist nichts Neues, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass die Chancen für einen echten Austausch zwischen Angehörigen verschiedener Disziplinen im einundzwanzigsten Jahrhundert eher ab- als zugenommen haben. Ein Mann, der bei einer Tagung in Deutschland mit mir auf dem Podium saß, gab zu, in seiner Fachrichtung, den Neurowissenschaften, habe die Spezialisierung ernsthafte Verständigungslücken geschaffen. Er sagte offen, dass er, obwohl er sich auf seinem eigenen Spezialgebiet auskenne, jede Menge Kollegen habe, deren Arbeitsprojekte ihm einfach unbegreiflich seien.
Im vergangenen Jahrzehnt oder so habe ich mich wiederholt am Grunde von Snows Kluft befunden und zu den Menschen hinaufgerufen, die auf beiden Seiten versammelt waren. Die Ereignisse, die mich an meine Position in diesem tiefen Tal führten, fallen gewöhnlich unter die freundlich klingende Rubrik «interdisziplinär». Wieder und wieder war ich Zeugin von Szenen wechselseitigen Unverständnisses oder, schlimmer noch, regelrechter Feindseligkeit. Lehrreich war eine Tagung an der Columbia University zur Förderung des Dialogs zwischen Neurowissenschaftlern, die über visuelle Wahrnehmung arbeiteten, und Künstlern. Die Naturwissenschaftler (lauter Stars auf ihrem Fachgebiet) machten ihre Präsentation, worauf die Künstlergruppe (lauter Stars in der Kunstszene) gebeten wurde, darauf einzugehen. Das ging nicht gut. Die Künstler waren empört über die schon in der Struktur der Tagung angelegte Herablassung. Jeder einzelne Inhaber wissenschaftlicher Wahrheit hielt seinen Vortrag, und dann wurden die Kreativen, alle zusammen an einem Tisch, aufgefordert, Kommentare zu einer Wissenschaft abzugeben, von der sie wenig Ahnung hatten. Im Frage-und-Antwort-Teil machte ich einen Vorschlag zur Güte, da mir auffiel, dass trotz unterschiedlicher Terminologien und Methoden Wege für einen Dialog zwischen Naturwissenschaftlern und Künstlern offenstanden. Die Wissenschaftler waren verwirrt. Die Künstler wütend. Ihre Antworten entsprachen der Position, die ihnen in der Wissenshierarchie zugeteilt worden war: die Wissenschaft oben, die Kunst unten.
Viele Essays in diesem Band greifen auf Einsichten sowohl aus den Natur- wie aus den Geisteswissenschaften zurück. Dies jedoch im intensiven Bewusstsein, dass die in den verschiedenen Fächern aufgestellten Hypothesen und verwendeten Methoden nicht notwendig identisch sind. Die Erkenntnisweisen von Physikern, Biologen, Historikern, Philosophen und Künstlern sind unterschiedlich. Ich hüte mich vor dem Absoluten in jeglichen Formen. Nach meiner Erfahrung kann man Naturwissenschaftler mit solch einem Statement mehr beunruhigen als Geisteswissenschaftler. Es hat einen Beigeschmack von Relativismus, von der Vorstellung, es könne kein Richtig oder Falsch, keine objektive Wahrheit gefunden werden oder, noch schlimmer, keine äußere Welt, keine Realität. Doch zu sagen, man misstraue dem Absoluten, heißt ja zum Beispiel nicht, die Gesetze der Physik wären nicht theoretisch auf alles anwendbar. Gleichzeitig ist die Physik kein abgeschlossenes Fach, und Meinungsverschiedenheiten unter Physikern dauern an. Sogar erledigte Fragen können weitere Fragen hervorbringen. Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik, das Gesetz, auf dem Snow als Zeichen naturwissenschaftlicher Bildung bestand, erklärt, wie Energie zerstreut wird, wenn man sie nicht daran hindert, und warum ein aus kochendem Wasser genommenes und auf die Arbeitsplatte gelegtes Ei schließlich erkaltet. Dabei gab es zu der Zeit, als Snow seinen Vortrag hielt, offene Fragen, inwiefern dieses Gesetz auf den Ursprung und die Entwicklung von Lebensformen Anwendung findet. In den Jahren nach Snows Vorlesung entwickelten der belgische Wissenschaftler Ilya Prigogine und seine Kollegen Fragen zu dem Hauptsatz in Bezug auf die Biologie weiter und bekamen für ihre Leistungen den Nobelpreis. Ihre Forschung zur Nichtgleichgewichtsthermodynamik führte zu einem wachsenden Interesse an selbstorganisierenden Systemen, die sich in einer Weise auf die Naturwissenschaften auswirkten, wie Snow es sich nicht hätte vorstellen können.
Doch kehren wir noch einen Moment zu den wütenden Künstlern zurück. Was ist Wissen, und wie sollten wir darüber denken? Die Künstler waren der Meinung, sie hätten gerade beobachtet, wie die Arbeit, die sie ihr Leben lang getan hatten, entweder auf neuronale Korrelate in einem anonymen Gehirn oder auf eine biologische Theorie der Ästhetik reduziert wurde, die sie erschreckend simpel fanden. Ich interessiere mich für biologische Systeme und dafür, wie die menschliche Wahrnehmung funktioniert. Ich glaube, die Neurobiologie kann zum Verständnis der Ästhetik beitragen, aber das geht nicht in einem Vakuum. Zwei zentrale Behauptungen, die ich in diesem Buch aufstelle, sind, dass alles menschliche Wissen partiell ist und niemand von der Gemeinschaft der Denker oder Forscher, in der sie oder er lebt, unberührt bleibt. Abgründe wechselseitigen Nichtverstehens zwischen Menschen aus verschiedenen Fachgebieten mögen unvermeidlich sein. Gleichzeitig wird ohne gegenseitigen Respekt kein Dialog zwischen uns möglich sein.
Als ich jung war, las ich Literatur, Philosophie und Geschichte. Ich entwickelte auch ein starkes Interesse an der Psychoanalyse, das nie nachgelassen hat. Mitte der achtziger Jahre promovierte ich in Anglistik. (Thema meiner Dissertation war Charles Dickens, was wohl meine Irritation über Snows Bewertung erklärt.) Vor etwa zwanzig Jahren bekam ich das Gefühl, in meiner Bildung fehle das, was ich heute «den biologischen Teil» nenne. Wie viele Menschen, die sich intensiv mit den Geisteswissenschaften befasst haben, hatte ich wenig Ahnung von Physiologie, obwohl ich als Migränepatientin etliche Bücher über Neurologie und neurologische Krankheiten für Laien gelesen hatte. Auch psychiatrische Störungen und die ständigen Veränderungen der diagnostischen Kategorien faszinierten mich, sodass ich nicht ganz unwissend in Medizingeschichte war. In der Zwischenzeit war die neurowissenschaftliche Forschung explodiert, und ich machte mich daran, etwas über jenes viel untersuchte Organ, das Gehirn, zu erfahren. Obwohl ich keine formale Ausbildung durchlief, las ich Unmengen, ging zu Vorlesungen und Tagungen, stellte Fragen, schloss Freundschaften mit aktiven Wissenschaftlern, und allmählich wurde das, was für mich schwierig und unzugänglich gewesen war, zunehmend lesbar. In den letzten Jahren habe ich sogar einige Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht.
Der Aufstieg der Naturwissenschaften in unserer Welt, der Grund, weshalb Snow glaubte, naturwissenschaftliche Bildung sei wichtiger als das Studium der Klassiker, und weshalb die Organisatoren der Tagung den Naturwissenschaftlern die Lehrerrolle gaben und den Künstlern die Rolle von Schülern, ergibt sich aus den konkreten Resultaten naturwissenschaftlicher Theorien – von Dampfmaschinen über elektrisches Licht zu Computern und Mobiltelefonen –, von denen keines unterschätzt werden sollte. Jeder Mensch auf der Erde ist mehr oder weniger beides, Nutznießer und Opfer wissenschaftlicher Erfindung. Daraus folgt jedoch nicht, dass das Lesen von Geschichte, Philosophie, Lyrik und Romanen, das Betrachten von visueller Kunst oder das Musikhören nicht ebenfalls das Leben von Menschen verwandelt, zum Guten wie zum Schlechten. Obwohl solche Veränderungen weniger konkret sein mögen, sind sie deshalb nicht weniger real oder werden auf irgendeine Weise minderwertiger als die Auswirkungen der Technologie. Wir alle sind auch Geschöpfe von Ideen.
Bei meinen Ausflügen in die Welten der Naturwissenschaft traf ich immer wieder auf die Adjektive «hart» und «weich» oder «präzise» und «schwammig». «Weich» und «schwammig» sind Begriffe, die nicht nur für schlechte Wissenschaftler verwendet werden, deren Methoden, Recherchen und Argumente nicht standhalten, weil sie nicht scharf denken können, sondern auch für Menschen, die in den Geisteswissenschaften tätig sind, und für Künstler aller Art. Was macht präzises Denken aus? Ist Zweideutigkeit gefährlich oder befreiend? Warum werden die Naturwissenschaften als hart und maskulin betrachtet, die Künste und Geisteswissenschaften dagegen als weich und feminin? Und warum wird hart gewöhnlich für so viel besser gehalten als weich? Einige Essays in diesem Buch kommen auf diese Frage zurück.
In «Die zwei Kulturen» spricht Snow (im englischen Original) ständig von men. Er meint man nicht als Universelles, eine Konvention, die dank des Aufstiegs der feministischen Wissenschaft nahezu aus der akademischen Welt verschwunden ist. In deren Büchern und Schriften sind he und man nicht mehr als Routinebezeichnungen für human being, Mensch. Doch Snow sprach nicht von der Menschheit. Sowohl seine Naturwissenschaftler wie seine literarischen Intellektuellen sind männliche Menschen. Obwohl 1959 Frauen auf beiden Seiten der von Snow angesprochenen Kluft arbeiteten, tauchen sie in seinem Vortrag nicht auf. Es mag hilfreich sein, daran zu erinnern, dass in England erst 1928 das passive und aktive Wahlrecht für Frauen eingeführt wurde, nur einunddreißig Jahre bevor Snow seine Rede hielt. Es war nicht etwa so, dass er die Frauen aus den zwei Kulturen verbannt hätte, sondern für ihn existierten sie in beiden Bereichen einfach nicht als Redner.
Die feministische Theorie ist wohl kaum ein Bollwerk des Konsenses. Es gab und gibt noch immer eine Menge internen Streit. Heutzutage ist es sicherer, von «Feminismen» als von Feminismus zu sprechen, weil es mehrere verschiedene Arten gibt; dabei wirken sich die Auseinandersetzungen, die innerhalb der Universitäten toben, oft nur peripher auf die breitere Öffentlichkeit aus. Dennoch haben feministische Wissenschaftlerinnen sowohl in den Geistes- wie in den Naturwissenschaften die Taubheit eines Snow gegenüber den Stimmen der Frauen zu etwas gemacht, was schwer durchzuhalten ist. Die metaphorischen Begriffe hart und weich, ob ausgesprochen oder nicht, prägen allerdings weiterhin beide Kulturen sowie die allgemeinere Kultur jenseits davon.
Ich liebe Kunst, Geistes- und Naturwissenschaften. Ich bin Schriftstellerin und Feministin. Ich bin auch eine leidenschaftliche Leserin, deren Ansichten durch die Bücher und Aufsätze aus vielen Bereichen, die zu meinem täglichen Leseleben gehören, ständig verändert und modifiziert wurden und werden. Die Wahrheit ist, dass ich randvoll bin mit den nicht immer harmonischen Stimmen anderer Schreibender. Dieses Buch ist mehr oder weniger ein Versuch, mir einen Reim auf diese pluralen Perspektiven zu machen. Alle hier aufgenommenen Essays sind zwischen 2011 und 2015 entstanden. Der Band ist in zwei Teile gegliedert, von denen jeder eine Leitlogik hat.
Der erste Abschnitt, «Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen», enthält Aufsätze zu bestimmten Künstlern sowie Untersuchungen zur selektiven Wahrnehmung, die unsere Beurteilung von Kunst, Literatur und der Welt schlechthin bestimmt. Einige waren Auftragsarbeiten. Der Titelessay wurde für den Katalog zu der von Carla Schulz-Hoffmann kuratierten Ausstellung Frauen. Picasso, Beckmann, de Kooning in der Münchner Pinakothek der Moderne geschrieben. «Ballonzauber» erschien auf der Website meines Verlags Simon & Schuster. (Bemerkenswerterweise hat es im Laufe von fast zwei Jahren nicht einen Kommentar dazu gegeben.) Der Vortrag «Meine Louise Bourgeois» wurde während der 2015 gezeigten Bourgeois-Ausstellung Strukturen des Daseins: Die Zellen im Münchner Haus der Kunst gehalten. Die Broad Foundation bat mich um einen Beitrag über Anselm Kiefer für ein von Joanne Heyler, Ed Schad und Chelsea Beck herausgegebenes Buch über ihre Sammlung. Der Text zu Mapplethorpe und Almodóvar entstand für eine Ausstellung in der Galería Elvira González in Madrid, und der zu Wim Wenders’ Film über die Choreographin Pina Bausch wurde im Booklet der von The Criterion Collection vertriebenen DVD abgedruckt. «Haarspaltereien über Haare» erschien in einer Anthologie zum Thema Frauen und Haar. «Sontag über Pornos: Fünfzig Jahre später» bestand zuerst nur aus ein paar Seiten für die Website des 92nd Street Y in New York zum fünfundsiebzigsten Jubiläum des Unterberg Poetry Center und wurde dann ein viel längerer Essay. «‹Keine Konkurrenz›» habe ich nur geschrieben, weil es mich dazu drängte. Eine theoretischere Version von «Das schreibende Selbst und der Patient in der Psychiatrie» hielt ich im September 2015 als Vorlesung im Rahmen des Richardson-Seminars zur Geschichte der Psychiatrie am DeWitt Wallace Institute for the History of Psychiatry des Weill Cornell Medical College; dort bin ich jetzt Dozentin für Psychiatrie und diskutiere die Storys, die von Patienten geschrieben wurden, als ich in der geschlossenen Abteilung einer New Yorker psychiatrischen Klinik ehrenamtlich einen Schreibkurs gab. Einige Details habe ich verändert, um die Privatsphäre der Schreibenden zu schützen. «Im Raum» ist ein Essay darüber, was die Psychoanalyse für mich als Patientin bedeutet hat. Ich habe ihn zu verschiedenen Zeiten in mehreren Ländern in unterschiedlichen Gewändern als Vortrag vor Psychoanalytikern gehalten. Im Großen und Ganzen können die Essays des ersten Teils von einem breiten Publikum gelesen werden. Ihr Ton variiert von leicht bis sachlich, aber man benötigt kein Fachwissen, um sie zu lesen.
Als ewige Außenseiterin, die in verschiedene Disziplinen hineinschaut, habe ich irgendwann begriffen, dass ich in einer Hinsicht deutlich im Vorteil bin. Ich erkenne, was die Experten oft in Frage zu stellen versäumen. Natürlich braucht man in einem Fach Kenntnisse, bevor irgendeine kritische Perspektive eingenommen werden kann, und sich auszukennen erfordert beständige Arbeit und Forschung. Es ist nämlich so: je mehr ich weiß, desto mehr Fragen habe ich. Je mehr Fragen ich habe, desto mehr lese ich, und dieses Lesen bringt weitere Fragen hervor. Es hört nie auf. Was ich von den Lesern erwarte, ist Offenheit, Skepsis gegenüber Vorurteilen und eine Bereitschaft, mit mir an Orte zu reisen, wo der Boden steinig und die Ausblicke unscharf sein mögen, aber trotz oder vielleicht wegen dieser Schwierigkeiten Freuden gefunden werden können.
Acht der neun Essays im zweiten Teil des Buches, «Was sind wir? Vorträge über das Menschsein», sind für akademische Konferenzen entstanden. Die einzige Ausnahme ist «Andere werden», ein Aufsatz über Mirror-Touch-Synästhesie, den ich für eine Anthologie zum Thema Mirror-Touch-Synesthesia: Thresholds of Empathy in Art schrieb, die mit Beiträgen von Künstlern, Natur- und Geisteswissenschaftlern in der Oxford University Press veröffentlicht wurde. Die anderen Texte wurden vor Fachpublikum verschiedener Couleur vorgetragen oder bei Zusammenkünften von Vertretern unterschiedlicher Disziplinen. Als ich diese Reden schrieb, hatte ich die Annehmlichkeit, bei meinen Zuhörern Kenntnisse vorauszusetzen, was bedeutet, dass manche Gedanken und Wörter uneingeweihten Lesern nicht vertraut sein mögen. 2012 war ich Fellow des Gutenberg-Forschungskollegs an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Eine meiner Aufgaben war es, den Eröffnungsvortrag der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Amerikastudien zu halten, «Grenzgebiete: Abenteuer der ersten, zweiten und dritten Person in sich kreuzenden Disziplinen», in dem es um die Probleme von Menschen geht, die in zwei oder mehr intellektuellen Kulturen leben. Der Mainzer Professor Alfred Hornung hatte ein starkes Interesse daran, Dialoge zwischen Natur- und Geisteswissenschaften zu fördern, und es gibt inzwischen ein transdisziplinäres Graduiertenkolleg «Life Sciences – Life Writing: Grenzerfahrungen menschlichen Lebens zwischen biomedizinischer Erklärung und lebensweltlicher Erfahrung» an der Universität.
«Warum diese Geschichte und nicht eine andere?» entstand als Vortrag im Southbank Centre auf dem London Literature Festival im Juli 2012, wurde aber von mir als Beitrag für einen 2016 veröffentlichten wissenschaftlichen Sammelband überarbeitet: Zones of Focused Ambiguity in Siri Hustvedt’s Works. Interdisciplinary Essays, herausgegeben von Johanna Hartmann, Christine Marks und Hubert Zapf. «Wie wichtig ist Philosophie in Sachen Gehirn?» trug ich 2012 auf der von der Cleveland Clinic organisierten International Neuroethics Conference «Brain Matters 3» in Cleveland vor. «Ich weinte vier Jahre lang, und als ich aufhörte, war ich blind» wurde beim Wintertreffen 2013 der Société de Neurophysiologie Clinique de Langue Française gehalten. In beiden Vorträgen geht es um das Mysterium der Hysterie oder Konversionsstörung, einer Krankheit, die das Psyche-Soma-Dilemma dramatisch beleuchtet, und in beiden Fällen wurde ich von den Organisatoren der Tagung eingeladen, weil sie mein Buch Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven gelesen hatten, in dem ich die Vieldeutigkeit neurologischer Diagnosen durch die Linse mehrerer Disziplinen untersuche.
Im September 2013 hielt ich vor der International Association for Suicide Prevention (IASP) in Oslo den Vortrag «Selbstmord und das Drama des Selbst-Bewusstseins», der im selben Jahr von Suicidology Online veröffentlicht und für das vorliegende Buch überarbeitet wurde. Selbstmordforschung ist schon aufgrund der Natur der Sache interdisziplinär. Sie greift auf Recherchen aus der Soziologie, Neurobiologie, Geschichte, Genetik, Statistik, Psychologie und Psychiatrie zurück. In den eineinhalb Jahren, die ich Zeit hatte, den Vortrag auszuarbeiten, verschlang ich Aberdutzende Bücher zu dem Thema. Nachträglich schätze ich mich glücklich, den Auftrag bekommen zu haben, da er mich veranlasste, intensiv über etwas nachzudenken, worüber ich vorher nicht intensiv nachgedacht hatte. Selbstmord ist ein trauriges Thema, doch nur wenige Menschen sind nicht davon berührt. «Warum sein Selbst töten?» ist eine tiefgründige Frage, auf die noch immer keine Antwort bereitsteht.
Anfang Juni 2014 war ich eine von zwanzig Teilnehmern und Teilnehmerinnen eines dreitägigen Symposiums in der Villa Vigoni über dem Comer See. Das Thema lautete «Als-ob-Konstruktionen und die darauf basierenden Vorgänge des Imaginierens, Simulierens und Sich-Hineinversetzens». Vertreter beider Kulturen nahmen teil. Wir hörten Beiträge von Forschern aus den Gebieten der Ästhetik, Architektur, Philosophie, Psychiatrie, Psychoanalyse und der Neurowissenschaften. Sogar ein Neurochirurg war dabei, der ein faszinierendes Referat über Korrekturoperationen an Kindern mit angeborenen Schädeldeformationen hielt. Trotz unseres bunt zusammengewürfelten Hintergrunds waren die Gespräche lebhaft. Haben wir uns gegenseitig ganz verstanden? Haben alle Anwesenden jedes Argument herausgefunden, das ich in meinem Beitrag «Konjunktivische Flüge: Denken durch die verkörperte Realität imaginierter Welten» vorzubringen hoffte? Nein, ich glaube nicht. Habe ich das abstruse Referat des Architekten gänzlich verstanden? Nein. Gleichwohl bin ich von der Konferenz mit dem Eindruck abgereist, dass zumindest in diesen drei Tagen an diesem verwunschenen Ort die Kluft zwischen Natur- und Geisteswissenschaften ein bisschen kleiner geworden war. «Erinnern in der Kunst: Das Horizontale und das Vertikale» ist ein Vortrag, den ich 2014 bei einem von der Signe and Ane Gyllenberg Foundation geförderten interdisziplinären Symposium, Memory Symposium – From Neurobiological Underpinnings to Reminiscences in Culture, in Finnland hielt.
Der letzte Essay in diesem Buch war die Festrede zu einer internationalen Konferenz über das Werk von Søren Kierkegaard an der Universität von Kopenhagen zu Ehren seines 200. Geburtstags im Mai 2013. Der große dänische Philosoph ist ein vertrauter Teil meines Lebens, seit ich ein Kind war, und ich ergriff die Gelegenheit, über ihn zu schreiben. Wieder kam die Einladung so lange im Voraus, dass ich sehr viel Zeit hatte, einmal mehr in die spannende, extrem schwierige, unerträgliche, aber überragende Welt von S.K. einzutauchen. Es war allerdings das erste Mal, dass ich auch Sekundärliteratur über den Philosophen las. Die Kierkegaard-Forschung ist eine Kultur für sich, eine regelrechte Papiermühle, die Tausende Seiten Kommentar zu den abertausend von Kierkegaard hinterlassenen Seiten ausstößt. Es gibt großartige Bücher über ihn, aus denen ich in meiner Rede zitiere, und das Søren Kierkegaard Forschungszentrum, das die Gesamtausgabe seines Werks betreut hat, ist von absolut beispielhafter wissenschaftlicher Strenge.
Indem ich mich nicht nur in die Werke von, sondern auch über Kierkegaard vertiefte, wollte ich die Ironie des Philosophen selbst zuspitzen, dessen beißende Hinweise auf Assistenzprofessoren und eigensinnige Wissenschaftler, die sich mit ihren Paragraphen und Fußnoten abmühen, für seine spezielle Form der Komödie ganz wesentlich sind. Neben dem beachtlichen Stapel hervorragender Schriften über S.K. gibt es ein ganzes Gebirge von trockenen, schnell zu vergessenden, nichtigen, aufgeblasenen und schlecht geschriebenen Beiträgen, die die flinke Brillanz des Mannes in müde, schwerfällige Langeweile verwandeln. Mein Vortrag war zum Teil eine Reaktion auf diese Berge von professoralem Stumpfsinn. Ich wollte in meinem Beitrag mit Kierkegaards formalen, oft novellistischen Strategien spielen, seine pseudonymen Posen anklingen lassen und veranschaulichen, dass seine Philosophie auch im Stil der Prosa selbst lebt, in ihren Strukturen, Bildern und Metaphern. Ich schrieb in der ersten Person, weil S.K. auf der ersten Person als dem Ort für menschlichen Wandel besteht. Manchmal ironisiere ich Kierkegaards Ironie. Ich finde, der Vortrag ist sehr gut lesbar. Trotzdem, er wurde für Kierkegaard-Spezialisten geschrieben, und es kommen Späße und Bezüge darin vor, die denen, die nicht persönlich mit dem Schriftsteller gerungen haben, womöglich entgehen werden.
«Kierkegaards Pseudonyme und die Wahrheiten der Fiktion» war bisher unveröffentlicht. Nachdem ich meine Fußnoten tagelang bearbeitet und so für die hochspezifischen Anforderungen einer Kierkegaard-Zeitschrift maßgeschneidert hatte, schaute ich mir die Regeln für eine Einreichung noch einmal genau an und musste schockiert entdecken, dass keine in der ersten Person geschriebenen Aufsätze angenommen wurden! Eine Zeitschrift, die sich einem Philosophen widmete, der das «Ich» und den individuellen Einzelnen vertritt, wollte offenbar nichts mit dem «Ich» von jemand anderem zu tun haben. Fairerweise muss ich erwähnen, dass ein Kierkegaard-Spezialist, den ich kenne, mir sagte, er denke, in meinem Fall wäre eine Ausnahme gemacht worden, aber das wusste ich zu jener Zeit nicht. Es zeigt sich also, dass es sogar innerhalb der Kierkegaard-Studien mindestens zwei Kulturen gibt. Religiöse und säkulare Kierkegaardianer sind nicht einer Meinung, aber es gibt auch noch andere fundamentale Aufspaltungen unter den Verehrern. Andererseits, wo bliebe bei einer allgemeinen Übereinstimmung der Spaß?
Wenn Sie dieses Buch von Anfang bis Ende lesen, werden Sie bemerken, dass ich auf Denker und Ideen zurückgreife, die mit der Zeit für mein eigenes Denken grundlegend geworden sind. Die Naturphilosophin Margaret Cavendish aus dem 17. Jahrhundert, der Neurologe und Philosoph Pierre Janet, Sigmund Freud, William James, John Dewey, Martin Buber, der französische Philosoph Maurice Merleau-Ponty, die amerikanische Philosophin Susanne Langer, die Anthropologin Mary Douglas und der englische Psychoanalytiker D.W. Winnicott tauchen häufig auf, um nur einige Autoren zu nennen, deren Werke mein Schreiben für immer verändert haben. Ich greife wiederholt auf eine von vielen Philosophen betonte phänomenologische Unterscheidung zurück, nämlich die zwischen einem präreflexiven, erlebenden bewussten Selbst, das sowohl Babys wie anderen Tieren eigen ist, und dem reflektierend bewussten Selbst eines Wesens, das über seine eigenen Gedanken nachdenken kann. Ich greife auf Spiegelsysteme im Gehirn zurück und auf neurowissenschaftliche Forschung, die Erinnerung mit Phantasie verknüpft, auf Ergebnisse aus der Epigenetik, auf Säuglingsforschung zu Entwicklung und Bindung, auf die erstaunlichen physiologischen Wirkungen von Placebos, auf die Rolle, die Erwartungen bei der Wahrnehmung spielen, und auf das, was ich als eklatante Fehler der klassischen Computertheorie des Geistes und deren gleichsam kartesianisches Erbe betrachte.
Zwar ist jeder Essay Teil dieses Buches insgesamt, doch jeder einzelne muss auch für sich als kohärentes Werk stehen, weshalb die Wiederholung wesentlicher Ideen nicht das Ergebnis von Faulheit, sondern eine Notwendigkeit ist. Obgleich diese Essays im Verlauf von vier Jahren geschrieben wurden, sind sie das Ergebnis jahrelangen intensiven Lesens und Nachdenkens über mehrere Disziplinen. Wenn von mir gesagt werden kann, dass ich eine Mission habe, dann ist es eine ganz einfache: Ich hoffe, Sie, die Leserinnen und Leser, werden entdecken, dass vieles von dem, was Ihnen von Büchern, Medien und vom Internet als wissenschaftlich oder sonst wie entschiedene Wahrheiten vorgesetzt wird, tatsächlich in Frage gestellt und revidiert werden kann.
Obwohl es mich manchmal etwas deprimiert, dass ich in der Kluft gelandet bin, die Snow vor Jahren berühmt machte, bin ich doch meistens froh darüber. Ich mache regelmäßig Ausflüge auf beide Seiten und habe in jeder Kultur enge Freunde. Es ist viel darüber geredet worden, eine schöne große Brücke über den Abgrund zu bauen. Momentan haben wir nur einen schwankenden provisorischen Steg, aber ich habe mehr und mehr Reisende sich in beide Richtungen begeben sehen. Sie dürfen dieses Buch als einen Bericht über meine Reisen hin und her betrachten. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich sie auch weiterhin machen kann, da es auf beiden Seiten noch reichlich unerforschtes Gebiet gibt.
S.H.
IEine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen
Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen
Kunst ist nicht die Anwendung eines Schönheitskanons, sondern das, was sich Trieb und Verstand über jeden Kanon hinaus ausdenken können. Wenn wir eine Frau lieben, kommt es uns ja auch nicht in den Sinn, ihre Glieder zu messen. Wir lieben mit unserem Begehren – obwohl schon alles unternommen wurde, um sogar auf die Liebe einen Kanon anzuwenden.[1]
Pablo Picasso
Es handelt sich um die wirkliche Liebe zu den Dingen der Erscheinung außer uns und den tiefen Geheimnissen der Ereignisse in uns selbst. Zu den Dingen außer uns wie in uns gehört das ewige Suchen nach der Individualität der eigenen Seele.[2]
Max Beckmann
Vielleicht habe ich in dieser früheren Phase die Frau in mir gemalt. Kunst ist ja keine rein männliche Betätigung. Mir ist bewusst, dass manche Kritiker dies als Eingeständnis einer latenten Homosexualität auffassen könnten. Wenn ich schöne Frauen malte, würde mich das zu einem Nicht-Homosexuellen machen? Ich mag schöne Frauen. In natura; sogar die Models in Modezeitschriften. Manchmal irritieren mich Frauen. Diese Irritation habe ich in der Frauen-Serie gemalt. Das ist alles.[3]
Willem de Kooning
Aussagen von Künstlern über ihre eigenen Werke sind spannend, weil wir etwas darüber erfahren, was sie zu tun glauben. Ihre Worte thematisieren eine Orientierung oder eine Idee, aber diese Orientierungen und Ideen sind nie abgeschlossen. Künstler (jedweder Art) sind sich nur teilweise dessen bewusst, was sie tun. Vieles, was beim Entstehen von Kunst passiert, ist unbewusst. Aber in den oben zitierten Kommentaren verbinden Picasso, Beckmann und de Kooning alle ihre Kunst mit Gefühl – die beiden ersten mit Liebe und der dritte mit Irritation, und bei jedem der drei Künstler waren Frauen irgendwie in den Prozess einbezogen. Für Picasso ist eine Frau zu lieben eine Metapher für Malen. Sein «Wir» ist eindeutig maskulin. Beckmann gibt einer imaginären «Malerin» Ratschläge, und de Kooning versucht zu erklären, inwieweit seine «Frauen» dadurch erschaffen wurden, dass er die Frau in sich selbst wachrief, wenn auch auf defensive und gequälte Weise. Alle drei behaupten, es gäbe eine grundlegende affektive Verbindung zwischen ihren inneren Zuständen und der Realität auf der Leinwand und ihre Kreativität würde auf die eine oder andere Art von einer Idee der Weiblichkeit durchzogen.
Was sehe ich? In dieser Ausstellung, Frauen, die ausschließlich Frauenporträts dieser drei Künstler zeigt, sehe ich reihenweise Bilder von Frauen, gemalt von Malern, die Vertreter der Moderne genannt werden müssen und deren Darstellungen der menschlichen Figur nicht mehr von den klassischen Begriffen von Ähnlichkeit und Naturalismus eingeengt waren. Für alle drei scheint das Wort «Frau» viel mehr zu umfassen als die Definition im Webster’s Dictionary: «Erwachsener weiblicher Mensch.» In Das andere Geschlecht stellte Simone de Beauvoir die Behauptung auf, man werde nicht als Frau geboren, sondern man werde eine Frau. Es trifft sicher zu, dass sich schon im Laufe einer einzigen Lebensspanne Bedeutungen des Wortes Frau ansammeln und verändern. Seit den fünfziger Jahren wird zwischen Geschlecht und Gender unterschieden. Ersteres bezeichnet weibliche und männliche biologische Körper, das Zweite gesellschaftlich konstruierte Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit, die mit der Zeit und der Kultur variieren, aber sogar diese Unterteilung wird inzwischen theoretisch angezweifelt.
In der Kunst greifen wir nicht auf lebende Körper zurück. Ich schaue in fiktive Räume. Es schlagen keine Herzen. Es fließt kein Blut. Die biologischen Kennzeichen des weiblichen Menschen – Brüste und Geschlechtsorgane –, die ich auf diesen Bildern sehe (falls ich sie sehe), sind Symbolisierungen. Schwangerschaft und Geburt kommen in diesen Bildern nicht ausdrücklich vor, aber manchmal ist das Nichtvorhandene dennoch wirkmächtig. Ich schaue auf Bewohner der Welt des Imaginären, des Spiels und der Phantasie, geschaffen von Künstlern, die jetzt tot sind, die aber alle im 20. Jahrhundert Kunst schufen. Geblieben sind nur die Zeichen der Körperbewegungen des Künstlers: Spuren eines Arms, der sich einstmals heftig oder vorsichtig im Raum bewegte; ein Kopf und ein Oberkörper, die sich vor- und zurückbeugten; Füße, die nebeneinander oder angewinkelt auf dem Boden standen; Augen, die aufnahmen, was da war und noch nicht auf der Leinwand war; und die Gefühle und Gedanken, die den Pinsel führten, die korrigierten, änderten und die Bewegungsrhythmen herstellten, die ich beim Betrachten der Bilder in meinem eigenen Körper fühle. Das Visuelle ist auch taktil und motorisch.
Während ich ein Gemälde betrachte, sehe ich mich selbst nicht. Ich sehe die imaginäre Person auf der Leinwand. Ich bin nicht aus mir selbst verschwunden. Ich bin mir meiner Gefühle bewusst – meiner Ehrfurcht, Irritation, Bestürzung und Bewunderung –, aber einstweilen ist meine Wahrnehmung von der gemalten Person erfüllt. Sie ist von mir, während ich betrachte, sie ist von mir, wenn ich mich an sie erinnere. In der Erinnerung mag sie nicht genau so sein, wie wenn ich direkt vor dem Bild stehe, sondern eher irgendeine Variante von ihr, die ich im Kopf habe. Während ich sie wahrnehme, stelle ich eine Beziehung zu dieser imaginären Frau her, zu Picassos Weinender, zu Beckmanns maskierter Columbine, zu de Koonings albernem Ungeheuer Woman II. Ich hauche ihnen Leben ein, wie Sie. Ohne einen Betrachter, Leser, Zuhörer ist Kunst tot. Etwas geschieht zwischen mir und ihr, einem «ihr», das den willentlichen Akt eines anderen in sich trägt, ein von der Subjektivität eines anderen erfülltes Ding, und in ihm kann ich Schmerz, Humor, sexuelles Begehren, Unbehagen empfinden. Deshalb behandle ich Kunstwerke nicht so, wie ich einen Stuhl behandeln würde, aber ich behandle sie auch nicht wie einen wirklichen Menschen.
Ein Kunstwerk hat kein Geschlecht.
Das Geschlecht des Künstlers bestimmt nicht das Gender eines Kunstwerks, welches das eine oder das andere oder vielfache Versionen davon sein kann.
Wer sind die weiblichen Gebilde dieser Künstler, und wie nehme ich sie wahr?
Meine Wahrnehmung der drei Gemälde ist weder ausschließlich visuell noch rein sinnlich. Gefühl ist immer Teil der Wahrnehmung, nicht von ihr getrennt. Kunst und Gefühl haben ein langes und gespanntes Verhältnis zueinander, seit Plato die Dichter aus seiner Republik verbannte. Philosophen und Wissenschaftler streiten immer noch darüber, was Gefühle oder Affekte sind und wie sie funktionieren, aber ein hartnäckiges Verständnis von Gefühl als etwas Gefährlichem, als etwas, was kontrolliert, abgestellt, dem Verstand unterworfen werden muss, ist Teil der abendländischen Kultur geblieben. Den meisten Kunsthistorikern ist beim Thema Gefühl ähnlich mulmig zumute, und sie schreiben stattdessen über Form und Farbe, Einflüsse oder den historischen Kontext. Dabei ist Fühlen nicht nur unvermeidlich, sondern absolut wesentlich für das Verstehen eines Kunstwerks. Tatsächlich wird ein Kunstwerk ohne es bedeutungslos. In einem Brief an einen Freund schrieb Henry James: «In der Kunst ist Gefühl immer Bedeutung.»[4] In seinem Buch über Aby Warburg zitiert E.H. Gombrich den Kollegen: «Außerdem hatte ich vor der ästhetisierenden Kunstgeschichte einen aufrichtigen Ekel bekommen. Die formale Betrachtung des Bildes – unbegriffen als biologisch notwendiges Produkt zwischen Religion und Kunstausübung […] schien mir ein steriles Wortgeschäft hervorzurufen.»[5] 1873 wurde von Robert Vischer das deutsche Wort Einfühlung als ästhetischer Begriff eingeführt, ein Wort, das über diverse historische Windungen im Englischen zu empathy werden sollte. Die heutige neurobiologische Emotionsforschung analysiert die komplexen affektiven Prozesse, die bei der visuellen Wahrnehmung am Werk sind. In «Affect as a Source of Visual Attention» von Mariann Weierich und Lisa Feldman Barrett heißt es: «Menschen begegnen der Welt nicht ausschließlich über ihre Sinne; vielmehr wird die Verarbeitung von Sinnesreizen vom allerersten Moment der Begegnung mit dem Objekt an von ihrem Gefühlszustand beeinflusst.»[6] Ein grundlegender Aspekt der Bedeutung eines jeden Objekts liegt in den Gefühlen von Freude, Leid, Bewunderung, Verwirrung, die es wachruft. Zum Beispiel nimmt ein Betrachter ein Objekt je nach dessen emotionaler Wichtigkeit oder Auffälligkeit als näher oder weiter entfernt wahr. Dieses psychobiologische Gefühl ist ein Geschöpf der Vergangenheit, der Erwartung, der Tatsache, dass wir gelernt haben, die Welt zu lesen. In diesem neurobiologischen Modell wird das, was wir lernen – auf Menschen und Objekte bezogene Gefühle und die Sprache, mit der wir sie ausdrücken –, Teil des Körpers, kommt vom Körper. Das Mentale schwebt nicht als kartesianischer Geist über dem Physischen.
Sie schluchzt
Ich betrachte Picassos Weinende Frau, und ehe ich Zeit finde, zu analysieren, was ich sehe, über Farbe und Form oder über Gestik oder Stil zu sprechen, habe ich Gesicht, Hand und einen Teil des Torsos auf der Leinwand registriert und reagiere unmittelbar emotional auf das Gemälde. Das Bild bringt mich aus der Fassung. Ich spüre eine Spannung in meinen Mundwinkeln. Ich will diese Figur weiter ansehen, aber ich fühle mich auch von ihr abgestoßen. Obwohl ich eine Weinende betrachte, finde ich die Darstellung grausam. Was geht hier vor?
Das Gesicht ist der Ort der Identität – die Stelle am Körper, der wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir erkennen Menschen nicht an ihren Händen und Füßen, nicht einmal uns vertraute. Nur wenige Stunden alte Neugeborene können die Gesichter von Erwachsenen imitieren, obwohl sie nicht wissen, was oder wen sie da ansehen, und obwohl sie ihr eigenes Bild im Spiegel erst viele Monate später erkennen werden. Babys scheinen ein visuosensomotorisches Bewusstsein vom Gesicht des anderen zu haben, was manche Forscher eine «Wie ich»-Reaktion genannt haben, die zu Imitation führt, die sogenannte «primäre Intersubjektivität».[7] Eine meiner Freundinnen, die Philosophin Maria Brincker, die über Spiegeltheorien arbeitet, grübelte vor ihrer sechsjährigen Tochter Oona laut über frühkindliche Imitation nach.
«Ein winziges Kind kann meinen Gesichtsausdruck nachmachen», sagte sie. «Ist das nicht schwer zu verstehen?»
«Nein, Mom», sagte Oona. «Das ist leicht. Das Baby hat ja dein Gesicht.»
Wenn wir jemanden im Leben, auf einem Foto oder einem Gemälde ansehen, haben wir zumindest bis zu einem gewissen Grad sein oder ihr Gesicht. Das Gesicht, das wir wahrnehmen, tritt an die Stelle unseres eigenen. Maurice Merleau-Ponty verstand dies als menschliche Interkorporealität, die nicht durch reflektierte Analogie erlangt wird, sondern unmittelbar in unserer Wahrnehmung enthalten ist.[8] Das Erkennen des Geschlechts gehört nicht zum frühkindlichen Leben. Es kommt später und ist ein oft durch unwesentliche Hinweise wie Haarlänge, Kleidung, Make-up usw. bestimmter Prozess. Aber meine Auffassung und Interpretation von Picassos Gemälde hat etwas von dieser dyadischen Realität an sich, mein Ich und das Du auf der Leinwand. Die Figur vor mir ist nicht naturalistisch. Woher weiß ich überhaupt, dass es eine Frau ist? Ich deute ihr Haar, ihre Wimpern, die Verzierungen auf ihrem Taschentuch, die Rundung einer sichtbaren Brust als weiblich. Die weinende Frau ist nur gemalt, und doch bewegen sich meine Mundwinkel als sensomotorisches Echo auf das Gesicht vor mir.
Die weinende Frau ist ein Bild ganz und gar externalisierten Kummers. Man vergleiche dieses Gemälde mit Picassos neoklassischem Bildnis seiner ersten Frau Olga Chochlowa von 1923, das die Ruhe einer Statue verbreitet, ein heiteres Objekt, dem gleichwohl eine verborgene Innerlichkeit und ein Anflug von Nachdenklichkeit innezuwohnen scheinen, oder mit Frau (Akt am Meer) aus dem Jahr 1929, bei der das Erkennen dieses komischen Dings als Person auf der Andeutung von Beinen, Armen und Hintern beruht. Zwei absurde Kegel – Anspielungen auf Brüste – schreiben ihm seine Weiblichkeit ein, genauso wie seine odaliskenhafte Pose – ein ins Groteske verdrehter Akt von Ingres. Das Vermessen von Gliedern ist nicht nötig. Bei dem Bildnis von Ingres erlaubt mir die Illusion von Realismus, ein Innenleben in die Darstellung zu projizieren, das, was Aby Warburg «mimetische Intensivierung als subjektive Handlung» nannte[9]. In Picassos Bild ist keine derartige Projektion möglich. Der «Wie ich»-Austausch ist grundlegend gestört. Diese Ding-Person ist ein Nicht-Ich.
Mein Gefühl für die Weinende ist komplexer, irgendwo zwischen subjektiver Identifizierung und objektivierender Distanz. Das Gesicht der Frau ist perspektivisch verzerrt. Ich sehe eine Nase und einen gequälten Mund im Profil, aber beide Augen und beide Nasenlöcher sind ebenfalls sichtbar, wodurch das Paradoxon eines erstarrten Schauderns entsteht – das würgende Aufsteigen von Schluchzern, bei dem sich der Kopf vor- und zurückbewegt. Die Tränen sind als zwei schwarze Linien mit kleinen bauchigen Kreisen darunter verzeichnet. Violett, Blautöne und dunkle Braun- und Schwarztöne sind im Abendland die kulturell kodierten Farben für Leid. Wir singen den Blues und tragen in Trauer Schwarz. Und das Taschentuch, das sie an ihr Gesicht hält, evoziert einen Wasserfall. Die schwarzen Linien seiner Falten lassen mich an mehr Tränen, an einen Strom von Tränen denken. Aber sie ist auch eine Fremde. Die sichtbare Hand, die sie ausstreckt, mit ihrem Daumen und zwei Fingern, hat Nägel, die sowohl Messern wie Krallen ähneln. Es ist etwas Gefährliches an diesem Leid, ebenso wie etwas leicht Lächerliches. Man beachte: ihr Ohr zeigt nach hinten.
Kunstgeschichte erzählt immer eine Geschichte. Die Frage lautet: Wie erzähle ich die Geschichte? Und inwieweit wirkt sich das Erzählen der Geschichte auf meine Betrachtung und Deutung des Bildes aus?
Die Geschichte der Mädchen
Ich weiß, dass ich da ein Bildnis von Dora Maar betrachte, der Künstlerin und Intellektuellen, deren eindringliche Fotos zu meinen Lieblingsbildern bei den Surrealisten gehören. Ihr ungewöhnliches Foto Portrait d’Ubu, das 1936 in der International Surrealist Exhibition in London ausgestellt wurde, verkörpert für mich die Idee des sanften Ungeheuers. Ich weiß auch, dass sie ein Verhältnis mit Picasso hatte und dass zur üblichen Picasso-Geschichte heutzutage die Frauen gehören, mit denen er zusammen war – oft seine «Musen» genannt – und die Teil des Kanons seiner Perioden und Stile sind. Wieder und wieder malte er einen Künstler mit dem Pinsel in der Hand vor seiner Staffelei und mit einer nackten Frau als Modell. Picassos Verbindung zwischen sexuellem Begehren und Kunst wird im Werk selbst obsessiv dargestellt.
In der unüberschaubaren Picasso-Literatur werden diese Frauen fast immer beim Vornamen genannt, Fernande, Olga Marie-Thérèse, Dora und so fort. Kunsthistoriker und Biographen haben sich die Intimität des Künstlers mit den Frauen zu eigen gemacht, aber der Maler selbst heißt selten, wenn überhaupt, Pablo, außer es geht um ihn als Kind – ein kleiner, aber vielsagender Hinweis auf die in dieser kunsthistorischen Umrahmung eines Lebenswerks enthaltene Herablassung. Beispielhaft hierfür ist John Richardson. In seiner dreibändigen Picasso-Biographie werden die Frauen im Leben des Künstlers alle bei ihren Vornamen genannt. Und Gertrude Stein, Picassos bedeutende amerikanische Schriftstellerin und Freundin, aber nicht seine Geliebte, wird wiederholt Gertrude genannt.[10] Enge männliche Freunde, ob berühmt oder nicht, haben immer Anspruch auf Nachnamen. Ich finde es faszinierend, dass niemand, den ich gelesen habe, bemerkt zu haben scheint, wie die Picasso-Literatur erwachsene Frauen ständig zu Mädchen macht.
Die Kriegsgeschichte
Picasso malte Maar 1937 mehrmals als Weinende, also im Jahr der Bombardierung der baskischen Stadt Guernica durch die Deutschen – ein Ereignis, das Picasso zu dem gleichnamigen erschütternden Gemälde veranlasste. Die Bilder der weinenden Frau werden daher oft als Teil einer schockierten Reaktion auf den Spanischen Bürgerkrieg gedeutet. Von Dora Maar stammen auch die Fotoserien, die den Entstehungsprozess dieses Werkes dokumentieren.
Die grausame Liebesgeschichte
Laut Françoise Gilot beschrieb Picasso das Bildnis von Maar als innere Vision. «Für mich ist sie die Weinende. Ich habe sie jahrelang in gequälten Gestalten gemalt, nicht aus Sadismus und auch nicht aus Lust; nur einer Vision gehorchend, die sich mir aufzwang. Es war die tiefe Realität, nicht die oberflächliche.»[11] Bei einer frühen Begegnung von Maar und Picasso beobachtete er, wie sie in einem Café das Messerspiel machte, wobei sie immer wieder zwischen ihre gespreizten Finger stach. Es war unvermeidlich, dass sie danebentraf, sich schnitt und blutete. Es wird erzählt, Picasso habe sie um die Handschuhe gebeten, die sie ausgezogen hatte, und diese in seiner Wohnung in einer Vitrine zur Schau gestellt. 1936 malte er Maar als schöne Harpyie, ihr Kopf auf einem Vogelkörper. Picassos Biographen haben seine Misogynie und seinen Sadismus unter den verschiedensten Gesichtspunkten beleuchtet, aber keiner von ihnen zweifelt daran, dass die Angst, Grausamkeit und Ambivalenz des Künstlers Eingang in seine Bilder fand. Am lapidarsten wurde dies von Angela Carter dargelegt: «Picasso liebte es, Frauen zu zerstückeln.»[12]
Die tränenreiche Frau mit ihren waffenartigen Fingernägeln lässt ohne Frage mannigfache traumartige Assoziationen zu: Krieg, Schmerz, sadistische Lust. Sie alle sind in der Weinenden angelegt.
Ideen werden Teil unserer Wahrnehmungen, aber wir sind uns ihrer nicht immer bewusst.
Die Geschichte der Kunst wird ständig von Kunstrichtungen, von Geld und Sammlern, von «ultimativen» Ausstellungen in Museen, von neuen Bezügen, Entdeckungen und Ideologien revidiert, die die Erzählung der Vergangenheit modifizieren. Jede Geschichte spannt disparate Elemente zeitlich zusammen, und jede Geschichte überspringt schon ihrem Wesen nach vieles.
Die Große Erzählung der Moderne und ihrer Macken
Der Name «Picasso» steht für viele Menschen weltweit sofort als Zeichen für moderne Kunst. «Picasso» wird gleichgesetzt mit einem heroischen Mythos von Größe – einer kämpferischen Erzählung von Einflüssen und stilistischen Revolutionen –, der mit einer Reihe von Frauen und ihrer nachfolgenden Vertreibung aus der Gunst zusammenfällt. Picasso als Heinrich VIII. Willem de Kooning nannte Picasso den «Mann, der zu schlagen ist», als wäre die Kunst ein Faustkampf, eine passende Metapher in der New Yorker Welt des abstrakten Expressionismus, in der eine schwelende Nervosität, Malen selbst könnte eine Beschäftigung für «Waschlappen» sein, zu einer Art kruder Parodie des amerikanischen Cowboys und knallharten Supermanns führte, deren perfekte Verkörperung das Medienimage eines großkotzigen, prügelnden Jackson Pollock war. Aber auch Frauen spielten das Spiel. Joan Mitchell war abgestoßen von dem, was sie als «Damen»kunst ansah, doch zu jener Zeit war ihr Werk, wenngleich immer respektiert, nur ein Nebenschauplatz des größeren Dramas. Erst nach ihrem Tod fand ihre Kunst die verdiente Anerkennung. Elaine de Kooning malte in den fünfziger Jahren als Reaktion auf den herrschenden Zeitgeschmack sexualisierte Bilder von Männern. Sie sagte: «Ich wollte Männer als Sexobjekte malen»[13], aber auch sie war und bleibt marginalisiert. Louise Bourgeois schuf ein erstaunliches Werk, aber bis sie siebzig wurde, gehörte es nicht zur Geschichte. Die immer wiederholte kunstgeschichtliche Erzählung geht folgendermaßen: Als Pollock bei einem Autounfall starb, wurde de Kooning der unangefochtene «König» der modernen Kunst in den USA, der größte Junge unter all den großen Jungen. Doch sogar de Kooning sollte spitze Bemerkungen zu hören bekommen, weil er das Figürliche nicht aufgab und sich nicht nach dem Diktat eines neuen Kanons richtete, der keine Zustimmung zum Gegenständlichen erlaubte.
Max Beckmann passt nicht gut in diese große Erzählung. Er ist eine ungelöste Frage, ein Loch in der Geschichte. Obwohl er wie Picasso und de Kooning sehr jung eine außerordentliche Begabung zeigte, anerkannt und berühmt wurde, passte er nie so recht in die Macho-Erzählung des Angriffs der Moderne auf die Tradition, die unaufhörlich zu neuen Formen führte. Er ließ sich in keinen «Ismus» zwängen. Vor dem Ersten Weltkrieg, in seinen Gedanken über zeitgemäße und unzeitgemäße Kunst aus dem Jahr 1912, prangerte er Fauvismus, Kubismus und Expressionismus als «das Schwächliche und zu Ästhetische dieser sogenannten neuen Malerei»[14] an. Er verspottete die neuen Kunstrichtungen als dekorativ und weibisch und setzte ihnen die Männlichkeit und Tiefe germanischer Kunst entgegen. Beckmann kritisierte «Gauguintapeten, Matisse-Stoffe, Picassoschachbrettchen»[15] und brachte die Künstler in Verbindung mit Raumausstattung, mit heimischem statt mit öffentlichem Raum. Für Beckmann waren Flächigkeit und Hübschheit mädchenhaft, Picassos Kunst eingeschlossen, aber seine Version der Geschichte sollte nicht den Sieg davontragen.
1931, in einem Katalogtext zu einer Ausstellung deutscher Malerei und Bildhauerei, die auch Werke von Beckmann zeigte, beschrieb Alfred H. Barr, der damalige Direktor des Museum of Modern Art in New York, die deutsche Kunst als «sehr anders» als französische und amerikanische Kunst:
Die meisten deutschen Künstler sind romantisch, sie scheinen weniger an Form und Stil als Selbstzweck interessiert und mehr an Gefühl, an emotionalen Werten und sogar an moralischen, religiösen, sozialen und philosophischen Betrachtungen. Deutsche Kunst ist keine reine Kunst […] Sie verwechseln häufig Kunst und Leben.[16]
Diese Passage ist absolut kurios und Barrs Unbehagen offensichtlich. Das Emotionale, Religiöse, Soziale und Philosophische sind für ihn «Unreinheiten»[17], wie Karen Lang hervorhebt. Was bedeutet das? Im Jahr 1931 muss dabei politische Besorgnis mitgewirkt haben. Auf Barrs berühmtem Katalogcover für die Ausstellung Cubism and Abstract Art im MoMa 1936 (ein Jahr vor der nationalsozialistischen Ausstellung Entartete Kunst in München, mit Werken von Beckmann) sind die deutschen Künstler verschwunden, und die moderne Kunst wird als stilübergreifendes Flussschaubild dargestellt, ein Diagramm, das zuerst von Wirtschaftsingenieuren in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts verwendet wurde. Mit Pfeilen, «Schwimmbahnen», die auf allerlei «Ismen» verweisen, präsentierte es dem Publikum moderne Kunst als einen bizarren Algorithmus von Ursache und Wirkung, eine reduktive Formel, als wollte es sagen: Seht nur! Das ist wissenschaftlich.
Die Hierarchie ist alt. Barrs Gebrauch der Worte «Stil» und «Reinheit» und sein abstraktes Flussdiagramm stehen für Intellekt, Verstand und Sauberkeit, «Romantik» und «Emotion» für den Körper und körperliche Sudelei, wo die Grenzen zwischen Innen und Außen verschwimmen. Intellekt kodiert als männlich; Körper als weiblich (die äußerste Ausscheidung eines Körpers ist ja die Geburt). Männliche Kultur und Naturwissenschaft als Gegensatz zur chaotischen weiblichen Natur. Doch für Beckmann war die Hervorhebung von Stil und Form über Bedeutung, über unverarbeitete Emotion gerade die Kraft, die die Kunst verweiblichte und entmannte, ein tuntiges Vertrauen auf Oberflächen, die er als weiblichen Flitterkram ansah. Je nach kultureller Sichtweise änderten sich männlich und weiblich Kodiertes. Es hing ganz davon ab, wie man seinen binären Gegensatz Frau/Mann artikulierte und wie man die Geschichte erzählte. Was meint Barr bloß, wenn er sagt, Deutsche verwechselten Kunst und Leben? Sicher wollte er nicht behaupten, Deutsche hielten Kunstwerke für lebende Körper. Wie könnte Kunst von etwas anderem als dem Leben kommen? Sie wird nicht von Toten gemacht. In der Malerei kann die Form nicht von der Bedeutung getrennt werden, und Bedeutung kann nicht aus den Gefühlen der Betrachterin oder des Betrachters angesichts eines Kunstwerks herausgelöst werden.
Fastnacht-Maske grün, violett und rosa, Columbine entstand 1950 in den Vereinigten Staaten, während Beckmanns letztem Lebensjahr. Wie viele deutsche Künstler und Intellektuelle war er zum Exilanten geworden. Was sehe ich? Ich spüre eine machtvolle Präsenz, herrisch, abweisend und maskiert. Aber in den Farben könnte ich baden – leuchtende Rosa- und Violetttöne vor dem Schwarz. Ich werde nicht von einer einzelnen Emotion ergriffen, sondern habe gemischte Gefühle – fühle mich angezogen, einen Anflug von Ehrfurcht und etwas von der Aufregung, die ich in dem Moment verspüre, wenn im Theater der Vorhang aufgeht. Wie üblich lockt das Gesicht meinen Blick an, um es zu prüfen und zu deuten, aber ich kann keine vorherrschende Emotion darin finden wie in dem Picasso. Sie scheint mich anzusehen, kühl, vielleicht verächtlich oder womöglich bloß gleichgültig. In der rechten Hand hält sie eine Zigarette, in der linken eine Karnevalskappe. Ihre gespreizten Schenkel mit den schwarzen Strümpfen sind überdimensional, als wären sie in den Vordergrund gestellt, wodurch das Gefühl entsteht, dass sie drohend über mir aufragt. Ich nehme die Perspektive eines Kindes ein. Vor ihr auf dem Hocker liegen fünf Spielkarten mit verzerrten Bildern darauf. Die schwarze Umrisslinie des einen Rechtecks überschneidet den schwarzen Strich, der ihren Oberschenkel umgrenzt.
Man kann dieses Gemälde leicht als Archetypus des Mysteriums Weib und seiner Sexualität lesen, eine weitere Ausgabe der Frau als das Andere, und natürlich ist etwas daran. Dieses Spätwerk ist nicht gerade auf «Tiefe» aus. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Beckmanns Bilder oberflächlicher, und er war mit Sicherheit von ebenden Bewegungen beeinflusst, die er kritisierte, insbesondere von Picasso. Aber mein Unbehagen und meine Verwirrung als Betrachterin interessieren mich. Die Themen Maskerade, Karneval, Commedia dell’arte, Zirkus, Masken und Maskieren kehren bei Beckmann immer wieder. Karneval ist die verkehrte Welt, das auf dem Kopf stehende Reich der Umkehrungen und Umpolungen, in dem die Maske nicht nur der Verkleidung dient, sondern entlarvt. Politische Macht und Autorität werden in einen jämmerlichen Scherz verwandelt, sexuelles Begehren greift um sich. Der bürgerliche Beckmann war der Verfasser des höchst ironischen Traktats Die soziale Stellung des Künstlers. Vom Schwarzen Seiltänzer (1927). «Respekt vor Geld und Macht ist eine Sache, die dem werdenden Genius nicht stark genug eingeprägt werden kann», heißt es darin[18]. Als Sanitäter im Ersten Weltkrieg sah Beckmann eine verkehrte, von innen nach außen gekehrte Welt. In einem Brief aus dem Jahr 1915 schrieb er über einen verwundeten Soldaten: «Schrecklich, so am linken Auge wurde das Gesicht auf einmal durchsichtig, wie bei einem zerbrochenen Porzellantopf.»[19] Die Verkehrungen finden sich in seiner Kunst wieder. Viele seiner Bilder können buchstäblich auf den Kopf gestellt werden, ohne ihre Form zu verlieren, als wären sie absichtlich so gemacht, dass man sie sowohl gerade, auf dem Kopf stehend als auch quer aufhängen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist das Bild Reise auf dem Fisch mit seinen männlichen und weiblichen Masken, der einer Frau für den Mann und umgekehrt. Wechselspiel der Geschlechter. Rollentausch.
Warum Briefe an eine Malerin?
Sie ist keine wirkliche Person. Jay A. Clarke merkt dazu an, Beckmann benutze seine ästhetische Aussage, um weibliche Maler als leicht zerstreute, flatterhafte Geschöpfe zu beleidigen, die auf ihren Nagellack starren[20]. Das trifft zu. In Beckmanns Schriften zur Kunst ist Weiblichkeit gleichbedeutend mit Oberflächlichkeit. Doch warum gibt er dann einer Malerin Ratschläge? Er war wohl kaum Feminist. Mann und Frau, Adam und Eva sind Pole, die sich in seinen Bildern oft im Kampf gegenüberstehen. Beckmanns Ermahnungen in den Briefen sind sowohl ernst als auch leidenschaftlich. Seine imaginäre Malerin scheint nicht mehr und nicht weniger zu sein als sein eigenes starrköpfiges künstlerisches Selbst, ein anderer Seiltänzer, der sich auf sein «Gleichgewicht» verlassen müssen kann und sich sowohl vor der «gedankenlosen Imitation der Natur» wie vor «steriler Abstraktion»[21] hüten muss. Sie ist Beckmanns Maske. Die der Frau für den Mann. Eine karnevaleske Verkehrung: von den Füßen auf den Kopf, von innen nach außen, wie Michail Bachtin in seinem Buch über Rabelais geltend macht. Sehen Sie sich Columbine an und sehen Sie sich danach die vielen Selbstporträts von Beckmann an: die Zigarette in der Hand, rätselhaft auf den Betrachter schauend. Mal hält er die Zigarette rechts, mal links. Beckmann war Rechtshänder, aber er stellte sich auch gespiegelt dar, eine weitere Umkehrung des Selbst.
Ich glaube, die gebieterische Columbine hat Beckmanns Gesicht oder vielmehr das Gesicht jenes inneren Selbst, das mit der sichtbaren Welt verschmilzt und mit der Innenseite nach außen gesehen wird. Vielleicht hat er die Frau in sich gemalt. Ironischerweise ist sie viel selbstbewusster und undurchschaubarer als Beckmanns letztes wirkliches Selbstporträt aus demselben Jahr, auf dem er ergreifend und clownesk zugleich wirkt und zum ersten Mal an seiner Zigarette ziehend zu sehen ist, statt dass er sie als elegantes Requisit benutzt.
De Koonings Women erregten 1953 in der Sidney Janis Gallery Aufsehen. Clement Greenburg nannte sie «wüste Sektionen». Ein anderer Kritiker sah darin ein «wüstes sadomasochistisches Drama von Malerei als einer Art Geschlechtsverkehr»[22]. Die Betonung lag, wie es aussieht, auf wüst. Die Bilder verunsichern auch heute noch. In seiner Einführung zur De-Kooning-Retrospektive im MoMa im Jahr 2011 schreibt John Elderfield, dass die Frage nach der Mysogynie «davon abhing und noch immer abhängt, wie Thema und Bildsprache sich nach dem Verständnis des Betrachters aufeinander beziehen». In dieser Erklärung gibt es keine einheitliche Wahrnehmung des Gemäldes, sondern zwei rivalisierende Teile, die die Frage nach dem Frauenhass beantworten sollen. Das ist ungefähr so wie Barrs Unterscheidung von Stil und Form kontra Emotion und «Leben». Elderfield fährt fort, indem er von «muskulösen, maskulinen Strichen» spricht, «wütenden Strichen, die inneren Aufruhr widerspiegeln», und behauptet, diese männlichen Pinselbahnen über die Leinwand seien verantwortlich für den «Misogyniegehalt – und hätten [auch] zu der Überlegung verleitet, ob der Gehalt missverstanden wird»[23]. (Elderfield scheint an der eigentlichen Frage vorbeizugehen, indem er, ohne Ironie, das Adjektiv «maskulin» als Synonym für «stark» verwendet.) Jedenfalls hat er unrecht. Der Schock bei der oder dem Betrachtenden rührt nicht von wuchtigen Pinselstrichen im Verhältnis zur Figur her, sondern von ihrer oder seiner unmittelbaren Wahrnehmung von jemandem mit einem Gesicht – einer auf verschiedene Weisen grinsenden, die Zähne fletschenden monströsen Frau auf einer Leinwand, aus Strichen gemacht, die eine Illusion hektischer Bewegung erzeugen. Und sie sieht verrückt aus.
Was sehe ich? Die Frauen sind groß, zum Fürchten und irre. Die meisten lächeln. Der grinsende Mund von Woman II ist durch einen Schlitz von ihrem übrigen Gesicht getrennt. Sie hat riesige Augen (wie eine Comicfigur), gewaltige Brüste, fleischige Arme, und ihre Schenkel sind gespreizt, geöffnet wie bei Beckmanns Columbine. Ihre Hände ähneln Klauen, Krallen, Messern und erinnern an Picassos Weinende. Eine Hand befindet sich ungefähr da, wo ihr Geschlecht sein sollte. Genitalien sind nicht erkennbar. Masturbiert sie? Die Grenzen ihres Körpers sind unbestimmt, Figur und Grund vermischen sich. Sie geht in das Umfeld über. Die Farben sind komplex. Auf und am Körper überwiegen verschiedene Rot-, Rosa- und Orangetöne. Auf ihrem Hals sind rote, rosa, weiße Striche. Sie ist eine wilde Frau, die keine Ruhe geben wird. Nachdem ich sie eine Weile angesehen habe, ängstigt sie mich weniger. Sie wird komischer. Auf die Seite gekippt sieht sie gut aus, verkehrt herum sogar noch besser. Sie ist eine aufgepeppte, aufgeladene dickleibige Karnevalsfrau. Woman III hat einen Penis, eine schwarz-graue spitze Erektion genau im Schritt. Keiner der Autoren, die ich gelesen habe, hat sich dazu geäußert, aber es ist ziemlich eindeutig. In Two Women, einer Pastell-Kohlezeichnung von 1954, sind wieder Phalli vorhanden – der eine eine riesengroße Schamkapsel wie in einer Aristophanes-Komödie. Ein Paar umherstolzierende Hermaphroditen? Die irritierende Frau in de Kooning? Der Mann in der Frau? Das Bild einer heterosexuellen Paarung? Ein Anflug der Homoerotik, gegen die de Kooning sich wehrte? Der weibliche Mann? Das Mischen und Vermengen von Geschlechtern. Von allem etwas?
Diese bizarren Wesen erinnern mich an meine Halluzinationen vor dem Einschlafen und an meine lebhaften Träume, wenn ein Gesicht und ein Körper, beide grotesk, ineinander übergehen, wenn ein Geschlecht im tollen Karneval des veränderten Bewusstseins ein anderes wird.
Die Frauen dieser Serie sind weitaus wilder als alle vorher und nachher. Sehen Sie sich die dämliche, grinsende Person in The Visit mit ihren gespreizten Beinen an. Fast können Sie sie kichern hören, aber sie erregt weder Angst noch Schrecken noch Schock. Woman II ist potent, fruchtbar und potenziell gewalttätig.
Bei Julia Kristeva heißt es: «Eine der präzisesten Darstellungen von Schöpfung, sprich künstlerischer Praxis, ist de Koonings Serie von Bildern mit dem Titel Women: wilde, explosive, komische und unzugängliche Kreaturen trotz der Tatsache, dass sie vom Künstler massakriert wurden. Aber was wäre, wenn sie von einer Frau geschaffen worden wären? Sie hätte sich offensichtlich mit ihrer eigenen Mutter auseinandersetzen müssen und somit mit sich selbst, was erheblich weniger komisch ist.»[24]
Kristeva erkennt die Kraft von de Koonings Werk an und fragt sich, was geschehen wäre, wenn eine Frau die Bilder gemalt hätte. Sie behauptet, eine Frau hätte sich mit der Frau als ihrer Mutter und somit mit sich selbst identifizieren müssen. Wird diese Identifikation eine Art Trauern, das Komik verhindert? Müssen wir sagen: Sie ist ich oder sie ist nicht ich? Entweder-oder? Die Mutter ist mächtig und in ihrer Macht furchterregend für alle Kleinkinder – ob männlich oder weiblich. Jedes Kind muss sich von seiner Mutter ablösen. Jungen jedoch können ihre Differenz benutzen, um aus der Abhängigkeit herauszukommen, was Mädchen nicht können. Für Kristeva werden de Koonings Bilder durch sexuelle Identifikation verkompliziert.
In ihrer De-Kooning-Biographie berichten Mark Stevens und Annalyn Swan von der letzten Begegnung des Künstlers mit seiner Mutter in Amsterdam nicht lange vor ihrem Tod. Er beschrieb seine Mutter als «ein zitterndes altes Vögelchen». Und dann, nachdem er sie verlassen hatte, sagte er: «Das ist der Mensch, den ich auf der Welt am meisten gefürchtet habe.»[25] Cornelia Lassooy schlug ihren Sohn, als er klein war.
Wir waren alle einmal im Leib unserer Mutter. Wir waren alle einmal Kleinkinder, und unsere Mütter waren riesengroß. Wir saugten Milch aus ihrer Brust. Wir erinnern uns an nichts dergleichen, aber unser sensomotorisches, emotional-perzeptuelles Lernen beginnt lange vor unseren bewussten Erinnerungen. Es beginnt sogar schon vor unserer Geburt, und wir werden davon geprägt und danach von den unzähligen symbolischen Assoziationen, die mit der Sprache und der Kultur